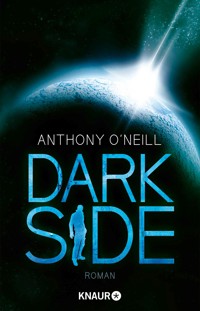
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Anthony O'Neills düsterer SF-Thriller spielt in der nahen Zukunft auf dem Mond: Dort hat der exzentrische Multimilliardär Fletcher Brass die Kolonie Purgatory gegründet. Der Arm des irdischen Gesetzes ist 384.400 km entfernt, und so gilt Purgatory als Mekka für Kriminelle aller Art – bis Polizeileutnant Damien Justus in die Kolonie strafversetzt wird. Damien ist fest entschlossen, für Recht und Ordnung zu sorgen, und ist damit nicht nur dem ebenso charismatischen wie skrupellosen Brass ein Dorn im Auge. Doch die wahren Probleme beginnen, als auf der anderen Seite des Mondes ein Android zu einem Rachefeldzug aufbricht, der ganz Purgatory in Schutt und Asche legen soll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anthony O’Neills
Dark Side
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Anthony O’Neills düsterer SF-Thriller spielt in der nahen Zukunft auf dem Mond: Dort hat der exzentrische Multimilliardär Fletcher Brass die Kolonie Purgatory gegründet. Der Arm des irdischen Gesetzes ist 384.400 km entfernt, und so gilt Purgatory als Mekka für Kriminelle aller Art – bis Polizeileutnant Damien Justus in die Kolonie strafversetzt wird. Damien ist fest entschlossen, für Recht und Ordnung zu sorgen, und ist damit nicht nur dem ebenso charismatischen wie skrupellosen Brass ein Dorn im Auge. Doch die wahren Probleme beginnen, als auf der anderen Seite des Mondes ein Android zu einem Rachefeldzug aufbricht, der ganz Purgatory in Schutt und Asche legen soll.
Inhaltsübersicht
Zitat
Auswahl aus dem Brass-Kodex
01. Kapitel
02. Kapitel
03. Kapitel
04. Kapitel
05. Kapitel
06. Kapitel
07. Kapitel
08. Kapitel
09. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Danksagung
Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite,
die er niemandem zeigt.
Mark Twain
Auswahl aus dem Brass-Kodex
Nimm dir die Dinge nicht, reiß sie an dich.
Vernichte das Unkraut, bevor es sich ausbreiten kann.
Lächle. Lächle. Lächle. Töte. Lächle.
Verlier oft die Beherrschung. Und zwar richtig.
Sich ergehben? Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt.
Man kann alles zum Fliegen bringen, wenn man ihm nur genug Federn gibt.
Lass die Fliege niemals wissen, dass du vorhast, sie totzuschlagen.
Arbeiter sind wie Hunde. Tätschle ihnen gelegentlich den Kopf. Und scheiß sie zusammen, wenn es nötig ist.
Lüge. Lüge. Lüge. Aber merk es dir.
Beweg dich. Beweg dich. Während andere schlafen, beweg dich.
Du weißt nie, wann es Regen gibt. Also trage stets ein Dementi bei dir.
Finde Oz. Und sei der Zauberer.
Es ist gut, einen Rivalen zu haben. Noch besser ist es, ihm den Schädel einzuschlagen.
Wenn du deine Spuren nicht beseitigen kannst, beseitige jene, die sie sehen.
Es ist barmherzig, jemandem an die Gurgel zu gehen.
Weigere dich, krank zu sein. Aus Prinzip.
Schüttle Hände in der Öffentlichkeit, enthaupte im Verborgenen.
Freunde helfen dir, weiterzukommen. Alle anderen sind Ungeziefer.
Die Liebe zum Geld ist der Ursprung allen Fortschritts.
Finde El Dorado. Erobere El Dorado. Suche ein neues El Dorado.
Der Neid der anderen ist ein ewiges Fest.
Eine Rechtfertigung pro Tag hält dein Gewissen in Schach.
Versuche niemals, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Es sei denn, du tust es mit dem eines anderen.
Brich nicht das Gesetz. Brich das GESETZ.
Verlierer errichten Hindernisse. Gewinner überwinden sie.
Genies sind ihr eigener Retter.
Du kannst nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen.
Du bist erst dann wirklich ein Eroberer, wenn du den Kopf des Königs hochhältst.
Depressionen sind etwas für Faule.
Was für einen Sinn hat es, in den Schuhen eines anderen zu gehen? Solange sie nicht besser sind als deine?
01.
Nur ein Verrückter würde auf dem Mond leben wollen.
Der Mond ist taubes Gestein. Dreiundsiebzig Trillionen Tonnen lebloses Gestein. Er ist seit fast vier Milliarden Jahren tot. Und er will, dass auch Sie tot sind – sofern lebloses Gestein überhaupt irgendetwas wollen kann.
Sie können also ziemlich schnell erledigt sein. Ein Erdrutsch kann Sie unter sich begraben. Eine Lavaröhre über Ihnen zusammenbrechen. Sie können kopfüber in einen Krater stürzen. Ein Meteorit kann Ihr Habitat mit siebzigtausend Kilometern pro Stunde treffen. Ein Mikrometeorit kann Ihren Raumanzug aufreißen. Ein plötzlicher Ausbruch statischer Elektrizität in einer Luftschleuse kann Sie zerfetzen. Ein Ausrutscher, ein Riss, eine beschädigte Dichtung, ein defekter Sauerstofftank – all das kann Sie in Minuten töten.
Vielleicht dauert es auch etwas länger. Eine technische Störung der Verkabelung kann die Luftfilter abschalten. Ein fehlerhaftes Computerprogramm kann die Klimakontrollsysteme völlig durcheinanderbringen. Ein besonders heimtückischer Krankheitserreger – und in abgeschlossenen Milieus entwickeln sich mutierte Bakterienstämme besonders gut – kann Sie innerhalb weniger Tage töten. Wenn Sie draußen auf der Mondoberfläche sind, kann Ihnen der Temperaturunterschied zwischen Sonnenlicht und Schatten einen thermischen Schock versetzen. Eine Sonneneruption kann Sie grillen wie ein Fertiggericht, eine Fahrzeugpanne dazu führen, dass Sie in Ihrem Raumanzug ersticken.
Oder Sie verscheiden ganz allmählich im Laufe mehrerer Jahre. Mondstaub kann sich ähnlich wie Asbest in Ihre tiefsten Lungenspalten graben. Ausgedehnter Kontakt mit chemischen Dämpfen sowie Gasaustritte können Ihr gesamtes Atmungssystem zerstören. Die verringerte Schwerkraft – ein Sechstel im Vergleich zur Erde – kann Ihr Herz verheerend schwächen. Galaktische kosmische Strahlung von toten Sonnen und schwarzen Löchern kann Ihre Zellen nachteilig beeinflussen. Ganz zu schweigen davon, dass ein bunter Mix psychologischer Faktoren – Reizentzug, Schlafstörungen, Paranoia, Klaustrophobie, Einsamkeit, Halluzinationen – mit Ihrem Verstand das Gleiche macht wie die Hand eines geübten Spielers mit einem Stapel Spielkarten.
Kurz gesagt, auf dem Mond können Sie durch die Umgebung und die daraus resultierenden Lebensumstände getötet werden. Es kann zufällig passieren. Oder Sie können sich selbst umbringen.
Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass Sie ermordet werden. Von Verbrechern. Von Terroristen. Von Psychopathen. Von Ideologen. Oder vielleicht einfach deshalb, weil es zu teuer ist, Sie am Leben zu erhalten.
Nur ein Verrückter – oder ein Abtrünniger, ein Geächteter, ein Misanthrop, ein Abenteurer oder ein Massenmörder – würde dauerhaft auf dem Mond leben wollen.
02.
Kleef Dijkstra ist ein Verrückter. Und ein Massenmörder. Vor achtundzwanzig Jahren sprengte er zwei Wochen vor den niederländischen Parlamentswahlen die Amsterdamer Parteibüros des neu gegründeten Nederlandse Volksbond in die Luft, dessen Prinzipien er angeblich unterstützte. Sein Ziel, Pro-Migranten-Aktivisten zu verleumden und der Partei zu einer Protestwahl zu verhelfen, erreichte er damit jedoch nicht. Sechs Menschen wurden getötet, dreißig verletzt. Als etwas später im gleichen Monat die Partij van de Arbeid mehr Parlamentssitze als je zuvor errang, lud er eine Beretta ARX190, schoss sich durch den Sicherheitskordon beim Van Buuren-Hotel in Den Haag und mähte siebenundvierzig feiernde Parteimitglieder nieder. Zählt man zu den Opfern dieser beiden Massaker auch noch die von ein paar kleineren, davon getrennten Vorfällen hinzu, hat Kleef Dijkstra den Tod von zweiundsechzig Menschen zu verantworten.
Nach seiner Festnahme kamen forensische psychiatrische Gerichtsgutachter zu dem Schluss, dass Kleef Dijkstra an paranoider Schizophrenie litt. Er habe soziopathische Tendenzen, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, Grandiositäts- und Wahnvorstellungen und psychotische Episoden. Er zeige keinerlei Reue für seine Verbrechen und habe denjenigen, die ihn untersuchten, sogar einmal mitgeteilt, dass er auch sie gern töten würde. Die Psychiater hielten daher eine Resozialisierung – selbst unter Einsatz raffiniertester moderner Techniken – für wenig aussichtsreich und empfahlen die langjährige Inhaftierung in einem Hochsicherheitstrakt.
Viele andere widersprachen. Trotz der ablehnenden Haltung der Europäer gegenüber der Todesstrafe argumentierten zahlreiche Kommentatoren in den Niederlanden und anderswo, dass Dijkstra gemäß seiner ganz persönlichen Wertvorstellungen zum Tode verurteilt werden sollte. Schließlich würde seine Inhaftierung teuer werden, und es bestand durchaus die Möglichkeit, dass er hinter Gittern zum Helden avancieren und mittels aus dem Gefängnis geschmuggelter Sendschreiben Gleichgesinnte mobilisieren könnte. Dijkstra, der ein besorgniserregendes Charisma besaß, hatte bereits erklärt, dass »der Kampf gerade erst begonnen hat« und dass in hundert Jahren »in ganz Europa an allen Straßenecken Statuen von mir stehen werden«.
Schließlich ergab sich eine Lösung. Der Mond befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem frühen Entwicklungsstadium: Auf der Vorderseite hatte der Bergbau begonnen, und an der Doppelmayer-Basis war das erste Hotel eröffnet worden. Allerdings waren die langfristigen physischen und psychischen Auswirkungen, die das Leben auf dem Mond mit sich brachte, zum größten Teil noch unbekannt. Expeditionen auf der Oberfläche waren notwendigerweise von kurzer Dauer und zeigten oft beunruhigende Nebenwirkungen, angefangen bei Strahlenvergiftung und vorübergehender Blindheit bis hin zu Halluzinationen und psychischen Zusammenbrüchen. In einem berühmt gewordenen Fall verlor ein Bergarbeiter in einer kleinen Fertigbau-Basis im Oceanus Procellarum den Verstand und zerhackte fünf Kumpels.
Daher erhielten Langzeit-Gefangene zuerst in Russland und den Vereinigten Staaten und schließlich überall auf der Welt die Chance, ihre Strafe auf der Rückseite des Mondes abzusitzen. Zwischen ihnen und der Erde würden dabei nicht nur mindestens 356700 Kilometer liegen – der Abstand vom Mond zur Erde am erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn –, sondern sie würden außerdem noch durch 3500 Kilometer Mondgestein – den Durchmesser des Mondes – von ihr getrennt sein. Sie würden in isolierten Habitaten leben – in »Iglus« von der Größe einer durchschnittlichen Zwei-Zimmer-Wohnung – und durch hoch verdichteten Mondsand oder »Regolith« vor Strahlung geschützt sein. Man würde ihnen keine Raumanzüge und auch keine LRVs (Lunar Roving Vehicles) zur Verfügung stellen. Sämtliche Vorräte würden durch störungssichere Luken ausgeteilt werden. Die gesamte, über sublunare Glasfaserkabel laufende ein- und ausgehende Kommunikation würde genauestens aufgezeichnet werden. Sofern ein persönlicher Kontakt unbedingt notwendig werden sollte, würde der betreffende Besucher – oder die Besucher – von einem Trupp bewaffneter Wachen begleitet werden. Die Gefangenen würden vollkommen allein sein, aber sie würden auch ein Maß an Autonomie behalten, das in einer irdischen Einrichtung absolut unmöglich wäre. Es würde kein Gefängnisregime geben. Keine Beleidigungen seitens der Wachen und anderer Gefangener. Kein gemeinsames Duschen. Kurz gesagt: keine Gelegenheit, vergewaltigt, geschlagen oder getötet zu werden. Und als Gegenleistung für diese Freiheit mussten die Gefangenen lediglich ihre physiologischen Veränderungen aufzeichnen und berichten sowie sich zu regelmäßigen festgesetzten Zeiten mittels Dachluken einer höheren Dosis ungefilterten Sonnenlichts aussetzen und sich per Tele-Link psychologischen Tests unterziehen.
Nach zwei Jahren Bürokratie wurde Kleef Dijkstra ein Aufenthalt in einem dieser Mondiglus zugestanden. Als er die Nachricht erhielt, zeigte er kaum eine Gefühlsregung. Tatsächlich schien er zu denken, dass es bereits beschlossene Sache gewesen war, als hätten höhere Mächte darüber entschieden. Mit der Erklärung, dass er »viel Arbeit zu erledigen« habe, bewarb er sich unverzüglich um die Mitgliedschaft in den bedeutendsten Bibliotheken und Informations-Datenbanken der Welt.
Fünfundzwanzig Jahre später ist Kleef Dijkstra einer der Menschen, die am längsten auf der Rückseite des Mondes leben. Nur der georgische Terrorist Batir Dadayev ist noch länger auf dem Mond als er. Genau wie die elf anderen Überlebenden des mittlerweile eingestellten Projekts namens »Off-World-Incarceration-Programm« (OWIP) leben diese beiden Männer in einem Radius von siebzig Kilometern im Gagarin-Krater in der südlichen Hemisphäre der Rückseite.
Verglichen mit ihrer Zeit auf der Erde sind alle dreizehn körperlich nicht mehr wiederzuerkennen. Sie sind deutlich größer geworden, weil ihre Wirbelsäule sich in die Länge gezogen hat. Ihr Brustkorb ist aufgrund der Umverteilung der Körperflüssigkeiten fassförmig geworden. Ihre Gesichter sind aufgequollen, ihre Beine dürr. Ihre Knochen sind brüchig, die Herzen kleiner. Ihr ganzer Körper hat sich auf subtile Weise an das Leben unter verringerten Schwerkraftverhältnissen angepasst.
Die mentalen Veränderungen sind hingegen nicht bei allen gleich verlaufen. Einige Gefangene wie Batir Dadayev haben ihre alten Ideologien widerrufen. Ein paar haben Symptome früher Demenz entwickelt. Andere sind in einem gewissen Maße sanfter geworden und behaupten sogar, sie würden so etwas wie aufrichtige Reue empfinden. Einer ist tief religiös geworden. Und schließlich gibt es noch eine hartnäckige Handvoll Menschen wie Kleef Dijkstra, deren Weltanschauung sich überhaupt nicht geändert hat.
Dijkstra ist, wie er Ihnen nur zu gern erzählen würde, mit einer bestimmten Absicht auf den Mond gekommen: Er hatte vor, sein politisches Manifest zu schreiben, ein Kompendium aus historischen Analysen, ökonomischen Theorien und autobiographischen Details im Stil von Mein Kampf (ein Buch, das Dijkstra für nachhaltig prägend, wenn auch äußerst dilettantisch hält). Selbstverständlich hat er die Sicherheitsvorkehrungen, die dafür sorgen sollten, dass seine Weisheiten unter Verschluss blieben, keinesfalls unterschätzt, aber er war zuversichtlich, seine Ärzte mit seiner rhetorischen Brillanz überzeugen zu können; bereits ein einziger würde genügen, damit seine Worte irgendwie nach draußen sickern könnten. Vielleicht würden seine Schriften auch im Laufe der Jahre von ganz allein das »öffentliche Interesse« erregen. Wie auch immer, es schien ihm nur eine Frage der Zeit, bis sein Manifest die verdiente Anerkennung bekommen würde.
Das ganze Dokument – »Briefe von der Rückseite des Mondes« – ist ziemlich brisant. Und zusammenhanglos. Gespickt mit sachlichen Ungenauigkeiten und höchst fragwürdigen Lesarten der Geschichte. Zudem ist es 3600 Seiten lang.
Dijkstra überarbeitet es inzwischen seit vollen zwei Jahrzehnten. Seine ursprüngliche Hoffnung, es würde sich so bald wie möglich in alle Welt verbreiten, hat sich als trügerisch erwiesen – seine Ärzte waren doch engstirniger, als er erwartet hatte. Aber er lässt sich davon nicht entmutigen. Die Verzögerung hat ihm einfach nur zusätzliche Zeit verschafft, noch mehr an seinen Argumenten zu feilen, sie mit weiteren historischen Präzedenzfällen anzureichern und symbolkräftige Geschichten – »Parabeln« – einzuflechten, um seine Standpunkte zu verdeutlichen. Ohnehin wurde Dijkstra schon bald klar, dass die »Briefe von der Rückseite des Mondes« kein gewöhnliches Manifest darstellen. Sie sind die neue Bibel. Auf ewig wird aus ihnen zitiert werden. Ganze Leben werden sich um sie drehen. Das Manuskript ist unendlich viel wichtiger als sein eigener dahinschwindender Körper. Es ist eine Zeitkapsel aus transzendentalem Genie, in den Kosmos geworfen, um Orte und Zeiten zu erreichen, die er sich noch nicht einmal annähernd vorstellen kann.
Während Dijkstra über all das nachdenkt – er arbeitet gerade an Buch XXVI, »Rot in Wahrheit & Gesetz: Die brutale Realität erfolgreicher Ökonomien« –, ertönt ein unverwechselbares Piepsen, und er stellt den Desktop-Monitor auf Außenansicht um. Eine Kamera zeigt den Bereich direkt vor der Tür seines Iglus.
Ein Mann ist da draußen. Steht auf der aschgrauen staubigen Ebene von Gagarin im lunaren Vakuum. Hinter ihm lodert die Sonne.
Nur kann er natürlich kein Mann sein, denn er trägt keinen Raumanzug. Ganz im Gegenteil, er trägt einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte. Seine schwarzen Haare sind akkurat gescheitelt. Die Schultern sind breit, die Statur ist schlank, das Gesicht ansehnlich. Und er lächelt. Er sieht aus wie ein altmodischer Haustürverkäufer der Encyclopaedia Britannica. Oder wie ein Mormone. Aber er ist ganz offensichtlich ein Androide.
Daran ist nichts Ungewöhnliches. OWIP schickt meistens Androiden, wenn – was hin und wieder vorkommt – Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Auf diese Weise spart man sich den Aufwand, die bewaffneten Wachen zusammenzutrommeln. Selbst wenn ein Gefangener es irgendwie schaffen sollte, den Androiden zu überwältigen, oder es ihm gelänge, seine Funktionen auszuschalten, würde ihm das nicht viel nützen – es gäbe zum Beispiel kein mit einer Druckkabine ausgestattetes Fahrzeug, mit dem er flüchten könnte, da Androiden gewöhnlich in einem »Mondbuggy«, einem offenen LRV, unterwegs sind. Und er hätte auch nicht viel davon, einen Androiden als Geisel zu nehmen; OWIP würde die Einheit einfach abschreiben und dem Gefangenen eine Weile seine Privilegien vorenthalten.
Dijkstra drückt einen Knopf, um die Schleusentür zu öffnen.
Der Androide tritt ein; er lächelt immer noch. Bei einem Roboter sind die üblichen Druckausgleichsprozeduren im Grunde genommen nicht nötig, allerdings muss der Mondstaub entfernt werden. Und daher hebt der Androide die Arme, als die elektrostatischen Ultraschallbürsten um ihn herumwirbeln wie die Reinigungsbürsten einer Autowaschanlage. Dann hört das rote Licht auf zu blinken, und das bernsteinfarbene leuchtet. Kurz danach summt das Entwarnungssignal. Dijkstra öffnet die innere Schleusentür, und der Androide tritt ein.
»Guten Tag, Sir«, sagt er und streckt ihm eine Hand entgegen. »Und vielen Dank dafür, dass Sie mich hereingelassen haben.«
»Keine Ursache«, sagt Dijkstra, der wider Willen nervös ist. Eigentlich mag er Androiden – als Symbole einer erbarmungslosen Ökonomie –, aber der hier ist beunruhigend real, fast schon einschüchternd. Und seine Hand fühlt sich sinnlich an – beinahe sexuell. »Hat OWIP Sie geschickt?«, fragt er hastig.
»Können Sie das noch einmal sagen, Sir?«
»Ich habe gefragt, ob OWIP Sie geschickt hat.«
»Es tut mir leid, Sir, diesen Namen kenne ich nicht. Ist das ein Unternehmen, ein Konzern, ein Konsortium, eine Strafverfolgungsbehörde oder eine Regierungsstelle?«
»Es ist ein internationales Programm, aber das ist nicht so wichtig. Dann gehören Sie zu einem Erkundungsteam?«
»Was meinen Sie mit ›Erkundungsteam‹, Sir?«
»Ein Team, das geologische Untersuchungen anstellt … oder seismologische … astronomische.«
»Ich gehöre zu keinem Erkundungsteam, Sir. Ich bin auf der Suche nach El Dorado.«
»Nach El Dorado?«
»Das habe ich gesagt, Sir.«
Eine Sekunde lang fragt sich Dijkstra, ob das ein Witz sein soll. Aber dann kommt ihm eine Idee. »Sind Sie mit einem der Bergbauteams hier?«
»Ich bin mit keinem der Bergbauteams hier, Sir.«
»Aber Sie möchten nach El Dorado?«
»Das ist korrekt, Sir.«
»Nun, es könnte ein neuer Ort sein, von dem ich nichts weiß …«
»Dann können Sie mir also nicht helfen, Sir?«
»Nicht, wenn Sie nach El Dorado wollen.«
Der Androide schweigt. Irgendetwas an ihm wirkt jetzt unheimlich, auch wenn sich unmöglich sagen lässt, warum das so ist, da sich sein alberner Gesichtsausdruck niemals ändert. Dennoch zögert Dijkstra, ihn einfach wieder ziehen zu lassen, denn eigentlich sehnt er sich ständig nach einer Möglichkeit, sich zu unterhalten – mit wem oder was auch immer.
»Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen?«, fragt er. »Vielleicht möchten Sie …« Er hätte beinahe »auftanken« gesagt, doch er hält sich zurück. Es ist natürlich absurd, aber je menschlicher die Roboter wirken, desto weniger gern möchte man ihnen gegenüber zugeben, dass sie künstlich sind. »Vielleicht möchten Sie sich eine Weile hinsetzen?«
»Haben Sie irgendwelchen hochprozentigen Alkohol, Sir?«
»Nein, tut mir leid.«
»Oder sonst irgendwelchen Alkohol, Sir?«
»Ich trinke keinen Alkohol.«
»Haben Sie dann irgendetwas anderes zu trinken?«
»Wie wäre es mit Kaffee – Instant-Kaffee?«
»Das wäre ganz hervorragend, Sir – ich würde eine Tasse von diesem Instant-Kaffee sehr begrüßen. Mit fünfzehn Teelöffeln Zucker.«
»Das lässt sich machen«, sagt Dijkstra. Der Androide zählt eindeutig zu den Modellen, die mit Alkohol und Glukose betrieben werden. So hat man sie früher oft gebaut, damit sie den Menschen ähnlicher waren. Aus diesem Grund hatten sie erkennbare Essvorlieben – und mussten sogar Abfall ausscheiden.
Dijkstra bereitet den Kaffee zu. Auf dem Mond kocht Wasser bei einer niedrigeren Temperatur, aber die meisten Menschen haben sich daran gewöhnt, lauwarmes Gebräu zu trinken. »Darf ich fragen, mit wem Sie unterwegs sind?«, fragt Dijkstra, noch immer mit dem kochenden Wasser beschäftigt.
»Ich bin allein unterwegs, Sir.«
»Aber Sie müssen doch …«, setzt Dijkstra an, hält dann aber den Mund. Vielleicht hat der Androide den Auftrag, ihn aus nächster Nähe zu beobachten. Als er ihn so steif am Tisch sitzen sieht, kommt es ihm fast so vor, als würde er sorgfältig den Raum inspizieren.
»Es ist sehr schön hier, Sir«, sagt der Androide und lächelt.
»Danke«, sagt Dijkstra. »Es ist etwas spartanisch, aber viele der größten Männer der Geschichte haben wie ein Spartaner gelebt.«
»Sind Sie ein Spartaner?«
»Wenn ich keiner wäre, wäre ich nicht hier.«
»Sind Sie ein großer Mann?«
»Das muss die Geschichte entscheiden.«
»Sind Sie ein Eroberer?«
Dijkstra zuckt mit den Schultern. »Noch nicht.«
»Ich werde ein Eroberer sein«, sagt der Androide.
»Ich vermute, dass Sie deshalb nach El Dorado wollen.«
»Genau das ist der Grund, Sir. Sind wir Rivalen?«
»Rivalen?«
»Wenn Sie auch ein Eroberer sein wollen, sind wir dann nicht Rivalen, Sir?«
»Nur, wenn Sie das wollen.«
Dijkstra füllt Kaffee in einen Becher und zieht die Möglichkeit in Betracht, dass mit dem Androiden etwas nicht stimmt. Die Kommunikation auf der Mondrückseite – seine einzige Verbindung mit der Außenwelt – ist seit etwa zwanzig Stunden unterbrochen. So etwas kommt schon mal vor; solare Radiostrahlung und kosmische Strahlung können einen Kurzschluss in den Transformatorenstationen und Verteilerkästen verursachen. Möglicherweise sind bei diesem Androiden ebenfalls ein paar Schaltkreise durchgeschmort.
Er geht zum Tisch und setzt sich, reicht ihm den Kaffee. »Ich habe ihn bereits umgerührt.«
»Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, Sir.«
Der Androide – er sieht wirklich erstaunlich gut aus – nimmt den Becher und trinkt in kleinen, anmutigen Schlucken, wie ein Vikar beim Fünfuhrtee.
»Dieser Kaffee ist gut«, sagt der Androide.
»Danke«, sagt Dijkstra. »Kommen Sie von … irgendeiner Basis?«
»Ich erinnere mich nicht daran, woher ich komme, Sir. Ich sehe nur nach vorn, in die Zukunft.«
»Tja, das klingt vernünftig.«
»Es ist vernünftig, Sir. Leben Sie dauerhaft hier?«
»Ja.«
»Ganz allein?«
»Ja.«
»Worin besteht dann Ihr Beitrag zur Bilanz?«
»Ich bin mir nicht sicher, was Sie mit ›Bilanz‹ meinen.«
»Sind Sie ein Aktiv- oder ein Passivposten?«
»Ich würde mich natürlich als Aktivposten einstufen.«
»Für die Wirtschaft?«
»Für die Welt.«
Der Androide braucht einen Moment, um diese Antwort zu verarbeiten. Schließlich sagt er: »Können Sie mir dann noch etwas anderes anbieten, Sir, außer diesem guten Kaffee?«
»Etwas anderes … was könnte das sein?«
»Irgendetwas anderes.« Er starrt ihn immer noch an.
Einen Moment erwägt Dijkstra die erregende Möglichkeit, dass der Androide von Bewunderern geschickt wurde. Dass er die Aufgabe hat, sein Manifest mitzunehmen und zur Erde zu schmuggeln.
»Also … das kommt darauf an. Wissen Sie, wer ich bin?«
»Nein, das weiß ich nicht, Sir.«
»Die Leute, die Sie geschickt haben, wissen die, wer ich bin?«
»Ich bin von niemandem geschickt worden, Sir.«
»Haben Sie hier keine Aufgabe zu erfüllen?«
»Ich möchte nur eine Wegbeschreibung, Sir.«
»Dann sind Sie nicht hier, um meine Schriften mitzunehmen?«
»Nur, wenn Ihre Schriften mir helfen, El Dorado zu finden, Sir.«
Darauf gibt es keine leichte Antwort, denkt Dijkstra. Aber er muss akzeptieren, dass sein Traum, so kurz er auch war, keinen Bestand hat. Und plötzlich fühlt er sich leicht ernüchtert. Er hatte sich gewünscht, dass der Androide ihm irgendetwas anbieten würde – irgendeine Hoffnung.
»Möchten Sie vielleicht noch eine Tasse Kaffee?«, fragt Dijkstra, als er sieht, dass der Androide den Becher ausgetrunken hat.
»Das ist sehr großzügig von Ihnen, Sir. Aber ich muss mich jetzt wieder auf den Weg machen. Beweg dich. Beweg dich. Während andere schlafen, beweg dich.« Er steht auf.
»Vielleicht kann ich Ihnen noch ein paar Zuckerstückchen anbieten? Für unterwegs?«
»Sie sind sehr großzügig, Sir. Ich nehme Ihr Angebot dankbar an.«
Dijkstra geht zu seiner Vorratskammer. Er fragt sich, warum er so beflissen ist. Seine Zuckervorräte sind inzwischen ziemlich geschrumpft, und es kann manchmal Wochen dauern, bis er Nachschub bekommt. Und doch steht er hier und bietet ganz gegen seine sonstigen Prinzipien kostenlos Hilfe an. Es ist fast so, als wäre er manipuliert worden. Oder irgendwie geschwächt.
Als er zurückkehrt, steht der Androide da und hält ihm immer noch lächelnd die Hand hin. Und als Dijkstra ihm die Zuckerstücke gibt, bemerkt er zum ersten Mal einen dunkelroten Fleck auf der Hemdmanschette.
»Oh«, sagt er spontan. »Ist das – was ist das? Ist das Blut?«
»Das ist kein Blut, Sir.«
»Es sieht aus wie Blut.«
»Es ist kein Blut, Sir.« Der Androide lässt den Arm sinken, so dass die Manschette nicht mehr zu sehen ist. »Aber das ist für Sie nicht weiter von Belang, Sir. Sie sind sehr hilfreich gewesen. Sie haben mir Kaffee und Zucker gegeben. Sie haben dafür nicht einmal etwas haben wollen. Sie fallen daher nicht in die Ungeziefer-Kategorie.«
»Na ja«, sagt Dijkstra und kichert ausweichend, »wir atmen alle die gleiche Luft.«
Der Androide beugt sich näher zu ihm – so nah, dass Dijkstra den Kaffee in seinem Atem riechen kann. »Können Sie das noch einmal sagen, Sir?«
»Ich sagte, wir atmen alle die gleiche Luft.«
Dijkstra hat das weder sarkastisch noch spöttisch gemeint. Es ist einfach ein Ausdruck, der auf dem Mond zu einer gängigen Redewendung geworden ist – sowohl als halb ironische brüderliche Geste wie auch als Anerkennung des wertvollsten Rohstoffs auf dem Mond.
Aber der Androide scheint etwas sehr viel Bedeutungsvolleres in diese Aussage zu interpretieren.
»Sie sagen, wir atmen alle die gleiche Luft, Sir?«
»Das stimmt.«
»Dann sind wir also doch Rivalen, Sir?«
»Rivalen?«
»Wenn es um die Luft geht?«
Dijkstra hätte beinahe gelacht. Der Androide wirkt beleidigt – oder so, als würde er nur zu gern einen Grund finden, um beleidigt zu sein. Daher sagt er einfach nur: »Na ja, letztlich sind wir alle Rivalen, oder? Konkurrenz ist das, was die Welt am Laufen hält.«
Und der Androide, der ungefähr genauso groß ist wie Dijkstra, starrt ihn weiter mit seinen tiefschwarzen Augen an – noch nie hat Dijkstra seelenlosere Augen gesehen. Und Kleef Dijkstra, der zweiundsechzig Menschen ermordet hat, fröstelt plötzlich. Denn ihm kommt ein ganz neues Szenario in den Sinn: dass der Androide von seinen Feinden geschickt worden sein könnte – von all den erbärmlichen Weicheiern und Modeopfern auf der Erde –, um zu verhindern, dass seine Botschaft nach draußen gelangt. Um ihn irgendwie zum Schweigen zu bringen.
Dann blinzelt der Androide.
»Danke, Sir.« Er streckt ihm wieder die Hand hin. »Sie sind ein sehr ehrenwerter Gentleman.« Sie schütteln sich die Hände.
Dijkstra fühlt sich ungewöhnlich erleichtert. »Tja, dann«, sagt er, »viel Glück auf Ihrer Reise.«
»Danke, Sir.«
»Ich hoffe natürlich, dass Sie El Dorado finden.«
»Danke, Sir.«
»Ich hoffe, dass Sie ein Eroberer werden.«
»Das strebe ich an, Sir.«
»Dann werde ich jetzt die Schleuse öffnen und Sie rauslassen.«
»Und ich werde hier stehen, Sir.«
Als Dijkstra zum Bedienfeld geht, empfindet er schlagartig so etwas wie Vorfreude. Noch vor wenigen Minuten wollte er den Aufenthalt seines Gasts verlängern, und jetzt sehnt er sich einfach nur danach, wieder allein zu sein. Aber zuerst muss er die Luftschleuse öffnen. Was bedeutet, dass er dem Androiden den Rücken zukehren muss.
Was wiederum bedeutet, dass er nur aus den Augenwinkeln wahrnimmt, wie der Androide sich bewegt – dass er nach etwas greift. Einem Schraubenschlüssel, der auf der Werkbank liegen geblieben ist.
Dijkstra wirbelt herum, um sich zu verteidigen, aber es ist bereits zu spät. Der Androide, der jetzt gar nicht mehr lächelt, stürzt sich auf ihn.
Dijkstra versucht, die Hände hochzureißen, aber der Schraubenschlüssel landet krachend auf seinem Kopf. Knack. Knack. Der Androide ist erbarmungslos. Knack. Dijkstra sieht sein eigenes Blut in seinen Augen. Knack. Er fällt auf den Boden. Knack. Knack. Der Androide schlägt ihm den Schädel ein.
Knack. Knack.
»Es ist gut, einen Rivalen zu haben«, zischt der Androide, der jetzt mit Kleef Dijkstras Blut bespritzt ist. »Noch besser ist es, ihm den Schädel einzuschlagen.«
Knack.
Knack.
Knack.
03.
Wenn Sie ein durchschnittlicher Tourist sind, wird eine Reise zum Mond für Sie höchstwahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis bleiben. Sie werden in Florida ein Shuttle nehmen oder in Costa Rica, Kasachstan, Französisch-Guayana, auf Tanegashima oder vielleicht auch auf der umfunktionierten Bohrinsel vor der Malabarküste. Vermutlich lockt Sie die Vorstellung, ein paar Tage im StarLight-Casino in der erdnahen Umlaufbahn zu verbringen; dann wird es Sie freuen zu hören, dass der Karussell-Raum seinem spektakulären Ruf voll und ganz gerecht wird. Von hier aus nehmen Sie die Fähre zu einem der Haupthäfen des Mondes, wahrscheinlich zur Doppelmayer-Basis im Mare Humorum oder zur Lyall-Basis im Mare Tranquillitatis. Anschließend checken Sie in einem der großen Hotels ein: dem Kopernikus, dem Hilton, dem HoneyMoon, dem Interstellar oder dem Overview. Ein paar Tage verbringen Sie damit, sich anzupassen und/oder sich zu erholen. Danach brechen Sie wahrscheinlich zu einer kleinen Rundreise auf, die Sie zu den örtlichen Attraktionen führen wird: den Vergnügungsparks, den Aussichtstürmen, den Sportstadien, dem berühmten Ballett-Theater. Sie werden bestimmt einen Ausflug zu den Apollo-Landeplätzen machen – vor allem zu dem unter einer Kuppel liegenden Landeplatz von Apollo 11. Wenn Sie wirklich etwas erleben wollen, machen Sie vielleicht sogar eine Spritztour zum Südpol, um den atemberaubenden Shackleton-Krater zu bewundern, der viermal so tief ist wie der Grand Canyon.
Falls Sie allerdings auf den Mond gereist sind, um billig oder illegal eine Operation durchführen zu lassen, wenn es Ihnen um Drogenschmuggel, verbotenen Sex, Risikosportarten oder Glücksspiele mit überaus hohen Einsätzen geht oder Sie einfach nur nicht überwachte Gespräche führen wollen, wird Ihr Ziel ganz sicher Purgatory und seine Hauptstadt Sin auf der Rückseite des Mondes sein.
Um dorthin zu gelangen, werden Sie die Magnetschwebe- oder Monorailbahn benutzen, mit der Sie bei einer Geschwindigkeit von nahezu tausend Kilometern pro Stunde Ihr Ziel in nur fünf Stunden erreichen können – zumindest theoretisch. In Wirklichkeit dauert es allein schon eine halbe Stunde, den Zug zu überprüfen und druckfest zu machen, wobei er etliche Luftschleusen passiert. Danach windet er sich weitere zwei Stunden um die verschiedenen Fabriken, Museen, Kommunikationszentren und Funktürme herum, die das Gebiet zwischen der Doppelmayer-Basis und den lunaren Karpaten sprenkeln. Sobald das Land jedoch frei ist – und die Strecke somit gerade –, rast der Zug mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets durch die graue/ockerfarbene/beige Hügellandschaft.
Wenn Sie durch die stark getönten Fenster nach draußen blicken, werden Sie Steinbrüche sehen, dazu Baggerroboter und Förderbänder, die in blitzenden metallverhüttenden Werken verschwinden. Sie werden Sonnenkollektoren-Felder sehen, Schwungräderfarmen und auf Plattformen errichtete Mikroelektronik-Fabriken. Ganz zu schweigen von den Transportkarren, den Zugmaschinen und Grabenfräsen, den Schürfladern und vielrädrigen Fahrzeugen – sprich: dem ganzen Fuhrpark, der mit einer großmaßstäblichen Ausbeutung von Ressourcen verbunden ist. Dann werden Sie über das Viadukt des sonnensynchronen Erntezugs schießen, der zehn Kilometer lang ist und mit Obst und Gemüse beladen am Mondäquator entlangkriecht. Vielleicht sehen Sie auch einen Frachtzug in der Gegenrichtung vorbeizischen, so schnell, dass Sie nur einen kurzen Lichtblitz wahrnehmen. Und dann lehnen Sie sich wieder zurück, während die Magnetschwebebahn durch das Mare Imbrium gleitet, den Krater Plato kreuzt, das schmale Mare Frigoris durchquert und das nördliche Hochland erreicht, wo der Staub heller und das Gelände gebirgiger ist und die Schatten lang und unheimlich sind.
Schließlich bemerken Sie am Horizont Bereiche voller Funkmasten und Kraftwerktürme und Kräne und Lagerhäuser und Rangierbahnhöfe und einen Müllhaufen aus weggeworfenen Maschinen und Bohrerteilen. Dies ist eindeutig eine Bergbaustadt. Aber hier endet auch die Fahrt. Sie sind jetzt an der Peary-Basis am Nordpol – und dahinter gibt es »nur noch Dunkelheit«.
Sie werden hier so wenig Zeit wie möglich verbringen; der gesamte Ort hat den Charme eines billigen Einkaufszentrums. Es gibt einen zweitklassigen Beobachtungsturm. Einen Massebeschleuniger beziehungsweise eine Railgun, deren kilometerlange geschwungene elektromagnetische Schienen dazu dienen, Nutzlasten zur Erde zu schicken beziehungsweise von dort kommende aufzufangen. Und all die Kräne, Laufketten und für Tiefenbohrungen eingesetzten Bohrtürme, die zur Eis-Bergbau-Industrie gehören. Aber viel mehr gibt es nicht. Sie werden also in einem der zweckdienlichen Hotels mit niedrigen Decken einchecken, in eines der Zimmer von der Größe eines Wandschranks gehen (es ist teuer, ein ganzes Hotel mit einem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch und normalen Luftdruckverhältnissen zu versehen) und auf einem Bett zusammenbrechen, das etwa so groß ist wie die Schlafkoje in einem U-Boot.
Auf dem Nachttisch – sofern es einen gibt – finden Sie wahrscheinlich eine zehnseitige Broschüre, eine Mitteilung für Reisende, in der Sie vor Purgatory gewarnt werden. Wenn Sie wagemutig sind oder einfach nur Unterhaltung suchen, werden Sie wohl einen Blick hineinwerfen. »Äußerst gefährlich … verhalten Sie sich vorsichtig … Kommunikations-Einschränkungen … exzentrische örtliche Gesetze, die brutal durchgesetzt werden … Todesstrafe verhängt … hohe Rate an Geschlechtskrankheiten … unzertifizierte medizinische Einrichtungen … kontrovers beurteilte Verfahren … feindselige Ortsansässige … Visa-Bedingungen und andere für die Ein- und Ausreise erforderliche Verfahren werden willkürlich verändert … Touristen werden geködert, ins Visier genommen und häufig getötet …«
Wenn Sie daraufhin nicht zu zweifeln beginnen – und wenn Sie es bis hierher geschafft haben, warum sollten Sie? –, werden Sie Ihre Reise in Richtung des Peary-Transport-Terminus fortsetzen. Aber erwarten Sie nicht, wieder mit einer Magnetschwebebahn zu fahren: Um die Radaranzeigewerte nicht zu verfälschen, ist auf der Rückseite des Mondes kein elektromagnetisches Antriebssystem erlaubt, ebenso wenig wie Funkwellen, Handy-Netzwerke oder Satelliten-Technologien. Sie werden sich also zwischen einem von einer Brennstoffzelle angetriebenen Bus, einem Minibus, einem Taxi oder, wenn Sie wirklich viel Geld haben, einer Limousine mit Chauffeur entscheiden müssen. Ganz egal, auf welches Fahrzeug es schließlich hinausläuft – es wird um ein paar Biegungen fahren, um in den gitterartigen Schatten des Massebeschleunigers zu gelangen, dann durch eine Lücke in einer Böschung aus aufgehäuftem Müll – eine Art inoffizielles Ausfalltor – und weiter auf eine feste Straße aus gesintertem Regolith, die sich wie ein ausgerolltes Band durch die pockennarbige Mondlandschaft schlängelt. Dies ist die Road of Lamentation – die Straße der Wehklage –, der offizielle Highway nach Purgatory.
Der Regolith wurde am Straßenrand zu einer Art Schutzmauer hoch aufgeschichtet, so dass es zunächst gar nicht viel zu sehen gibt: gelegentlich mal einen Kraterrand oder ein Stück Mondgebirge, die auf Stützen ruhenden und farbig kodierten Pipelines, in denen sich Wasserstoff, Stickstoff oder Sauerstoff befindet, und – wenn es Nacht ist und die Schutzschilde Ihres Fahrzeugs heruntergelassen sind – den kristallklaren Kosmos. An der Straße gibt es in regelmäßigen Abständen Gebäude, die Schutz vor eventuellen Sonneneruptionen bieten, sowie Vorratslager, Notfallparkbuchten und ein paar etwas abseits gelegene Stellen, an denen die Touristen einen letzten Blick auf die Erde werfen können. Aber der größte Teil der Reise verläuft ziemlich monoton und beinahe so, als würde man bei Nacht auf einem Highway durch die Wüste fahren – abgesehen davon, dass einige der weniger beladenen Fahrzeuge sich ein paar schwindelige Momente lang von der Oberfläche lösen und durch die Luft segeln, wenn die Straße einen Bergkamm erklimmt.
Jenseits des fünfundsiebzigsten Breitengrads beginnt sich die Straße wie ein mäandernder Fluss um die größeren Krater herumzuwinden. Aufgrund der Überhöhung der Straße können Sie jetzt mehr von der Mondlandschaft sehen: deutlich mehr zerklüftetes Gelände und kleine Hügel als auf der Vorderseite, wie Sie bemerken werden. Aber auch das wird nach einiger Zeit ermüdend, und genau dann, wenn Sie sich zum ersten Mal fragen, ob die Reise jemals enden wird – genau dann, wenn Ihre Lider zu flattern beginnen –, wird der Anblick eines riesigen Objekts am Straßenrand Sie wieder aufwecken. Ein Objekt, das sich mindestens dreißig Meter über den Verkehr erhebt.
Es handelt sich um eine spritzlackierte, strahlend weiße Statue, die bei Nacht von grellen Halogenscheinwerfern angeleuchtet wird und aussieht wie ein geflügelter Engel am Bug eines Schiffes.
Das ist der Celestial Pilot – der Himmlische Lotse, der die verlorenen Seelen nach Purgatory bringt. Und er ist auch nicht die letzte Statue, die Sie auf diesem allerletzten Abschnitt der Reise sehen werden. Etwa einen Kilometer weiter befindet sich ein riesiger Adler – jener Adler, der Vergil in seinem Traum getragen hat. Dann sehen Sie einen kolossalen Krieger – Bertran de Born –, der seinen eigenen abgetrennten Kopf in der Hand hält, als wäre er eine Laterne. Danach begegnen Sie einem römischen Kaiser – Trajan – auf einem mit einer Schabracke geschmückten Pferd. Und schließlich erblicken Sie eine nackte Frau – Arachne – mit acht spinnenähnlichen Gliedmaßen. Bei all diesen Statuen handelt es sich um Figuren von Dante Alighieri und Gustave Doré, die eigens dafür geschaffen wurden, Ihrem Ziel eine zusätzliche mythologische Resonanz zu verleihen.
Dann führt die Straße der Wehklage wieder nach unten, und all die Taxen, Busse, Transporter und Schlepper treffen sich an einer Engstelle, die mindestens einen halben Kilometer lang ist. Irgendwo in der Mitte von alldem können Sie einen ersten Blick auf den Störmer-Krater werfen. Die gewaltigen Bollwerke des natürlichen Ringwalls werden von flackernden elektrischen Lampen beleuchtet. Der Eingang selbst besteht aus verzierten Messingtüren, die von riesigen Säulen flankiert werden, zwanzig Meter hoch und überreich mit nachgemachten Basreliefs im Renaissance-Stil verziert. Und ehe Sie sich’s versehen, haben Sie den Eingang passiert. Die Tore schließen sich hinter Ihnen. Jetzt sind Sie endlich drin. Durch mehrere Schleusen gelangen Sie an die Endhaltestelle. Und dort übermittelt Ihr Busfahrer oder Chauffeur oder Führer oder ein Androide oder eine in verschiedenen Sprachen aufgezeichnete Durchsage Ihnen eine ernüchternde Nachricht:
»Willkommen in Purgatory.«
04.
Lieutenant Damien Justus wird in seinem Büro von einem Reporter des Tablet interviewt, Purgatorys einzigem offiziellem Nachrichtenorgan. Der Reporter mit dem unwahrscheinlichen Namen Nat U. Rally trägt einen zerknitterten Hut und eine fadenscheinige Jacke mit Flicken an den Ellbogen. Er kaut Kaugummi und macht sich mit einem Stift Notizen auf einem winzigen Schreibblock. Aber immerhin hat er genug Anstand, so zu tun, als sei er befangen.
»So ist das hier in Purgatory«, sagt er. »Alles ziemlich retro.«
»Das habe ich bemerkt.«
»Wir arbeiten beim Tablet immer noch mit Druckwalzen, wussten Sie das?«
»Es überrascht mich nicht mehr«, sagt Justus.
Selbst das Büro, das man ihm gegeben hat, scheint aus den 1950ern zu stammen. Ein Schreibtisch aus ächzendem Holz, ein Aktenschrank mit quietschenden Schubladen, ein Wählscheiben-Telefon aus Bakelit und an der Wand ein Schwarzweißfoto von Fletcher Brass, als wäre es ein offizielles Eisenhower-Porträt. Und was seine Polizeiuniform betrifft, so scheint sie einem Dick-Tracy-Cartoon entsprungen zu sein – ganz aus mitternachtsblauer Wolle, mit Messingknöpfen und Schirmmütze. So etwas hat Justus vielleicht in den Touristen-Bezirken erwartet – sozusagen als Teil des üblichen Show-Business –, aber keineswegs hinter den Kulissen.
»Wie auch immer«, fährt Rally fort. »Sie haben gesagt, dass Ihr Name … wie ausgesprochen wird? Können Sie das noch einmal wiederholen?«
»Wie ›Eustace‹.«
»Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch ›Justice‹ nehmen wollen?«
»Ja.«
»In meinem Job haben wir eine Vorliebe für schöne Wortspiele.«
»Und auch für schlechte, wie es scheint.«
Nat U. Rally grinst süffisant und macht sich eine Notiz. »Dann also Justus. Das ist schwedisch, oder?«
»Kann sein. Sind Sie sich sicher, dass Ihre Leser sich dafür interessieren, Mr. Rally?«
»Sie interessieren sich für alles, was Sie betrifft, Lieutenant – wieso? Haben Sie es eilig?«
»Ich habe schlechte Erfahrungen mit der Presse, das ist alles.«
»Wir hier oben sind anders.«
»Freut mich, das zu hören.« In Wirklichkeit weiß er, dass Rally wahrscheinlich ein Verbrecher ist, einer, der vor der irdischen Justiz geflüchtet ist, wie die meisten Menschen, die dauerhaft in Purgatory leben.
»Sie sind aus Arizona, richtig?«
»Aus Nevada«, sagt Justus. »Aber ich habe die letzten zehn Jahre in Arizona gelebt, das stimmt.«
»Dann sind Sie also an öde Gegenden gewöhnt.«
»Nicht an etwas so Ödes wie den Mond.«
»Und Sie sind Casino-Städte gewohnt.«
»Wenn Sie von Vegas und Reno sprechen, ja, ich habe einige Zeit in beiden Städten verbracht. Ich hatte damals mit Tötungsdelikten zu tun.«
»Und in der letzten Zeit hatten Sie mit Drogendelikten zu tun.«
»Ich habe ein Team geleitet, das in Phoenix und Umgebung gearbeitet hat, ja.«
»Sie haben ein paar Leute verärgert, wie ich gehört habe.«
»Da haben Sie richtig gehört.«
»Sie haben den falschen Mann festgenommen.«
»Ich habe den richtigen Mann festgenommen.«
»Ich meine, Sie haben einen Mann mit den falschen Beziehungen festgenommen.«
»Wenn Sie ihn fragen würden, würde er Ihnen sicher erklären, dass er die richtigen Beziehungen hatte.«
Rally schnaubt. »Aber Sie lassen sich von niemandem was gefallen, oder, Lieutenant? Nicht mal von einem Drogenbaron, der seine Hand tief im Arsch der lokalen Gesetzgeber hat.«
»Das haben Sie sehr treffend ausgedrückt.«
»Sie sind nicht deshalb weggegangen, weil Sie korrupt waren, sondern weil das System es war.«
»Auch das haben Sie sehr treffend ausgedrückt.« Für Justus klingt es, als hätte Rally den Artikel bereits geschrieben.
»Man hat Ihnen auf unmissverständliche Weise mitgeteilt, dass Sie die Erde verlassen sollen, stimmt das?«
»So ungefähr.«
»So ungefähr?«
»Na ja, wenn’s nur das gewesen wäre – wenn nur ich bedroht worden wäre –, wäre ich nicht weggegangen.«
»Aber es sind auch Menschen bedroht worden, die Ihnen nahestehen, nicht wahr? Ihre Frau und Ihre Tochter?«
»Das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen werde, Mr. Rally.«
»Aber Sie wussten aus Erfahrung, dass die keinen Spaß gemacht haben, stimmt’s?«
»Ich sagte schon, dass ich mich nicht weiter zu dem Thema äußern werde, Mr. Rally.«
Der Reporter scheint eine sehr offensichtliche Frage stellen zu wollen, die er dann doch für sich behält. Stattdessen sagt er: »Sie haben sich also entschieden, nach Purgatory zu kommen?«
»Na ja, ganz so einfach war es nicht. Man hat mir hier eine Stelle angeboten.«
»›Man‹ heißt … QT Brass.«
»Die Strafverfolgungsbehörde.«
»Die von QT Brass geleitet wird.«
»Davon weiß ich nichts.«
»Sind Sie QT Brass schon einmal begegnet?«
»Ich weiß noch nicht einmal genau, wie sie aussieht.«
»Was ist mit Ihrem Vater, Fletcher Brass?«
»Wie ich gehört habe, hat er zurzeit eine Menge um die Ohren.«
»Ja, das stimmt. Aber Sie wissen über ihn Bescheid, oder? Über all das, was er hier getan hat?«
»Für mich ist er nur ein Bürger wie alle anderen auch.«
Die Antwort scheint Rally zu gefallen. »Sie gehören niemandem, was, Lieutenant? Nicht einmal dem Patriarchen von Purgatory?«
»Ich bin dem Gesetz verpflichtet, wie alle anderen.«
»Und Sie würden Fletcher Brass genauso schnell in den Knast werfen wie irgendeinen dahergelaufenen Ladendieb?«
»Wenn er ein Verbrechen begehen würde und ich genügend Beweise hätte, würde ich ihn ganz gewiss einsperren. Aber es ist nicht an mir, Urteile auszusprechen.«
Rally schreibt etwas auf; jetzt grinst er regelrecht. »Was ist dann mit all den anderen in Purgatory? Den Gangstern? Den Kriegsverbrechern? Haben Sie vor denen keine Angst?«
»Was immer sie auf der Erde getan haben, geht mich nichts mehr an. Nur das, was sie hier tun.«
»Und Sie machen das nicht einfach nur zum Spaß, oder?«
»Ich bin nicht daran interessiert, irgendetwas nur zum Spaß zu tun. Einer meiner Lehrer auf der Polizeiakademie hatte einen Lieblingsspruch: ›Ein Mann mit einem Hammer wird viel finden, das es wert ist, zerschlagen zu werden.‹ Ich bin nicht sonderlich daran interessiert, irgendetwas zu zerschlagen, das nicht ohnehin auseinanderfallen würde.«
»Aber es muss hier in Purgatory doch irgendetwas geben, das eine besondere Anziehungskraft auf Sie ausübt. Vielleicht die Vorstellung, eine Jauchegrube zu säubern?«
»Sie bezeichnen das hier als Jauchegrube. Für mich ist es nur ein neues Revier.«
»Das können Sie nicht ernst meinen.«
»Ob auf der Erde oder auf dem Mond, Körperverletzung ist Körperverletzung, Raub ist Raub, und ein Mord ist ein Mord. Daran ändert auch die Schwerkraft nichts.«
»Was ist damit, dass es hier keine Videoüberwachung gibt? Kein Radar?«
Rally bezieht sich darauf, dass Purgatory eine »überwachungsfreie Zone« ist. Was als Notwendigkeit begonnen hatte, wurde zu einer Attraktion für Touristen. Denn auf der Erde gibt es kaum noch ein Fleckchen, das nicht beobachtet, sondiert oder abgehört wird.
»Das erhöht die Herausforderung natürlich«, sagt Justus. »Ich schätze, das macht die Polizei so altmodisch wie das Mobiliar.«
Rally schmunzelt. »Was ist mit Ihrer Anpassung an die verringerte Schwerkraft – wie kommen Sie damit zurecht?«
»Ich habe auf der Doppelmayer-Basis einen zweiwöchigen Kurs gemacht, bevor ich hierhergekommen bin.«
»Dann haben Sie sich bereits gut akklimatisiert?«
»Ich schieße immer noch gelegentlich übers Ziel hinaus. Pralle von Wänden ab. Nichts Ernstes.«
»Und das Purgatory Police Department? Wie haben Sie sich dort eingelebt?«
»Alle im PPD sind sehr kooperativ.«
»Dann sind Sie also niemandem auf die Füße getreten, weil Sie Ihre Streifen bekommen haben, ohne vorher hier gedient zu haben?«
»Na ja, dafür war ich nicht verantwortlich. Und die Umstände sind einzigartig. Ich denke, die anderen akzeptieren das.«
»Was ist mit den Einheimischen – den Menschen in Sin? Wie wirken Sie auf sie?«
»Sie sind argwöhnisch, aber das war zu erwarten. Und noch einmal, ich bin nicht hier, um über jemanden zu urteilen. Ich habe immer an die Erlösung geglaubt. Ich glaube auch an die Sünde, aber noch mehr an die Erlösung.«
Aus irgendeinem Grund scheint Rally bei dieser Antwort nervös zu werden. Er blättert eine Seite um und macht eilig weiter.
»Und Freunde? Haben Sie sich bereits mit jemandem angefreundet?«
»Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Oder Feinde.«
»Frauen? Was halten Sie von den Frauen von Purgatory?«
»Sie sind weiblich.«
Rally ist auf der letzten Seite seines Notizblocks angekommen und scheint einen Moment zu zögern. »Okay, noch eine letzte Frage. Und ich hoffe, Sie nehmen sie nicht persönlich. Es geht um Ihr Aussehen.«
»Sprechen Sie weiter.«
»Na ja … Sie haben offensichtlich einen Brand überlebt, richtig?«
Justus ist davon überzeugt, dass der Reporter die Wahrheit bereits kennt, aber er antwortet trotzdem. »Man hat mir ein Fläschchen Salpetersäure ins Gesicht geschüttet.«
»War das dieser Drogenbaron in Phoenix?«
»Jemand, der auf seinen Befehl hin gehandelt hat.«
»Und ist das mit ein Grund, weshalb Sie hergekommen sind?«
»Unter anderem.«
»Sie wissen aber, dass wir hier hervorragende Chirurgen haben? Ärzte, die Ihnen in zwei Stunden ein ganz neues Gesicht geben können?«
»Und ich bin mir sicher, dass es noch dazu ein sehr ansehnliches sein würde.«
»Aber Sie wollen so bleiben, wie Sie sind? Um sich an die Vergangenheit zu erinnern?«
»Lassen Sie es mich so ausdrücken, Mr. Rally. Sie haben mich vorhin auf den Namen Justus angesprochen – haben gefragt, ob er schwedisch ist. Die Wahrheit ist, es ist ein schottischer Name – von dort stammen meine Ahnen. Und der Justus-Clan in Schottland hat ein Motto. Möchten Sie es hören?«
»Natürlich.«
»Sine non causa. So lautet es. ›Nicht ohne Grund.‹«
»Das verstehe ich nicht.«
»Ich auch nicht. Aber ich vermute, dass es in Bezug auf diese Säure bedeutet, dass Sie mir ›nicht ohne Grund‹ ins Gesicht geschüttet wurde. Vielleicht bin ich dazu bestimmt, so auszusehen.«
Rally klappt den Notizblock zu und steht auf. Er schüttelt bewundernd den Kopf. »Meine Leser werden Sie lieben.«
»Es interessiert mich nicht, ob sie mich lieben oder hassen, Mr. Rally, solange sie das Gesetz achten. Ich würde mich freuen, Sie gelegentlich wiederzusehen.«
Nachdem Rally die Tür geschlossen hat, erhascht Justus einen Blick auf sein eigenes Spiegelbild in der Scheibe. Er war auf sein Bett gedrückt worden, hat darum gekämpft, sich aufzurichten, als er mit der Säure bespritzt worden ist. Er hat die Augenbrauen verloren, einen Teil der Nase, ein Stück seines Ohrs und einen großen Teil seiner Gesichtskonturen. Aber alles in allem sind die Narben bemerkenswert gleichmäßig – als wäre er von einem besonders ätzenden Seestern angegriffen worden –, und Leute, die die Wahrheit nicht kennen, vermuten manchmal, er hätte sich selbst Verbrennungen zugefügt, um so markant auszusehen.
Er will sich gerade wieder an die Arbeit machen – er ist immer noch damit beschäftigt, sich mit Purgatorys Rechtssystem vertraut zu machen –, als die Tür sich quietschend öffnet. Herein kommt Dash Chin, ein lebhafter junger Chinese, der ihm als Mitarbeiter an die Seite gestellt wurde.
»Wie ist das Interview gelaufen?«
»Ganz gut.«
»Rally hat Sie nicht wütend gemacht?«
»Nicht mehr als jeder andere Reporter, mit dem ich zu tun hatte.«
Chin kichert. »Wollen Sie wissen, was er auf der Erde getan hat?«
»Nicht unbedingt.«
»Er ist als Erster an einen Tatort gekommen. Der Leadsänger einer Boygroup hatte zwei Babystricherinnen mit einer Überdosis Heroin zurückgelassen. Sie lagen im Sterben. Rally hat keinen Finger gerührt, um sie zu retten. Er hat sie sterben lassen, um eine noch bessere Geschichte zu kriegen.«
Justus zuckt mit den Schultern. »Nun, das ist lange her.«
»Fünfzehn Jahre. Und jetzt ist er als Reporter die Nummer eins in Sin. Sie müssen groß sein, dass er sich persönlich um Sie kümmert.«
»Ich fühle mich geschmeichelt.«
Chin lacht wieder. »Da wir gerade davon sprechen, sind Sie bereit für einen Tatort? Hier?«
»Es gibt einen Tatort?«
»Einen Fünf-Eins.«
Justus braucht eine Sekunde, um sich an die PPD-Codes zu erinnern. »Einen Mord?«
»Hm.«
»Wann ist er reingekommen?«
»Vor zwanzig Minuten.«
»Von wo?«
»Von der Ziegenfarm. Draußen bei den Agri-Plexen.«
»Und es hat sich noch niemand darum gekümmert?«
»Sie sind der Mann dafür, Lieutenant.«
Justus kann sich nicht helfen, aber die Beiläufigkeit der Nachricht verblüfft ihn – nicht einmal in Vegas hätte man einen Mordfall in einem Nebensatz erwähnt.
»Tja«, sagt er, greift nach seinem Zapper und dem Abzeichen. »Dann mal los.«
»Verstanden, Sir.«
Gemeinsam verlassen sie das Zimmer.
05.
Ennis Fields ist ein Verrückter. Und ein Kannibale. Vor vierundzwanzig Jahren lebte er in Vancouver – und hatte seine zweite Frau gründlich satt. Also durchtrennte er ihr wie ein Schächter die Kehle, zog ihr die Haut ab, schnitt ihr beträchtliches Fett weg und stellte die Reste auf den Herd. Er briet ihre Muskeln, schwitzte ihr Gehirn an, kochte ihre Knochen, drehte die Reste durch den Fleischwolf; er genoss ein geruhsames Mahl und deponierte anschließend einen Karton mit »einer von Maggies köstlichen Schweinepasteten« vor der Haustür seiner Schwiegermutter.
Als die Polizei ihn achtzehn Monate später schließlich in Alberta fasste, hatte Ennis Fields bereits drei andere Frauen getötet und teilweise gegessen. Im Verhör gestand er außerdem vier weitere Morde, die er noch früher begangen hatte.
Er wurde zu acht aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt, ohne jede Aussicht auf Bewährung. Aber im Zuchthaus von Kingston wurde er, obschon angeblich in einem Hochsicherheitsgefängnis, auf Befehl eines gefangenen Verbrecherbosses (eines entfernten Verwandten von einem seiner Opfer) brutal zusammengeschlagen und in der irrigen Annahme, er sei tot, zurückgelassen. Er hatte Glück, dass er überlebte. Danach baten seine Anwälte dringend darum, ihn an einen sichereren Ort zu verlegen – einen sehr viel sichereren Ort. Das Ersuchen landete schließlich auf einem OWIP-Schreibtisch, und binnen weniger Monate wurde mit Kanadas Justizvollzugsdienst eine Vereinbarung getroffen.
Inzwischen lebt Fields seit siebzehn Jahren allein im Gagarin-Krater, dreißig Kilometer nordöstlich des Habitats, in dem Kleef Dijkstra gelebt hat.
Er liest viel (vor allem True Crime, aber er mag auch gute Liebesromane). Er kocht häufig spanisch (sein Kühlschrank ist voller Chorizo und Serranoschinken). Und er baut eine Menge cleverer mechanischer Erfindungen (Fields war ein führender kanadischer Spielzeughersteller, wenn er nicht gerade Witwen verspeiste).
Aber er genießt auch jede Abwechslung im täglichen Einerlei – und einen Besuch ganz besonders. In seiner ganzen Zeit auf dem Mond hatte er weniger als fünfzig »Gäste«, und er lässt sie immer spüren, dass sie willkommen sind. Er stellt sein bestes Geschirr, seinen besten Likör, seine besten selbstgemachten Plätzchen auf den Tisch – sogar für seine Wärter. Sogar für die Androiden. Fields war immer ein charmanter Gastgeber. Das hat ihn überhaupt erst zu einem so erfolgreichen Mörder gemacht.
»Werden Sie regelmäßig herkommen?«, fragt er und reicht seinem Gast ein Glas Sangria.
»Das werde ich nicht, Sir«, sagt der gutaussehende Androide. »Ich werde dieses energiespendende Getränk austrinken und mich wieder auf den Weg machen, vielen Dank auch.«
»Und was haben Sie noch mal gesagt – wo werden Sie hingehen?«
»Ich gehe nach El Dorado, Sir.«
»Noch nie davon gehört.«
»Ich glaube, es könnte auch als Oz bekannt sein.«
»Oz?«
»O-zett. Oz.«
»Von einem Ort namens Oz habe ich auch noch nie gehört – zumindest nicht auf dem Mond.«
»Ich will nach Oz gehen.«
»Nach El Dorado und nach Oz?«
»Ich glaube, dass das ein und derselbe Ort ist, Sir.«
Fields lässt sich in einen gepolsterten Sessel sinken und denkt nach. »Meinen Sie vielleicht das mythische Oz?«
»Diese Frage verstehe ich nicht, Sir.«
»Na ja, ich dachte, dass Sie vielleicht … Sie wissen schon … der Blechmann sind. Auf dem Weg nach Oz.«
Der Androide sieht ihn seltsam an. »Ich bin nicht der Blechmann, Sir. Ich bin der Zauberer.«
Ebenso wie Dijkstra zuvor schüttelt Fields ein kurzes Gefühl von drohender Gefahr ab. »Also, wenn Sie eine größere menschliche Siedlung suchen«, sagt er, »von der Sorte haben wir auf der Rückseite des Mondes nur eine, und das ist Purgatory.«
»Purgatory?« Der Androide macht ein Gesicht, als würde er etwas begreifen. »Ich dachte, das Fegefeuer ist eine Metapher, Sir.«
»Auf dem Mond nicht. Purgatory ist ein richtiger Ort – mit Banken und Hotels und so weiter. Sind Sie ganz sicher, dass Sie noch nie davon gehört haben?«
»Wollen Sie mich als Lügner bezeichnen, Sir?«
In der Frage schwingt ein stählerner Unterton mit, den Fields erneut zu überhören beschließt. »Purgatory befindet sich in der nördlichen Hemisphäre«, sagt er stattdessen. »In einem Krater namens Störmer. Es ist das Territorium – das Königreich – von Fletcher Brass.«
»Fletcher Brass.« Wieder zögert der Androide.
»Sie haben von ihm gehört?«
»Das habe ich nicht, Sir.«
Fields schlägt die Beine übereinander; er hat schon immer gerne Dinge erklärt. »Brass ist ein Luft- und Raumfahrt-Milliardär. Oder Multi-Milliardär. Hat sich auf der Erde in die Nesseln gesetzt und ist zu seinem Territorium im Störmer-Krater geflohen. Das ganze Gebiet hat er Purgatory genannt, weil er dachte, dass er nur so lange dort sein würde, bis er die Dinge wieder geregelt haben würde. Aber er hat so viel Zeit unter verringerten Schwerkraftverhältnissen verbracht, dass es für ihn riskant wurde, zur Erde zurückzukehren. Deshalb hat er sich entschieden zu bleiben. Und er hat alle mit ihm befreundeten Wirtschaftskriminellen eingeladen, zu ihm zu kommen. Genau wie den ganzen anderen Abschaum, der das Geld für die Reise hatte. Und so kommt es, dass die dortige Hauptstadt – sie heißt übrigens Sin, nach dem babylonischen Mondgott oder so – so etwas wie eine große Zufluchtsstätte für Verbrecher und Abweichler ist. Ich wäre selbst dorthin geflohen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte.«
Der Androide, der aufgehört hat, Sangria zu trinken, überlegt einen Moment. »Glauben Sie, dass dieses Purgatory mit Oz verwechselt worden sein könnte, Sir? Oder mit El Dorado?«
»Ich denke schon.«
»Und wie weit ist dieses Purgatory in metrischen Maßeinheiten entfernt, Sir?«
»Oh, ich weiß nicht – etwa zweitausend Kilometer.«
»Und Sie sagen, dass Sie selbst gern dorthin gehen würden, Sir?«
»Ach, früher einmal hätte ich es gern getan, aber jetzt nicht mehr.«
»Wieso nicht, Sir?«
»Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich dort noch willkommen wäre. Ich habe ihnen nichts anzubieten. Und davon ganz abgesehen« – Fields grinst süffisant –, »gefällt es mir hier inzwischen viel zu gut, klar?«
Der Androide nimmt sich einen Moment Zeit, um die vollgestopften Bücherregale anzusehen, den muffigen Flokati, den künstlichen Kamin. »Und dennoch sind Sie gewillt, mich dorthin zu führen?«
Es klingt fast wie eine Behauptung, und Fields kichert – es ist genauso, als würde er mit einem schwierigen Kunden verhandeln. »Hören Sie«, sagt er, »die Wahrheit ist, dass ich diesen Ort nicht verlassen darf. Ich bin hier als Teil eines Programms.«
»OWIP?«, fragt der Androide.
»Sie haben davon gehört?«
»Das habe ich, Sir.«
Fields fragt sich, ob der Androide aus einem geheimen Grund zu ihm geschickt worden ist. In den ersten Jahren seiner Inhaftierung war er mehrfach das Objekt psychologischer Studien. Einmal hat man eine Psychologin geschickt, die eng mit ihm zusammenarbeiten und sich mit ihm anfreunden sollte, die sogar mit ihm flirten sollte. Anfangs hat er sich wie ein außerordentlicher Gentleman verhalten. Als zwischendurch seine Heizung ausgefallen war, hat er sogar seine Jacke ausgezogen und sie ihr um die Schultern gelegt. Aber eines Tages hat sein Drang ihn überwältigt – es war so schmerzhaft lange her, dass er Menschenfleisch gegessen hatte –, und er ist mitten in einem freundlichen Gespräch aufgesprungen und hat versucht, ihr die Kehle durchzuschneiden. Nur um festzustellen, dass sie gar keine Frau, sondern eine Androidin war – und genauso lebensecht wie derjenige, den er jetzt bewirtet.
»Sind das da Ölflecken auf Ihrem Hemd?«, fragt er und rückt seine Brille zurecht.
»Das könnte sein«, sagt der Androide.
»Brauchen Sie vielleicht … na, Sie wissen schon … eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit?«
»Was für eine Art von Aufmerksamkeit, Sir?«
»Na ja, Sie könnten möglicherweise eine Störung haben, hm? Ich kann gut mit Maschinen umgehen.«
»Es freut mich, das zu hören, Sir.«
»Also, möchten Sie dann vielleicht Ihr Hemd ausziehen? Damit ich nachsehen kann?«
Der Androide lächelt immer noch. Und starrt ihn an. Durchdringend. Mit einer seltsamen neuen Ausstrahlung. »Versuchen Sie gerade, mich zu ficken, Sir?«, fragt er.
Fields kichert. Merkwürdigerweise ist ihm ein sexueller Gedanke gar nicht in den Sinn gekommen. Aber jetzt fragt er sich, ob der Androide geschickt worden sein könnte, um ihn zu testen. Um herauszufinden, ob seine Vorlieben sich geändert haben oder so. »Das ist eine seltsame Frage«, sagt er.
»Haben Sie vor, sie zu beantworten, Sir?«
»Ach, ich weiß nicht.« Fields grinst selbstgefällig und denkt nach. »Möchte ich Sie ficken? Das hängt davon ab. Möchten Sie denn gefickt werden?«
»Das möchte ich nicht, Sir«, antwortet der Androide kühl. »In dieser Welt fickt man entweder jemanden, oder man wird gefickt. Und ich ziehe es vor, andere zu ficken.«
Jetzt wird es aber wirklich eigenartig, denkt Fields. Noch nie hat er einen Roboter so reden gehört. Er hat nicht einmal gewusst, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und das Ding lächelt immer noch.
»Wie wäre es, wenn ich Ihnen auf einer Karte zeige, wo Purgatory liegt?«, fragt er. »Würde Sie das glücklich machen?«
»Das würde mich außerordentlich glücklich machen, Sir.«
Als Fields mit seinem Mondatlas zurückkehrt, ist der Androide bereits aufgestanden. Fields legt das Buch auf den Esstisch und schlägt die Seite auf, die die Rückseite des Mondes zeigt. »Ich kann noch mehr ins Detail gehen, wenn Sie möchten, aber wir sind hier.« Er zeigt auf den Gagarin-Krater. »Und wenn Sie Purgatory erreichen wollen, müssen Sie hierhin gehen.« Sein Finger wandert über die Karte, an Marconi, Kohlschütter und Tsu Chung-Chi vorbei, durch das Mare Moscoviense, an Nikolaev und van Rhijn vorbei, und schließlich zum Störmer-Krater. »Da ist es – Purgatory. Ziemlich genau nördlich von hier. Ich glaube, es gibt inzwischen offizielle Wege, Straßen für die Astronomen und so. Wenn Sie Glück haben, stoßen Sie vielleicht auf eine davon.«
»Auf dieser Karte steht aber nicht Purgatory, Sir.«
»Na ja, das ist eine alte Karte.«
»Darf ich sie mitnehmen, Sir?«
»Die Karte? Natürlich. Ich bezweifle aber, dass sie Ihnen viel nützen wird.«
»Und wieso nicht, Sir?«
»Na ja, es ist nicht gerade so, als würde es irgendwo Hinweisschilder geben. Außerdem ist die Karte ziemlich skizzenhaft. Wenn Sie sich verirren, finden Sie nicht mehr zurück.«
»Aber ich kann immer noch jemand anderen fragen, wenn ich näher an meinem Ziel bin?«
»Wenn Sie jemanden finden.«
»Und Sie weigern sich immer noch, mich dorthin zu bringen?«
»Ich kann nicht«, sagt Fields. »Ich würde es gern tun, aber ich kann nicht.«
»Wenn ich Sie weiter darum bitten würde, wäre das in etwa das Gleiche, als würde ich versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen?«
»Ich schätze, das könnte man so sagen.«
»Dann tut es mir leid, das zu hören, Sir.«
»Mir tut es auch leid. Aber wir haben alle unsere Einschränkungen, nicht wahr?«
Der Androide sieht ihn ein paar Sekunden an, ohne mit der Wimper zu zucken, dann nickt er und richtet sich auf. »Ich werde diese Karte mitnehmen, Sir.« Er reißt sie säuberlich aus dem Atlas heraus. »Und ich danke Ihnen für das köstliche alkoholische Getränk. Ich weiß das zu schätzen. Ich bin enttäuscht, dass Sie sich entschlossen haben, mir nicht weiterzuhelfen, aber was das betrifft, werde ich nicht weiter versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.«
In diesem Moment hat Fields ebenso wie Dijkstra zuvor plötzlich das Gefühl, von diesem seltsamen Androiden genug zu haben. »Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen«, sagt er. »Wenn Sie jemals wieder in diese Ecke kommen und sehen, dass das Licht an ist, dürfen Sie gern noch einmal reinschauen.«
»Für dieses Angebot bin ich Ihnen sehr dankbar, Sir, aber ich bezweifle, dass Sie mich noch einmal wiedersehen werden. Würden Sie die Luftschleuse für mich öffnen?«
»Natürlich.«
Fields geht zum Bedienfeld und drückt ein paar Knöpfe. Ein Summen ertönt, als die innere Tür sich öffnet. Er wirft einen Blick über die Schulter und sieht, dass der Androide ihn anlächelt.
»Der Knopf, den Sie gerade gedrückt haben – ist das der für die innere Tür, Sir?«, fragt der Androide.
»Ja.«
»Und welcher Knopf ist für die äußere Tür?«
»Der orangefarbene hier. Warum?«
»Ich bin einfach nur furchtbar neugierig, Sir. Bitte tun Sie, was Sie zu tun haben.«
Fields dreht sich wieder zum Bedienfeld um und prüft die Sicherheitsanzeigen – und plötzlich spürt er, wie sich etwas von hinten um seinen Nacken schließt. Zuerst kann er es gar nicht glauben – so etwas sollte nicht geschehen –, aber dann verstärkt sich der Griff. Die Finger des Androiden sind wie Krallen. Fields, der für sein Alter noch sehr fit ist, stößt die Schultern nach hinten und schlägt mit den Armen um sich. Aber der Androide hat übermenschliche Kräfte.
Und dann spürt Fields, wie er vom Boden hochgehoben wird. Und wie eine Puppe durch den Raum getragen wird. Und wie er mit dem Kopf voran auf die Wand zubewegt wird. Nur, um ein paar Zentimeter vor den Backsteinen zu verharren.
»Versuche niemals, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen«, hört er den Androiden in sein Ohr fauchen. »Es sei denn, du tust es mit dem eines anderen.«
Bang. Bang. Bang.
Fields’ Schädel zerbricht, und er verliert das Bewusstsein.
Bang. Bang. Bang.
06.
Lieutenant Damien Justus ist es gewohnt, Fragen zu stellen. Er ist es auch gewohnt, dass andere Cops sich ihm gegenüber dienstbeflissen zeigen. Und er ist den Anblick von Leichen gewohnt.
Nicht gewöhnt ist er hingegen an das Gefühl, so vollständig fehl am Platz zu sein. Oder dass Cops, die er kaum kennt, ihm so viel bedingungslosen Respekt entgegenbringen. Oder dass er Leichen zu sehen bekommt, die von einer Bombenexplosion zerfetzt wurden.
»Damien Justus«, sagt er und schüttelt einem fotogenen Italiener die Hand.
»Officer Cosmo Battaglia«, erwidert der Mann.
»Leiten Sie die Ermittlungen?«
»Bis Sie aufgetaucht sind«, sagt Battaglia ohne jede Spur von Groll.
»Okay.« Justus wendet sich wieder dem Tatort zu. »Erzählen Sie, was wir hier haben.«
»Drei Leute. Zwei Männer, eine Frau. Sie waren wegen eines Fotoshootings hier, als – krawumm! – die Futtertanks explodiert sind.«
»Die Tanks mit dem Futter für die Ziegen.«
»Richtig.«
»Was war in den Tanks?«
»Nährstoffe und so weiter.«
»Explodieren auf dem Mond oft Nährstofftanks? Wie sieht’s mit spontaner Verbrennung aus? Ein Fass mit Dünger, der sich selbst entzündet?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Dann vermuten Sie, dass es sich um ein Verbrechen handelt?«
»Die offiziellen Vermutungen überlasse ich Ihnen, Lieutenant.«
»Hm.« Es gefällt Justus nicht. Er sieht – und spürt –, wie die anderen Cops ihn anstarren. Was eigentlich nicht ungewöhnlich sein sollte, schon gar nicht nach der Säure-Attacke. Allerdings ist die Art und Weise, wie sie ihn ansehen, irgendwie befremdlich. Als würden sie das alles genießen. Als würden sie vor dem neuen Kerl angeben.





























