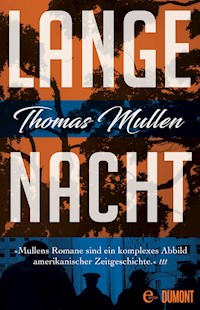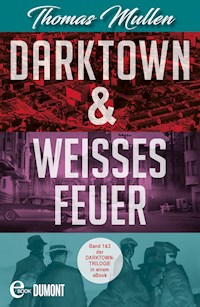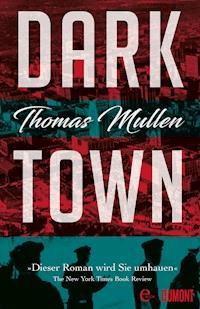14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Darktown-Trilogie in einem Band! Drei hochspannende, vielschichtige Kriminalromane und zugleich das atmosphärisch dichte Gesellschaftsporträt eines gespaltenen Landes, das den Rassismus nie überwunden hat. »Darktown« 1948 ist Atlanta eine geteilte Stadt: auf der einen Seite die reichen weißen Viertel. Auf der anderen Seite »Darktown«, das Viertel der schwarzen Einwohner, »beschützt« von der ersten schwarzen Polizeieinheit. Als eine junge schwarze Frau tot aufgefunden wird, scheint das niemanden weiter zu interessieren – bis auf Lucius Boggs und Tommy Smith, zwei schwarze Cops, die sich gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit machen. Zwischen zwielichtigen Alkoholschmugglern, scheinheiligen Puffmüttern, korrupten Gesetzeshütern und unter permanenter rassistischer Unterdrückung riskieren Boggs und Smith ihre neuen Jobs – und ihr Leben –, um den Fall zu lösen. »Weißes Feuer« Atlanta 1950: Auch nach zwei Jahren Dienstzeit wird die Arbeit der ersten schwarzen Polizisten Atlantas täglich von Rassismus bestimmt. Die Cops Lucius Boggs und Tommy Smith haben kaum Befugnisse, und um Ermittlungen durchzuführen, und sind auf die Hilfe weißer Polizisten angewiesen, die ihre Arbeit aber zumeist durch Schikanen und Willkür behindern. Als schwarze Familien in ein ehemals rein weißes Viertel ziehen, beginnen die Rassenkonflikte zu brodeln. Ausgerechnet jetzt werden Boggs und Smith auf die Revierkämpfe zweier Schmugglerbanden aufmerksam. Ihre Ermittlungen führen sie nicht nur zu weißen Drahtziehern, sondern auch ins eigene Umfeld. Bald sind beide persönlich so tief in den Fall verstrickt, dass nicht weniger als ihre moralische Integrität auf dem Spiel steht. »Lange Nacht« Atlanta 1956: In der pulsierenden Südstaatenhauptstadt verschärfen sich die Rassenkonflikte, als die Bürgerrechtsbewegung mit dem jungen Reverend Martin Luther King Jr. einen neuen Wortführer bekommt. In dieser ohnehin schon angespannten Lage wird der Herausgeber der führenden schwarzen Tageszeitung ermordet. Sofort gerät Tommy Smith ins Fadenkreuz der rassistischen Polizei. Um sich zu entlasten, muss Smith mehr über die Geschichte erfahren, an der Bishop gearbeitet hat. Die Mordermittlung wird unterdessen von verschiedenen Seiten torpediert: durch sich einmischende FBI-Agenten, korrupte Detectives und kommunistische Aktivisten. Im Kampf um Gerechtigkeit tun sich Tommy Smith und Lucius Boggs ein letztes Mal zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1886
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über die Bücher
»Darktown«
1948 ist Atlanta eine geteilte Stadt: auf der einen Seite die reichen weißen Viertel. Auf der anderen Seite »Darktown«, das Viertel der schwarzen Einwohner, »beschützt« von der ersten schwarzen Polizeieinheit. Als eine junge schwarze Frau tot aufgefunden wird, scheint das niemanden weiter zu interessieren – bis auf Lucius Boggs und Tommy Smith, zwei schwarze Cops, die sich gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit machen. Zwischen zwielichtigen Alkoholschmugglern, scheinheiligen Puffmüttern, korrupten Gesetzeshütern und unter permanenter rassistischer Unterdrückung riskieren Boggs und Smith ihre neuen Jobs – und ihr Leben –, um den Fall zu lösen.
»Weißes Feuer«
Atlanta 1950: Auch nach zwei Jahren Dienstzeit wird die Arbeit der ersten schwarzen Polizisten Atlantas täglich von Rassismus bestimmt. Die Cops Lucius Boggs und Tommy Smith haben kaum Befugnisse, und um Ermittlungen durchzuführen, sind sie auf die Hilfe weißer Polizisten angewiesen, die ihre Arbeit aber zumeist durch Schikanen und Willkür behindern. Als schwarze Familien in ein ehemals rein weißes Viertel ziehen, beginnen die Rassenkonflikte zu brodeln. Ausgerechnet jetzt werden Boggs und Smith auf die Revierkämpfe zweier Schmugglerbanden aufmerksam. Ihre Ermittlungen führen sie nicht nur zu weißen Drahtziehern, sondern auch ins eigene Umfeld. Bald sind beide persönlich so tief in den Fall verstrickt, dass nicht weniger als ihre moralische Integrität auf dem Spiel steht.
Ein meisterhaft komponiertes Krimi-Epos von bedrückender Aktualität
»Faszinierend, düster und aufrüttelnd.«THE GUARDIAN
»A brilliant blending of crime, mystery, and American history. Terrific entertainment.« Stephen King
Lange Nacht
Atlanta 1956: In der pulsierenden Südstaatenhauptstadt verschärfen sich die Rassenkonflikte, als die Bürgerrechtsbewegung mit dem jungen Reverend Martin Luther King Jr. einen neuen Wortführer bekommt. In dieser ohnehin schon angespannten Lage wird Arthur Bishop, der Herausgeber der führenden schwarzen Tageszeitung ermordet. Sofort gerät der Journalist und ehemalige Cop Tommy Smith ins Fadenkreuz der rassistischen Polizisten. Um sich zu entlasten, muss Smith mehr über die Geschichte erfahren, an der Bishop gearbeitet hat. Die Mordermittlung seiner Ex-Partner Lucius Boggs und Sergeant Joe McInnis wird unterdessen von verschiedenen Seiten torpediert: durch sich einmischende FBI-Agenten, korrupte Detectives und kommunistische Aktivisten. Im Kampf um Gerechtigkeit tun sich Smith und seine ehemaligen Kollegen ein letztes Mal zusammen.
»Thomas Mullen führt den Leser ins Herz der Südstaatenfinsternis, dorthin, wo Unmenschliches und allzu Unmenschliches einen fruchtbaren Nährboden finden.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung über ›Darktown‹
Über den Autor
© Jeff Roffman
Thomas Mullen wurde 1974 in Rhode Island geboren. 2006 erschien sein Debütroman ›Die Stadt am Ende der Welt‹, der von der Zeitschrift USA Today als „Bester Debütroman des Jahres“ und von der Zeitung Chicago Tribune als eines ihrer „Books of the Year“ benannt wurde (DuMont 2020). Bei DuMont erscheint außerdem seine von Publikum und Presse gefeierte ›Darktown‹-Trilogie, die nach ›Darktown‹ (2018) und ›Weißes Feuer‹ (2019) mit ›Lange Nacht‹ (DuMont 2020) ihren Abschluss findet. Thomas Mullen lebt mit seiner Familie in Atlanta.
Berni Mayer, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, hat Germanistik und Anglistik studiert. Er ist Autor und Journalist und arbeitet für diverse Podcasts. Bei DuMont sind seine Romane ›Rosalie‹ (2016) und ›Ein gemachter Mann‹ (2019) erschienen. Berni Mayer lebt mit seiner Familie in Berlin.
Thomas Mullen
DIE DARKTOWN-TRILOGIE
DarktownWeißes FeuerLange Nacht
Drei Romane in einem Band
Aus dem Englischen von Berni Mayer
Von Thomas Mullen ist bei DuMont außerdem erschienen:
Darktown
Weißes Feuer
Lange Nacht
Die Stadt am Ende der Welt
Vollständige E-Book-Ausgabe der in deutscher Sprache im DuMont Buchverlag erschienenen Werke ›Darktown‹ (© 2018), ›Weißes Feuer‹ (© 2019) und ›Lange Nacht‹ (© 2021)
E-Book 2024
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Die amerikanischen Originalausgaben erschienen 2016 unter dem Titel ›Darktown‹ (© Thomas Mullen 2016) bei 37Ink/Atria Books, New York, 2017 unter ›Lightning Men‹ (© Thomas Mullen 2017) bei 37Ink/Atria Books, New York, und 2020 unter ›Midnight Atlanta‹ (© Thomas Mullen 2020) bei Sphere/Little Brown, New York.
Published by arrangement with Thomas Mullen.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
© 2024 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Berni Mayer
Covergestaltung der abgebildeten Einzelromane: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Covermotive: © akg-images/AP (›Darktown‹), © plainpicture/Glasshouse/Charles Klein (›Lange Nacht‹)
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book: 978-3-7558-1096-4
www.dumont-buchverlag.de
Thomas Mullen
DARKTOWN
Roman
Aus dem Englischen von Berni Mayer
»Sie können mir glauben, es war nicht leicht für mich, die Hand zu heben und zu sagen: ›Ich, Willard Strickland, ein Negro, schwöre hiermit feierlich, die Pflichten eines Negro-Polizisten zu erfüllen.‹«
– Officer Willard Strickland, Atlanta Police Department (pensioniert), in einer Rede von 1977, in der er sich an seine Verpflichtung im Jahr 1948 als einer der ersten acht afroamerikanischen Polizeibeamten der Stadt erinnert
1
ES WAR FAST MITTERNACHT, als einem der neuen Laternenpfähle auf der Auburn Avenue die zweifelhafte Ehre zuteilwurde, als Erster von einem Auto gerammt zu werden. Die Scherben des zersplitterten Frontscheinwerfers eines weißen Buicks verteilten sich über dem Gehweg unter dem jetzt schiefen Pfahl.
Die Heuschrecken surrten unbeirrt in der stickigen Juliluft weiter. In der ganzen Stadt hatten die Leute die Fenster geöffnet, der Aufprall hatte sicher einige geweckt. Keine zehn Meter entfernt stand ein einsamer Fußgänger, ein alter Mann auf dem Heimweg, der die Böden einer Zuckerfabrik gefegt hatte. Er war zurückgewichen, als das Auto über den Bordstein gesprungen war, aber jetzt stand er da, gespannt, ob der Laternenpfahl doch noch umfallen würde. Was nicht passierte. Zumindest noch nicht.
Der Buick setzte langsam zurück, das Vorderrad löste sich vom Bordstein. Diese Bewegung veranlasste den Laternenmast, sich in die andere Richtung zu neigen, zu weit, und wieder zurückzuschwingen wie ein gigantisches Metronom.
Der Fußgänger hörte, wie eine Frau etwas rief wie: »Was zum Teufel machst du da? Bring mich einfach nach Hause.« Der Fußgänger schüttelte den Kopf und schlurfte davon, bevor noch etwas Schlimmeres passierte.
Ob man die Laternenpfähle tatsächlich als »neu« bezeichnen konnte, war eine Frage der Perspektive. Eigentlich waren sie schon ein paar Monate alt, doch bedachte man, wie viele Jahre die Oberhäupter der farbigen Gemeinde von Atlanta gebraucht hatten, um den Bürgermeister von ihrer Notwendigkeit zu überzeugen, und wie viele Jahre die Negroes auf ihrer belebtesten und reichsten Straße im Dunklen hatten laufen müssen, fühlten sich die vom Himmel geschickten Straßenlaternen immer noch wie neu an.
Das alles wusste der Fahrer des Buicks nicht.
Als er versucht hatte, auf der leeren Straße zu wenden, hatte er seinen Wendekreis falsch eingeschätzt. Oder die Breite der Straße, oder die Physik im Allgemeinen. Vermutlich hatte er auch nicht bemerkt, dass nur zwei Querstraßen weiter zwei Beamte der Polizei von Atlanta standen.
*
Fünf Minuten zuvor hatte Officer Lucius Boggs seinen Partner Tommy Smith endlich auf sein Hinken angesprochen.
»Das ist doch nicht beim Baseballspielen passiert. Gib’s zu.«
»War eben ein harter Slide«, sagte Smith.
»McInnis hast du aber erzählt, du bist auf die dritte Base zugerannt.«
Beim morgendlichen Appell hatte Smith ihrem Sergeant, McInnis, versichert, dass sein Knie in Ordnung sei, eine kleine Verstauchung aus einem Match mit Freunden. Sie wissen ja, wie diese Plätze sind, Sir, man hat null Haftung. McInnis hatte mit versteinertem Blick zugehört, als hätte er in seinem Leben schon mehr als genug Blödsinn von Farbigen vernommen, doch beschlossen, dass die Angelegenheit es nicht wert sei, nachzubohren.
»Ich bin aus ’nem Fenster gefallen«, gab Smith jetzt gegenüber Boggs zu. Sie standen auf der Hilliard Street, nur drei Querstraßen vom Negro YMCA entfernt, dessen Untergeschoss ihnen als provisorische Wache diente. Um die Uhrzeit war die Sonne längst verschwunden, doch sie hatte mehr als genug Hitze bis zu ihrem nächsten Auftauchen dagelassen. Beide Polizisten hatten ihre Unterhemden durchgeschwitzt, und selbst ihre Uniformen waren feucht.
»Aus deinem?«
»Was glaubst du?«
Boggs verschränkte die Arme und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Und welche Lady wolltest du mit deinen akrobatischen Fähigkeiten beeindrucken?«
»Eigentlich hat sie meine Akrobatik anfangs ganz gut unterhalten. Bis ihr Mann in die Wohnung gestürmt kam.«
»Bist du irre?«
»Mir hat sie erzählt, dass er sie verlassen hat. Seine Zelte in Detroit aufschlägt. Meinte so was wie, sie braucht einen Anwalt wegen der Scheidungspapiere.«
Beamte der Polizei von Atlanta waren angewiesen, sich an einen strikten ethischen Kodex zu halten: kein Alkohol, noch nicht einmal privat, und keine Frauengeschichten, doch bis zu Tommy Smith war das offensichtlich noch nicht durchgedrungen. Negro-Officer mieden pflichtbewusst jeglichen Alkohol, denn sie wussten, dass Zeugen sie jederzeit melden konnten und sie damit ihren Job verlieren würden, doch Smith war mit der Vorstellung, plötzlich auf dem Pfad der Tugend zu wandeln, völlig überfordert.
»Du spielst mit deinem Leben.«
»Von Verheirateten lass ich grundsätzlich die Finger.«
»Außer von der. Und dem Mädchen mit den kandierten Pekannüssen. Und der …«
»Das ist was anderes. Wir kannten uns schon ewig.«
Sie setzten sich wieder in Bewegung.
»Und was ist dann passiert?«
»Was glaubst du denn? Hab mir die Hose hochgezogen und bin aus dem Fenster gesprungen.«
»Welches Stockwerk?«
»Drittes.«
»Nein!«
»Eins von diesen Häusern ohne Feuerleiter. Dafür gehe ich noch ziemlich aufrecht, würde ich sagen.«
»Was war mit dem Ehemann?«
»Ich bin nicht geblieben und hab gelauscht.«
»Machst du dir gar keine Sorgen?«
»Sie kam mir vor wie ein Mädchen, das auf sich aufpassen kann. Eins, das sich was einfallen lässt.«
Boggs war der Sohn eines Priesters, und obwohl er beschlossen hatte, nicht in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, war ihm die Vorstellung, sich wie sein Partner quer durch die Stadt zu vögeln, gänzlich fremd. Seine eigene Erfahrung mit Frauen beschränkte sich auf harmlose Verabredungen mit wohlerzogenen und gebildeten jungen Frauen der besseren Negro-Gesellschaft, zudem hatte er gerade erst eine gelöste Verlobung mit einem Mädchen hinter sich, dem der Gedanke, der eigene Ehemann könne jederzeit nachts erschossen oder erschlagen werden, dann doch zu sehr zu schaffen gemacht hatte.
Ein Streifenwagen tauchte auf, die Frontscheinwerfer waren seltsamerweise ausgeschaltet. Auf der Hilliard gab es weder Straßenlaternen noch einen Gehweg. Sie hörten auf zu reden und blieben stehen, fragten sich, ob sie zurücktreten sollten oder ob sie das wie Schwächlinge aussehen ließ.
Dann beschleunigte der Wagen, und sie wichen tatsächlich auf einen Flecken Gras und Unkraut aus, der jemandem als Vorgarten diente. Der Einsatzwagen hielt auf sie zu, kam leicht ins Schlingern und legte dann eine Vollbremsung hin.
Sie erblickten flüchtig die Gesichter von zwei weißen Polizisten, die sie nicht kannten. Offensichtlich Cops aus einem anderen Bezirk, die nur auf Durchreise waren.
»Uuuh-uuuh-uuuh!«, brüllten die weißen Cops.
»Aaah-aaah-aaah!«
Affen- und Orang-Utan-Laute. Vielleicht ein bisschen Gorilla dabei.
»Wuu-wuu-wuu-bugga-bugga!«
»Passt auf eure Ärsche auf, Nigger!«
Dann raste der Streifenwagen davon, die weißen Cops darin hysterisch lachend.
Man durfte sich die Angst nicht anmerken lassen. Für die war das nur ein harmloser Scherz, selbst wenn sie mit dem Auto auf einen zuhielten, während man gerade über die Straße ging; selbst wenn sie einen beinahe erwischten. Boggs hatte mehr als nur einmal versucht, einen Streifenwagen anzuhalten, als er Hilfe bei einer Verhaftung benötigte, und mehr als nur einmal hatte der Wagen Kurs auf ihn genommen, bis er zur Seite springen musste. Im Anschluss Gelächter. Klar, wenn sie eines Tages tatsächlich einen der farbigen Polizisten überfahren würden, dann würden sie halt behaupten, es sei ein Unfall gewesen.
Boggs und Smith war die Lust auf Anekdoten vergangen, als sie die Ecke Auburn erreichten. Die Nacht war still, vom beinahe mechanischen Surren der Heuschrecken und dem Frage- und Antwortspiel der Grillen abgesehen. Die Leuchtreklame über Bailey’s Royal Theater war erloschen, genau wie die Lichter der Juwelier- und Schneiderläden. Im dritten Stock des Bürogebäudes der Atlanta Life Insurance Company hatte jemand eine Lampe angelassen, doch bis auf die Straßenlaternen blieb es dunkel. Dann hörten sie den Aufprall.
Sie drehten sich um, in der vagen Hoffnung, dass der Streifenwagen einen Hydranten gerammt hatte oder in eine Mauer gerast war, doch stattdessen sahen sie zwei Blocks weiter einen weißen Buick auf dem Bordstein und einen tanzenden oder zumindest torkelnden Laternenmast. Sie beobachteten, wie das Licht einmal flackerte, dann noch einmal, es erinnerte sie an ihre elektrischen Lampen zu Hause bei Gewitter.
Der Buick setzte zurück. Von hier aus konnten sie das Nummernschild nicht entziffern. Dann kam er auf sie zu.
Keine drei Monate waren sie jetzt Streifenpolizisten rund um die Auburn Avenue (die Gegend, in der sie bis auf die Kriegsjahre immer gewohnt hatten) und die West Side auf der anderen Seite von Downtown. Noch vertraute man Atlantas acht schwarzen Polizisten keine Streifenwagen an, doch zumindest durften sie Uniformen tragen. Schwarze Mützen mit dem goldenen Kranz der Stadt, dunkelblaue Hemden, auf die ihre glänzenden Dienstmarken gepinnt waren, und schwarze Krawatten (Smith trug als einer von nur zwei Cops Fliege, weil er das schneidiger fand). Ihre breiten Gürtel waren beschwert mit einem Arsenal aus Waffen und Ausrüstungsgegenständen, darunter auch Schusswaffen, was eine Menge weißer Leute in Atlanta und Umgebung in Angst und Schrecken versetzte.
Boggs trat auf die Straße und hob die Hand. Die weißen Cops mochten ja Spaß am Versuch haben, ihre farbigen Kollegen zu überfahren, doch Zivilisten tickten da anders. Hoffte er. Der Buick fuhr langsamer als erlaubt, so als schämte er sich. Seine Scheinwerfer spiegelten sich in Boggs’ Marke.
Der Buick hielt an.
»Er lässt den Motor laufen«, sagte Smith nach ein paar Sekunden.
Boggs trat zur Fahrertür, Smith lief parallel zu ihm über den Gehweg zur Beifahrertür. Die Sohlen von Smiths Schuhen erzeugten so gut wie kein Geräusch, denn an jenem Morgen hatte jemand den Asphalt so gründlich gefegt, dass kein Zweig und keine Kippe weit und breit zu sehen war.
Das gleißende Scheinwerferlicht hatte es ihnen bisher unmöglich gemacht, einen Blick in den Wagen zu werfen. Nur die Silhouetten eines Fahrers mit Hut und eines Beifahrers ohne waren zu erkennen gewesen.
Boggs öffnete den Mund und wollte nach Führerschein und Zulassung fragen, als er sah, dass der Fahrer weiß war. Damit hatte er nicht gerechnet. Womit er gerechnet hatte, war, dass der Fahrer betrunken war, und damit lag er richtig. Während der korpulente weiße Mann ihn mit einer Mischung aus Unmut und Verachtung anstarrte, wurde Boggs von einer Alkoholfahne eingenebelt.
»Kann ich bitte Ihren Führerschein und Ihre Zulassung sehen, Sir?«
Man traf nicht besonders viele Weiße in Sweet Auburn, dem reichsten Negro-Viertel in Atlanta – oder in der ganzen Welt, wie es unter Kleinkriminellen hieß. Abenteuerlustige Weiße, die in den finsteren Ecken der Stadt nach Glücksspiel oder Huren Ausschau hielten, trieben sich normalerweise in der Decatur Street entlang der Bahngleise herum, eine halbe Meile südlich von hier. Oder sie gerieten in eine der ruchlosen Gegenden, die von farbigen Polizisten patrouilliert wurden. Dieser Bursche hier hatte sich entweder verfahren oder war so besoffen und dämlich, dass er dachte, jedes farbige Stadtviertel eigne sich zur Befriedigung seiner Triebe, wobei sich in der Gegend eigentlich überwiegend Kirchen, Immobilienbüros, Banken, Versicherungsgesellschaften, Beerdigungsinstitute, Friseurläden und um diese Uhrzeit längst geschlossene Restaurants befanden. Es gab ein paar Nachtklubs, doch das waren anständige Läden, in denen sich Negroes trafen, und Weiße wurden nur an Samstagen eingelassen, wenn Negroes der Zutritt verboten war.
Der graue Filzhut saß weit oben auf dem Kopf des Fahrers, so als hätte er sich gerade den Schweiß von der Stirn gerieben. Was sich auch weiterhin empfahl, denn seine Haut glänzte immer noch. Sein Haar war hellgrau, seine blaue Krawatte saß locker, und sein Leinensakko war zerknittert. Er wirkte durchgeschwitzter, als man als Autofahrer wirken sollte, dachte Boggs. So als hätte er gerade etwas sehr Anstrengendes hinter sich.
Auf der anderen Seite des Wagens filzte Smith seine Beifahrerin mit Blicken. Sie trug ein gelbes Sommerkleid, eins von der Art, wie sie ihn schon im Frühling anmachten, und auch jetzt im tiefsten Sommer war er niemand, der sich über die Hitze beklagte, solange die Frauen von Atlanta dabei halbnackt durch die Gegend liefen. Sie war klein genug, um ihre Beine im Fußraum übereinanderzuschlagen, der Saum ihres Kleides bedeckte ihr Knie. In einem kleinen Medaillon, das aussah, als würde es an ihrem schweißnassen Hals kleben, brach sich das Licht.
Nur für den Bruchteil einer Sekunde nahm sie Blickkontakt mit Smith auf, doch das reichte ihm für ein paar Fakten. Sie hatte helle Haut und war jung, maximal Anfang zwanzig. Das Rot auf der rechten Seite ihrer Lippen passte nicht zum Rot ihres Lippenstifts. Rot und leicht geschwollen. Obwohl Smith den Fahrer nicht erkennen konnte, erahnte er die Hautfarbe des Mannes anhand der Art, wie sich Boggs’ Stimme leicht veränderte, als er nach den Papieren fragte. Nicht zwangsweise unterwürfig, aber höflicher, als es die Situation erforderte.
»Nein, kannst du nicht«, antwortete der Fahrer.
Boggs war bewusst, dass die rechte Hand des Mannes neben ihm auf dem Sitz lag und er sie deshalb nicht sehen konnte. Boggs beschloss, vorerst nicht darauf einzugehen und darauf zu hoffen, dass Smith sie im Auge behielt. Die linke Hand des Mannes lag beiläufig auf dem Lenkrad, der Motor lief immer noch.
»Sie haben einen Laternenmast gerammt, Sir.«
»Ich hab ihn höchstens leicht gestreift.« Er sah Boggs noch nicht einmal an.
»Er hängt schief und muss repariert werden. Außerdem …«
»Du verschwendest meine Zeit, Junge.«
Für einen kurzen Moment war nichts zu hören als das Crescendo der Laubheuschrecken, erst dann ließ sich der Mann dazu herab, Boggs anzusehen. Nur um zu kontrollieren, wie sein Satz bei dem vorlauten Negro angekommen war. Doch Boggs ließ sich nicht das Geringste anmerken. Er war sehr gut darin, völlig ausdruckslos zu wirken, das wusste er. Eltern, Lehrer, Freundinnen hatten es ihm bestätigt. Woran denkst du? Wo bist du gerade? Er hatte diese Fragen immer gehasst. Ich bin genau hier. Ich denke einfach nur nach, mach mir meine Gedanken. Und nein, ihr könnt sie nicht lesen.
Normalerweise schaute man weißen Leuten nicht direkt in die Augen. Doch Boggs war die Polizei. Es war erst das dritte Mal, dass er und Smith es mit einem weißen Straftäter zu tun hatten. Farbige Beamte liefen nur in den farbigen Vierteln Streife, und Weiße verirrten sich nur selten dorthin.
»Ich muss Ihren Führerschein und Ihre Zulassung sehen, Sir.«
»Du musst gar nichts sehen, Junge.«
Boggs fühlte, wie sein Herz raste, und befahl sich, ruhig zu bleiben.
»Bitte schalten Sie den Motor aus, Sir«, sagte er, und ihm wurde bewusst, dass er genau mit dem Satz hätte anfangen sollen.
»Du darfst mich doch gar nicht festnehmen, und das weißt du.«
Auf der anderen Seite nutzte Smith die Gunst der Stunde, um den Rücksitz zu durchleuchten. Außer einem Straßenatlas auf dem Boden konnte er nichts erkennen. Der Wagen war vor dem Krieg hergestellt worden, doch er befand sich in gutem Zustand, der Lack glänzte. Smith richtete das Licht auf den vorderen Sitz, auf dem die Frau geradeaus starrte, ihre Haare verweigerten ihm die Sicht auf sie. Er hatte gehofft, der Lichtstrahl würde sie dazu bringen, ihn anzuschauen, damit er ihre Verletzung inspizieren oder noch weitere finden konnte, doch sie wandte sich noch mehr von ihm ab.
Im Gegensatz zu Boggs hatte Smith einen guten Blick auf die Fläche zwischen Fahrer und Beifahrer. Er sah, dass die rechte Hand des Mannes schützend auf einem großen braunen Umschlag lag.
»Ich bin autorisiert, Ihnen einen Strafzettel auszustellen, und genau das werde ich tun. Ich kann außerdem jederzeit weiße Beamte rufen, falls eine Festnahme notwendig wird. Denke nicht, dass das bei einer Verkehrswidrigkeit sein muss, aber wenn Sie es mit Ihrem Ton drauf ankommen lassen wollen, dann steh ich ganz zu Diensten.«
Der weiße Mann lächelte amüsiert.
»Oh. Oh, verdammt. Du bist einer von den ganz hellen Jungs, oder?« Er nickte, musterte Boggs von oben bis unten, als bestaunte er zum ersten Mal ein exotisches Raubtier, das der Zoo neu importiert hatte. »Ich bin schwer beeindruckt. Ihr habt’s ja wirklich weit gebracht.«
»Sir, ich frage Sie jetzt zum letzten Mal nach Ihrem Führerschein und Ihrer Zulassung.«
Er lächelte weiter, blieb weiter regungslos.
»Wie lautet Ihr Name, Miss?«, fragte Smith auf der anderen Seite des Wagens.
»Sprich sie nicht an«, fuhr ihn der Mann an und wandte sich um. Von seiner Position aus konnte er sicher nicht mehr sehen als Smiths Marke (tut uns leid, wir sind nämlich wirklich echte Cops) und vielleicht noch den Griff seiner Pistole im Holster (ja, auch die ist echt).
»Geht es Ihnen gut, Miss?«, fragte Smith die Frau. Schauen wir doch mal, wie es dem weißen Mann schmeckt, wenn man ihn ignoriert. Ihr Gesicht konnte er immer noch nicht sehen, doch beim Atmen bewegte sich ihr Haar zumindest hin und wieder so weit, dass er die rechte, aufgeplatzte Seite ihrer Lippen erkennen konnte. Dennoch weigerte sie sich weiterhin, sich ihm zuzuwenden.
Smith warf seinem Partner über das Autodach hinweg einen Blick zu. Beide hätten diesen Wichtigtuer nur zu gern festgenommen, doch sie waren sich nicht sicher, ob die Zentrale ihnen einen weißen Streifenwagen schicken würde – für einen Verkehrsunfall, dessen einziges Opfer ein Gegenstand war. Zudem hassten es Atlantas acht farbige Polizisten, die weißen Cops zu rufen. Es war eine lästige Erinnerung daran, wie wenig Autorität sie selbst besaßen.
Smith beugte sich erneut zu ihr hinunter: »Ihr Freund ist aber nicht sehr freundlich, Miss.«
»Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit ihr reden, Jungchen«, sagte der weiße Mann.
»Sir«, sagte Boggs zu Hinterkopf und Hut in dem Versuch, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen (hatte er die je gehabt?), und genervt davon, dass sein Partner die Eskalation suchte, »wenn Sie mir nicht Führerschein und Zulassung zeigen, dann ruf ich die …«
Er kam gar nicht dazu, seine lächerliche Drohung zu vollenden, für deren Notwendigkeit er sich so schämte und für ihre Umsetzung in die Tat noch viel mehr, denn inmitten seines Satzes wandte sich der weiße Mann wieder der Straße zu, legte den Gang ein, und der Buick rumpelte vorwärts.
Beide Cops wichen zurück, damit er ihnen nicht über die Füße fuhr.
Der Buick entfernte sich und besaß noch nicht einmal den Anstand, schnell zu fahren. Der weiße Mann floh nicht, er hatte nur keine Lust mehr, so zu tun, als würde ihre Anwesenheit ihn kümmern.
»Halt oder ich ruf die echten Cops?« Smith schüttelte den Kopf. »Komisch, dass das nicht funktioniert.«
*
Atlanta, Georgia. Zu zwei Teilen konföderiert-rassistisch, zu zwei Teilen schwarz und zu einem Teil etwas, für das sich noch keine Bezeichnung gefunden hatte. Mehr als eine Stadt, aber auch noch kein Landkreis, stattdessen eine merkwürdige Kombination aus beidem; einst ein verschlafener Eisenbahnknoten, doch der Bedarf an Wehrmaterial und dessen Transport hatten zu Kriegszeiten eine Bevölkerungsexplosion verursacht. Auch nach dem Krieg hörten die Kamine der Fabriken, der Textilindustrie und der Eisenbahn nicht auf zu rauchen, denn der Alltag war zurück, die Amerikaner benötigten dringend neue Kleidung, Waschmaschinen und Autos, und der Süden hatte billige Arbeitskräfte zu bieten, die in keiner Gewerkschaft waren. Atlanta wuchs weiter, die Züge spuckten immer mehr Neuankömmlinge aus, in den Wohnhäusern wurde es enger, der illegale Handel mit Schnaps wanderte von den Bergen hinunter in die Stadt, und die Straßen wurden überflutet von Ehrgeiz, Intrigen und Prügeleien, denn dort, im Bergvorland von Georgia, war etwas entfesselt worden, das wohl nicht mehr aufzuhalten war.
*
Zwanzig Blocks von Boggs und Smith entfernt spaltete sich Officer Denny Rakestraw mal wieder in zwei Teile auf.
Er stand in einer Gasse, die von der Decatur Street abging, in einem farbigen Stadtteil, obwohl er und sein Partner weiß waren. Starrte auf die Mondsichel über ihm, perfekt eingerahmt von den Dächern zweier Backsteingebäude. Vernahm den Klang eines sich nähernden Frachtzugs gen Westen, der quälend langsam aus Downtown heranratterte. Dann warf er einen Blick auf seine polierten Stiefel. Dann drehte er sich zu dem Streifenwagen um, den sie am Straßenrand geparkt hatten. Das Blaulicht war aus, denn sein Partner, Lionel Dunlow, wollte keine Aufmerksamkeit erregen.
Dunlow schlug erneut auf den Negro ein. »Ich hab dich gefragt, ob wir uns verstanden haben, Nigger!«
Rakestraw sah, wie der Negro etwas sagen wollte, doch Dunlow drückte die Hände zu eng um seine Kehle.
Dann hörte Rakestraw ein Schlurfen, und er widmete seine Aufmerksamkeit wieder dem Eingang der Gasse. Sie wurden von zwei Silhouetten beobachtet.
»Verdammt, jag die weg«, wies Dunlow seinen jüngeren Partner an.
Rakestraw ging einen Schritt auf die beiden Silhouetten zu. Es handelte sich entweder um junge Männer oder um Teenager, sie waren groß, aber schmal, stellten kaum keine Bedrohung dar. Waren von den Schlägen angelockt worden, sahen aber nicht so aus, als wollten sie eingreifen.
»Haut ab!«, brüllte Rakestraw in seiner tiefsten Stimmlage, die Bassnoten bliesen förmlich den Staub aus dem Mörtel der Backsteinwände. Die Schatten verschwanden.
Dann ein erneuter Schwinger von Dunlow und der Negro lag auf dem Boden.
»Dachte, wir wollten keine Aufmerksamkeit erregen«, sagte Rakestraw.
Für Officer Dunlow war das hier eine echte körperliche Herausforderung. Ihm lief der Schweiß über die Wangen, und seine Mütze saß schief. Sein Gürtel ächzte unter seinem Wohlstandsbauch, und nach fünf oder sechs Schlägen war er bereits völlig außer Atem. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis er die medizinischen Tests nicht mehr bestehen würde.
Rakestraw selbst hatte nicht zugeschlagen, im Grunde hatte er sich kaum bewegt, und doch fühlte sich die Haut unter seiner Uniform glitschig an. Nicht von der körperlichen Anstrengung – im Gegenteil –, sondern von der Anstrengung, sich zurückhalten zu müssen, von dem Unbehagen, das alles einmal mehr mit ansehen zu müssen.
»Hast recht«, sagte Dunlow, holte Luft. Er trat zu dem schwer atmenden Haufen, der bis vor ein paar Minuten noch ein Negro gewesen war, allein unterwegs und von Dunlow des illegalen Schnapshandels verdächtigt. Dunlow blickte auf den Haufen hinunter. »Haben wir uns verstanden, Freundchen?«
Es war ein Satz, den Rakestraw seinen Partner mittlerweile so oft hatte benutzen hören, dass er ihn bis in den Schlaf verfolgte. Dunlow und die Kriminellen verstanden sich, genau wie Dunlow und die Zeugen, sogar mit den Richtern, vor denen er aussagte, verstand sich Dunlow. Der Mann schien überzeugt davon zu sein, dass er über einen extrem reichhaltigen Erfahrungsschatz verfügte, den er großzügig mit seinen Mitmenschen teilte.
»Ja, ja. ’asteh schon.« Es klang komisch, ihm fehlten ein paar Zähne.
Rakestraw sah dieses Funkeln in den Augen seines Partners, etwas, das er mittlerweile kannte. Es verhieß ganz und gar nichts Gutes. Deshalb ging Rakestraw auf ihn zu und legte seinem Partner die Hand auf die Schulter. Dunlow überragte ihn um gute fünf Zentimeter. Das und der Altersunterschied machten das Ganze zu einer heiklen Angelegenheit. Wie ein Sohn, der seinen betrunkenen Vater davon abhält, die eigene Mutter zu schlagen.
»Dunlow«, sagte Rake.
Dunlow drehte sich zu Rake um, für eine Sekunde schien es, als würde er ihn nicht erkennen, so als hätte er tatsächlich einen Sohn und nicht seinen Partner erwartet. Dunlow besaß zwei Söhne im Teenageralter, Raufbolde, nach allem, was man wusste, die nur dank des Berufs ihres Vaters noch keine eigene Polizeiakte hatten.
Die Augen des älteren Polizisten funkelten bedrohlich, und er wirkte, als wollte er gleich auch noch gegen diesen jugendlichen Störenfried die Hand erheben, so wie er es vermutlich schon oft bei seinen Söhnen getan hatte. Doch dann erkannte er Rake und kehrte in die Gegenwart zurück.
»Ich denke, er hat’s jetzt verstanden«, sagte Rake.
»Ja.«
Doch nicht ohne einen abschließenden und nachdrücklichen Tritt in die Eingeweide. Der Klumpen auf dem Boden atmete lang und rasselnd ein und war dann still, als hätte er Angst, die Luft wieder herauszulassen. Als er ausatmete, waren die beiden Cops aus der Gasse verschwunden.
Rake redete sich ein, dass die extreme Reaktion seines Partners auf den Schmuggler mit seinem leidenschaftlichen Engagement für das Durchsetzen der städtischen Alkohol-Gesetze zu erklären sei. Er redete sich eine Menge Dinge über Dunlow ein. Das kostete ihn eine Menge Kraft, so wie der Glaube an eine Religion, ein bedingungsloser Glaube an Dinge, die man nicht beweisen konnte. Denn im Fall des gar nicht so besonders gottgleichen Dunlow gab es immer wieder deutliche Hinweise auf das Gegenteil. In den Wochen seit seinem Amtsschwur hatte er Dunlow mindestens ein Dutzend Männer verprügeln sehen, statt sie festzunehmen (in der Regel Negroes), er hatte gesehen, wie er Leuten vorgeschrieben hatte, was sie als Zeugen vor Gericht aussagen sollten, und er hatte gesehen, wie er Bestechungsgelder von Alkoholschmugglern, Betrügern und gewissen Damen entgegengenommen hatte.
Es gab überhaupt so einiges zu lernen in Rakes neuem Gewerbe. Vier Jahre lang hatte er mit denkbar schlechten Überlebenschancen als Aufklärungsposten in Europa gedient, war oft lange Zeit auf sich allein gestellt gewesen und hatte irgendwann den Unterschied zwischen Gefahr und Gelegenheit, zwischen Kollaborateuren und Spionen gelernt. Zurück in Atlanta fiel ihm die Erkundung der moralischen Landkarte plötzlich wesentlich schwerer.
Rake fragte sich, ob es einen speziellen Grund dafür gab, dass Dunlow diesen Negro verprügelt hatte, eine spezielle Botschaft, die er damit senden wollte, und wenn ja, ob sie subtiler war als die Botschaft seines Hundes, wenn er beim Spaziergang in der Nachbarschaft sein Bein hob. In solchen Momenten wurde Rake bewusst, dass sein Job nur daraus bestand, die Leine festzuhalten. Halt die Leine fest.
Also stand er hier und spaltete sich in zwei Hälften auf. Eine, die weiterhin seinem moralischen Kompass folgte, diesem unstet wackelnden Ding, das einen davon abhielt, Fremde grundlos zu verprügeln. Die andere Hälfte lernte, so gut sie konnte, von Dunlow und Konsorten, adaptierte diese kuriosen und oft gegen jede Intuition sprechenden Überlebenstipps für Darktown.
»Ich fahre«, sagte Rake und öffnete die Fahrertür, noch bevor sein Vorgesetzter widersprechen konnte.
Dunlow setzte sich auf den Beifahrersitz und zog seine Handschuhe aus, rang nach Luft.
»Alles gut?«, fragte Rake.
»Harten Schädel hatte der Bastard.«
»Klang auch so.«
»Du weißt, dass ein Niggerschädel beinahe fünf Zentimeter dicker als unserer ist?«
Rake war niemand, der auf solche Kommentare einging, doch er fürchtete, in Gegenwart von Dunlow bleibe ihm keine Wahl, also entschied er sich für ein neutrales: »Wusste ich nicht.«
»Hab ich in einem Magazin gelesen. Schädellehre.«
»Dann les ich wohl die falschen Magazine.«
»Wundert mich nicht, College-Junge.« So nannte ihn Dunlow, obwohl er noch nicht einmal einen Abschluss hatte. Er hatte bloß zwei Jahre studiert, bevor der Krieg alles verändert hatte. Dank seiner eingewanderten Mutter sprach er fließend Deutsch und hatte zudem zwei Jahre lang Kurse an der University of Georgia belegt, ein Talent, das man durchaus zu schätzen gewusst hatte. »Egal, erklärt auf jeden Fall so einiges. Nicht nur, warum da kein Platz für ein voll ausgebildetes Gehirn ist, sondern auch, warum das solche Dickschädel sind.«
»Auf mich wirkte sein Schädel gar nicht so unempfindlich.«
Dunlow machte eine Faust, dann spreizte er die Finger. Seine Daumen waren äußerst gelenkig, er konnte sie bis zu seinen Handgelenken zurückziehen, ein schauerlicher kleiner Zirkustrick, mit dem er gern die neuen Rekruten erschreckte, wenn er nach dem Öffnen einer Flasche Cola vor Schmerz aufschrie, nur um anschließend beim entsetzten Gesichtsausdruck seines Gegenübers in unbändiges Gelächter auszubrechen. Er gab damit an, der beste Daumenringer in seiner Grundschulklasse gewesen zu sein. Eine bizarre Auszeichnung, derer sich nur einer wie er rühmen konnte. Es bedeutete zudem, dass er jedes Mal ein paar Zentimeter mehr Spiel hatte, wenn er jemandem die Hände um den Hals legte, ein Vorteil, vom dem er erst eben wieder Gebrauch gemacht hatte.
Dunlow ballte die Hand erneut zur Faust. Rake hörte eine Sehne einrasten.
»Ah, Scheiße. So ist’s besser.«
Dann meldete sich die Zentrale über Funk mit der Nachricht, dass der Negro-Beamte Boggs ein Verkehrsdelikt gemeldet habe, und der Frage, ob einer der echten Cops das Bedürfnis verspüre, zu helfen. Dunlow nahm das Mikrofon in die Hand und sagte: »Nichts lieber als das.«
*
Nachdem der weiße Mann weggefahren war, waren Boggs und Smith zur nächstbesten Polizeirufsäule gelaufen und hatten einen Streifenwagen angefordert, um eine Festnahme durchzuführen. Die Zentrale ersparte Boggs gnädigerweise jeglichen Kommentar, als er die Informationen über Funk durchgab. Wagen D-152 erklärte sich sofort bereit. Smith und Boggs waren überrascht. Sonst ließen sich die weißen Cops reichlich Zeit, bevor sie auf Anfragen der farbigen Beamten reagierten. D-152 war heute Nacht wohl ziemlich langweilig.
Fünf Minuten später liefen sie ein paar Blocks südlich der Auburn auf die National Pencil Factory und ihren anhaltenden Geruch von Sägespänen zu, da sahen sie den Buick wieder. Ordnungsgemäß hielt er an einem Stoppschild an der nächsten Querstraße. Doch er schien nicht weiterfahren zu wollen.
»Was macht der da?«, fragte Boggs. »Dreht der hier seine Runden, weil er was sucht?«
Boggs stellte sich vor, wie er auf die Reifen des Buicks schoss. Was ihm natürlich die sofortige Kündigung einbringen würde oder Schlimmeres. Kein farbiger Polizeibeamter hatte bisher eine Schusswaffe im Dienst abgefeuert.
»Vielleicht hat er aufgegeben«, sagte Smith. Er beeilte sich jetzt, rannte noch nicht, sein verletztes Knie war aber alles andere als begeistert.
Er und Boggs waren nur noch gute drei Meter entfernt, als sie sahen, wie der weiße Mann das Mädchen schlug. Selbst durch die Heckscheibe war nicht zu übersehen, wie der graue Ärmel die langen Haare der Beifahrerin zur Seite riss. Der ganze Wagen schien einen Satz zu machen.
Dann setzte sich der Buick wieder in Bewegung.
»Lass uns dranbleiben«, sagte Boggs.
Der Buick fuhr in Richtung Süden. Nur noch zwei Blocks bis zur nächsten Rufsäule. So konnten sie die Zentrale zumindest über die aktuelle Position des Wagens unterrichten, falls Einheit D-152 tatsächlich unterwegs war.
Sie rannten. Der Buick blieb nach wie vor unter Normalgeschwindigkeit, als würde er sich an etwas heranpirschen. Es war offensichtlich, dass sein Fahrer nicht bemerkte, dass die beiden Cops ihn verfolgten.
Smiths Knie warnte ihn jetzt unmissverständlich, dass dieses ganze Gerenne so schnell wie möglich aufhören musste. Sie erreichten die Kreuzung Decatur Street, unmittelbar nördlich der Eisenbahnschienen. Erneut hielt der Buick an einem Stoppschild. Dann öffnete sich die Beifahrertür und die Frau schoss heraus, ihr gelbes Kleid eine winzige Flamme in der dunklen Nacht, bevor sie in einer Gasse erlosch.
Der Buick blieb, wo er war, die Tür stand offen wie eine unbeantwortete Frage. Dann beugte sich der weiße Mann hinüber, und man sah, wie seine bleiche Hand unkoordiniert nach dem Türgriff tastete. Er schloss die Tür und fuhr weiter.
»Ihn jagen oder ihr folgen?«, fragte sich Boggs laut, als er und Smith stehen blieben.
Sie hätten sich aufteilen können. Smith hätte der Frau hinterherlaufen können und Boggs den Buick verfolgen. Doch Sergeant McInnis hatte sie eindringlich davor gewarnt, sich zu trennen. Vermutlich dachte das Department, dass ein Negro-Polizist allein nicht besonders vertrauenswürdig wirke oder ein zweiter einen beruhigenden Einfluss auf den anderen habe. Oder so was in der Art. Wer konnte schon die Logik der Weißen durchschauen?
»Ich will, dass der Hurensohn einen Strafzettel kriegt«, sagte Smith. »Oder verhaftet wird.«
»Ich auch.«
Obwohl nur einer von ihnen ihr Gesicht gesehen hatte, und selbst das nur eine Sekunde lang, ließen sie das Mädchen so in eine Nacht entkommen, die sie nie wieder ausspucken würde.
*
Boggs sprintete in östlicher Richtung die Decatur entlang. Eine halbe Meile vor ihm lagen die Türme von Downtown im Dunklen. In der Nähe vernahm er die Geräusche sich koppelnder und entkoppelnder Frachtwaggons und die anderer Stahlriesen, die sich durch die Nacht mühten. Smith verfolgte den Buick, der in südliche Richtung fuhr, hinein in den kurzen Tunnel, der unter den Gleisen hindurchführte. Er verlor den Anschluss. Die Ratten stoben in alle Richtungen davon, als der Buick durch eine Wasserlache preschte, die das zwanzigminütige Gewitter vom Nachmittag hinterlassen hatte. Smith war kurz davor aufzugeben, als er die vertraute Sirene eines Streifenwagens hörte.
Er lief durch den Tunnel mitten in eine von Blaulicht erhellte Szenerie: links die abzweigenden Gleise, Müll auf Straße und Gehweg und ein quer stehender Streifenwagen, der dem Buick den Weg versperrte, sodass er endlich zum Halten gekommen war.
Der weiße Polizist am Steuer sprang aus dem Wagen, die linke Hand erhoben, die rechte am Griff seiner Pistole, die noch im Halfter steckte.
»Das ist Dunlows Wagen«, sagte Smith, als Boggs ihn eingeholt hatte.
Dunlow stand ganz oben auf Boggs’ und Smiths Liste der meistgehassten weißen Kollegen. Natürlich gab es nicht wirklich eine entsprechende Liste. Und natürlich gab es keine weißen Cops, die nicht ganz oben gestanden hätten. Vielleicht lag es auch nicht daran, dass Dunlow so viel schlimmer als der Rest war, sondern daran, dass er ein Dauerproblem darstellte. Die farbigen Beamten durften nur die Schichten von 18 bis 2Uhr übernehmen, und da es nur acht von ihnen gab, konnten ihnen die weißen Beamten jederzeit einen Besuch in ihrem neuen Revier abstatten. Kein weißer Polizist war jemals auf der Auburn Avenue Streife gelaufen, sie schauten nur vorbei, wenn sie einen farbigen Sündenbock brauchten oder ihre angestaute Wut an unschuldigen Negroes auslassen wollten. Ansonsten mieden die weißen Cops die farbigen Viertel. Nur Dunlow schien sich hier wie zu Hause zu fühlen, ein Gefühl, das ihm die Anwohner ganz sicher nicht vermitteln wollten.
»Lass mich mit ihm reden«, sagte Boggs. Er war der diplomatischere von beiden, was Smith nicht gerne zugab, obwohl er wusste, dass es so war.
Sie richteten ihre Mützen und Krawatten, stellten sicher, dass ihre Hemden in den Hosen steckten, und nahmen Haltung an, während sie langsam auf den weißen Buick zugingen.
Dunlow hatte die Fahrertür erreicht, gefolgt von seinem Juniorpartner Rakestraw. Dunlow musterte den Fahrer länger als notwendig, bevor er anfing zu reden. Vermutlich hielt er das für furchteinflößend. Die Tage, als er hauptsächlich aus Muskeln bestanden hatte, waren längst vorüber, doch er verfügte immer noch über beeindruckende Masse.
»Führerschein und Zulassung bitte.«
Boggs hatte sein Leben lang versucht, einen Bogen um weiße Männer wie ihn zu machen. Jetzt musste er mit ihnen zusammenarbeiten.
Deshalb konzentrierte sich Boggs lieber auf Dunlows Partner. Er ging zu Rakestraw und beugte sich zu dessen Ohr. Falls Rakestraw die körperliche Nähe provozierte, ließ er es sich nicht anmerken. Sie wussten nicht so genau, was sie von Rakestraw halten sollten, der sich meistens im langen Schatten seines Partners versteckte. Wahrscheinlich würde er sich als derselbe Bastard wie Dunlow entpuppen, sobald man ihn näher kennenlernte.
»Da saß eine erwachsene weibliche Negro im Wagen neben ihm. Sie ist zu Fuß geflohen, an der Ecke Hilliard und Pittman. Einen Block davor hat er sie ins Gesicht geschlagen.«
»Das haben Sie gesehen?«
»Die haben hier ihre Runden gedreht. Ist nur ein paar Minuten her.«
Rakestraws neutraler Gesichtsausdruck und sein angedeutetes Nicken konnten sowohl »Interessant« als auch »Wen schert’s?« bedeuten. Oder dass er die farbigen Cops bei ihrem weißen Sergeant melden und Konsequenzen fordern würde, weil sie die Frau nicht verfolgt hatten.
Der Fahrer reichte Dunlow seine Papiere. »Die lassen euch jetzt die Afrikaner babysitten?«, scherzte er.
»Sie haben also nach einem Unfall Fahrerflucht begangen?«, antwortete Dunlow.
»War kein Unfall. Hat irgendein anderer Wagen einen Unfall gemeldet?«
»Es war ein Laternenmast auf der Auburn Avenue«, sagte Boggs.
Dunlow starrte ihn an. Er schien den Einwurf des farbigen Kollegen nicht sonderlich zu schätzen. Er reichte die Papiere an Rakestraw weiter, der zurück zum Wagen lief, um die Informationen an die Zentrale weiterzuleiten. Dann wandte er sich an die farbigen Beamten. »Das wär dann alles, Jungs.«
Boggs warf seinem Partner einen Blick zu. Smith biss sich auf die Zunge, das konnte er sehen, doch er hielt sich zurück. Noch hatten sie Dunlow nichts von der Tätlichkeit erzählt, deren Zeuge sie geworden waren. Das Opfer war verschwunden, klar, doch Straftat blieb Straftat.
Boggs öffnete den Mund. Er gab sich Mühe, seine Worte mit Bedacht zu wählen, doch bevor er etwas sagen konnte, verfiel der Fahrer in einen lallenden Singsang: »Zurück in den Dschungel, Affen!«
Dunlow lächelte.
Mehr Bestätigung brauchte der Fahrer nicht. Er steigerte sich in einen schallenden Refrain hinein: »Ja! Wir haben keine Bananen!«
Boggs sah Dunlow an, sah, wie ihm die Darbietung ein breites Grinsen ins Gesicht zauberte. Boggs hielt den Blick einen Moment lang, in der Hoffnung, dass seine Botschaft ankam, doch er ahnte, dass auch sein angestrengter Blick nichts ausrichten konnte.
Der Gesang wurde jetzt lauter. Boggs konnte noch nicht einmal seinem eigenen Partner in die Augen blicken, er hätte nur den Zorn gesehen, der auch sein eigener Zorn war, und das konnte er nicht zulassen.
Boggs und Smith entfernten sich. Das zuckende Blaulicht fiel am Bahnübergang über einen in östlicher Richtung vorbeifahrenden Frachtzug.
»Hurensohn«, fluchte Smith.
Boggs spuckte auf den Boden. Eine Kakerlake, halb so lang wie sein Schuh, wuselte über den Bürgersteig.
»Wette zwei Dollar, dass die ihm noch nicht mal einen Strafzettel verpassen«, sagte Smith. Die Wette war Boggs zu riskant.
*
Ein sechsjähriger Junge namens Horace war drei Blocks von seinem Zuhause entfernt, als er die Lady in dem gelben Kleid vorbeirennen sah. Er fand sie hübsch, obwohl er nicht allzu viel von ihrem Gesicht erkennen konnte. Warum also fand er sie hübsch? Die Frage würde er sich später stellen, als er noch mal an diesen Moment zurückdachte.
Er lief allein durch die Nacht, denn seine Mutter hatte ihn geweckt und es ihm aufgetragen. Sie war sehr krank und benötigte einen Arzt. Sie hatte Horace den Weg genau beschrieben. Ihr zuliebe musste er sich beeilen, denn wenn er zu lange brauchte, vergaß er die Wegbeschreibung.
Die Lady hämmerte an eine Haustür.
Horace beobachtete sie im Vorbeigehen, und sie musste ihn gehört haben, denn sie drehte sich um und sah ihn an. Sie sah ihn an und gleich wieder weg, wie das Erwachsene tun, wenn sie merken, dass du nur ein Kind bist und sie dich wieder vergessen können.
Er lief weiter. Sie hörte auf zu klopfen.
An der nächsten Kreuzung schaute er in beide Richtungen, bevor er die Straße überquerte. Doch dann beschloss er, sich nach der Lady umzudrehen. Er beobachtete, wie sie von der Veranda kam und nach hinten in den Garten lief, wo er sie aus den Augen verlor. Dann schaute er wieder in beide Fahrtrichtungen, doch jetzt kam ein Auto, und er wartete. Das Auto hielt am Straßenrand, genau da, wo Horace stand. Die Tür öffnete sich auf der anderen Seite, der Motor lief noch, und die Scheinwerfer blendeten ihn.
Ein hagerer weißer Mann in einem hellgrauen Anzug kam auf ihn zu.
»Hallo, mein Sohn. Was machst du hier um die Uhrzeit?«
Mit einer solchen Stimme redeten Erwachsene, die es nicht gewohnt waren, mit Kindern zu sprechen.
Horace murmelte irgendwas von seiner Mutter.
Der Mann ging in die Knie, sodass seine Augen fast auf Horace’ Höhe waren. Sie waren tiefblau. Sein Hut passte zum Anzug.
»Ganz langsam, mein Sohn, hör auf zu nuscheln.«
Zunächst war Horace nur irritiert gewesen, als der Mann aus dem Auto gestiegen war. Jetzt hatte er Angst. Da war etwas in den Augen und an dem wachsartigen weißen Gesicht des Mannes, etwas an der Art, wie er Horace ansah. Als ob er sich sehr für ihn interessierte.
»Meine Mama ist krank. Ich hole den Doktor.«
Ein lauter Knall, als fiele eine Straße weiter eine Mülltonne um, dann das Geheule von Coyoten.
»Das tut mir leid. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage an dich, mein Junge. Hast du heute Nacht hier draußen eine farbige Lady mit langen Haaren gesehen? In einem gelben Kleid?«
Horace nickte. Der Mann lächelte. Seine Zähne sahen aus wie bei einer Karikatur aus der Zeitung.
»Sie ist in das Gebäude dort gelaufen, stimmt’s?«
»Sie hat geklopft, aber niemand hat ihr aufgemacht, Sir.« Ihm fiel ein, dass er »Sir« sagen musste. Vorher hatte er es vergessen. »Sie is’ stattdessen hintenrum.«
*
Rakestraw saß im Streifenwagen und gab Führerschein- und Zulassungsnummer durch, während er seinem Partner beim Plausch mit dem Fahrer zuschaute. Worüber redeten die? So viel Konversation war normalerweise nicht notwendig.
Der Fahrer hieß Brian Underhill und war dreiundvierzig Jahre alt. Auf dem Führerschein stand eine Adresse in Mechanicsville, mit dem Auto nicht weit von hier. Die Zentrale meldete, es gebe keine Einträge über einen Mr.Underhill, keinen Haftbefehl, keine Bewährungsauflagen. Rakestraw war dabei, den Strafzettel auszufüllen, als er innehielt. Er war sich nicht sicher, wie sein Partner weiter vorgehen wollte. Also stieg er aus dem Wagen und ging auf den Buick zu.
Dunlow war gerade mitten im Satz, doch er brach ab, als Rake ihm die Papiere reichte.
»Danke«, sagte Dunlow. »Ich habe Mr.Underhill hier gerade empfohlen, ein wenig vorsichtiger zu fahren.«
»Ja, Sir, Officer.« Der Fahrer schien sich über irgendetwas zu amüsieren. Genau wie Dunlow.
»Alles klar«, sagte Dunlow. »Schönen Abend noch.«
Underhill startete seinen Buick.
»Keinen Strafzettel?«, fragte Rake, als Underhill bereits einen Block entfernt war.
»Er und ich, wir haben uns schon verstanden.«
»Und deshalb stellen wir ihm keinen Strafzettel aus, obwohl er betrunken eine Laterne umgefahren hat?«
»Welche Laterne? Siehst du hier eine?«
»Boggs und Smith sagen, sie hätten es gesehen.«
»Ich kann mich nicht erinnern, dass die Darkies behauptet haben, sie wären dabei gewesen. Kann natürlich sein. Aber selbst wenn – eine Lampe weniger in Darktown. Der Mann hat quasi nur seine Bürgerpflicht erfüllt.«
Dunlow ging zurück zum Wagen, dieses Mal zur Fahrertür.
»Ich frag mich, wer das Mädchen war«, sagte Rakestraw beim Einsteigen und versuchte, nicht allzu vorwurfsvoll zu klingen.
»Noch mal: Ich selbst kann mich an kein Mädchen erinnern. Die Darkies behaupten, sie hätten sie gesehen, und ich bin sicher, die schnüffeln gerade überall in den Büschen nach ihr rum.«
Dunlow glaubte vermutlich, dass farbige Polizisten über einen außergewöhnlich guten Geruchssinn verfügten. Neben weiteren Kräften.
»Und wenn Boggs und Smith einen Bericht darüber schreiben?«, fragte er.
»Die sind dämlich, aber nicht so dämlich. Die Nigger wissen, dass ich hart zurücktrete, wenn sie mir auf die Füße steigen.« Er startete den Wagen. »Lass uns in einer anständigeren Gegend dieser schönen Stadt eine Runde drehen.«
*
Der weiße Mann in dem hellgrauen Anzug hatte Horace ungewöhnlich lange angelächelt.
»Du bist ein artiger kleiner Junge, stimmt’s?«
»Ja, Sir.« Horace’ Mutter hatte ihn gemahnt, weiße Menschen nie von sich aus anzusprechen, sie stets »Sir« oder »Ma’am« zu nennen, schön höflich zu bleiben und so schnell wie möglich zu verschwinden, bevor sie etwas Schreckliches taten.
Zu welchen Gemeinheiten solche Leute in der Lage waren, wollte sie nicht sagen. Horace vermutete, sie verspeisten farbige Menschen oder zumindest farbige Kinder. Und was hatte seine Mutter noch gesagt? Genau: Schau ihnen nicht in die Augen.
Und doch hatte Horace dem Mann in dem Moment in die Augen geschaut, als er in die Hocke gegangen war, und auch jetzt konnte er den Blick nicht abwenden. Sie waren so blau und leer, dass es sich anfühlte, als saugten sie ihn auf, um die Leere zu füllen. Horace verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen.
Der Mann streckte die Hand aus und tätschelte Horace’ Kopf. Erst ein Mal, dann ein zweites Mal. Beim zweiten Mal blieb die Hand liegen. Dann bewegte sie sich langsam zu seinem Nacken.
Horace zuckte zusammen.
Die Hand des Mannes glitt hinter Horace’ rechtes Ohr, bevor sie wieder auftauchte. Zwischen Daumen und Zeigefinger schimmerte ein Zehn-Cent-Stück.
»Damit kannst du den farbigen Doktor bezahlen.«
Horace begriff, dass er seine Hand ausstrecken sollte, also tat er es, und der Mann drückte ihm die Münze in die Handfläche. Dann stand der Mann auf, und ohne Blickkontakt war es, als hätte er sich in Luft aufgelöst.
Horace überquerte eilig die Straße. Die Münze immer noch fest mit der Hand umklammert, war er schon einen Block weiter, als ihm auffiel, dass er tatsächlich die Wegbeschreibung seiner Mutter vergessen hatte. Er hatte sich verirrt und war unendlich müde.
2
AM NÄCHSTEN MORGEN waren Rake und Dunlow auf der Jagd nach einem entflohenen Sträfling.
Ihre Schicht begann früher als üblich um zehn Uhr morgens wegen eines merkwürdigen Personalwechsels, den keiner so richtig nachvollziehen konnte. Unausgeschlafen und randvoll mit Kaffee waren sie auf der Suche nach einem James James Jameson – sein echter Name –, der am Vortag aus dem Staatsgefängnis in Reidsville geflohen war. Das APD war gerade erst davon unterrichtet worden. »Triple James«, wie ihn die Cops nannten, war vor zwei Jahren wegen versuchten Mordes ins Gefängnis gewandert, als Rake noch ein frustrierter Zivilist gewesen war, der sich mehr schlecht als recht an ein Leben nach dem Krieg und einen Job in einer Textilfabrik gewöhnte. Der Prozess hatte im Mittelpunkt der lokalen Berichterstattung gestanden und war selbst landesweit Thema gewesen, denn im Norden gab es nicht wenige, die den Negro für zu Unrecht verurteilt hielten. Typisch für Leute, die sich aus der Ferne in fremde Angelegenheiten einmischen.
»Der Junge hatte schon Dreck am Stecken, bevor er überhaupt geboren wurde«, sagte Dunlow, als sie durch Nebenstraßen rasten.
»Was sagen die in Reidsville, wie er rausgekommen ist?«
»Die offizielle Version lautet Ausbruch. Schüsse vom Wachturm, aber der flinke Nigger kann entkommen, kennt man ja. Aber ich hab da einen pensionierten Kumpel in der Gegend, und der hat gehört, dass Triple James und ein paar andere Nigger den Highway sauber gemacht haben und nur zwei Aufseher dabei waren. Und einer davon geht spazieren oder so was, und der andere, jetzt der einzige Aufseher, denkt, das wär ein guter Zeitpunkt, um mal den Straßenrand zu gießen. Leider hat er diese Infektion, bei der das Pinkeln ewig dauert. Und wehtut wie die Hölle. Hab ich zumindest gehört. Egal, Triple James hat sich wohl mittlerweile von seinen Fußfesseln befreit – Gott weiß, wie –, und während der Wärter sich mit seinem Ding in der Hand einen abmüht, verabschiedet sich Triple James in die Pinienwälder.«
»Du machst Witze.«
»Mein Sohn, überschätze niemals die Intelligenz unserer Kollegen bei der Polizei.«
»Solange du da bist, wird mir das auch nicht passieren.«
Die Beamten wurden ausgesendet, um zunächst ein paar naheliegende Orte zu überprüfen: die Wohnung der Exfreundin, zuletzt bekannte Geschäftspartner, die armen alten Eltern, Onkel, Tanten, diverse Bekannte. Offenbar wusste Dunlow, dass die Schwester von Triple James gerade erst umgezogen war, behielt die Information aber während der Einsatzbesprechung für sich und ließ auch Rake erst im Wagen davon wissen. Die Schwester wohnte in einem belebten Negro-Viertel ein paar Blocks südlich der Auburn Avenue. Das war das Gute an Dunlows Vorliebe für die farbigen Viertel: Er kannte die Straßen, die Leute und ihre Geschichte. Er konnte die Zukunft mit erstaunlicher Präzision vorhersagen.
Atlanta war eine merkwürdige Stadt, doch diese Merkwürdigkeit lernte Rake erst jetzt nach dem Krieg zu schätzen, denn er war vorher auch nie woanders gewesen. Dennoch kannte er nur Teile der Stadt. Die Hochhäuser Downtowns, die breiten, von Straßenbahnen, Pferdekarren und Taxis verstopften Alleen, kleine, dreieckige Parks an konfusen Kreuzungen, plötzliche Sackgassen, die jeden Neuankömmling aus dem Konzept brachten. Die großen Hotels und Bürogebäude, die stilvollen Theater und die dunklen Lücken dazwischen, enge Gassen, die sich nachts zu gefährlichen Orten wandeln konnten. Während seiner Zeit in Europa hatte er London und Paris kennengelernt und begriffen, wie klein Atlanta dagegen war, doch seine Stadt gab das nicht gerne zu, und tatsächlich schien jedes Jahr ein neues zehn- bis fünfzehnstöckiges Gebäude in der Skyline aufzutauchen. In jede Richtung wichen die Hochhäuser früher oder später Fabriken, Werken oder Eisenbahnlinien, meist umgeben von schäbigen Arbeitersiedlungen. Hinter dieser Grenzlinie aus Barracken drängten sich Shotgun Houses, Bungalows, Häuser im Queen-Anne- oder Tudor-Stil, je nachdem wie wohlhabend das Viertel war. Außerhalb des Stadtzentrums gab es überall Bäume, ein Dach aus Eichenkronen schirmte diesen Teil der Stadt die überwiegende Zeit von der Sonne ab, im Sommer dankte man Gott dafür. Dahinter kam schon die Provinz: Farmland, das ein oder andere Dorf mit einer einzigen Straße, von Eseln gezogene Pflüge, Baumwollplantagen, ein Anblick, der sich über Jahrzehnte nicht verändert hatte. Selbst innerhalb der Stadtgrenzen war Rake auf ländliche Gegenden gestoßen, von denen er gar nicht glauben konnte, dass sie nur ein paar Meilen vom Kapitol entfernt lagen. Baufällige alte Farmen und Ställe samt Vieh, das neugierig seinem Streifenwagen hinterherglotzte.
Die Gegenden östlich und westlich von Downtown waren Rake besonders fremd: die sich wie ein Korridor gen Osten ziehende Auburn Avenue und die West Side, auf der anderen Seite von Downtown, beides Negro-Viertel.
Die Straße, die Dunlow jetzt ansteuerte, lag nur ein paar Blocks südlich der Auburn und wurde von schmalen, zweistöckigen, holzverschalten Reihenhäusern flankiert. Kräuselmyrten welkten in der Hitze, ihre lavendelfarbenen Blüten hingen herunter wie überreife Früchte. Die Wolken verdunkelten den Himmel schon am Morgen und kündigten Regen an.
»Seine Schwester wohnt hier mit ihrem Mann im ersten Stock«, sagte Dunlow.
»Lass mich raten, sie heißt Jamie Jamie Jameson.«
»Sie heißt Belle. Ist erst vor ein paar Wochen hergezogen. Der Ehemann ist mehr oder weniger sauber, zumindest laut Akte. Aber bei so einem Mädel …«
»Was sagt ihre Akte?«
»Hat keine. Aber du kennst doch die Verwandtschaft. Ich klopf mal höflich an die Tür und du schleichst dich hinten rein.«
Die Hintertür. Na großartig. Natürlich war das Überraschungsmoment auf seiner Seite, das konnte ein Vorteil sein, aber Rake hatte oft genug die gegenteilige Erfahrung gemacht. Hintereingänge führten in die Küche, und in der Küche gab es Messer. Erst vor zwei Monaten hatte ein betrunkener Mann, etwa dreißig Kilo schwerer als er, Rake bei einem ähnlichen Hintertür-Manöver in den Arm geschnitten und war erst nach drei Schlägen mit dem Schlagstock zu Boden gegangen.
Niemand war auf dem Bürgersteig, als Rake den engen Weg am Haus entlang unter Wäscheleinen hindurch ging. Keine bellenden Hunde, noch nicht. Hinter dem Haus begrenzte ein alter Holzzaun den Garten, keineswegs in dem Zustand, das Gewicht eines Erwachsenen auszuhalten. Im nicht umzäunten Nachbargarten lagen Kisten und Kartons, also schleppte Rake eine Holzkiste, die nach faulen Pfirsichen roch, zum Zaun. Er stellte sich darauf und in der Sekunde, bevor das nasse Holz unter ihm nachgab, schwang er sich über den Zaun. Er kastrierte sich dabei fast selbst, vermied nur um Haaresbreite eine ernsthafte Verletzung. Die Landung auf dem Hintern wusste er nicht zu vermeiden, zum Glück war kein Publikum anwesend.
Dieser Teil blieb unerwähnt, wenn jemand von der Arbeit eines Polizisten schwärmte. Doch soweit Rake es beurteilen konnte, bestand der Job zu neun Teilen daraus und zu einem Teil aus dem anderen Zeug.
Jetzt war das andere Zeug dran.
Er schlich die Stufen zur Terrasse so leise hoch, wie er nur konnte, was nicht besonders leise war, denn die ächzenden Planken ließen nicht gerne auf sich herumtrampeln. Er hatte so lange gebraucht, dass er Dunlow bereits im Haus wähnte, vermutlich verprügelte er längst grundlos den Schwager von Triple James.
Eine dünne Gardine vor dem Fenster der Hintertür verhinderte, dass Rake mehr erkennen konnte als die Umrisse einer dunkelhäutigen Person in der Küche. Rake klopfte so heftig an der Tür, dass Gegenstände in der Küche wackelten. Die Gestalt drehte sich um.
*
Auf der Vorderseite schlug Dunlow auf die Tür ein, als schuldete sie ihm Geld.
»Polizei, aufmachen!«
Die Tür leistete Widerstand. Er schlug erneut dagegen und sah den Spalt mit jedem Schlag größer werden. Nigger konnten sich einfach keine guten Türen leisten. Sogar diejenigen, die es in die besseren Viertel schafften, hatten dürftige Türen, war ihm aufgefallen. Diejenigen, die sich wie Weiße benahmen, damit man dachte, sie seien was Besseres. Man musste nur an die Tür hämmern, und schnell kam die Wahrheit zum Vorschein.
»Ich komm ja schon, ich komm ja schon«, sagte drinnen ein Mann. Freddie, fiel es Dunlow wieder ein. Er hatte sich vielleicht ein-, zweimal mit ihm unterhalten, nichts Wichtiges, doch den Namen hatte er sich gemerkt. Einen Nigger, der die Schwester eines Mörders heiratet, sollte man im Auge behalten.
Endlich ging die Tür auf, ganz ohne diese lästigen Ketten. Dunlow trat ein wie der Feldherr, als der er sich fühlte.
Freddie war hager und klein. Den haut doch schon ein scharfer Ton um, dachte Dunlow. Wie sich so kleine Leute fortpflanzen und ihre Gene verteilen konnten, war ihm ein Rätsel. So wie dieses ganze Völkchen.
»Freddie, richtig? Freddie, der Mann, der das Herz von Triple James’ Schwester erobert hat.«
Freddie blickte zu Boden. »Was kann ich für Sie tun, Officer?«
Weil der kleine Mann seine Aufmerksamkeit eigentlich nicht verdiente, sah sich Dunlow im Zimmer um. Blitzsauber. Verdächtig sauber. An den Wänden hingen lediglich zwei Fotografien, auf der einen ein strahlendes Negro-Brautpaar und dazu die in Schale geworfene Verwandtschaft. Sah neu aus. Auf dem anderen Bild Freddie in Armee-Hosen. Herrgott, wie Dunlow es hasste, wenn sie Uniformen trugen. Vielleicht fand er ja noch einen Vorwand, das Bild von der Wand zu reißen, bevor er hier fertig war.
Eine Pflanze am Fenster neigte sich in Richtung des dünnen Sonnenstrahls, der sich durch die dicht gedrängten Häuser quetschte. Kein Spielzeug oder schreiende Babys, das stand ihnen also noch bevor. Gläser auf einem ausrangierten Couchtisch in einem engen Zimmer, darin dümpelte etwas vor sich hin, was aussah wie Coca-Cola. Ein elektrischer Ventilator, der ziellos herumstand.
»Du kannst mir ruhig sagen, wo er steckt.«
»Wen meinen Sie, Officer?«
Dunlow holte langsam Luft, was ihn – wie er gehört hatte – größer wirken ließ, vor allem gegenüber kleineren Menschen.
»Du weißt, wen ich suche.«
Freddie ließ seinen Blick hektisch durch den Raum schweifen, doch jedes Mal, wenn er zu Dunlow zurückkehrte, sah er nicht mehr als seine Brust. Hin und wieder schien er auch die Pistole in Dunlows Halfter zu fixieren. Vielleicht hatte Freddie noch nie eine aus der Nähe gesehen. Das bezweifelte Dunlow allerdings.
»Entschuldigen Sie, Officer, ich bin ein wenig verwirrt.«
Dunlow legte seine riesige linke Hand auf die rechte Schulter des Negro. Er spürte, wie Freddies Kapuzenmuskel zuckte.
»Mach seine Probleme nicht zu deinen, Junge.«
Freddie blieb eine Antwort schuldig.
»Was hast du gemacht, bevor ich kam, sag schon? Musst du nicht bei der Arbeit sein?«
»Ich, äh, hab mir freigenommen. Bin nicht ganz gesund.«
»Tatsächlich? Ein Jammer. Hust mir keine Nigger-Keime ins Gesicht, ja?« Dunlow lächelte, doch Freddie schien seinen Sinn für Humor nicht zu teilen.
Rake sollte eigentlich längst die Hintertür eingetreten haben, dachte Dunlow. Er hörte ein Geräusch aus der Küche, ein Klopfen.
»Wer ist das?«
»Meine Frau, Belle. Sie macht mir Mittagessen, Sir.«
»Ist die auch krankgeschrieben, oder was?« Dunlow hatte immer noch die Hand auf Freddies Schulter.
»Ja, Sir, sie kümmert sich um mich.«
»Also mir kommst du nicht krank vor.«
Schweigen. Freddie trug nur ein ärmelloses Unterhemd zu seinen Hosen. Dunlow war in Uniform, und doch schwitzte nur der Negro.
»Na ja, ich habe fast den ganzen Vormittag geschlafen.«
Hinter Freddie war ein enger Flur, dahinter führte eine Tür ins Schlafzimmer. Die Küche lag außer Sichtweite.
Dunlow wurde lauter. »Hör doch mal mit dem Geklopfe da drinnen auf, Belle, und komm ganz langsam und sachte da raus, damit wir uns alle miteinander unterhalten können.«
Das Klopfen hörte auf. Freddie wirkte nervös. Dunlow hatte eigentlich kaum damit gerechnet, dass er Triple James hier antreffen würde, doch die Wahrscheinlichkeit stieg mit jeder Sekunde.
»Du warst also den ganzen Tag zu Hause?«
»Ja, Sir.«
Endlich hörte Dunlow, wie Rake gegen die Hintertür hämmerte.
»Also nur ihr beiden Frischverheirateten, und beide freigenommen heute?«
»Ja, Sir.«
»Dann sag mir, warum da drei Gläser stehen.«
Die Schranktür neben ihm flog auf und traf seinen Ellenbogen. Ein panischer Negro sprang wie ein geölter Blitz heraus, und Dunlow erhaschte nur einen kurzen Blick auf Triple James’ Gesicht, bevor der Sträfling seine knasterprobte Faust geradewegs auf Dunlows Nase setzte.
Dunlow taumelte nach hinten. Mit der Rechten griff er nach seiner Waffe, zog den Hahn mit dem Daumen zurück, doch etwas in seinem Unterarm verkrampfte und hinderte ihn daran, die Pistole aus dem Halfter zu ziehen. Das Taubheitsgefühl stammte von dem Schlag – Jesus, konnte der Nigger zuschlagen – und breitete sich über seinen Nacken bis in seine Hände aus. Dann erwischte ihn Triple James ein zweites Mal.
Dunlow bekam die rechte Hand nicht rechtzeitig hoch, um den Schlag abzuwehren, sonst hätte er seine Waffe Freddie überlassen müssen, der daran zog. Er wich noch weiter zurück und wäre womöglich gestürzt, wäre da nicht – wie vom Himmel geschickt – die Wand gewesen. Mit der Linken schlug er um sich, traf zwar nichts, doch wenigstens brachte er Triple James dazu, dem Schlag auszuweichen.
Das schenkte ihm eine Sekunde, er beugte seine rechte Schulter und rammte den kleinen Freddie vor ihm aus dem Weg. Jetzt standen sich Dunlow und Triple James gegenüber, der entflohene Sträfling hatte die Fäuste oben wie ein gottverdammter Boxer. Leider war Freddie nicht ganz so abgemeldet, wie Dunlow gedacht hatte. Der schwarze Pinsel war zwar zu Boden gegangen, doch er war noch nicht ganz platt. Freddie schnappte nach Dunlows gehalfterter Waffe über ihm und schaffte es irgendwie, den Abzug zu betätigen.
*
Rake wartete darauf, dass die Gestalt die Tür öffnete, als er den Schuss hörte.
Jesus Christus