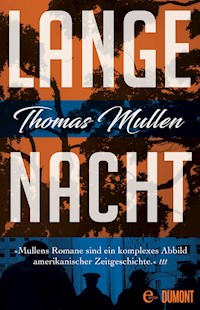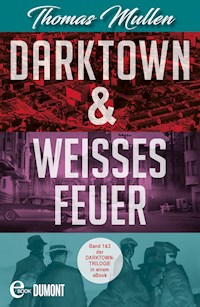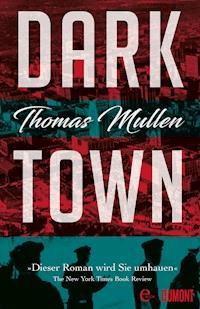9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Darktown
- Sprache: Deutsch
Atlanta 1950: Auch nach zwei Jahren Dienstzeit wird die Arbeit der ersten schwarzen Polizisten Atlantas täglich von Rassismus bestimmt. Die Cops Lucius Boggs und Tommy Smith haben kaum Befugnisse, und um Ermittlungen durchzuführen, sind sie auf die Hilfe weißer Polizisten angewiesen, die ihre Arbeit aber zumeist durch Schikanen und Willkür behindern. Als schwarze Familien – darunter die von Smiths Schwester – in ein ehemals rein weißes Viertel ziehen, beginnen die Rassenkonflikte in der sich rasant verändernden Stadt zu brodeln. Ein unkontrolliertes Ausbrechen der Gewalt scheint jederzeit möglich. Ausgerechnet in dieser aufgeheizten Atmosphäre werden Boggs und Smith durch eine Festnahme auf die Revierkämpfe zweier Schmugglerbanden aufmerksam. Ihre Ermittlungen führen sie nicht nur zu weißen Drahtziehern, sondern auch ins eigene Umfeld. Bald sind beide persönlich so tief in den Fall verstrickt, dass nicht weniger als ihre moralische Integrität auf dem Spiel steht. Ein hochspannender, vielschichtiger Kriminalroman und zugleich ein atmosphärisch dichtes Gesellschaftsporträt eines gespaltenen Landes, das den Rassismus nie überwunden hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Arbeit der schwarzen Cops Lucius Boggs und Tommy Smith wird täglich von Rassismus bestimmt. Sie haben kaum Befugnisse, und um Ermittlungen durchzuführen, sind sie auf die Hilfe weißer Polizisten angewiesen, die ihre Arbeit aber zumeist durch Schikanen und Willkür behindern. Als schwarze Familien – darunter die von Smiths Schwester – in ein ehemals rein weißes Viertel ziehen, beginnen die Rassenkonflikte in der sich rasant verändernden Stadt zu brodeln. Ein unkontrolliertes Ausbrechen der Gewalt scheint jederzeit möglich. Ausgerechnet in dieser aufgeheizten Atmosphäre werden Boggs und Smith durch eine Festnahme auf die Revierkämpfe zweier Schmugglerbanden aufmerksam. Ihre Nachforschungen führen sie nicht nur zu weißen Hintermännern, sondern auch zu ihren eigenen Familien. Bald sind beide persönlich so tief in den Fall verstrickt, dass nicht weniger als ihre moralische Integrität auf dem Spiel steht.
»Moralisch komplex und mit fein gezeichneten Charakteren vertieft diese hervorragende Fortsetzung von ›Darktown‹ Mullens Porträt von Amerika vor der Bürgerrechtsbewegung.«
Library Journal
© Jeff Roffman
Thomas Mullen
wurde 1974 in Rhode Island geboren. Er ist der Autor mehrerer Romane, darunter ›The Last Town on Earth‹ (2006), für den er den James Fenimore Cooper Prize erhielt. Der erste Band der gefeierten ›Darktown‹-Reihe erschien 2018 bei DuMont, mit ›Weißes Feuer‹ legt Thomas Mullen nun den Nachfolger vor. Er lebt mit seiner Familie in Atlanta.
Berni Mayer,
geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, hat Germanistik und Anglistik studiert. Er ist Autor und Journalist und arbeitet für diverse Podcasts. Bei DuMont sind seine Romane ›Rosalie‹ (2016) und ›Ein gemachter Mann‹ (2019) erschienen. Berni Mayer lebt mit seiner Familie in Berlin.
Thomas Mullen
WEISSES FEUER
Roman
Aus dem Englischen von Berni Mayer
Von Thomas Mullen ist bei DuMont außerdem erschienen:
Darktown
eBook
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel ›Lightning Men‹ bei 37Ink/Atria Books, New York.
© 2017 by Thomas Mullen
Published by Arrangement with Thomas Mullen
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
© 2019 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Berni Mayer
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-8321-8476-6
www.dumont-buchverlag.de
Es ist, als ob man Geschichte mit Blitzen schreibt.
– Ein beeindruckter Präsident Woodrow Wilson nach der Vorführung des Ku-Klux-Klan-Propagandafilms The Birth Of A Nation
Jeder neutrale Beobachter der ethnischen Geschichte Amerikas muss sich eingestehen, dass Rassismus höchst wandlungsfähig ist.
– Michelle Alexander, The New Jim Crow
PROLOG
DER TUNNEL IST lang und dunkel, und obwohl seine Beine sich bewegen, hat er das Gefühl, von einer unsichtbaren Kraft gezogen zu werden, dann weicht der Tunnel, und er steht allein unter dem riesigen Himmel Georgias. Zu seiner Rechten, vor einem lavendelfarbenen Glühen, wabern indigoblaue Wolkenfetzen, die sich mit dem Sonnenaufgang sicher auflösen werden. Zu seiner Linken Dunkelheit. Hier fühlt er sich bereit zum Aufbruch, auf der Schwelle zwischen Nacht und Tag, auf dem Scheitelpunkt von Sommer und Herbst, denn der Morgen ist so viel kühler als erwartet. Das Hemd, das er trägt, reicht nicht ganz aus, doch zumindest ist es seins, er besitzt es schon seit langer Zeit. Es ist zu dünn, denn es war Sommer, als man ihn damals verhaftete und seine Kleider gegen eine Gefängnisuniform ausgetauscht hatte. So lange her mittlerweile. Er steht da und zittert, begreift, wie riesig der Himmel und wie klein er selbst und wie unglaublich es ist, dass er hier allein steht, und es bilden sich Tränen in seinen Augen.
Er geht langsam, denn seine ersten Schritte als freier Mann sollen kein Hinken sein, obwohl sein rechtes Knie schmerzt, zwei Jahre schon, seit seinem Sturz bei der Brücke. Er weiß, dass seine rechte Schulter ein paar Zentimeter höher steht als die linke, eine Folge der Arbeit in Ketten, das endlose Schwingen der Axt hat seinen Körper verformt.
Er hatte vergessen, wie es sich anfühlt, sich draußen in der Welt zu bewegen, ohne das Gerassel an Hand- und Fußgelenken. Als hätte man ein Geräusch seines Körpers entfernt, als hätte ihm ein Prophet einen Dämon ausgetrieben.
Sein altes Hemd ist zu weit an der dünnen Taille, doch eng an den Armen. Er hat Felsen zertrümmert und Asphalt gegossen, Straßen gebaut, Gräben ausgehoben und Abwasserrohre verlegt. Er hat sogar Stallungen für Geflügel gebaut, sich der Ironie durchaus bewusst, dass er als Gefangener ein Gefängnis für niedere Kreaturen errichtete. Einmal hat er eine über einen Meter lange Strahlennatter getötet, die sich unter dem Laub schlängelte. Muss vorletzten Herbst oder den davor gewesen sein – er hat das Zeitgefühl verloren – als er dem Biest mit der Schaufel eins auf den nicht enden wollenden Hals gegeben hat. Danach hatte er über seine eigenen Reflexe gestaunt und sich gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, die Schlange hätte ihn gebissen, ihm das Gift eingeflößt und ihn innerhalb weniger Stunden aus diesem ganzen Elend erlöst. Es gab Tage und Nächte, in denen er sich wünschte, es wäre so passiert. Doch jetzt ist er anderer Meinung, denn jene Tage und Nächte haben sich verflüchtigt, und er hat überlebt, um Zeuge dieses atemberaubenden Sonnenaufgangs zu werden.
Die Hose ist mit ziemlicher Sicherheit nicht seine. An der Hüfte sitzt sie einigermaßen, doch sie ist fast zehn Zentimeter zu kurz. Sie muss einem anderen Negro-Gefangenen gehört haben, womöglich jemand, der noch die nächsten Jahre einsitzt. Deshalb spürt Jeremiah beim Gehen jetzt die kalte Herbstluft an seinen Fußgelenken.
Er vernimmt die Rufe von Vögeln und das, obwohl der nächste Baum Hunderte Meter entfernt steht. Noch sieht er keine Vögel am Himmel, obwohl es schon heller geworden ist, ein dunkles Blau liegt jetzt im Osten, und das lavendelfarbene Glühen hat sich in den wolkenlosen Westen verzogen. Die Sonne lugt über das flache Land und verleiht Jeremiah einen Schatten, einen recht langen, und mit jedem seiner Schritte wird der gigantische Schatten nur noch länger.
Es gab eine Zeit, als er dachte, er wäre fertig mit Gott. Er gewöhnte sich ab, Gott um seine Freilassung zu bitten, nach konkreten Dingen zu fragen, spezielle Wünsche zu äußern wie den Besuch seiner Liebsten oder wenigstens einen Brief, sondern bat um das nicht Greifbare. Ruhe. Geduld. Die Fähigkeit, den Tag zu überstehen. Mit langsamen Schritten dankt er jetzt dem Gott, von dem er sich eine kurze Zeit lang abgewandt hatte. Dem Gott, der ihn nicht aufgegeben hat. Dem Gott, der Jeremiah so viel Ungerechtigkeit beschert hatte, das in keinem Verhältnis zu seinen Verfehlungen stand, viel mehr als nur eine barsche und willkürliche Lektion, und ihm wie die reinste Boshaftigkeit vorkam. Ist Gott böse?, hatte sich Jeremiah in jenen ersten Wochen im Gefängnis gefragt. Doch seine Zweifel sind verschwunden. Er kann nicht anders als »Danke, Jesus« sagen, laut genug, sodass es jemand gehört hätte, wäre er hier nicht so allein.
Er geht jetzt schneller, der Schock über die riesige Außenwelt klingt nur langsam ab, das verstörende Gefühl des Alleinseins, keine Menschen, die links und rechts an ihm befestigt sind. Und obwohl er nicht weiß, worauf er zugeht, spürt er, dass er dahin muss, schneller, während sein Schatten mit ihm Schritt hält.
Er hat noch nicht mal ein Viertel der breiten Schotterpiste zurückgelegt, die Sohlen seiner alten Schuhe haben kaum sichtbare Spuren im noch nachtfeuchten Boden hinterlassen, als er sich umdreht und einen letzten Blick auf das Gefängnis wirft. Der Kalkstein schimmert weiß im spitzwinkligen Licht der Morgensonne, die amerikanische Flagge und die von Georgia hängen leblos an ihren Masten. Das Gefängnis wirkt stumm aus dieser Entfernung, man hört keine Türöffner, keine Sirenen oder Schreie, nimmt keinerlei Bewegung wahr. Er ist tatsächlich das einzige Lebewesen hier, bis ein plötzliches Zucken seine Aufmerksamkeit auf eine bisher regungslose Silhouette über ihm lenkt. Einer der Wärter mit den Gewehren blickt auf ihn herab.
»Nigger, du beeilst dich mal besser!«
Jeremiah kann nicht anders, als schneller zu gehen, obwohl er sich dafür schämt, obwohl ihm klar ist, dass er frei ist und der Wärter nicht mehr über ihn verfügen kann. Er fühlt sich wie ein Geflüchteter, der nicht weiß, wohin ihn seine Flucht führt.
*
Das Georgia State Prison befindet sich in einem Außenbezirk von Reidsville oder im Zentrum, Jeremiah ist sich nicht sicher. Vielleicht liegt das Problem auch darin, dass ein Ort wie Reidsville kein Zentrum hat, nur aus Außenbezirken besteht, und weil Jeremiah vorher ohnehin noch nie aus Atlanta rausgekommen war, hat er keine Ahnung, wo er ist.
Der Wärter, der ihm seine alte Kleidung und ein paar notariell beglaubigte Schreiben zusammen mit 75Cents ausgehändigt hatte, hatte ihm den Weg zum Bahnhof beschrieben, doch Jeremiah hat ihn schon wieder vergessen. Es war zu schwer, sich Details wie »nächste rechts«, »dann geradeaus« oder »links halten« zu merken, so unfassbar scheint ihm immer noch seine Freilassung. Er hatte dem Wärter gesagt, dass er zum Bahnhof will, weil seine Familie ihn da abholt, aber das war gelogen, denn seine Mutter und seine Schwester sind 1946 aus Georgia geflohen, und hier wartet niemand mehr auf ihn.
Nein, das stimmt nicht ganz. Es gibt noch sein Mädchen, und obwohl sie schon vor Jahren aufgehört hat, ihm Briefe zu schreiben, gehören die Erinnerungen an ihre Berührungen und ihr Lachen zu den wenigen Dingen, die ihn durchhalten lassen haben. Er hat so oft von ihr geträumt, dass er sich fragt, ob seine Fantasie und seine Sehnsucht sie in seiner Vorstellung verändert haben, ob sie überhaupt so aussieht und klingt. Und doch treibt ihn der Gedanke an sie voran.
Seine Uhr hatte ihm der Wärter natürlich nicht zurückgegeben, also weiß er auch nicht, wie lange er schon marschiert. Lange genug, um sich zu wünschen, man hätte ihm eine Feldflasche mitgegeben.
Zwei Reihen mächtiger Eichen werfen ihren Schatten über die frisch geteerte Straße. Zu beiden Seiten Farmland, Erdnussfelder, Mais und sogar ein bisschen Baumwolle. Er kommt an klapprigen Bretterbuden vorbei, an schiefen Dächern und fehlenden Fensterscheiben, es riecht nach Heckenkirsche und wildem Hanf, er wischt sich mit dem Hemdsärmel den Staub von der Nase, denn selbst ein Taschentuch hat er nicht, nur die 75Cents in seiner Hose. Er weiß nicht mehr, ob er die 75Cents bei seiner Verhaftung dabeihatte oder ob sie eine Art staatliches Taschengeld sind.
Es ist Oktober, und die roten Wespen schweben über den Blumen und fliegen über die Straße. Ihm fällt ein, dass die Wespen jedes Jahr um diese Zeit nerven, aber jetzt machen sie ihm nichts aus, sie sind ein weiterer Aspekt eines Lebens, das er fast vergessen hat.
Dann hört er in der Ferne den unverwechselbaren Klang einer Sirene.
Er wird schneller, sein Herzschlag durchdringt jede Faser seines Körpers. Seine Hände zittern, er stolpert beinahe, er kratzt sich an den Wangen, an der Brust und am Hals, als wären da unsichtbare Insekten. Die Sirenen werden lauter. Warum hat er Angst? Die Sirenen können doch nicht ihm gelten. Es klingt, als wären mindestens drei Wagen unterwegs. Das ist eine Gefängnis-Eskorte, sagt er sich, aber die Panik lässt nicht nach.
Die Sirenen verklingen, bis er sich nicht mehr sicher ist, ob er sie noch hört oder sie sich nur eingebildet hat. Vermutlich wird er sie auch im Schlaf noch hören, immer wieder, ein Leben lang.
Er weiß, dass das Gefängnis auf der Negro-Seite der Stadt steht, und als er ein kleines Schindelhaus in der Ferne sieht und den Geruch von Biscuits wahrnimmt, dankt er Jesus erneut, im Vertrauen darauf, dass es sich um ein Lokal handelt, das er betreten darf.
Zwei Autos parken davor. Ein Schild über dem Eingang teilt ihm zwar nicht den Namen des Lokals mit, dafür aber, dass Gott darüber wache, was als Segen gemeint sein kann oder als Warnung für mögliche Einbrecher. Drinnen entpuppt es sich als Mischung aus Café und Lebensmittelladen. Vier Gänge auf der rechten Seite sind voll mit Waren, und links stehen drei kleine Tische und ein Tresen. Eine dünne alte Negro-Frau, mindestens siebzig, und die erste Frau, die er seit Monaten zu Gesicht bekommt, beäugt ihn misstrauisch durch dicke Brillengläser. Das Haar hat sie zu einem strengen Knoten gebunden, neben ihrer glänzenden Kasse aus Metall stapelweise Zigarettenstangen.
Er lächelt, und das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit spricht er zu einer freien, fremden Person; unsicher, ob sein »Guten Morgen« irgendwie altbacken klingt oder sein Lächeln, sein Auftreten, sonderbar wirken. Wie begrüßen sich Fremde im Jahr 1950?, fragt er sich.
Fünf Minuten später hat er auch das letzte bisschen Gravy mit seinem Biscuit aufgesaugt und eine zweite Portion bestellt. Köstlich ist gar kein Ausdruck. Und der Kaffee, lieber Himmel, der stellt Dinge mit seinem Herz und Kopf an, die er nicht für möglich gehalten hätte. Er ist ein unbeschriebenes Blatt, und jeder Schluck, jeder Bissen ist wie eine neue Sprache, die auf ihn gedruckt wird, ein vollkommen neuer Sinn.
Ich bin unvollkommen, mein Schöpfer. Ich bin Lehm. Ich bin noch formbar. Ich kann noch immer alles sein. Das hat er all die Jahre wiederholt gebetet, so oft, Versprechen und Fürbitte zugleich.
Er steht jetzt auf, bereit zu gehen. Er hat genug von den langen und misstrauischen Blicken der Frau, als warte sie nur darauf, dass er etwas falsch macht. Als würde er nichts lieber tun, als erneut das Gesetz zu brechen. Tatsächlich ist er enttäuscht darüber, dass er sich verrechnet hat und nur noch ein 10-Cent-Stück übrig hat. Er würde gerne Zigaretten kaufen, aber das kann er sich nicht leisten, und wie soll er erst an ein Ticket nach Atlanta kommen?
Die Tür geht auf, und ein Negro kommt herein, weißes pomadisiertes Haar, in Wellen von seiner glänzenden Stirn ausgehend.
»Tag, Marcie, wie geht’s?«
»Mittel bis gut. Wird ein wunderschöner Tag, Reverend.«
Es ist merkwürdig, Fremden zuzuhören. Genau wie die Blicke, die ihm der Reverend zuwirft – oder bildet sich Jeremiah das nur ein? Sein Instinkt sagt ihm, dass er abhauen sollte. Er schreitet zur Tür, in gebührendem Abstand zum Reverend, aus Angst vor unfreiwilligem Kontakt, darauf achtend, bei niemand einen Alarm auszulösen.
Als wären drei Stunden vergangen, so warm ist es draußen. Die Sonne ist erwacht und hat ihre Kräfte vervielfacht. Er hätte fragen sollen, wie weit es noch bis zum Bahnhof ist, aber er hat Angst. Angst wovor? Er weiß es nicht.
Dann öffnet sich die Tür hinter ihm, und er hört die Stimme des Reverends.
»Guten Morgen!«
Jeremiah dreht sich um. Der Reverend kommt auf ihn zu, eine Tüte in der Hand. Er ist groß gewachsen, seiner Figur nach zu urteilen verbringt er seine Zeit nicht ausschließlich mit der Lektüre der Bibel. Zur Linken des Priesters steht ein blauer Ford Pick-up, vermutlich seiner, da er vorher noch nicht da war.
»Guten Morgen, Reverend«, antwortet Jeremiah.
Der Reverend mustert seine zu kurzen Hosenbeine, seine Haare, denen ein Schnitt guttun würde. Jeremiah trägt auch einen Bart, nicht weil er es will, sondern weil er heute eigentlich seinen wöchentlichen Termin beim Gefängnis-Frisör gehabt hätte.
»Ein guter Tag, um das Leben zu genießen, oder?«, fragt der Priester.
»So ist es, Reverend.«
Über ihnen in den Bäumen schreien sich Krähen gegenseitig vorwurfsvoll an.
»Wie lange waren Sie drin?«
»Fünf Jahre. Und einen Monat. Und sechs Tage.«
»Ach ja, niemand beherrscht die Kunst des Rechnens wie ein Mann im Gefängnis.« Der Reverend macht eine Pause, vielleicht überlegt er, welches Verbrechen Jeremiah bei so einem Strafmaß begangen haben muss.
»Wo soll’s hingehen?«
»Atlanta. Irgendwie. Schätze mit dem Zug.«
»Der nächste Bahnhof ist in Statesboro.«
Noch eine Stadt, von der er noch nie gehört hat. »Okay.« Er deutet die Straße hinab. »Da lang?«
»Mehr oder weniger. Aber zirka dreißig Meilen von dem Fleckchen Erde entfernt, auf dem Sie gerade stehen. Wie heißen Sie?«
»Jeremiah.«
»Sie kennen die Bibel?«
»Ja, Sir.«
»Jeremiah war ein Prophet. Er hat Gottes Bund mit Israel vorausgesagt. Dass sie das auserwählte Volk sind und gerettet werden.«
»Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides.«
Der Reverend lächelt, macht sich ein neues Bild von ihm. »Sie kennen sie tatsächlich.«
»Ich würde doch keinen Priester anlügen.«
»Es ist eins meiner Lieblingskapitel.« Kurzes Schweigen. »Aber da gab es ein Wenn. So wie es auch heutzutage immer ein Wenn gibt. Das Wenn lautet: Gott wird sie retten, wenn sie ihn und nur ihn anbeten, nicht die falschen Götter. Wir sündigen, doch es gibt immer die Chance auf Vergebung. Wie die bedingungslose Liebe eines Elternteils. Bei Gott allerdings unter einer Bedingung: dass wir ihn anbeten.«
Jeremiah ist erstaunt, dass ihm nach einer aus fünf Jahren, einem Monat und sechs Tagen bestehenden mehr als deutlichen Lektion gleich wieder jemand die nächste erteilt, doch mit der hier kann er was anfangen.
»Ja, Sir.«
»Heute Morgen gab es ein Feuer«, sagt der Reverend. »Ein Haus der Weißen ist niedergebrannt, fragen Sie mich nicht wie. Sie sind ein Glückspilz.«
»Wie das?« Wie ein Glückspilz hat Jeremiah sich schon lange nicht mehr gefühlt.
»Wenn die einen Negro aus dem Gefängnis entlassen, gibt es drei Möglichkeiten, mein Sohn. Eins: Die Familie oder die Freunde des Gefangenen holen ihn ab. Zwei: Wenn die Angehörigen keinen Wagen haben, bringt ihn das Gefängnis mit dem Bus zum Bahnhof, wo seine Leute auf ihn warten. Und drei: Wenn er niemanden hat, der ihn abholt, lassen sie den Gefangenen zu Fuß gehen. Sie geben ihm 75Cents, lieg ich richtig? Und zirka eine oder zwei Stunden später, nachdem er sein Geld für Zigaretten oder etwas Essen ausgegeben hat, verhaftet ihn die örtliche Polizei von Reidsville wegen Landstreicherei.«
»Ich bin rechtmäßig entlassen worden, ich bin nicht ausgebrochen.«
»Das spielt keine Rolle.«
»Ich hab diese Papiere.« Jeremiah greift in seine Tasche, hört erst auf, daran zu ziehen, als er den Priester lachend den Kopf schütteln sieht.
»Das spielt keine Rolle, mein Sohn. So machen die das. Ich hab es schon zu oft mitansehen müssen. Das Haus hat heute Morgen gebrannt, die gesamte Polizei war da, um der freiwilligen Feuerwehr zu helfen. Das bedeutet, wer auch immer Sie festnehmen sollte, hatte Besseres zu tun.«
Der Priester schweigt, lässt das Gesagte sacken.
»Wenn ich Sie wäre, würde ich heute Abend niederknien und Gott dafür danken, dass er dieses Feuer gelegt hat, und ihn bitten, dass er niemand dafür töten musste. Denn falls er das hat, haben Sie auch noch die Opfer auf dem Gewissen, als Dank für Ihre Freiheit am heutigen Tag.«
Jeremiah denkt darüber nach. Genau diese Art von brutaler Willkür würde zu Gott passen, um uns zu verwirren und uns zu prüfen. Er hatte davon gehört, dass die Cops solche Dinge tun, und er hatte Gefangene getroffen, die behauptet hatten, sie wären nach der Entlassung in schockierend kurzer Zeit wieder eingebuchtet worden, aber er hatte nicht in Erwägung gezogen, dass so ein Schicksal auch ihm blühen könnte.
»Ich habe ihn nicht gebeten, jemand meinetwegen zu töten.«
»Ich behaupte ja nicht, dass er’s getan hat, Sohn. Ich sage nur, die Würfel sind heute Morgen seltsam gefallen, und Sie sind nun mal der Nutznießer dieses ungewöhnlichen Wurfs. Und es wird mich einen halben Tank Benzin kosten, die sechzig Meilen hin und zurück zu fahren, und zwei Dollar, um Ihnen ein Ticket nach Atlanta zu kaufen, aber genau das werde ich tun, denn wenn Gott ein Feuer legt, um Sie vor dem Gefängnis zu bewahren, dann soll dieses Opfer nur ein kleiner Beitrag meinerseits sein. Steigen Sie ein.«
»Danke, Sir.«
»Wie ich bereits sagte, danken Sie ihm.«
Eine Sirene unterbricht ihre Unterhaltung. Jeremiah dreht den Kopf, und das Land ist hier so flach, dass er einen Streifenwagen in ihre Richtung rasen sehen kann. Er blickt zu seinem barmherzigen Samariter und merkt, wie die lebenserfahrene Aura des Priesters einem weniger selbstbewussten Ausdruck weicht.
»Ich … ich geh lieber allein.« Jeremiah schickt sich an zu gehen.
»Nein. Sie bleiben hier.« Der Reverend klingt nervös, während er die Straße im Auge behält. In wenigen Sekunden wird das Polizeiauto hier sein.
»Ich will Ihnen keinen Ärger machen.«
»Verhalten Sie sich einfach ruhig.«
Jeremiahs Hände zittern. Warum sollten sie es erneut auf ihn abgesehen haben? Warum sind sie so? Ich verstehe diese Welt nicht. Mit diese Welt meinte er nicht die Welt außerhalb des Gefängnisses, sondern alles. Nach dem, was ihm widerfahren ist, weiß er, dass er die grundsätzliche Fähigkeit verloren hat, Sinn in Ereignissen zu sehen und dem Gesetz von Ursache und Wirkung zu vertrauen. Die Welt funktioniert nach einer eigenen perversen Logik, die er vergeblich versucht zu begreifen.
Das Polizeiauto wird langsamer und biegt in den Parkplatz ein. Der Kies knirscht, während es neben dem Pick-up zum Halten kommt.
Lieber Gott, bitte nicht das, ich hab versucht, dir treu zu dienen, und ich muss mein Mädchen wiederfinden, und wir werden zusammen alt werden und gemeinsam zu dir beten, bitte, bitte, ich will dein Diener sein, ich bitte dich nur um das Eine.
Der Priester wirft Jeremiah einen flüchtigen Blick zu, dreht sich noch nicht einmal um zu ihm und sagt: »Es tut mir leid, Sohn.«
»Tag, Odell«, sagt der Polizist, als er aus dem Wagen steigt und auf den Priester zukommt. Gelblich blasses Gesicht, wie frisch geschlagene Butter, die jedoch schon anfängt zu schmelzen, seiner glänzenden Haut nach zu urteilen. Jeremiah sieht den Schweiß, obwohl der breitkrempige Hut des Beamten das Licht des Vormittags fernhält. Seine hellbraune Uniform ist feucht unter den Achseln, und er klingt müde.
»Guten Morgen, Officer«, sagt der Reverend.
»Wen haben Sie denn da bei sich?«
Jeremiah schaut zur Seite, vermeidet Blickkontakt. »Jeremiah Tanner, Officer, Sir.«
»Gerade frisch draußen, wie? Was haben Sie mit ihm vor, Odell?«
Der Reverend blickt stur geradeaus. »Ich hab nur jemandem eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Wollte keine Probleme verursachen.«
»Zur Hölle noch mal«, sagt der Cop, als atme er lediglich aus, als sei er sich nicht darüber klar, dass das kein Wort ist, das man gegenüber einem Mann Gottes äußert. »Was für ein Morgen.«
»Geht’s den Leuten gut?«, fragt der Reverend.
»Welchen Leuten?«
»Der Brand. Ich kann ihn noch an Ihnen riechen.«
Jeremiah kann das auch. Der Polizist stinkt nach verbranntem Holz, wie ein Kamin im Winter, aber da mischt sich noch etwas anderes mit rein, bitter und scharf.
»Es war fürchterlich. Fürchterlich.«
Bitte, Gott, verschone mich, bitte.
Mehr scheint der Polizist zu dem Thema nicht sagen zu können. Er steht da, eine Hand am Dach des Pick-ups, und zuerst hatte Jeremiah das für eine besitzergreifende Geste gehalten (mir gehört nicht nur der Pick-up, sondern auch ihr beide), doch mit jeder verstreichenden Sekunde wirkt sie anders.
»Geht es Ihnen gut?«, fragt der Reverend.
Bitte, Gott, bitte, lass nicht zu, dass der Mann mich mitnimmt.
Jeremiah hat noch zu viel Angst, um den Mann direkt anzuschauen, aber aus dem Augenwinkel beobachtet er, wie der Polizist mit der Hand, die sich nicht am Truck festhält, seinen Körper hochfährt, als müsse er sich versichern, dass noch alles dran ist. Über seinem Herzen bleibt sie liegen. Dann fällt er um.
»Officer Dave?«, ruft der Reverend erschrocken. Der Polizist landet in einer merkwürdigen, völlig unnatürlichen Position. Er liegt auf der Seite, einen Arm unter sich begrabend, während die Hand des anderen Arms noch immer an seine Brust greift, als suche sie einen Schalter, irgendetwas, um das Herz wieder einzuschalten. Der Reverend rollt den Polizisten sanft auf den Rücken.
Jetzt haben sich mehr Falten auf Officer Daves Stirn gebildet, als Jeremiah je bei einem Weißen gesehen hat. Der Cop scheint den Atem anzuhalten, sein Gesicht ist rot, der gesamte Körper verkrampft.
»Officer Dave, können Sie sprechen?« Der Reverend ist panisch, und erst später wird sich Jeremiah fragen, ob ihm so etwas schon mal passiert ist, denn natürlich besuchen Priester oft die Sterbenden, aber wie oft sehen sie Gott so schnell und unbarmherzig zuschlagen?
Der Polizist hebt seinen Kopf ein wenig, es scheint, als versuche er verzweifelt, anstelle der nutzlosen Zunge mit dem ganzen Körper zu antworten, dann schlägt sein Kopf auf dem Boden auf und er entkrampft sich.
»Oh Gott, oh Gott!« Der Priester ist für einen kurzen Moment so reglos wie der Polizist, dann ergreift er das Handgelenk des weißen Mannes und tastet nach einem Puls. »Halten Sie durch, Officer Dave, halten Sie durch.« Jeremiah kann das Gesicht des Priesters nicht sehen, als der plötzlich klar und dringlich wie bei einer Predigt spricht: »Herr Jesu, bitte verschone diesen Mann. Bitte, Gott, lass ihn seine Familie wiedersehen.«
Jeremiah fragt sich, ob dem Reverend bewusst ist, dass Gott innerhalb von Sekunden höchst widersprüchliche Gebete von diesem Ort aus erhält.
Hast Du das getan, Herr? War ich das?
Der Reverend steht da, blickt zuerst auf das Polizeiauto, dann zu Jeremiah, dann wieder auf den umgefallenen Mann. »Wir müssen … wir müssen ihn in ein Krankenhaus bringen. Helfen Sie mir, ihn da reinzuschaffen!«
Officer Dave in den Pick-up zu heben ist nicht einfach, denn beiden – zumindest Jeremiah – ist unwohl dabei, einen weißen Mann zu berühren, noch dazu einen wehrlosen. Sie heben ihn vorsichtig an beiden Seiten an, fast wie Sargträger, und beim Ziehen und Tragen hinterlassen seine Schuhe lange Spuren im Kies. Mit Mühe setzen sie ihn auf den Beifahrersitz, und nachdem Jeremiah die Tür geschlossen hat, lehnt der Kopf des Polizisten an der Scheibe. Das sieht unbequem aus, und vielleicht ist er bereits tot, doch der Reverend besteht darauf, dass er noch am Leben ist.
Jeremiah hebt den Hut auf, der dem Mann vom Kopf gefallen war, und behält ihn im Schoß, nachdem er hinten auf den Pick-up-Truck gesprungen ist. Die Sonne brennt auf Jeremiahs Haut, während der Reverend aufs Gas drückt und sie davonfahren. Hinter ihnen bleiben das Polizeiauto und der Lebensmittelladen zurück, wie eine winzige bewohnte Insel mitten in Gottes Ozean. Der Fahrtwind ist zu laut, und Jeremiah bleiben nur seine Gedanken, seine auf schockierende Weise in Erfüllung gegangenen Gebete, seine tiefe Verwirrung.
Hast Du ein Feuer für mich gelegt und Unschuldige getötet, Gott? Hast Du auch diesen Mann niedergestreckt? Wofür hast Du mich vorgesehen? Was steht mir bevor?
Er starrt auf den Hut des Polizisten, den er verkehrt herum in den Händen hält, er bemerkt die Schweißflecken und fühlt die Feuchtigkeit, führt ihn an die Nase und atmet ein, riecht das verbrannte Holz und behält den Geruch in der Brust.
*
Sie erreichen eine Kleinstadt, und der Reverend überfährt ein Stoppschild, während er gleichzeitig hupt. Er biegt in ein Rondell vor einem weißen Gebäude ein – klein für Atlanta-Verhältnisse, doch hier ist es, das Bezirkskrankenhaus.
Ein dünner weißer Mann in einem blauen Kittel wedelt mit den Armen, es ist das universelle Zeichen für Hier geht’s nicht weiter, das Jeremiah aus seinen Arbeitseinsätzen an den Bahngleisen nur zu gut kennt, doch der Reverend fährt trotzdem weiter und hält direkt vor dem erzürnten Mann.
»Wir nehmen hier keine Farbigen auf!«
»Ich habe einen weißen Mann, der krank ist. Einen Polizisten!«
Der Arzt oder Pfleger wirft jetzt einen Blick durch das Fenster, und obwohl Officer Dave mit seinem zerzausten, schweißnassen, an der Scheibe klebenden Haar nicht gerade wie im Dienst wirkt, kann man das Hemd seiner Uniform und seine Dienstmarke erkennen, und jetzt begreift auch der weiße Mann den Ernst der Lage. Er schaut wieder den Reverend an, dann prüfend nach hinten zu Jeremiah, als suche er nach Waffen oder Blutspuren.
»Was ist passiert?«
»Wir haben uns unterhalten, und er ist einfach umgekippt. Keine Ahnung, ob’s das Herz ist oder ein Hitzschlag von dem Brand oder sonst was, aber er braucht Hilfe!«
Der Mann befiehlt ihnen, hier zu warten, und das tun sie auch, zumindest, bis er im Gebäude verschwunden ist.
»Komm runter«, sagt der Reverend, während er seine Tür öffnet. Jeremiah klettert aus dem Pick-up, der Reverend greift in seine Tasche und reicht ihm einen Fünfer. »Das sollte locker für ein Ticket nach Atlanta reichen.« Dann noch ein Fünfer. »Und das ist deine Versicherung dagegen, dass die Polizei von Atlanta deine leeren Taschen als Ausrede benutzt, um dich wegen Landstreicherei zu verhaften.«
»Danke, Sir. Ich danke Ihnen vielmals.«
»Sie verschwinden jetzt besser von hier. In ein paar Minuten wird’s hier von Cops nur so wimmeln.«
»Was ist mit Ihnen?«
»Ich komm schon zurecht. Jetzt laufen Sie einfach runter zur nächsten Ecke und nehmen den Bus nach Statesboro. Wenn der Bus noch braucht, verstecken Sie sich lieber. Ich gebe hier mein Bestes für Sie.«
»Danke.«
Der Priester hält Jeremiah kurz an der Schulter fest, als wolle er einen letzten ausgiebigen Blick auf den Mann werfen, für den Gott sich so ins Zeug gelegt hat. Er sagt: »Möge Gott dich segnen und schützen.« Jeremiah nickt, dann geht er.
*
Gott schickt ihm den Bus innerhalb von Sekunden. Er ist fast leer, und Jeremiah sitzt ganz allein in der letzten Reihe, der Wind weht durch ein offenes Fenster warm in sein Gesicht. Etwa eine Stunde ist er unterwegs. Dann sieht er endlich die mit spanischem Moos überwachsenen Lebenseichen in gespenstischer Schönheit an sich vorbeiziehen – fremdartig für jemand aus Atlanta, wie eine andere Welt. Vorbei an der Ampel vor dem kleinen Bahnhof, der von Palmettopalmen flankiert wird. Drei Farbige stehen draußen im sogenannten »Warteraum für Farbige«, im Grunde nur eine überdachte Plattform. Der Warteraum der Weißen befindet sich im Inneren.
Als er in den Zug steigt, in den vorderen Waggon für Schwarze, in dem es nach Ruß riecht, denkt er über die Worte des Reverends nach, über die Warnungen seines Namensvetters, des Propheten Jeremiah. Er wundert sich über die Ereignisse dieses Morgens, fragt sich, ob er stark genug für die Herausforderungen ist, die Gott als Nächstes für ihn bereithält. Warum muss Jeremiah, der Gott ohnehin liebt, auf diese Weise geprüft werden? Und wenn Jeremiah Gott wirklich liebt, warum hält er ihn dann für so grausam, so manipulativ, so verletzend? Ist das wirklich Liebe oder etwas Schlimmeres? Und sollte Jeremiah das Unglück der letzten fünf Jahre gar nicht verdient haben, hat er es dann auch nicht verdient, auf Kosten Officer Daves und der Weißen, die in dem Haus verbrannt sind, gerettet zu werden? Mit welcher Rechenkunst würde der Priester diese Gleichung lösen?
Jeremiah sitzt am Fenster, spürt, wie es die Welt unter ihm wegzieht, erst träge und schwer, dann mit mehr Geschwindigkeit und Kraft, bis er fast schwerelos ist, gen Norden auf die Stadt zurasend, aus der er verstoßen wurde.
1
OFFICER LUCIUS BOGGS sah Männer jetzt mit anderen Augen. Er war immer ganz zufrieden gewesen mit seiner Erscheinung, seinen knappen ein Meter achtzig, schlank und gesund, weder der Schnellste noch der Stärkste, aber irgendwo dazwischen. Er hielt sich für normal, ein zu groß gewachsenes Kind, dem irgendwann bewusst geworden war, dass es ein Mann ist. Doch seit er diesen Beruf ergriffen hatte, hatte sich seine Perspektive verändert. Er erkannte, dass ihn die größeren Männer jetzt mit anderen Augen betrachteten – und das waren nicht wenige. In jenen ersten Wochen betonte seine eng anliegende Uniform nur die Tatsache, dass er nicht gerade ein Muskelpaket war, dass er nicht so furchteinflößend wirkte wie die meisten Männer, denen er auf der Straße begegnete. Deshalb verschärfte er sein Training, verbrachte an den meisten Tagen zwei zusätzliche Stunden im YMCA, am Sandsack und an der Boxbirne, am Sprungseil, an den Gewichten, bevor er nach einer Dusche die Treppe hinunter in den Keller des Y stieg, der den Negro-Polizisten als Wache diente. Als Resultat seiner monatelangen Anstrengungen hatte er gute sechs Kilo Muskelmasse und eine Hemdgröße zugelegt, und doch fühlte er sich immer noch abhängig von dem Schlagstock an seinem Gürtel und der Pistole in seinem Holster. Jedes Mal, wenn er einem anderen Mann begegnete, beäugte er dessen Körpergröße, warf einen Blick auf seinen Brustumfang und die Reichweite seiner Arme und rechnete nach. Das mochte gewinnsüchtig und oberflächlich scheinen, und doch waren es unerlässliche Beobachtungen, die das eigene Leben oder das des Partners retten konnten, wie ihnen Sergeant McInnis eingebläut hatte. Seien Sie sich immer im Klaren darüber, mit wem Sie es zu tun haben und wie Sie aus der Nummer wieder rauskommen, falls es hässlich wird, pflegte er zu sagen. Und hässlich wurde es nicht selten.
Der Mann, der an diesem Abend die Straße überquerte, war Boggs Schnelleinschätzung nach um die ein Meter sechzig und dem Sitz seiner dünnen Jacke nach eher ein Leichtgewicht. Die Jacke war zugeknöpft, es gab etliche potenzielle Verstecke für eine Waffe. Er zündete sich eine Zigarette mit einem silbernen Sturmfeuerzeug an, was bedeutete, dass es sich um einen Kriegsveteranen handeln konnte, vertraut im Umgang mit Schusswaffen. Außerdem benutzte er dazu seinen linken Daumen, was bedeutete, dass er Linkshänder war.
Über solche Dinge dachte Boggs mittlerweile nach, wenn er Fremden begegnete.
Boggs und sein Partner, Tommy Smith, liefen Streife in der Jackson Street, ein paar Blocks südlich der Auburn Avenue. Keine Minute nachdem der Mann die Straße überquert hatte, nur ein Block vor ihnen, rochen sie es: Das war kein Tabak, den der Mann da rauchte.
»Interessant«, sagte Smith. Der Mann bog um die Ecke, und bevor sie auch nur daran denken konnten, ihm zu folgen, sahen sie einen Wagen ohne Licht in die Jackson einbiegen. Er entzog sich ihrer Sicht hinter einem zweistöckigen Gebäude, in dem sich einst eine Kirche der Pfingstbewegung befunden hatte, das aber seit einem Jahr leer stand. Einen Moment lang hörten sie leise Stimmen, doch keine sich öffnende oder schließende Tür. Dann tauchte der Wagen wieder auf, dieses Mal mit eingeschalteten Scheinwerfern, und fuhr in die Richtung zurück, aus der er gekommen war.
»Du sprichst ihn an, ich nehm ihn hoch«, flüsterte Smith.
Sie teilten sich auf, Smith schlich lautlos um das Gebäude herum und verschwand in einer Seitenstraße. Boggs unternahm vorsichtige Schritte, bis er die Gasse hinter der verrammelten Kirche erreicht hatte. Er sah einen Mann an der Mauer lehnen, vor ihm auf dem Boden eine Obstkiste.
»N’Abend«, sagte Boggs und hatte kaum gefragt »Was haben Sie hier zu suchen?«, als der Mann schon die Augen aufriss und in die entgegengesetzte Richtung davonsprintete. Wo Smith wartete.
Smith trat in die Gasse und warf sich auf den Mann, der vom eigenen Schwung sofort mit voller Wucht zu Boden befördert wurde. Innerhalb von Sekunden hatte ihm Smith Handschellen angelegt, ihn aufgerichtet, gegen die Wand gedrückt und vergeblich nach Waffen durchsucht.
»Moment, hey, das ist ein Riesenmissverständnis!«
In der Obstkiste fand Boggs Einweckgläser voller Hochprozentigem und eine King-James-Bibel.
»Offenbar missverstehen Sie das Spirituosengesetz«, sagte Boggs.
Selbst so viele Jahre nach dem Ende der Prohibition blieb Atlanta in Alkoholfragen streng und vergab nur an wenige Gaststätten Lizenzen. Illegalen Schnaps zu verkaufen war längst nicht mehr so rentabel, doch Schwarzbrenner fanden immer noch Abnehmer, von Billard-Saloons und Nachtklubs, denen die Lizenz fehlte, bis hin zu Individuen, die das harte Zeug dem wässrigen Bier vorzogen.
»Ihr könnt mir echt glauben, so was hab ich noch nie gemacht!«, beharrte der Schwarzbrenner.
»Na klar. Und wir haben ein Riesenglück, dass wir dich beim ersten Mal erwischen«, sagte Smith. Er zog dem Mann das prall gefüllte Portemonnaie aus der Hosentasche, drehte ihn um und drückte seine Schultern nach unten. »Hinsetzen.«
In seinem Ausweis stand Woodrow W.Forrester, Negro. Er war klein und etwas gedrungen, und er schien höllische Angst zu haben, jedenfalls reflektierte seine schweißnasse Stirn den Strahl ihrer Taschenlampen. Wie auf so vielen Abschnitten ihrer Streife gab es auch in dieser Gasse keine Straßenbeleuchtung. Boggs und Smith wechselten jede Woche die Batterien ihrer Taschenlampen.
»Nein, wirklich! Ein Kumpel von mir macht das normalerweise, aber der ist krank geworden und sagt, er muss das Zeug pronto unter die Leute bringen, oder er geht pleite. Er macht das nur, weil er für vier Kinder sorgen muss, und ich hab selbst drei.«
»Sehr schade«, sagte Smith. »Deine Kinder müssen dann wohl hungern, wenn du im Gefängnis sitzt, oder?«
Boggs hob eins der Gläser hoch und schüttelte es, bevor er den Deckel abschraubte und daran schnupperte; er brauchte die Nase noch nicht einmal ans Glas zu halten, um den Fusel zu riechen. Er schlug die Bibel auf, die in der Mitte ausgehöhlt war – vom Buch der Richter bis hin zu Johannes. Das Loch war gefüllt mit etwa zwanzig bereits vorgedrehten Joints.
»Jetzt kommt schon, ihr seid doch nicht angeheuert worden, um anderen Farbigen das Leben schwer zu machen. Ich versuch doch auch nur, über die Runden zu kommen.«
»Sie kommen über die Runden, indem Sie unsere Gemeinde mit diesem Zeug da vergiften«, sagte Boggs.
»Nur dieses eine Mal. Es war ein Fehler, ich geb’s ja zu. Ich bekenne mich schuldig, hier und jetzt. Aber bitte, ich kann doch nicht ins Gefängnis, ich hab auch einen echten Job.«
»Nämlich?«, fragte Smith.
»Ich koche in der Kantine der Telefonfabrik.«
»Ts, ts, ts«, machte Smith. »Die werden aber keinen Typen mit Vorstrafe weiterbeschäftigen.«
»Jetzt seid doch nicht so. Ihr könnt das Geld auch behalten. Nehmt den Schnaps mit, oder kippt ihn in den Gully, mir egal. Aber verpasst mir keine Vorstrafe.«
Smith schaltete seine Taschenlampe aus und ging vor Forrester in die Hocke.
»Erstens, versuch nicht, uns zu bestechen.« Er deutete auf sein eigenes Gesicht. »Sieht das weiß aus für dich? Mag ja sein, dass ihr die weißen Cops schmieren könnt, aber mit uns läuft das nicht. Kapiert?«
»Jawohl, Sir.«
Die Tatsache, dass er sogar versucht hatte, sie zu bestechen, sprach für Forresters Ehrlichkeit, dachte Boggs. Hätte er bereits vorher Gras und Schnaps verkauft, würde er die Regeln kennen und Atlantas Negro-Cops kein solches Angebot unterbreiten.
Natürlich war auch eine andere Erklärung denkbar. Vielleicht war der Kerl in Wirklichkeit einer der üblichen Dealer und hatte mitbekommen, dass manche Negro-Polizisten eben doch bestechlich waren. Boggs hatte noch nie einen Cent genommen und Smith auch nicht, da war er sicher. Doch in den über zwei Jahren bei der Polizei hatten sie erfahren müssen, dass die Hälfte der weißen Polizisten Schmiergeld annahm, wie lang also würden die Negro-Beamten noch Nein sagen? Als Sohn eines Predigers war Boggs nur allzu vertraut mit der Fehlbarkeit der Menschen, sogar solcher mit Autorität. Besonders solcher mit Autorität.
»Zweitens«, sagte Smith, immer noch vor Forrester in der Hocke, »bin ich ein fleißiger Angler und lasse mir nicht einfach einen Fang durch die Lappen gehen. Wenn ich überhaupt einen Gedanken an so etwas verschwenden würde, dann nur, wenn ich wüsste, dass ich kurz davor bin, einen noch dickeren Fisch zu fangen. Kannst du folgen?«
Forresters gerunzelte Stirn deutete nicht darauf hin.
»Wir nehmen Sie fest«, übersetzte Boggs, »außer Sie kennen jemand Wichtigeren, den wir uns schnappen können.«
»Jetzt kommt schon, ich hab euch doch gesagt, dass ich neu im Geschäft bin. Ich kenn keine dicken Fische.«
»Dann tut’s mir leid für dich.« Smith packte Forrester am Kragen und zog ihn hoch. »Die kleinen Sardinen wie du werden als Erstes frittiert, wenn sie uns keine Informationen liefern.«
»Was ist mit Ihrem Kumpel? Weiß er was?«, wollte Boggs wissen.
Forrester drehte den Kopf, als halte er nach einem Fluchtweg Ausschau, doch er sagte nichts.
Die nächste Rufsäule, um einen Wagen zu bestellen, war zwei Blocks entfernt. Smith schubste Forrester von hinten, nicht zu heftig, aber es reichte, um einen Verurteilten in Richtung seines traurigen Schicksals zu bewegen. Sie waren nur ein paar Schritte gegangen, als es aus ihm herausplatzte. »Ich weiß, wann die Lieferungen kommen.«
Boggs, der vorausgegangen war, drehte sich um. Er legte Forrester eine Hand auf die Brust, um ihn anzuhalten. »Erst behaupten Sie, Sie hätten das noch nie gemacht, jetzt wissen Sie, wann die Lieferungen kommen?«
»Wie ich schon sagte, ich koch bei Phelbs, der Telefonfabrik. Ich mach auch sauber. Komm vor dem Mittagessen und geh um Mitternacht, dreimal die Woche, und manchmal wird da nicht nur Essen geliefert.«
Boggs schaute über die Schulter des Kochs hinweg in die Augen seines Partners. Smith, der Begabtere der beiden, wenn es darum ging, Lügen aufzudecken – vielleicht weil er selbst mehr Erfahrung im Lügen hatte, dachte Boggs –, wirkte interessiert.
»Ich höre«, sagte Smith.
»Ich halt mich aus so was raus, aber ein paarmal war ich draußen und hab den Müll weggebracht, und plötzlich kommt da ein Laster und zwei Typen springen raus, und dann noch ein paar, und dann packen sie Kisten in andere Autos, und dann fährt der Laster sofort wieder weg. War kaum ’ne Minute da. Und ich denk mir, okay, was die da liefern, wollen die verdammt schnell wieder loswerden. Aber ich stell keine Fragen, bin nicht der Typ, der bei so einem Schwachsinn mit–«
»Wann passiert das?«
»Halb zwölf. Mittwochs.«
Mit anderen Worten: in dreißig Minuten.
*
Eine halbe Stunde vor Mitternacht lehnte Boggs an einer Backsteinmauer der Phelbs-Werke, zwei Blocks südlich der Gleise, im Industriegebiet von Cabbagetown, wo ankommende und wegfahrende LKWs niemand verdächtig vorkamen. Von der Straße aus war er nicht zu sehen, verborgen von einem parkenden Lieferwagen, auf dem das Bild einer lächelnden weißen Frau prangte, die einen Hörer ans Ohr hielt. Aus der Nähe schienen ihre Augen ihn wütend anzufunkeln, trotz des Lächelns auf ihrem Gesicht.
Smith stand einen Block weiter, um die Ecke einer Gasse, und beobachtete die Straße. Schon die ganze Nacht hatten sie das Heulen der Züge gehört. Auf ihrem Weg hierher waren sie durch einen Tunnel unter den Gleisen gelaufen, der Geruch von Kohle hing schwer in der Luft, und sogar um diese Uhrzeit konnten sie den Feuerschein der Schweißgeräte sehen, während Arbeiter die kaputten Gleise und Waggons in den nahen Betriebshöfen reparierten. Sie hatten die verwunschenen Gräber auf dem Oakland Cemetery umlaufen, der unter anderen ganze Legionen von toten konföderierten Soldaten behauste. Und sie waren an der nach Holzspänen riechenden Bleistiftfabrik vorbeigekommen, in der vor Jahrzehnten ein junges Mädchen ermordet worden war, ein aufsehenerregendes Verbrechen, für das später ein jüdischer Mann gelyncht wurde. Im Westen zeichneten sich die dunklen Bürotürme von Downtown ab und Gerüste, die wie riesige Skelette über halb fertige Neubauten ragten.
Einen möglichen Übergabeort für Schnaps und Gras zu überwachen gehörte nicht zu ihren Aufgaben. Gegenüber McInnis würden sie die Wahrheit etwas dehnen müssen, so tun, als seien sie zufällig auf die Lieferung gestoßen. Wären sie nach Handbuch vorgegangen, hätten sie sofort gemeldet, was der Informant ihnen mitgeteilt hatte, und wären dann weiter ihre Streife gelaufen, in der Hoffnung, dass das Departement ein paar Beamte von der Sitte schickte, um die Gegend auszukundschaften. Doch sie wussten, dass das nicht passieren würde. Keiner der weißen Polizisten hätte es für nötig gehalten, eine Übergabe in dem Teil der Stadt zu überwachen, den sie noch immer »Darktown« nannten.
Boggs und Smith war seit einer ganzen Weile klar, dass sie selbst tätig werden mussten, wollten sie den Drogen- und Alkoholfluss in ihre Gemeinde stoppen. Doch blieben ihnen zahlreiche Privilegien verwehrt, die für weiße Cops selbstverständlich waren. Sie durften nach wie vor keine Polizeiautos fahren oder außerhalb der vorgegebenen Negro-Viertel Streife laufen. Trotz dieser geografischen Einschränkung gab es genug zu tun, denn über ein Drittel der Bewohner Atlantas waren schwarz und lebten zusammengepfercht auf einem Fünftel der Gesamtfläche. Und nur zehn Negro-Polizisten beschützten diese Tausende von Seelen.
Sie durften keine Uniform auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Nachhauseweg tragen und mussten sich im Keller des YMCA in der Butler Street umziehen, ihrem vollkommen untauglichen, schimmelnden und rattenverseuchten Hauptquartier. Sie mussten mitanhören, wie die weißen Cops sie »Nigger« nannten. Ihre Jobs schienen alles andere als sicher. Sie lebten in ständiger Angst, dass sich das Blatt wendete, dass einer der anderen Negro-Polizisten einen schlimmen Fehler beging oder ein schlimmer Fehler von den weißen Cops erfunden und ihnen angehängt wurde und Bürgermeister Hartsfield damit endlich die notwendige Munition lieferte, dieses merkwürdige Experiment zu beenden und Boggs und seine Kollegen zurück in ihre alten Jobs zu schicken, als Versicherungsvertreter, Grundschullehrer, Metzger und Hausmeister.
Boggs hörte einen sich nähernden LKW.
Er spähte über den Kotflügel des Lieferwagens der Telefonfabrik, hinter dem er sich verbarg, und sah einen mit grüner Plane abgedeckten Sechsachser in den Hof einbiegen. Er sah aus wie ein altes Armeefahrzeug, das nach dem Krieg in einer Auktion verkauft worden war. Auf der Fahrertür stand Cherokee Fußböden und darunter eine Adresse in Dalton, neunzig Meilen weiter nördlich. Die Tür öffnete sich, und ein untersetzter Negro sprang heraus, eine Schiebermütze aus Tweed ins Gesicht gezogen. Der Motor lief weiter.
»Los, los!«, sagte jemand. Boggs meinte, Schritte von zwei Personen zu hören, dann wurden es mehr, aus unterschiedlichen Richtungen kommend. Ein Motor heulte auf, und noch ein Wagen fuhr auf den Hof. Er schlich weiter zur Vorderseite des Phelp-Trucks. Neben dem Fahrer, den er bereits gesehen hatte, standen zwei schwarze Männer am Heck des Fußböden-LKWs. Das neu hinzugekommene Fahrzeug war ein grüner Dodge Pick-up, der hinter dem Fußböden-Truck im Leerlauf wartete. Zwei weitere Männer, beide weiß, gesellten sich dazu, und alle luden sie jetzt eilig Kisten vom Fußböden-Truck in den Dodge.
Zwei Weiße. Boggs war nicht überrascht. Der meiste Schnaps wurde weit außerhalb der Stadtgrenzen gebrannt, in den Bergen von North Georgia oder hinter den Bundesstaatsgrenzen, in den Carolinas oder Tennessee. Es gab Gerüchte, dass die Schnapsbrenner jetzt auch Marihuana anpflanzten, weil der Schnaps ihnen nicht mehr dasselbe einbrachte wie einst. So ziemlich alle dieser Leute, die da aus ihren Bergtälern in den Smoky Mountains angefahren kamen, waren weiß.
Atlantas schwarzen Polizisten war es nicht erlaubt, Weiße zu verhaften. Sie durften ja kaum mit Weißen interagieren. Doch Boggs und Smith hatten langsam genug von dieser Ohnmacht.
Boggs kroch weiter, fast bis zum Heck des Dodge, und öffnete den Verschluss seines Schlagstocks am Gürtel. Er hörte das Klirren gefüllter Glasbehälter. Hörte erneut jemanden »Los« sagen und den Aufprall von Kisten.
In dem Moment, als ein Mann aus dem Dodge ausstieg, sprang Boggs hinter ihn und verpasste ihm einen Schlag auf den Hinterkopf. Der Mann fiel um, und Boggs stand jetzt dem nächsten Glied der Lieferkette gegenüber, einem weißen Mann mit einer schwarzen Melone und einem zerknitterten grauen Jacket, der die Augen beim Anblick eines Negros in Polizeiuniform weit aufgerissen hatte.
»Polizei! Legen Sie das weg und nehmen Sie die Hände hoch!«
Nach einer Schrecksekunde ließ der Mann die Kisten nach vorne überkippen. Boggs sprang zur Seite, während rings um ihn herum Glas zerbrach und schwere Einweckgläser auf seinen Füßen landeten, überall Scherben und Schnaps.
»Polizei! Alle auf den Boden!«, brüllte Smith, der aus seinem Versteck am anderen Ende des Hofs gesprungen war.
Boggs sah einen mit Lehm verdreckten Stiefel hinten aus dem Fußböden-LKW aussteigen und dann erst den Rest des Mannes, doch sein Blick fixierte eh nur die Schrotflinte, den Rest ignorierte er mehr oder weniger. Er warf sich zur Seite, dorthin, wo er sich kurz zuvor versteckt hatte. Ein ohrenbetäubender Knall. Mörtel und Ziegelstücke flogen ihm um die Ohren und regneten auf den Hof.
Die Schrotflinte explodierte erneut. Dann drei Schüsse aus einem kleineren Kaliber, hoffentlich Smiths Waffe.
Erst zum zweiten Mal in seiner Laufbahn zog Boggs seine Dienstwaffe und entsicherte sie. Wieder auf den Beinen rannte er zur Vorderseite des LKWs, dann um ihn herum, die Waffe schussbereit in beiden Händen, die Beine fest auf dem Boden in dem Versuch, die perfekte Haltung unter diesen alles andere als perfekten Umständen einzunehmen.
Doch da war niemand, auf den er die Waffe hätte richten können. Er sah seinen eigenen Partner, ebenfalls mit erhobener Pistole, auf ihn zusprinten, bevor die Szene vor ihm in zwei Teile zu zerbrechen drohte. Der Dodge und der Fußböden-LKW verließen beide den Innenhof. Ihre Motoren brüllten, die Räder drehten in den Lachen aus Alkohol durch, bevor sie endlich Halt fanden und davonrasten.
Ein weiterer Knall, als jemand die Schrotflinte von der Ladefläche des LKWs abfeuerte. Boggs duckte sich, hörte Glas und Holz splittern. Er rief nach seinem Partner, wollte wissen, ob es ihm gut ging, doch statt einer Antwort hörte er, wie Smith die Straße hinunterrannte. Die beiden Trucks fuhren in unterschiedliche Richtungen. Smith jagte dem Dodge hinterher, also folgte Boggs dem Fußböden-Truck, der bereits gute 30Meter entfernt war und schnell außer Sichtweite geriet. Er versuchte, einen Blick auf das Nummernschild zu erhaschen, doch es war zu dunkel.
Er stellte sich vor, wie er auf den Truck schoss – wie in einem dieser Gangster-Filme: Cagney feuerte und traf einen der Hinterreifen, er zerplatzte, oder das Rad löste sich von der Achse. Dann würde sich der gesamte Truck hart nach links neigen, der Fahrer würde panisch werden, versuchen ihn wieder in die Spur zu bringen, aber das funktioniert bei der Geschwindigkeit nicht, und so würde sich das gesamte Fahrzeug wie in Zeitlupe überschlagen. Dann gäbe es eine Explosion, oder der gesamte Wagen würde mindestens in sich zusammengestaucht. Der Fahrer wäre tot, und Boggs würde seine Marke verlieren, weil er leichtsinnig auf ein flüchtendes Fahrzeug gefeuert hatte und dafür wegen Totschlags belangt würde. Und die Stadt Atlanta hätte einen Negro-Polizisten weniger. Was ein großartiger Anlass wäre, auch die anderen neun rauszuschmeißen.
Er steckte seine unbenutzte Waffe ein, während der LKW außer Sichtweite verschwand.
Er rannte einen Block weiter zur nächsten Notrufsäule. Außer Atem musste er sich gegenüber der Zentrale wiederholen, die Beschreibung der Fahrzeuge und der Richtungen, in die sie gefahren waren. So spät an einem Werktag waren die Straßen frei, es wäre nicht schwer, einen von beiden zu erwischen, aber er wusste, dass es zu nichts führen würde. Er durfte keine heiße Verfolgungsjagd erwarten, keine Straßensperren und ganz sicher keine Festnahmen. Die Schnapsbrenner hätten genauso gut längst wieder in den Bergen sein können.
*
Während Boggs Meldung machte, kehrte Smith von seiner vergeblichen Verfolgungsjagd zurück und begutachtete den Hof. Zerbrochene Flaschen, ein von Kugeln durchlöcherter schwarzer Ford mit zersprungener Windschutzscheibe, Pistolenrauch, der in der trockenen Nachtluft hing. In der Mitte des Hofs lag der weiße Mann, den Boggs bewusstlos geschlagen hatte. Er atmete und sein Puls ging normal, doch Smith konnte sich jetzt schon McInnis’ Reaktion ausmalen. Er legte dem blassen Mann Handschellen an.
Dann sah er den anderen Mann.
Er lag einen Meter vom Lieferwagen der Telefonfabrik entfernt, hinter dem Boggs sich versteckt hatte. Ein Negro, obwohl Smith das nur an den Händen und am Kiefer festmachen konnte, das Gesicht war zum großen Teil weggeschossen, zumindest auf der nach oben gewandten Seite. Er lag seitlich auf dem Rücken, trug Arbeiterschuhe, Jeans und ein hellbraunes Flanellhemd mit dunkelroten Flecken.
»Hast du den erschossen?«, fragte Boggs, der abgehetzt von der Notrufsäule zurückkehrte.
»Nein. Du?«
»Ich hab keinen Schuss abgegeben. Sicher, dass du ihn nicht getroffen hast?«
»Ich stand da drüben.« Smith deutete nach rechts. »Ich hab dreimal geschossen, in die Richtung. Der Bursche hier wurde von da erschossen, wo wir gerade stehen, mit Blick auf die Mauer. Außer …«
Smith drehte sich um und überquerte die Straße, Boggs folgte ihm. Smith lief in den Tunnel, der unter die Bahngleise führte, und knipste seine Taschenlampe an. Er fand eine kleine Lache, die nach frischem Kautabak roch. Dann drehte er sich wieder zur Fabrik um, stellte sich vor, wie er mit einem Gewehr in der Hand die Augen zusammenkniff und zielte.
»Ich dachte auch, ich hätte ein Gewehr gehört«, sagte er. »Die hatten einen Wachposten hier. Als wir auftauchten, hat er angefangen, auf uns zu schießen. Muss den eigenen Mann erwischt haben.« Sein Blick ging zu Boggs. »Noch mal Glück gehabt, im Gegensatz zu dem da drüben.«
*
Ein paar Minuten später war Boggs so im Adrenalinrausch, dass er seine Füße kaum mehr auf dem Boden spürte. Er hatte immer wieder die auf ihn gerichtete Schrotflinte vor Augen. Seit er seinen Eid abgelegt hatte, war er geschlagen, getreten, getroffen, gebissen, geschnitten, angefahren und sogar entführt worden, doch das war das erste Mal, dass jemand eine Waffe auf ihn abgefeuert hatte.
Auf dem Boden saß der Mann, den Boggs niedergeknüppelt hatte – in Handschellen und wieder bei Bewusstsein. Die Tatsache, dass Boggs einen weißen Mann k.o. geschlagen hatte, überstieg im Moment noch seine Vorstellungskraft.
Die Polizisten Dewey Edmunds und Champ Jennings hatten die Schüsse aus sechs Blocks Entfernung gehört und waren die Ersten, die zu ihnen stießen. Sie ließen den Schauplatz auf sich wirken. Glasscherben und Teile der Backsteinmauer lagen über den gesamten Parkplatz verstreut. Der Schnaps hatte sich mit dem Zementstaub zu einem fiesen alkoholischen Schlamm vermischt.
Smith erklärte ihnen, was sie gerade verpasst hatten.
»Gottverdammte Scheiße, Jungs!« Dewey steckte seine Waffe weg und fing an zu lachen. »Sollen wir gleich alle unsere Dienstmarken abgeben oder warten, bis der Sergeant kommt und es offiziell macht?«
»Uns passiert nichts«, beharrte Boggs, dem die Ohren brummten.
Dewey und Champ bildeten ein seltsames, aber sympathisches Duo. Champ war der Größte der Negro-Polizisten und zog den Griff seiner Lieblingsaxt einem Schlagstock vor. Er war in einer kleinen Negro-Gemeinde im südlichen Georgia aufgewachsen und neigte dazu, das Gute im Menschen zu sehen. Dewey war der kleinste Polizist in ganz Atlanta, doch ein unbezwingbarer Ex-Boxer, der im Grunde jede Aussage eines Zivilisten für eine Lüge hielt.
Dewey pfiff und schüttelte den Kopf beim Anblick der Scherben. »Ich werd schon vom Geruch dieser Scheiße da besoffen. Dass mir hier keiner eine Zigarette anzündet, kapiert?«
Champ hatte tatsächlich nach einer gegriffen, doch jetzt ließ er sie heimlich wieder zurück in seine Tasche gleiten, in der Hoffnung, dass es keiner bemerkt hatte.
Dewey schüttelte den Kopf in Richtung der vier zurückgelassenen Kisten, zwei auf dem Boden, zwei offenbar aus einem der flüchtenden Trucks gefallen. »Kein Wunder, dass meine Telefonrechnung so hoch ist«, sagte er. »Ich bezahl die Scheiße hier mit.«
»Glaubst du wirklich, dass die Telefongesellschaft mit Schnaps handelt, oder haben die Dealer nur den Ort hier genutzt?«, fragte Champ. Erst mit zwölf waren er und seine Familie nach Atlanta gezogen, und er hatte einen starken ländlichen Akzent, mit dem er die Zuneigung jener wenigen gewann, die nicht von seiner Körpergröße abgeschreckt wurden.
»Keine Ahnung. Ruf doch bei der Vermittlung an, vielleicht ist die Frau da betrunken.«
»Nee, weiße Telefonistinnen fassen das Zeug nicht an.«
»Junge, was redest du da? Denkst du, weiße Ladies trinken nicht? Und ihre Scheiße stinkt auch nicht?«
Champ verschränkte die Arme. »Was ich meine: Das Zeug hier ist für Negros, und das weißt du.«
»Verdammt richtig«, sagte Smith.
*
»Sie sind dran«, sagte Sergeant McInnis zu Boggs, nachdem er kurz mit Smith am anderen Ende des Hofs gesprochen hatte. Boggs gefiel dieser Ansatz nicht – sie zu trennen, um festzustellen, ob ihre Aussagen sich deckten. So redeten sie normalerweise mit Verdächtigen.
Nachsichtig oder freundlich waren nicht die Worte, die ihm als Erstes in den Sinn kamen, wenn er an ihren weißen Sergeant dachte. Anfangs hatte sich McInnis in ihrer Gegenwart äußerst unwohl gefühlt, und sie hatten sich gefragt, wie lange es wohl dauern würde, bis er kündigte, aus Entrüstung darüber, dass man ihn zum Aufpasser der farbigen Cops ernannt hatte. Und doch hatte McInnis in den letzten zwei Jahren Boggs’ Respekt gewonnen. Er hatte sich bei etlichen Disputen mit weißen Beamten für sie eingesetzt und schien sich mit seiner Rolle und seinem Status als Außenseiter des Departements anzufreunden. Vielleicht hatte er aber auch nur gelernt, sich mit einer aussichtslosen Situation abzufinden, denn mittlerweile war klar, dass ihn seine Oberen nicht versetzen würden. Ob er wollte oder nicht, er blieb der einzige weiße Cop im Revier an der Butler Street.
»Sie haben keine Schüsse abgegeben?«
»Nein, Sir.«
»Geben Sie mir Ihre Waffe.«
Boggs gehorchte. McInnis überprüfte die Kammer, roch an der Trommel, fühlte ihre Kühle. Der Mangel an Vertrauen tat weh. McInnis gab die Waffe zurück.
»Wo haben Sie den Dealer geschnappt?«
»Jackson Street. Hinter der alten Kirche.«
»Also sind Sie auf dem Weg hierher an zwei Rufsäulen vorbeigekommen.« McInnis hatte sehr dunkles Haar und ebenso dunkle, dünne Brauen. Er kniff die Augen zusammen, obwohl kein Licht ihn blendete, als hätte er eine Migräne.
»Tut mir leid, Sir. Wir mussten uns beeilen, um rechtzeitig hier zu sein.«
»Sie hätten sich beinahe zu ihrer eigenen Beerdigung beeilt. Einen Dealer in einer Gasse zu verhaften ist das Eine, aber es ist doch klar, dass Sie in Unterzahl sind, wenn Sie einfach so bei einer Übergabe auftauchen. Wundert mich nicht, dass Smith rumgeballert hat, aber Sie hab ich für schlauer gehalten.«
»Ja–«
»Die Sitte wird in fünf Minuten hier sein, und soweit ich weiß, haben wir ihnen gerade eine verdeckte Ermittlung versaut. Zur Hölle, der Mann, den Sie k.o. geschlagen haben, könnte ein Informant sein. Und der Tote – Smith, Sie können von Glück reden, wenn der Mann mit einem anderen Kaliber als Ihrem erschossen wurde.«
»Sergeant«, sagte Smith, der dazugekommen war, »auf gar keinen Fall habe ich den Mann erschossen.«
»Kann sein, dass ich Ihnen glaube, aber was denken Sie, was die von der Mordkommission dazu sagen?« Er sah sie abwechselnd an. »Nicht nur, dass Smith jemand erschossen hat, sondern dass Boggs dazu einen weißen Mann niedergeschlagen hat.«
McInnis fand etliche weitere Punkte, über die er sich nun ausließ. Darüber, dass Smith einen Bericht über das Abfeuern einer Dienstwaffe ausfüllen musste oder wie man mit der bevorstehenden Ankunft eines Reporters der Atlanta Daily Times umging. Die einzige Negro-Tageszeitung der Stadt war immer scharf auf Stories ihrer farbigen Helden im Einsatz. Zum Abschluss erhob McInnis seine Stimme: »Mal ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir uns in einem gottverdammt weißen Viertel befinden!«
Ja und nein, dachte Boggs. Die Fabrik lag ein paar Blocks außerhalb ihres Reviers, doch die Rassengrenze verlief hier nicht ganz eindeutig. Die Bevölkerungsexplosion nach dem Krieg hatte die Negros in ehemals rein weiße Gegenden drängen lassen. Boggs und seine Kollegen hatten keine neuen Stadtkarten erhalten, in denen die demografischen Veränderungen abgebildet waren, lediglich eine kryptische Anweisung von McInnis »in ihrem Teil der Stadt« zu bleiben.
Boggs warf einen Blick auf den festgenommenen weißen Mann, der den Kopf hängen ließ, als schlafe er. Würden die weißen Cops ihn zur Rede stellen, weil er einen Weißen niedergeschlagen hatte, auch wenn es sich um einen Straftäter handelte? Der Gedanke allein war absurd, aber das bedeutete vermutlich, dass es genauso kommen würde.
»Werden die MrPhelps befragen?«, fragte Smith. Champ und Dewey standen bei den zurückgelassenen Kisten und nahmen den Bestand an Schnaps und getrocknetem Marihuana auf, der noch unter Strohresten begraben lag.
»Wen?«, fragte McInnis.
Boggs deutete auf das drei Meter entfernte Schild. »Phelps Telefone. ›Ihre Verbindung zur Zukunft!‹ Vielleicht weiß der Besitzer was.«
»Nein, ich glaube nicht, dass die Detectives einem der reichsten Männer Atlantas Alkohol- und Drogenschmuggel unterstellen werden. Sie informieren ihn aber bestimmt darüber, dass man seine Mauer durchlöchert und seinen Hof in einen Tatort verwandelt hat.«
»Die Reichen brechen wohl nicht das Gesetz?«, fragte Smith.
McInnis verschränkte die Arme. »Ich sag ja nicht, dass es mich schockieren würde, wenn jemand wie er mit drinsteckt. Aber er wäre ein Idiot, wenn er seine Fabrik als Umschlagort nutzen würde. Und außerdem und viel wichtiger: Das geht uns nichts an.«
Smith hatte das Nummernschild des flüchtenden Dodge erkennen können, doch vermutlich handelte es sich um einen gestohlenen Wagen oder zumindest gestohlene Nummernschilder. Er deutete auf den festgenommenen Mann.
»Können wir ihn jetzt verhören?«
»Nein. Können Sie nicht. Das erledigen die Detectives.«
Smith öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn wieder. Dann öffnete er ihn doch. »Sergeant, nur ein paar Fragen. Bitte. Wo er schon hier ist.«
»Sie wissen genau, dass das nicht Ihre Aufgabe ist, Officer Smith.« McInnis zeigte auf die beiden nahenden Einsatzwägen, Blaulicht, Sirenen, weiße Cops hinterm Steuer. »Es ist ihre.«
2
BEIM ERSTEN ANBLICK hatte Denny Rakestraw den Endbahnhof für eine Burg gehalten.
Seine in Deutschland geborene Mutter hatte ihm gerne die Sagen und Abenteuer von verfeindeten Fürsten und Baronen, von Goten und Römern vorgelesen. Und vielleicht hatte sein Faible für Gewalt mit seinem ersten Holzschwert begonnen, mit dem er aus Versehen den Lieblingsschaukelstuhl seiner Mutter kaputt gemacht hatte, dessen rechte Lehne einem seiner mächtigen Schwerthiebe nichts entgegenzusetzen gehabt hatte. Er war damals vier oder fünf gewesen, und doch hatten seine Eltern den einarmigen Schaukelstuhl noch jahrelang behalten, wie ein Mahnmal für die zerstörerische Ader ihres Sohns.
Er erinnerte sich noch an seinen ersten Ausflug zum Bahnhof, er hatte seine Eltern begleitet, um eine Tante oder einen Onkel oder einen Groß-Irgendwas abzuholen. Er wirkte tatsächlich wie eine Burg mit seinen beiden wie Geschütztürme aussehenden Spitzen, die sieben Stockwerke hoch über die Stadt wachten, und einer Fläche, die sich über einen gesamten Block erstreckte. Dazu der schwarze Rauch, der hinter dem Gebäude aufstieg, als ob dort Hexen in ihren Kesseln etwas zusammenbrauten oder Bauern ihr Hab und Gut verbrannten, um plündernde Truppen am Vorrücken zu hindern. Rake hatte vor Aufregung große Augen gemacht. Seine Eltern hatten geglaubt, dass den Kleinen der Anblick der vielen Züge begeistern würde, doch als sie ihn mit nach drinnen nahmen und er weder Ritter noch Drachen noch eine einzige Streitkeule oder ein Wappen sah, war er untröstlich. Seine Eltern deuteten seine Tränen als panische Angst vor der Menge: überall Menschen, die mit dem Zug in die Stadt gekommen waren, um bei Rich’s