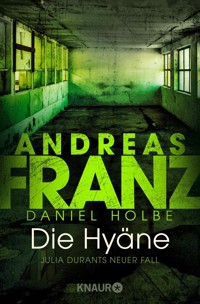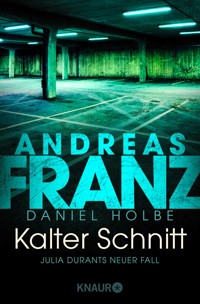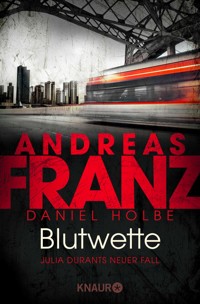Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julia Durant ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein mörderisches Rätsel um obskure Bibelzitate versetzt Frankfurt in Angst und Schrecken - Der zweite Fall für Kommissarin Julia Durant von Spiegel-Bestseller-Autor Andreas Franz ist ein fesselnder Kriminalroman mit überraschenden Wendungen. Ein unbekannter Täter schickt der Frankfurter Kripo rätselhafte Bibelzitate. Ein makaberer Scherz oder steckt mehr dahinter? Die Kriminalpsychologen vermuten einen Zusammenhang mit einer brutalen Mordserie, die die Handschrift eines religiösen Fanatikers trägt. Doch Hauptkommissarin Julia Durant ist skeptisch und ermittelt auf eigene Faust. Wird sie das mörderische Geheimnis der Bibelzitate lüften, bevor der Täter erneut zuschlägt? Das achte Opfer, der zweite Band der spannenden Krimi-Reihe von Bestseller-Garant Andreas Franz ist ein fesselnder deutscher Kriminalroman, der die Leser von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Franz
Das achte Opfer
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Unbekannter schickt der Frankfurter Kripo obskure Bibelzitate. Ein geschmackloser Scherz? Die Kriminalpsychologen glauben an einen Zusammenhang mit einer Mordserie, die die Handschrift eines religiösen Fanatikers trägt. Doch Hauptkommissarin Durant ist da mal wieder anderer Meinung.
Inhaltsübersicht
Prolog
Samstag, 18.00 Uhr
Sonntag, 11.00 Uhr
Zwei Jahre später
FÜNF JAHRE SPÄTER
Montag, 6.30 Uhr
Dienstag, 8.00 Uhr
Mittwoch, 8.00 Uhr
Donnerstag, 8.00 Uhr
Freitag, 6.30 Uhr
Samstag, 11.00 Uhr
Sonntag, 12.30 Uhr
Montag, 7.30 Uhr
Dienstag, 0.45 Uhr
Mittwoch, 7.30 Uhr
Donnerstag, 7.30 Uhr
Freitag, 7.45 Uhr
Samstag, 2.15 Uhr
Epilog
Prolog
Halb zehn. Große Pause. Es war stickig im Klassenzimmer, und alle strömten hinaus in die Gänge und hinunter auf den Pausenhof. Auch Carla, zwölf Jahre alt, einsfünfundfünfzig groß, mit noch sehr knabenhafter Figur und einem kindlich-naiven Gesichtsausdruck, graublauen Augen und schulterlangem, dunkelblondem Haar, stieg die Treppen hinab, ein Schulbrot, das ihre Mutter ihr am Morgen eingepackt hatte, in der linken Hand. Sie fühlte sich nicht sonderlich wohl, vor einem Monat hatte sie zum ersten Mal ihre Periode gehabt, die einhergegangen war mit heftigen Unterleibsschmerzen und Übelkeit; sie hatte zwei Tage dem Unterricht fernbleiben müssen. Glücklicherweise war sie frühzeitig von ihrer Mutter aufgeklärt worden, so daß dieses erste Mal nicht zu einem Horrortrip wurde; dennoch hatte sie Angst gehabt. Wovor genau, hätte sie nicht auszudrücken vermocht. Vielleicht, weil Blut ihr immer Angst machte, vielleicht, weil die Schmerzen so heftig waren, vielleicht aber auch nur vor dem Neuen, Unbekannten, das sie trotz aller Aufklärung noch nicht ganz verstand. Aus den Erzählungen ihrer Mutter entnahm sie lediglich, daß sie damit den ersten Weg zum Frauwerden beschritt. Und Frauwerden bedeutete, Kinder bekommen zu können, vorsichtig im Umgang mit Jungs und Männern zu sein, und, und, und …
Sie hatte Hunger, aber keinen Appetit. Da waren wieder diese leichte, bohrende Übelkeit und das Ziehen in ihrem Bauch, und sie ahnte, daß es bald wieder soweit sein würde. Sie hielt das Brot eine Weile in der Hand, betrachtete es, während um sie herum geredet, gestritten, gelacht oder gebalgt wurde, Jungen die Mädchen hänselten, ein paar Lehrer als hilflose Aufpasser fungierten und die Sonne bereits jetzt am Morgen mit unbarmherziger Kraft von einem wolkenlosen, milchig-blauen Himmel schien. Sie stand einen Moment unschlüssig, ob sie essen sollte oder nicht, als sie von hinten angetippt wurde. Sie drehte sich um, ihre beste und auch einzige Freundin, die dreizehnjährige Sylvia, grinste sie an. »Na, auch keinen Hunger?«
»Nee, nicht so richtig. Mir geht’s nicht so besonders. Hab Bauchweh.«
»Kriegst du wieder deine Tage?« fragte Sylvia und legte einen Arm um Carlas Schultern.
»Hmh, sieht so aus. Verdammter Mist.«
»Ach komm, ist alles halb so schlimm. Ich hab den Scheiß schon seit zwei Jahren und komme inzwischen ganz gut damit zurecht.«
»Hast du auch immer solche Schmerzen?«
»Geht so. Ich hab ganz gute Tabletten dagegen. Damit läßt sich’s aushalten. Auf jeden Fall stirbt man nicht daran.«
»Das weiß ich auch! Ist trotzdem ein blödes Gefühl.«
Sie gingen ein Stück über den Hof, setzten sich auf eine der vielen Rundbänke. Carla nahm ihr Brot und warf es in den neben ihr stehenden Abfallkorb. Sie hatte die Beine eng geschlossen, die Hände gefaltet, den Blick zu Boden gesenkt. »Hör mal zu, Carla, ich hab da eine Idee. Am Samstag steigt bei Matti eine kleine Fete. Du kennst doch Matti, oder?«
»Hab den Namen schon mal gehört, aber …«
»Das ist der Dunkelhaarige da drüben am Geländer. Er ist schon in der zehnten, und – na ja, er hat mich gefragt«, sagte sie lachend und zuckte mit den Schultern. »Du mußt dir mal vorstellen, ausgerechnet mich, ob ich nicht Lust hätte, auch zu kommen.« Sie machte eine kurze Pause und fuhr dann fort: »Bei der Gelegenheit hat er mich auch gleich gefragt, ob ich dich nicht fragen will, ob du nicht auch Lust hättest …«
Carla blickte erstaunt auf. »Was, ich?«
»Ja, warum nicht du?«
»Ich bin zwölf, wenn du das vergessen haben solltest.«
»Na und? Ich bin dreizehn und gehe auch hin. Ich kann dir nur soviel verraten – was ich bis jetzt von Mattis Feten gehört habe, da soll’s ganz schön abgehen.«
»Wie meinst du das?«
»Tolle Musik und so ’n Zeug. Der macht das regelmäßig, wenn seine Eltern mal wieder verreist sind. Was ist, kommst du mit?«
»Weiß nicht. Ich glaube kaum, daß meine Eltern das erlauben.«
»Und warum nicht? Du kannst ihnen ja sagen, daß du mit mir dorthin gehst und wir auch nicht länger als bis elf oder höchstens zwölf bleiben. Dein Vater oder meine Mutter können uns ja abholen. Das Wichtigste ist doch, daß die Alten wissen, wo wir sind. Dann machen sie sich auch keine Sorgen. Brauchen sie im übrigen auch nicht, ist alles ganz harmlos. Ich weiß auch schon von ein paar anderen, die hingehen.«
»Mal sehen.«
»Schau, heute ist Montag. Wenn du heute oder morgen deine Tage kriegst, dann bist du am Samstag auch wieder einigermaßen fit. Überleg’s dir. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du …«
»Mal sehen, was sich machen läßt. Aber versprechen kann ich gar nichts.«
»Okay, wir können ja heute nachmittag oder heute abend mal telefonieren.«
Sie standen von der Bank auf und gingen mit langsamen Schritten zum Schulgebäude zurück. Sie folgten einfach dem Strom der anderen Schüler, die sich nach und nach in den einzelnen Klassen verteilten. Die nächsten zwei Stunden würden die Hölle werden. Mathe. Wenn es überhaupt ein Fach gab, das Carla haßte, dann dieses. Nicht, weil sie es nicht kapierte, sie gehörte zu den besten Schülerinnen der Klasse, sondern weil sie einfach nicht begriff, wozu sie das alles lernen sollte. Es gab nur einen einzigen Traum, den sie sich später erfüllen wollte – Schauspielerin. Und das Talent dazu besaß sie, wahrscheinlich hatte sie es von ihrer Mutter geerbt, die bis vor wenigen Jahren nicht nur als Model in vielen Zeitschriften und Magazinen, sondern auch im Fernsehen in zahlreichen Werbespots zu sehen gewesen war. Jetzt hatte sie ihr Engagement zurückgeschraubt, wollte etwas Ruhe in ihr Leben bringen und sich mehr um die Familie kümmern. Aber schon seit sie ein kleines Kind war, wußte Carla, daß sie nichts mehr wollte, als eines Tages auch auf der Bühne und vor der Kamera zu stehen.
Samstag, 18.00 Uhr
Gemeinsam mit Sylvia betrat Carla Mattis Haus, eine geräumige Villa nicht weit von ihrem eigenen Haus entfernt. Sie hatte ihr hübschestes, dunkelblaues Kleid angezogen, sich etwas geschminkt, um dadurch ein wenig älter auszusehen. Sie hatte ihren Eltern gesagt, daß sie nach der Party mit zu Sylvia gehen und auch dort übernachten würde. Sie bräuchten sich also keine Sorgen zu machen.
Außer Matti waren noch ein paar Jungen und Mädchen von der Schule da, und einige Gesichter, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Soweit sie feststellen konnte, war sie die jüngste der Anwesenden, die meisten waren etwa zwischen fünfzehn und zwanzig. Vielleicht sogar ein wenig älter. Einige tranken Bier, andere auch härtere Sachen. Manche rauchten, laute Musik hämmerte aus riesigen Lautsprechern. Man mußte fast schreien, wollte man sich unterhalten. Ein paarmal meinte sie, von Blicken förmlich verfolgt zu werden, aber sie konnte sich auch täuschen. Matti kam kurz zu ihr, wechselte einige belanglose Worte mit ihr. Sie fühlte sich nicht sonderlich wohl in der Umgebung: der Lärm, die vielen fremden Gesichter, der schwer in der Luft hängende, süßliche Geruch. Und doch war sie neugierig, trank eine Cola, beobachtete das Treiben um sich herum.
Zwanzig Uhr. Sie saß immer noch auf ihrem Stuhl, ohne daß sich irgend jemand um sie gekümmert hätte. Selbst Sylvia, ihre beste Freundin, war seit über einer halben Stunde in dem Treiben verschwunden, zuletzt hatte sie sie mit einem bestimmt fünf oder sechs Jahre älteren Jungen die Treppe zum ersten Stock hochgehen sehen. Sie trank eine weitere Cola, als eine ihr unbekannte junge Frau auf sie zukam und sich zu ihr setzte. Carla schätzte sie auf etwa zwanzig, sie war groß, hatte lange, dunkle Haare und ebenso dunkle, große Augen, sie trug ein schwarzes Minikleid, das jede ihrer reichlich vorhandenen Rundungen mehr als betonte. Für einen Moment sah sie Carla direkt an, schließlich sagte sie mit warmer, weicher Stimme: »Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du zum ersten Mal hier?«
Carla nickte.
»Na ja, beim ersten Mal ist es noch ein bißchen – komisch, oder? Aber man gewöhnt sich dran. Willst du nicht lieber was anderes trinken … als diese Cola? Soll ich dir was mixen?«
»Was denn?« fragte Carla mißtrauisch.
»Laß dich einfach überraschen. Es wird dir schmecken, ich garantiere es dir. Und außerdem fühlst du dich danach mit Sicherheit ein bißchen wohler.«
»Ich fühl mich nicht unwohl …«
»Ach komm, das sieht doch jeder, daß dir das alles hier nicht ganz geheuer ist. Ich bin gleich wieder da.« Sie erhob sich, reichte Carla die Hand und fügte hinzu: »Übrigens, ich heiße Anna, und du?«
»Carla.«
»Ein hübscher Name, wirklich. Bis gleich.«
Kaum eine Minute später kehrte Anna zurück, ein Glas in der Hand, das sie Carla hinhielt. »Hier, das ist garantiert besser als Cola. Du mußt es aber auf einen Zug austrinken.«
»Warum?«
»Man muß sich an den Geschmack erst gewöhnen, das ist alles. Es ist wie mit Medizin. Aber ich schwöre dir, es ist nichts Schlimmes. Also komm, trink.« Carla nahm das Glas und trank es leer, wie Anna gesagt hatte. Das Getränk schmeckte etwas bitter, und es brannte anfänglich im Magen. Doch schon nach wenigen Augenblicken spürte sie Wärme in sich aufsteigen, spürte sie, wie die Anspannung, die sie während der letzten zwei Stunden verspürt hatte, schwand.
»Na, und? Besser jetzt?«
Carla lächelte zum ersten Mal an diesem Abend. »Ein bißchen.«
»Möchtest du noch eins?«
»Ja, warum nicht?«
»Komm mit, dann kann ich dich auch gleich den anderen vorstellen. Es sind alles ganz nette Typen.«
Sie wurde einem nach dem anderen vorgestellt, trank ihr zweites Glas leer. Ein junger Mann in Jeans, T-Shirt und einem Blazer kam auf sie zu, lächelte sie an.
»Na, wie geht’s?«
»Ganz gut, warum?«
»Nur so ’ne Frage. Kennst du eigentlich schon das Haus?«
»Nein, wie sollte ich?«
»Mein Bruder Matti ist nicht gerade ein besonders aufmerksamer Gastgeber. Aber du mußt ihn entschuldigen, er ist noch jung und unerfahren. Wenn du gestattest, werde ich mich deiner annehmen. Einverstanden?«
»Von mir aus.«
»Gut, gehen wir nach oben. Oben ist nämlich mehr los als hier unten. Highlife, wenn du verstehst, was ich meine. Also, komm.«
»Wie heißt du?«
»Nenn mich Charles oder Charly. Aber nur meine Freunde dürfen mich Charly nennen.«
»Okay, Charly.«
Sie gingen die Treppe hoch, betraten das zweite Zimmer links. Vier Jungs und vier Mädchen saßen an einem Glastisch und blickten auf, als Charly und Carla in das Zimmer kamen. Die einzige Person, die Carla kannte, war Sylvia, die anderen hatte sie noch nie zuvor gesehen.
»Hier, setz dich. Wir haben hier eine gemütliche, aber aufregende Runde. Es wird dir gefallen.« Charly blickte einen auf der anderen Seite des Tisches stehenden Mann an, gab ihm ein Zeichen. Der Mann ging an einen Schrank, holte ein kleines Päckchen heraus, legte es auf den Tisch. Charly öffnete es, kippte den weißen Inhalt auf die Glasplatte. Er sagte: »So, Leute, jetzt kann die Party losgehen.«
Sonntag, 11.00 Uhr
Carla wachte auf. Ihr war schwindlig und übel, sie setzte sich auf. Sylvia schlief noch, sie atmete ruhig und gleichmäßig. Die Übelkeit wurde stärker, Carla rannte ins Badezimmer und übergab sich. Die Übelkeit ließ nach, sie versuchte sich zu erinnern, aber sosehr sie sich auch anstrengte, die vergangene Nacht war einfach aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Sie ging zurück in Sylvias Zimmer, setzte sich aufs Bett, hielt den Kopf zwischen ihren Händen.
»Hey, was ist los mit dir?«
Carla drehte den Kopf ein wenig, sah Sylvia stumm an.
»Ist dir schlecht?«
»Sauschlecht. Was ist gestern abend passiert?«
»Nichts weiter, warum?«
»Ich fühl mich hundeelend. Und ich kann mich an nichts mehr erinnern.«
»Warte, ich hab was für dich. Ist gegen die Übelkeit. Bei mir war’s beim ersten Mal auch so.« Sie stand auf, holte ein Glas, ging ins Bad und kam kurz darauf zurück. »Hier, trink das. Du wirst dich gleich besser fühlen.«
Carla trank, ohne zu fragen, was Sylvia ihr da gab. Die Übelkeit hörte fast augenblicklich auf.
»Und?«
»Geht schon wieder. Danke.«
»Und du kannst dich an nichts erinnern?«
»Nein, gar nichts.«
»Mann o Mann! Ich kann mir aber vorstellen, daß der eine oder andere sich an dich erinnern kann.«
»Wie meinst du das?«
»Hast du schon mal mit einem Jungen geschlafen?«
»Spinnst du? Ich habe auch nicht vor …«
»Na ja, vielleicht ganz gut, daß du dich nicht erinnern kannst«, sagte Sylvia und legte sich wieder ins Bett.
»Was meinst du damit?«
»Nur so.«
»Hör auf, so ’n Scheiß zu reden. Sag mir lieber, was passiert ist.«
»Hör zu, Carla, es tut mir leid, aber – es ist passiert. Du hast letzte Nacht mit mindestens drei Jungs geschlafen. Zumindest haben sie es erzählt.«
»Du spinnst doch! Ich und mit Jungs geschlafen! Daß ich nicht lache!«
»Frag sie doch«, sagte Sylvia mit seltsam kalter Stimme.
»Soll ich dir die Namen nennen?«
»Ist das wirklich wahr?« fragte Carla mit weit aufgerissenen Augen.
»Wenn ich’s dir sage. Aber tröste dich, ich hatte auch meinen Spaß. Es war ’ne geile Fete, ehrlich.«
»Wenn meine Eltern das erfahren …«
»Ach, Quatsch, deine Eltern erfahren kein Wort. Und bevor du gehst, gebe ich dir noch was mit. Hier«, Sylvia zog ihre Nachttischschublade heraus und gab Carla zwei kleine Tütchen.
»Versteck die gut, damit niemand sie findet. Das Zeug wird dir den Tag versüßen.«
»Was ist es?«
»Gib einfach die Hälfte des Inhalts auf den Handrücken, und atme es ein. Die Wirkung ist phänomenal. Ich spreche da aus Erfahrung.«
»Es ist doch kein Rauschgift, oder?«
»Rauschgift! Blödsinn! Heroin ist Rauschgift. Nein, das hier ist harmlos. Aber gut, verdammt gut sogar.«
Carla steckte die Tütchen in ihre Jeanstasche, in der sie auch das Kleid und die Schuhe verstaute. Sie zog sich ein weißes Sweatshirt, Jeans und Turnschuhe an, kämmte sich noch einmal über und verließ das Haus. Auf dem Weg nach Hause dachte sie an nichts anderes als an die verlorene Erinnerung.
Zwei Jahre später
Carla saß allein in dem Zimmer, die Tür stand offen. Der Fernseher lief ohne Ton, aus der Stereoanlage hämmerten monotone Technorhythmen. Die Sonne fiel schräg durch das kleine Fenster. Im Zimmer befanden sich ein Schrank, zwei Sessel, ein Tisch und ein großes, weiches Bett. Seit über einem Jahr lebte sie in diesem Haus, in diesem Zimmer, hier aß und trank sie, und hier empfing sie ihre Freier. Meist handelte es sich dabei um ältere Männer, die sich vorher bei Maria, die die Termine verwaltete, anzumelden hatten. Der nächste Mann würde in etwa einer Stunde kommen, ein fettleibiger Kerl, der Carla schon oft bestiegen hatte, der so viel Geld hatte, daß er es sich mühelos leisten konnte, die fünfhundert Mark, die eine Stunde kostete, auch mehrmals im Monat zu bezahlen. Sie haßte diesen Typen, genau wie all die anderen, die ihre geilen Schwänze in sie hineinsteckten. Sie haßte Maria, obgleich die ihr nie etwas getan hatte, ganz im Gegensatz zu Rick, dem allgegenwärtigen Aufpasser, der sie regelmäßig schlug und sie inzwischen mehr als einmal vergewaltigt hatte. Und sie haßte diesen gottverdammten Charly, Mattis Bruder, der sie hierhergebracht hatte. Sie hätte damals, auf jener Party, nie vermutet, was für ein Teufel hinter diesem Lächeln steckte, zu welcher Brutalität er fähig war.
Sie stand auf, etwas schwerfällig, schloß die Tür, ging zum Schrank, holte die Spritze heraus, zog sie voll mit dem Heroin, das sie, seit sie hier lebte, spritzte, band sich die Manschette um den Oberarm, stach die Nadel in eine gut sichtbare Vene und ließ das Gift langsam in ihren Körper fließen. Allmählich schwand das Zittern, ihr Atem wurde ruhiger. Der fette Kerl konnte kommen.
Sie zündete sich eine Zigarette an, kippte ein Wasserglas halbvoll mit Wodka und trank es in einem Zug leer.
Der Fette kam pünktlich zur verabredeten Zeit. Schweiß lief in Bächen über sein feistes, widerliches Gesicht, seine verschlagenen Schweinsaugen glitten gierig über den vor ihm sitzenden, zerbrechlich wirkenden Körper. Er legte die fünfhundert Mark auf den Tisch, sagte, was Carla tun sollte, und Carla tat es. Und er gehörte zu jenen, die es ohne Kondom haben wollten, denen es scheißegal war, welches Risiko sie damit eingingen oder was sie unter Umständen den Mädchen damit antaten. Das Heroin und der Alkohol verhinderten, daß sie den Schmerz spürte, wenn er mit seinem riesigen, dicken Schwanz in sie eindrang. Das Heroin und der Alkohol machten sie gleichgültig dem gegenüber, was mit ihr geschah.
Manchmal dachte sie an ihre Eltern und an ihren Bruder, aber die hatten wahrscheinlich längst die Suche nach ihr aufgegeben und glaubten mit Sicherheit, daß sie tot war. Carla wußte nicht einmal, in welcher Stadt sie war. Aber es war bestimmt nicht mehr Friedberg.
Als der Fette fertig war, zog er sich an, sagte »Bis bald« und verschwand. Carla sah ihm nicht einmal hinterher. Kurz darauf kam Rick herein, nahm wortlos das Geld, zählte nach und steckte es in die Hemdtasche.
»Hast du noch genug Stoff?« fragte er kalt.
»Nein, nur noch einen Schuß. Und der Wodka ist auch fast alle.«
»Okay, ich besorg dir beides. Du hast heute abend noch zwei Kunden, mach dich also frisch. Und mach verdammt noch mal das Fenster auf, hier drin stinkt’s wie in einem – Puff!« Er lachte meckernd und ging. Carla drehte die Musik wieder auf, öffnete das Fenster, warme Luft strömte herein. Sie ließ sich rücklings auf das Bett fallen, starrte an die Decke, dachte an gar nichts. Es gab nichts mehr, woran zu denken sich lohnte.
Rick kehrte nach einer guten Stunde zurück, warf fünf Tütchen Heroin auf den Tisch und stellte die beiden Flaschen Wodka daneben. »Hier, verstau das. Es darf keiner sehen, daß du das Zeug nimmst. Irgendwann mußt du mit dem Scheiß aufhören.«
Carla nickte nur müde. Der nächste Kunde kam um sieben, er wollte nicht viel, er wollte nur dasitzen, das nackte Mädchen betrachten und sich dabei selbst befriedigen. Allein dafür war er bereit, eine Menge Geld zu bezahlen.
Für zweiundzwanzig Uhr war der letzte Freier des Tages angekündigt. Auch er kam pünktlich. Wie alle hatte auch er zu klingeln, wie alle Neuen wurde auch er eingehend gemustert, bevor er eingelassen wurde. Es war ein junger Mann, ein sehr junger Mann, mit kurzgeschnittenen, braunen Haaren, groß, muskulös, in Jeans, einem weißen T-Shirt, Sakko und Tennisschuhen. Carla sah erst auf, als er bereits im Zimmer stand. Sie kniff die Augen zusammen, ungläubig staunend betrachtete sie den vor ihr Stehenden. Waren es ein oder zwei Jahre, seit sie ihn zuletzt gesehen hatte? Es war auf jeden Fall eine verflucht lange Zeit. Eine Zeit, in der sie aufgehört hatte, ein kleines Mädchen zu sein, und doch keine Frau wurde. In der sie gelernt hatte, sich die Spritze zu setzen und zu saufen. In der sie drei bis vier Schachteln Zigaretten am Tag rauchte und nicht mehr wußte, was in der Welt vor sich ging. In der ihr das Leben zunehmend gleichgültiger wurde. Und jetzt auf einmal stand er da, Patrick, der große, gute Patrick. Sie erhob sich wie in Zeitlupe von ihrem Sessel, ging auf ihn zu, legte wortlos die Arme um seinen Hals und drückte sich ganz fest an ihn.
»Patrick! Mein Gott, Patrick! Wo kommst du her? Und wie hast du mich gefunden?«
»Ich habe nie aufgehört, dich zu suchen, mein kleines Schwesterchen. Nie. Und jetzt endlich habe ich dich gefunden, und ich werde dich mit nach Hause nehmen. Mama und Papa glauben nämlich, daß du schon nicht mehr lebst. Was ist bloß passiert?«
»Ich weiß es nicht«, sagte sie kopfschüttelnd. »Ich weiß es wirklich nicht.« Unvermittelt fing sie an zu weinen und legte ihren Kopf an seine Schulter.
»Ich hol dich jetzt hier raus. Kapiert?« sagte er ernst.
»Wie willst du das machen?« fragte sie mutlos. »Die passen hier auf. Ich darf ja nicht mal allein auf die Straße, immer nur in Begleitung. Ich hab nämlich schon mal versucht abzuhauen, aber sie haben mich wieder eingefangen und jetzt …«
»Du wirst dich jetzt anziehen und einfach mit mir aus diesem Haus gehen.«
»Sie werden dich umbringen«, flüsterte sie.
»Ich habe eine Pistole dabei. Wir wollen doch mal sehen, wer schneller ist. So kurz vor dem Ziel lasse ich mich jetzt nicht mehr aufhalten. Du gehörst nicht in diesen verdammten Puff, du gehörst nach Hause, zu unserem Vater und unserer Mutter. Sie werden sich wahnsinnig freuen, dich zu sehen. Und dann fängt das Leben neu an. Und ich werde dir dabei helfen. Du hast mir so wahnsinnig gefehlt. Du warst und wirst es immer bleiben – meine kleine Schwester. Und keiner wird meiner kleinen Schwester mehr weh tun. Ich schwöre es dir bei meinem Leben.«
Carla zog sich die Jeans und ein T-Shirt über, schlüpfte in ihre Turnschuhe. Sie öffnete die Tür einen Spalt, lugte hinaus in den nur schwach erleuchteten Gang, auf dem sich kein Mensch aufhielt. Patrick holte die Pistole aus der Innentasche seines Sakkos und steckte sie in die rechte Seitentasche. Vorsichtig und geräuschlos schritten sie über den Teppich, gelangten an die Eingangstür. Patrick blickte um sich, sie waren allein. Er drückte die Klinke, die Tür ging leise auf. Carla huschte nach draußen, Patrick folgte ihr, ließ die Tür sanft ins Schloß fallen. Sie liefen über den dunklen Hinterhof zum unverschlossenen Auto. Carla öffnete die Beifahrertür, Patrick ging um den Wagen herum, wollte gerade einsteigen, als eine Stimme von hinten ihn zurückhielt.
»Na, Junge, wohin so eilig? Und was willst du mit meinem Mädchen?«
Ohne sich umzudrehen, erwiderte Patrick: »Dein Mädchen? Daß ich nicht lache! Carla ist meine Schwester, und unsere Eltern haben sie schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Und genau deswegen werde ich jetzt mit ihr nach Hause fahren.«
»Du wirst nirgendwohin fahren, Kleiner. Sie gehört schon lange nicht mehr deinen Eltern, sie gehört nicht einmal sich selber. Sie gehört nur mir und der Organisation. Es ist vorbei, Kleiner.«
Patrick umfaßte den Pistolenknauf, drehte sich um. Er sah den anderen nur schemenhaft, zog schnell die Waffe aus der Tasche, doch bevor er abdrücken konnte, blitzte zweimal das Mündungsfeuer des anderen auf; zwei fast lautlos abgefeuerte Kugeln trafen ihn in Brust und Kopf. Patrick fiel nach hinten, den Blick starr nach oben gerichtet. Blut sickerte aus seinem Mund und der Stirn. Rick ging auf ihn zu, blickte kalt und zynisch auf den Toten und wandte dann seinen Kopf in Carlas Richtung. Carla stieg, ohne ein Wort zu sagen, aus und begab sich zurück zum Haus. Sie weinte nicht einmal.
Rick holte sein Handy aus der Jackentasche, wählte eine Nummer. Knapp fünf Minuten später erschienen zwei Männer, die den toten Patrick in einen alten Teppich wickelten, in den Kofferraum ihres Mercedes luden und davonfuhren. Sie fuhren etwa eine Stunde über Land und brachten ihn zurück nach Friedberg, wo sie ihn unter einer Brücke am Stadtrand wie ein Stück Müll ablegten.
Carla lebte noch ein halbes Jahr, sie spritzte Heroin, trank flaschenweise Wodka, und an einem kühlen Mittwoch im Mai setzte sie sich eine Spritze, trank eine halbe Flasche Wodka und fiel in einen tiefen Schlaf, aus dem sie nicht mehr aufwachte. Ein paar Männer fuhren ihre Leiche in der folgenden Nacht in ein tagsüber stark frequentiertes Waldgebiet bei Frankfurt. Carla war gerade fünfzehn geworden.
FÜNF JAHRE SPÄTER
Montag, 6.30 Uhr
Julia Durant, Hauptkommissarin bei der Kripo Frankfurt, wachte um halb sieben auf. Die Sonne fiel in hellen Strahlen durch das geöffnete Fenster. Durant fühlte sich elend, ihr war übel, sie hatte Kopfschmerzen, das grelle Licht blendete sie. Sie hatte wieder einmal die Vorhänge nicht zugezogen, reine, kühle Morgenluft wehte herein. Sie setzte sich auf, die Übelkeit nahm zu, ihr war etwas schwindlig. Sie schloß kurz die Augen, dachte an den vergangenen Abend, die Geburtstagsfeier bei einer Kollegin vom Betrugsdezernat, schalt sich eine Närrin, wieder einmal zuviel durcheinander getrunken zu haben. Sie stand auf, ging mit schweren Schritten zum Bad, entleerte ihre Blase, wusch sich kurz die Hände und übers Gesicht, sah im Spiegel die tiefen Ränder unter den Augen, das typische Zeichen dafür, daß sie in den letzten Wochen viel zuwenig geschlafen hatte. Sie holte ein paarmal tief Luft, um damit gegen die Übelkeit anzukämpfen, und ging, nur bekleidet mit einem Slip und Trägerhemd, in die Küche. Sie öffnete den Kühlschrank, holte die unangebrochene Tüte Milch heraus, stellte sie auf den Tisch, nahm die Cornflakes vom Regal und eine kleine Schüssel aus dem Hängeschrank. Sie setzte sich, gab Cornflakes und Milch in die Schüssel und streute ein paar Löffel Zucker darüber. Sie aß langsam, allmählich beruhigte sich ihr Magen. Nach dem Essen brühte sie sich eine Tasse Kaffee auf. Sie zündete sich eine Gauloise an, inhalierte tief und trank einen Schluck vom heißen Kaffee.
Um kurz nach sieben ging sie zurück ins Bad, putzte sich die Zähne, legte etwas Make-up auf, das die Ringe unter ihren Augen kaschieren sollte, zog die Lippen nach und bürstete sich das dunkle, halblange Haar. Sie betrachtete sich noch einmal im Spiegel, fand, daß sie sich gegenüber der letzten halben Stunde äußerlich kaum verändert hatte, nahm sich zum wer weiß wievielten Male vor, mehr zu schlafen und vor allem weniger zu rauchen und zu trinken. Im Schlafzimmer zog sie frische Unterwäsche an, Jeans und eine weitgeschnittene, beige Bluse sowie die weißen Tennisschuhe, warf einen letzten Blick in die Küche und das Wohnzimmer, hängte ihre Handtasche über die Schulter und verließ die Wohnung. Sie schloß hinter sich ab und ging die Treppen hinunter. Ihre Zeitung war trotz mehrmaliger Reklamation wieder nicht im Briefkasten. Sie fluchte leise vor sich hin und ging zum Auto. Obwohl die Sonne von einem wolkenlosen Himmel schien, ein frischer Wind vom Taunus herüberwehte und die drückende Großstadtluft mit sich forttrug, wäre Julia Durant heute lieber zu Hause geblieben und hätte sich die Bettdecke über den Kopf gezogen, um einfach nur zu schlafen.
Sie quälte sich durch den morgendlichen Berufsverkehr und dachte über die vergangenen Wochen und Monate nach, die, was ihre Arbeit bei der Mordkommission anging, eher eintönig verlaufen waren. Im letzten halben Jahr hatten sie gerade einmal sechs Tötungsdelikte zu bearbeiten gehabt, wovon vier bereits nach wenigen Tagen aufgeklärt waren, lediglich die andern beiden waren harte Nüsse, da die Opfer nicht identifiziert werden konnten. Weder anhand von Finger- oder Gebißabdrücken, noch hatte einer der Toten einen Ausweis bei sich getragen. Laut Bericht der Gerichtsmedizin waren die Opfer beide zwischen Mitte Zwanzig und Mitte Dreißig und aller Wahrscheinlichkeit nach keine Deutschen, eher Osteuropäer. Alles deutete darauf hin, daß die Toten in den Kreisen der organisierten Kriminalität verkehrt hatten und dort auch ihre Mörder zu suchen waren, vor allem, weil die Art der Tötung auf professionelles Vorgehen schließen ließ. Beide waren mit einem Genickschuß praktisch hingerichtet worden. Die Aufklärung eines Mordes innerhalb des organisierten Verbrechens war fast aussichtslos, da man in der Regel bei den Befragungen auf eine Mauer des Schweigens stieß und ein Wort zuviel schon den Tod bedeuten konnte. Dennoch hatte sich vor einem Monat ein anonymer Anrufer bei der Kripo gemeldet und gesagt, daß ein gewisser Winzlow, weltweit anerkannter Kunstkenner und Museumsdirektor, zwei Morde in Auftrag gegeben habe und in einem seiner Häuser Waffen und Drogen deponiert seien. Außerdem gab er die Initialen der angeblich Ermordeten mit I. T. und N. B. an. Nach einer gründlichen Durchsuchung diverser Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume waren tatsächlich Waffen und Drogen gefunden worden. Daraufhin nahm man Winzlow fest, mußte ihn aber nach vierundzwanzig Stunden wieder laufenlassen, da das Haus, in dem die Waffen und Drogen gefunden worden waren, verpachtet und Winzlow keine direkte Beteiligung nachzuweisen war, ebensowenig wie dem Pächter. Doch es stand in den nächsten Tagen eine Anhörung Winzlows an, in Anwesenheit seines Anwalts, eines Staatsanwalts und eines Richters.
Julia Durant brauchte eine halbe Stunde bis zum Präsidium. Sie stellte den Wagen im Hof ab, lief die Treppe hinauf, über den langen Gang, ihre Schritte hallten von den Wänden wider, und betrat ihr Büro. Hauptkommissar Berger saß bereits hinter seinem Schreibtisch, eine aufgeschlagene Akte vor sich. Er blickte auf, als die Kommissarin eintrat, und murmelte ein »guten Morgen«. Sie erwiderte den Gruß, hängte ihre Tasche an den Kleiderhaken, nahm die Schachtel Zigaretten heraus, zündete sich eine an und setzte sich.
»Irgendwas Aufregendes gewesen am Wochenende?« fragte sie, während sie den inhalierten Rauch ausblies.
»Was verstehen Sie unter aufregend?«
»Ach, vergessen Sie’s. Was liegt heute an?«
»Schreibkram. Wir haben noch einige Akten aufzuarbeiten. Ich weiß, ich weiß, das ist nicht gerade Ihre Lieblingsbeschäftigung, aber irgendwann muß das auch mal gemacht werden. Tut mir leid.« Er machte eine kurze Pause und sagte dann: »Ach so, bevor ich’s vergesse, unser anonymer Anrufer im Fall Winzlow hat noch einmal angerufen und gesagt, daß die beiden nicht identifizierten Toten Mitglieder der Russenmafia waren.«
»Namen?«
»Nein, wieder nur die Initialen. Er sagt, er selbst kenne die vollständigen Namen nicht. Na ja, wer’s glaubt! Und er hat noch einmal betont, daß Winzlow den Auftrag zu deren Ermordung gegeben hat. Und außerdem habe Winzlow noch zwei Männer liquidieren lassen. Bevor ich unseren Anrufer etwas dazu fragen konnte, hatte er aber schon wieder aufgelegt.«
»Damit kommen wir nicht weiter. Womit wir die Sache wahrscheinlich wieder einmal zu den unerledigten Fällen legen können. An diesen Winzlow wird wohl kaum ranzukommen sein. Richtig?«
»Scheint so.« Berger zuckte mit den Schultern und lehnte sich zurück. Er nahm seine Tasse mit dem inzwischen kalten Kaffee vom Tisch, trank einen Schluck und sah die Kommissarin an. Sie erwiderte seinen Blick und dachte dabei, daß Berger alt und müde geworden war. Das war er aber vermutlich schon damals, vor mehr als zwei Jahren, als in Frankfurt mehrere Mädchen auf grausame Weise abgeschlachtet worden waren. Eigentlich hatte er, nachdem der Mörder gefaßt war, vorgehabt, sein Haus zu verkaufen, den Dienst zu quittieren und mit seiner Tochter nach Florida zu ziehen. Aber er hatte irgendwie den Absprung nicht geschafft, es offensichtlich nicht fertiggebracht, Frankfurt den Rücken zu kehren, der Stadt, in der seine Frau und sein Sohn begraben lagen. Noch immer besuchte Berger mindestens zweimal in der Woche den Friedhof, stellte frische Blumen in die Vase und fuhr dann nach Hause. Die Abende verbrachte er meist allein in dem für ihn viel zu großen Haus. Seine Tochter hatte das Abitur mit Bravour bestanden, jetzt besuchte sie die Polizeischule, um vielleicht eines Tages in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Berger war dick geworden, sein Gesicht wirkte aufgedunsen, und Julia Durant fragte sich nicht zum ersten Mal, ob er nicht vielleicht ein Alkoholproblem hatte. Aber es war nicht ihre Aufgabe, im Privatleben ihres Vorgesetzten herumzuschnüffeln, damit mußte er allein klarkommen.
»Okay«, sagte Durant und erhob sich, »dann werde ich mich mal an die aufregende Arbeit machen.« Dabei verzog sie den Mund, nahm einen Stapel Akten und blätterte die erste davon durch. Sie haßte diese Büroarbeit, diesen Schriftkram, und hätte ihn lieber anderen überlassen. Doch solange es in Frankfurt so friedlich blieb, mußte sie diese langweiligen Sachen erledigen.
Kommissar Hellmer kam zur Tür herein, kurz darauf Kommissar Kullmer, der ein mürrisches Gesicht machte.
»Schlechtes Wochenende gehabt?« fragte Durant spitz.
»Was geht Sie das an? Hauptsache, Sie hatten ein gutes Wochenende.« Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und schlug die Beine übereinander.
»Hier«, sage Julia Durant und deutete auf die Akten. »Das muß erledigt werden.«
»Na toll!« sagte Kullmer und rollte mit den Augen. »Scheißarbeit!«
»Finde ich auch«, erwiderte die Kommissarin, »aber ich mach’s trotzdem. Und wenn wir alle vier uns beeilen, dann haben wir diesen … Scheiß … auch bald hinter uns. Wie heißt es doch so schön – packen wir’s an.«
»Ich hab Kopfschmerzen«, sagte Hellmer und kniff die Augen zusammen. »Hat mal einer ’ne Aspirin?«
»Warte, ich glaub, ich hab noch eine in meiner Tasche«, sagte Julia Durant und stand auf. Hellmer war der einzige in der Abteilung, mit dem sie sich duzte und der ihr sympathisch war, auch wenn sie nicht viel über ihn wußte, außer, daß vor knapp zwei Jahren seine Ehe wegen einer Geliebten in die Brüche gegangen war. Er hatte damals aber nicht nur seine Frau und die drei Kinder verloren, sondern auch seine Geliebte. Jetzt lebte er allein in einer kleinen Zweizimmerwohnung, und von dem Geld, das er verdiente, blieb nach Abzug der Unterhaltskosten gerade noch so viel übrig, daß er die Miete und seinen sehr bescheidenen Lebensstil bezahlen konnte. Manchmal machte er einen richtig deprimierten Eindruck, seine Augen waren dann stumpf und leer, und irgendwie tat er ihr leid. Das Leben machte für ihn allem Anschein nach keinen Sinn mehr. Dabei war er noch relativ jung, gerade einmal fünfunddreißig, doch manchmal glaubte sie, in die Augen eines alten Mannes zu blicken.
»Hier, meine letzte«, sagte sie und reichte das Aspirin an Hellmer weiter.
»Danke.« Er schenkte sich ein Glas voll Wasser ein und spülte die Tablette herunter. Er wollte sich gerade setzen, als das Telefon klingelte. Berger nahm ab, hörte einen Moment zu und sagte dann: »Okay, ich schicke jemanden vorbei.« Er notierte eine Adresse und legte auf.
»Tja, ich schätze, Sie sind fürs erste von dieser ›Scheißarbeit‹ befreit. Eine Tote, erdrosselt, wie es scheint. Fahren Sie hin, ist in Bornheim.« Er reichte der Kommissarin den Zettel mit der Adresse. »Ich werde auch gleich die Spurensicherung informieren.«
Vor dem alten, fünfstöckigen Gebäude parkten zwei Streifenwagen. Einer der Beamten führte Julia Durant, Hellmer und Kullmer in den dritten Stock. Im Hausflur roch es unangenehm nach abgestandenem Bratfett, die Stufen knarrten bei jedem Schritt, die kahlen Fenster waren verschmiert. Drei weitere Streifenpolizisten befanden sich am Tatort. Die Wohnung war schmutzig und unaufgeräumt, Zeitungen lagen verstreut auf dem Fußboden, dazu einige leere Bier- und Schnapsflaschen. Das Sofa und der Sessel waren zerschlissen, der Fernsehapparat lief, aus dem Nebenzimmer schrie ein Baby. Die Tote lag auf dem Rücken, den Kopf zur Seite gedreht, die Augen weit offen. Sie war nackt, ihre Beine waren gespreizt. Ihr langes, blondes Haar war fettig und zerwühlt. Schon auf den ersten Blick erkannten die Beamten, daß hier der Tod durch Erdrosseln eingetreten war. Dicke Striemen und Blutergüsse waren am Hals zu sehen.
»Wer hat sie gefunden?« fragte Durant einen der Polizisten. »Eine Frau aus der Wohnung darüber hat uns angerufen und gemeint, daß sie heute nacht ungewöhnlichen Lärm gehört habe, aber sie habe sich nichts weiter dabei gedacht, weil es hier häufiger laut zugeht. Na ja, und dann hat sie aber doch ein paar ihr merkwürdig vorkommende Schreie gehört und hat heute morgen hier geklingelt, worauf ihr jedoch keiner aufgemacht hat. Sie hat nur das Baby schreien hören und gedacht, daß da etwas nicht stimmen könnte. Und dann hat sie uns verständigt. Wir haben die Tür aufgebrochen und sie gefunden.« Dabei deutete er auf die Tote.
»War die Tür abgeschlossen?«
»Nein, nur zugezogen.«
»Haben Sie irgend etwas hier angefaßt?«
»Nein.«
»Gut.« Sie kniff die Lippen aufeinander, kniete sich vor die Tote, die nicht älter als drei- oder vierundzwanzig zu sein schien. »Die Leute von der Spurensicherung werden sich freuen. So wie das hier aussieht. Mein Gott, wie kann jemand in so einem Müllhaufen leben?« Sie erhob sich wieder, ging in das Zimmer, wo das Baby in einem Bett lag. Es hatte die Augen weit aufgerissen. Bis auf eine Windel war es nackt, es war kühl in dem Raum. Es machte einen verkümmerten, unterernährten Eindruck.
»Ein Krankenwagen soll kommen und das Baby ins Krankenhaus bringen. Es sieht sehr vernachlässigt aus.« Sie kam zurück aus dem Kinderzimmer und sagte achselzuckend: »Dann werden wir uns mal um die Personalien und die Nachbarn kümmern. Wie heißt die Tote?«
»Verona Tietgen, geboren am 23.4.74.«
»Wohnt sie schon lange hier?«
»Keine Ahnung.«
»Gut, befragen wir die Nachbarn.«
Durant, Hellmer und Kullmer stellten die routinemäßigen Fragen, ob irgendwer aus dem Haus die Tote näher gekannt hatte, mit wem sie verkehrte, ob sie einen festen Freund hatte, ob sie arbeitete. Bereits nach einer halben Stunde wußten sie, daß Verona Tietgen seit etwas über einem Jahr hier wohnte, das Baby etwa fünf Monate alt war und sie ständig wechselnde Männerbekanntschaften hatte. Allerdings gab es einen Mann, der regelmäßig bei ihr verkehrte und der auch letzte Nacht im Haus gesehen worden war. Julia Durant glaubte nicht, daß es schwer sein würde, diesen Mann, der eventuell auch der Täter war, ausfindig zu machen. Dem ersten Eindruck nach zu urteilen, war die Getötete Alkoholikerin, wahrscheinlich sogar drogenabhängig. Zumindest schlossen die herumliegenden Spritzen diese Möglichkeit nicht aus. Verona Tietgen war, so glaubte die Kommissarin, mit ziemlicher Sicherheit von einem ihrer vielen Bekannten getötet worden, womöglich im Alkohol- oder Drogenrausch. Die Kollegen von der Spurensicherung hatten ihre Arbeit aufgenommen, auch der Arzt war eingetroffen und untersuchte die Leiche.
»Der Tod ist vor etwa fünf bis sechs Stunden eingetreten«, sagte er. »Allem Anschein nach stand sie unter Drogen- und Alkoholeinfluß. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Einstichstellen an den Armen und Beinen. Und sie hatte kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr. Mehr kann ich im Augenblick nicht sagen. Sie erfahren die Details nach Abschluß der Autopsie.«
»In Ordnung«, sagte Durant. Das Baby war inzwischen von einem Krankenwagen abgeholt worden, die erste Befragung der Nachbarn beendet. Gegen elf Uhr verließen die Kommissarin und ihre Kollegen den Tatort, die Spurensicherung würde noch eine Weile in Anspruch nehmen, danach würde die Wohnung versiegelt werden. Sie fuhren zurück ins Präsidium, wo sie einen ersten, kurzen Bericht ablieferten. Noch im Laufe des Tages würden sie sich um die Bekannten von Verona Tietgen kümmern und vielleicht schon am Abend den Täter ermitteln können. Ein Routinefall, mehr nicht.
Berger hörte dem Bericht zu, nickte nur und zündete sich eine Zigarette an. Er sagte nichts, er reichte nur wortlos Durant einen Brief. Sie zog die Stirn in Falten.
»Was ist das?«
»Keine Ahnung, lesen Sie, ist an Sie adressiert.«
Sie öffnete den Umschlag, holte ein Blatt heraus. Sie las.
Dann sah ich: Das Lamm öffnete das erste der sieben Siegel; und ich hörte das erste der vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: Komm! Da sah ich ein weißes Pferd; und der, der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben, und als Sieger zog er aus, um zu siegen.
Keine Unterschrift, nichts, außer diesen ominösen Zeilen.
»Was soll das?« fragte sie und gab den Brief Berger. Er las, runzelte die Stirn, danach lasen auch Hellmer und Kullmer. »Ein Verrückter«, meinte Kullmer nur. »Oder was meinen Sie?«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es ein merkwürdiger Brief.«
Hellmer nickte nur. »Merkwürdig und trotzdem bescheuert. Ich würde sagen, das Ding gehört in den Papierkorb.«
Die Kommissarin nahm den Brief wieder an sich, las ihn ein weiteres Mal. Sie schüttelte den Kopf. Ihre Intuition, die sie nur selten im Stich gelassen hatte, sagte ihr, daß dieser Brief eine Bedeutung hatte. Nur welche, das vermochte sie noch nicht zu sagen. Und warum war er an sie adressiert?
»Nein, ich behalte ihn. Fragt mich nicht, warum, aber irgendwas steckt dahinter.«
»Wer’s glaubt, wird selig«, meinte Kullmer lakonisch und steckte sich eine Zigarette an.
»Das Lamm öffnete das erste der sieben Siegel! Pah, was für ein Blödsinn! Hört sich an, wie irgend so ein Schwachsinn von Shakespeare oder Goethe oder …«
»Ein Zitat aus der Bibel«, erwiderte Durant lakonisch.
»Aus der Bibel?« fragte Hellmer. »Wie kommst du darauf?«
»Mein Vater war Priester. Ein wenig kenne ich mich in der Bibel aus. Soweit ich mich erinnern kann, stammt das Zitat aus der Johannesoffenbarung. Ich werde später zu Hause nachsehen, ob ich es in meiner Bibel finde.«
»Sie haben eine Bibel?« fragte Kullmer anzüglich grinsend. »Tja, es soll Leute geben, die sich ab und zu auch mit etwas Anständigem beschäftigen«, gab sie spitz zurück.
»Schwachsinn. Wenn das wirklich aus der Bibel stammt, dann haben wir es hier vielleicht mit einem religiösen Fanatiker zu tun. Vielleicht mit einem, der sich auserkoren fühlt, die ach so böse Welt zu retten.«
»Wenn Sie meinen. Aber im Augenblick haben wir Wichtigeres zu tun. Wir haben nämlich noch einen Mord zu bearbeiten. Also, machen wir uns an die Arbeit.« Sie blickte zur Uhr, kurz vor zwölf. Sie hatte Hunger. »Ich werde mir jetzt eine Currywurst holen, danach sollten wir mal sehen, ob die Spurensicherung schon etwas Brauchbares zu bieten hat.«
Hellmer erhob sich von seinem Stuhl. »Ich komme mit. Ich könnte nämlich auch was zu essen vertragen.«
Gemeinsam verließen Julia Durant und Hellmer das Büro, überquerten die Mainzer Landstraße und gingen in einen kleinen Imbiß in der Nähe des Präsidiums. Sie aßen jeder eine Currywurst und tranken ein kleines Glas Bier, bezahlten und kehrten um halb eins zurück. Berger war allein im Büro, Kullmer war noch einmal an den Tatort gefahren.
»Und, hat die Spurensicherung schon angerufen?« fragte die Kommissarin.
»Nein, aber Sie können ja mal kurz nachfragen.«
Sie zündete sich eine Zigarette an, nahm den Hörer vom Telefon, wählte die Nummer. Sie hatte den Notizblock vor sich liegen. Sie sagte »Ja« und »Das hilft uns weiter« und »Danke« und legte wieder auf. Sie hatte sich ein paar Namen aufgeschrieben.
»Ich denke, wir werden den Kerl bald haben. Sie haben zahlreiche Fingerabdrücke gefunden, von denen drei zu Typen gehören, die einschlägig vorbestraft sind. Helmut Maier wegen Drogenbesitzes und -handels, Georg Zickler wegen Notzucht und Mißhandlung Minderjähriger und Karl-Heinz Schenk wegen versuchten Totschlags und Drogenhandels. Ich nehme mal an, daß einer von den dreien die junge Frau umgebracht hat.« Sie drückte ihre halbgerauchte Zigarette im Aschenbecher aus, nahm ihre Handtasche und sagte: »Dann holen wir uns mal die Fotos der drei und legen sie den Hausbewohnern vor.«
Berger nickte. Er wußte, der Fall würde schnell geklärt sein. Als Durant und Hellmer die Tür hinter sich geschlossen hatten, zog er die unterste Schublade seines Schreibtischs heraus, hob einige Akten an und holte eine halbvolle Flasche Weinbrand hervor. Er schraubte den Verschluß ab, nahm einen kräftigen Schluck, verschloß die Flasche wieder und legte sie zurück in ihr Versteck.
Julia Durant und ihre Kollegen hatten die Fotos der Verdächtigen den Hausbewohnern gezeigt. Immer wieder wurde auf das Bild, das Karl-Heinz Schenk zeigte, gedeutet. »Der war auch gestern abend hier«, sagte eine Nachbarin. »Ich bin ihm im Treppenhaus begegnet, das war so gegen elf, nach den ›Tagesthemen‹. Er kam gerade hoch, als ich mit meinem Hund noch mal auf die Straße bin. Als ich zurückkam, etwa eine halbe Stunde später, war es ziemlich laut in der Wohnung.«
»Laut? Inwiefern?«
»Musik, das Baby hat geschrien, was die beiden aber offensichtlich nicht weiter gestört hat, denn sie haben sehr laut geredet und vor allem gelacht.«
»Gelacht?«
»Na ja, gelacht eben. Was weiß ich, was die getrieben haben. Aber irgendwann hat der Krach aufgehört …«
»Und dann später in der Nacht wieder angefangen«, sagte die andere Nachbarin, die auch die Polizei alarmiert hatte. »Mitten in der Nacht ist es richtig laut geworden.«
»Und warum haben Sie nichts unternommen? Warum haben Sie sich nicht beschwert oder gleich die Polizei gerufen?«
Die alte Frau schüttelte nur müde lächelnd den Kopf. »Nein, nein, so einfach geht das hier nicht. Schauen Sie, ich lebe allein, und das sind junge Leute. Ich habe keine Lust und auch keine Kraft mehr, mir Ärger wegen so was einzuhandeln. Es war ja nicht jede Nacht so.«
»Aber es kommt oder, sagen wir, kam öfter vor, oder?«
»Na ja, ab und zu. Aber letzte Nacht war es schon besonders laut. Und dann später noch die Schreie, aber …« Sie zuckte mit den Schultern und sah zu Boden. »Es tut mir leid, ich habe ja nicht ahnen können, was da unter mir passiert ist.«
»Nein, das konnten Sie nicht«, sagte Julia Durant. »Trotzdem vielen Dank für Ihre Hilfe.«
»Ich hoffe, Sie finden den Kerl bald. Solche Schweine gehören für den Rest ihres Lebens ins Zuchthaus. Bringen eine junge Mutter um!«
»Ich denke, wir werden ihn finden«, sagte die Kommissarin. Sie ging zum Auto zurück.
Auch diesmal war es das gleiche wie so oft, man hörte oder sah etwas Verdächtiges, aber man hatte Angst. Erst kürzlich war in einer vollbesetzten U-Bahn um kurz nach zwanzig Uhr eine junge Frau von vier Halbwüchsigen zusammengeschlagen und vergewaltigt worden, ohne daß auch nur einer der Fahrgäste eingeschritten wäre. Nicht das Verbrechen an sich machte sie wütend, sondern die Angst und zum großen Teil auch Teilnahmslosigkeit der anderen Menschen. Vom Auto aus veranlaßte sie, daß die Fotos der drei Verdächtigen an sämtliche Polizeistationen im Rhein-Main-Gebiet weitergeleitet wurden. Als nächstes fuhr sie mit Hellmer zu der Adresse, unter der Karl-Heinz Schenk gemeldet war. Er wohnte im dritten Stock eines von außen wie von innen unscheinbaren, aber sauberen Mehrfamilienhauses.
Julia Durant klingelte, er öffnete die Tür. Er trug Designer-Jeans, teure, italienische Schuhe und ein Seidenhemd. Um den Hals hatte er eine goldene Panzerkette, am linken Handgelenk eine Rolex. Sie hielt ihren Dienstausweis vor das Gesicht mit dem dunklen Dreitagebart.
»Herr Schenk?«
»Ja?« fragte er mit zu Schlitzen verengten Augen.
»Dürfen wir reinkommen?«
»Was gibt’s denn?«
»Nur ein paar Fragen, mehr nicht.«
Er gab die Tür frei, ließ Durant und Hellmer eintreten. Schenk setzte sich auf die Couch, nahm ein Glas Bier und trank einen Schluck. Keine Spur von Nervosität.
»Sie kennen eine Verona Tietgen?«
»Kann sein«, sagte er und tat gelangweilt.
»Kennen Sie sie, oder kennen Sie sie nicht?«
»Was wollen Sie von mir?«
»Frau Tietgen ist letzte Nacht einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.«
»Und was habe ich damit zu tun?«
»Nun, ganz einfach. Wir haben ihre Fingerabdrücke überall in der Wohnung gefunden, und außerdem sind Sie gestern am späten Abend gesehen worden, wie Sie das Haus, in dem Frau Tietgen wohnte, betreten haben.«
Schenk grinste und schenkte sich Bier nach. »Und weiter? Ist das alles?«
»Nein. Niemand hat gesehen, wie Sie das Haus verlassen haben. Zumindest nicht, bevor Frau Tietgen getötet wurde.«
»Na und, was will das besagen?«
»Hatten Sie gestern nacht mit Frau Tietgen Geschlechtsverkehr?«
»Scheiße, was soll das? Wollen Sie mich über mein Sexualleben befragen?«
»Hatten Sie, oder hatten Sie nicht?«
»Ja, verdammt noch mal, wir haben miteinander geschlafen.«
»Und wann haben Sie das Haus verlassen?«
»Keine Ahnung, hab nicht auf die Uhr gesehen.«
»Sie haben sich aber auch gestritten.«
»Wer sagt das?«
»Das ist doch egal. Es war jedenfalls nicht zu überhören gewesen. Um was ging es bei dem Streit?«
»Keine Ahnung. Unwichtig.«
»Lieber Herr Schenk, unwichtig ist in diesem Fall gar nichts. Also, um was ging’s? Drogen?«
Schenk sah kurz zu Durant, dann zu Hellmer, der sich Notizen machte. »Ich will meinen Anwalt sprechen.«
»Oh, Sie wollen jetzt schon einen Anwalt haben? Dann steckt also doch mehr dahinter.«
»Sie können mich mal. Ohne meinen Anwalt sage ich kein einziges Wort mehr.«
»Okay, Sie können mit Ihrem Anwalt sprechen, aber auf dem Präsidium. Sie sind nämlich vorläufig festgenommen. Und zwar wegen des dringenden Tatverdachts, Verona Tietgen heute in den frühen Morgenstunden getötet zu haben.«
»O verdammt, ich habe sie nicht erwürgt!«
Die Kommissarin grinste ihn an, ließ einen Moment verstreichen, sah, wie Schenk mit einem Mal kalkweiß wurde. »Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen gesagt zu haben, wie Frau Tietgen getötet wurde. Tja, ich schätze, wir gehen dann mal. Wenn ich bitten dürfte.« Hellmer holte die Handschellen aus der Jackentasche. »Stehen Sie bitte auf, und drehen Sie sich um. Die Hände bitte hinter den Rücken.«
Schenk stand langsam auf, Hellmer legte ihm die Handschellen an. Sie fuhren ins Präsidium, Schenks Anwalt wurde verständigt und traf eine halbe Stunde später ein. Er beriet sich kurz mit seinem Mandanten im Vernehmungszimmer, bevor dieser abwechselnd von Durant und Hellmer befragt wurde. Gegen neunzehn Uhr erklärte er, daß er kein Wort mehr zu dem Fall sagen wolle.
»Hat Frau Tietgen Sie in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«
»Hat sie Drogen von Ihnen bekommen oder gefordert?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«
»Wie Sie wollen, es ist Ihre Zeit. Nur noch eine Frage – haben Sie Verona Tietgen heute in den frühen Morgenstunden getötet?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«
»Gut, dann werden wir Sie jetzt in Ihre Zelle zurückbringen lassen. Aber über eines sollten Sie sich im klaren sein – Sie stehen nicht nur mit einem, sondern mindestens mit anderthalb Beinen im Zuchthaus. Die Indizien sprechen eindeutig gegen Sie. Wir sehen uns dann morgen. Gute Nacht.«
Ein uniformierter Beamter legte ihm Handschellen an und führte ihn aus dem Zimmer. An der Tür drehte Schenk sich noch einmal um. »Und wenn ich es war, was passiert dann mit mir?«
»Weiß nicht, das hat letztendlich der Richter zu entscheiden. Sie kennen das ja, von Notwehr über Totschlag bis hin zu vorsätzlichem Mord ist alles möglich.«
»Ja, klar, ich denke, es war Notwehr. Sie hat mich ausgesaugt.«
»Was meinen Sie damit?«
»Gute Nacht.«
Die Kommissarin vermutete, daß Verona Tietgen sterben mußte, weil sie vielleicht immer mehr Geld für Drogen von Schenk forderte, vielleicht hatte sie ihn unter Druck gesetzt. Womit, darüber konnte man im Augenblick nur spekulieren. Es interessierte Durant jetzt auch nicht weiter. Sie wußte, daß Schenk der Täter war, und es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis er ein umfassendes Geständnis ablegte.
Gegen zwanzig Uhr fuhr Julia Durant nach Hause, sah die wenige Post durch, ließ sich Badewasser einlaufen, machte sich eine Scheibe Brot mit Salami und trank eine Flasche Bier. Sie stellte den Fernsehapparat an, setzte sich nach dem Baden in Unterwäsche auf ihren Sessel, nahm den anonymen Brief aus ihrer Handtasche und las ihn zum dritten Mal. Sie holte die Bibel aus dem Bücherregal, schlug die Johannesoffenbarung auf, blätterte schnell ein paar Seiten, bis sie auf die in dem Brief geschriebenen Zeilen stieß. Sie wußte nicht, warum dieser Brief abgeschickt worden war, vor allem aber wußte sie nicht, warum er ausgerechnet an sie adressiert war. Vielleicht war es ein Zufall, aber sie hatte aufgehört, an Zufälle zu glauben. Vielleicht war dieser Brief nur der Anfang eines Spiels, doch was für ein Spiel das sein sollte, konnte sie nicht einmal erahnen.
Um zehn schaltete sie den Fernsehapparat wieder aus und ging zu Bett. Sie hatte diesmal die Vorhänge zugezogen, das Fenster gekippt. Sie schlief schnell ein.
Er ging langsam von der Garage zum Haus, das hell erleuchtet war. Er schloß die Tür auf, betrat den langen, geräumigen Flur, stellte seinen Koffer auf den Boden, zog die Jacke aus und hängte sie an die Garderobe. Er lockerte seine Krawatte, öffnete den obersten Knopf seines Hemdes, nahm den Koffer und ging ins Wohnzimmer. Anna, das Hausmädchen, kam ihm aus der Küche entgegen, eine treue Seele, auf die er sich jederzeit verlassen konnte. Seit seine Frau aus der Psychiatrie entlassen worden war und die Tage meist damit zubrachte, im Sessel zu sitzen und ins Leere zu starren, mußte Anna noch eine zusätzliche Aufgabe übernehmen, nämlich darauf zu achten, daß seine Frau nichts Unbedachtes tat, nicht noch einmal versuchte, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Fast fünf Jahre war es jetzt her, seit sie fünfzig Tabletten Rohypnol zusammen mit einer halben Flasche Cognac eingenommen hatte, und es war Anna zu verdanken, daß sie noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden konnte, wo man ihr den Magen auspumpte und sie danach noch zwei Wochen in einem komaähnlichen Zustand verbrachte, aus dem sie erst allmählich erwachte.
Aber sie war nicht mehr die Frau der vergangenen Jahre, lebenslustig und voller Elan, ihre Augen strahlten nicht mehr im alten Glanz, in ihrem Gesicht zeigte sich kaum noch eine Regung. Auch wenn ihr Körper noch lebte, bisweilen in einer Art katatonischer Starre, so hatte sie doch innerlich aufgehört zu leben. Ihre Seele hatte mit dieser Welt abgeschlossen, mit dieser für sie so grausamen, ungerechten und unmenschlichen Welt. Dabei war sie gerade einmal sechsundvierzig Jahre alt, mittelgroß und schlank, sie hatte dunkelblondes Haar, das in sanften Schwüngen bis knapp über ihre Schultern fiel, ein makelloses, markantes Gesicht mit großen, azurblauen Augen, vollen, sinnlichen Lippen, leicht hervorstehenden Wangenknochen und einer geraden, schmalen Nase. Ein Gesicht, das bis vor zwanzig Jahren von den Titelblättern zahlreicher Magazine strahlte. Bis sie zum zweiten Mal schwanger wurde und ihre Karriere zugunsten der Familie aufgab. Aber sie sagte, sie habe es nie bereut, denn erst durch die Kinder habe sie den wahren Sinn des Lebens erkannt. Und sie war eine gute Mutter und versuchte den Kindern das zu geben, was sie brauchten, sie schimpfte nur selten, nicht ein einziges Mal hatte sie ihre Hand heben müssen.
Sie waren eine intakte Familie – bis vor acht Jahren. Irgend etwas war geschehen, irgend etwas Unheimliches hatte sich in diese Harmonie gedrängt, langsam, schleichend, unbemerkt. Und als sie es bemerkten, war es zu spät. Erst war es Carla, die sich zunehmend veränderte und eines Tages einfach verschwunden war. Wohin, das wußte keiner. Sie suchten sie, schalteten die Polizei ein, aber es gab keinen Hinweis darauf, wo Carla sich aufhielt. Und je mehr Zeit verstrich, desto mehr waren sie überzeugt, daß Carla tot war. Nur einer wollte nicht an Carlas Tod glauben, Patrick, ihr Bruder. Es war eine fast abgöttische Liebe, die er für seine Schwester empfand, und er setzte all seine Energie ein, sie zu finden oder zumindest eine Gewißheit zu haben – entweder ob sie lebte und einigermaßen wohlbehalten war, oder ob sie tot war. Wenn die Polizei und seine Eltern auch längst die Hoffnung und Suche aufgegeben hatten, er war überzeugt, sie eines Tages zu finden.
Und er hatte sie tatsächlich gefunden, doch irgend jemand wollte nicht, daß er sie mit nach Hause nahm. Man hatte seine Leiche am Stadtrand von Friedberg entdeckt, zwei Kugeln aus einer 357er Magnum hatten seine Brust und seinen Kopf durchdrungen.
Patricks Mutter war bei der Nachricht zusammengebrochen, sie hatte zunächst für mehrere Tage jegliche Nahrungsaufnahme verweigert und war von einem Weinkrampf in den nächsten gefallen – es war so sinnlos, so irrational, daß ausgerechnet ihr Sohn sterben mußte. Daß er auf so schäbige Weise von dieser Welt genommen worden war. Und für sie war es absurd zu hören, daß Patrick in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sei. Sie wußte nicht, daß er seine Schwester Carla gefunden hatte und dies der Grund für seinen Tod war. Auch Patricks Vater wußte nichts über die wahren Hintergründe, ebensowenig wie die Polizei. Aber für die Polizei war klar, warum Patrick ermordet worden war – bei seiner Leiche fand man zwanzig Gramm gestrecktes Heroin, mehrere Tütchen Kokain sowie viertausend Mark. Doch sein Vater mochte nicht an diese unglaubliche Theorie glauben, geschweige denn seine Mutter. Patrick, ein Dealer – niemals! Es mußte einen anderen Grund geben, weshalb er mit noch nicht einmal zwanzig Jahren ermordet worden war.
Als Patricks Mutter auch am zehnten Tag nach seinem Tod nichts gegessen und fast nichts getrunken hatte, wurde sie auf ärztliche Anordnung in eine Klinik eingewiesen, wo sie künstlich ernährt wurde. Nach drei Wochen schien sich ihr Zustand gebessert zu haben, doch als sie wieder zu Hause war, fiel sie in immer tiefere Depressionen, sie begann zu trinken und den Tag damit zuzubringen, im Sessel vor dem Kamin zu sitzen und vor sich hinzustarren oder stundenlang Bilder ihrer Kinder anzuschauen und dabei zu weinen. Erst hatte sie Carla verloren, weshalb, an was, an wen? – sie hatte keine Antwort darauf. Und jetzt auch noch Patrick. Doch in ihrem tiefsten Innern glomm noch ein winziger Funken Hoffnung, daß wenigstens Carla eines Tages zurückkehren würde. Bis zu jenem Morgen, an dem Spaziergänger sie in einem Waldstück in der Nähe von Frankfurt fanden. Ihre nackte Leiche war noch relativ unverwest, der Tod erst knapp einen Tag vor ihrem Auffinden eingetreten, wie die Autopsie eindeutig ergab. Ihr Körper war von unzähligen Einstichstellen übersät. Die Obduktion hatte ebenso ergeben, daß Carla nicht nur an einer Überdosis Heroin gestorben war, sondern auch noch eine akute Alkoholvergiftung hatte, der Promillegehalt ihres Blutes zum Zeitpunkt des Todes wurde laut gerichtsmedizinischem Gutachten mit knapp 5,3 Promille angegeben, ein absolut sicherer Todescocktail. Außerdem wurden mehrere verschiedene Spermaspuren sowohl im Vaginal- als auch im Analbereich nachgewiesen, dazu eine chronische Leberentzündung, zwei Magengeschwüre, von denen eines bereits einmal durchgebrochen war, vor allem aber war das Mädchen mit dem HI–Virus infiziert. Wo sie sich den Virus eingefangen hatte, vermochte keiner zu sagen, ob durch eine verseuchte Spritze oder ungeschützten Geschlechtsverkehr …
Es blieben so viele Fragen offen. Warum war sie von einem Tag auf den anderen verschwunden? Wo hatte sie gelebt? Was hatte sie getan, um das Geld für ihren Stoff zu beschaffen? Wann war sie süchtig geworden? Und warum war sie gestorben? Auf die letzte Frage hatte einer der Kriminalbeamten vom Drogendezernat lakonisch geantwortet, es sehe fast so aus, als habe sie sich das Leben genommen. Wer trinkt schon so viel Wodka auf einmal und gibt sich dann noch eine Überdosis fast reinen Heroins?
Carlas Mutter hatte nicht geweint, als sie vom Tod ihrer Tochter erfuhr. Sie war damals allein zu Hause gewesen, nur Anna, das Hausmädchen, war bei ihr. Nachdem ihr die Todesnachricht überbracht worden war, war sie nach oben ins Bad gegangen, hatte sich eingeschlossen, die fünfzig Tabletten Rohypnol mit einer halben Flasche Cognac runtergespült und darauf gewartet, daß auch für sie das Leben endlich ein Ende hatte. Doch Anna hatte sie gerade noch rechtzeitig gefunden, den Notarzt alarmiert, der sie sofort ins Krankenhaus bringen und den Magen auspumpen ließ. Nach einigen Tagen wurde sie in die geschlossene Abteilung des St.-Valentius-Krankenhauses, einer psychiatrischen Klinik im Rheingau, überwiesen, wo sie, mit Unterbrechungen, mehr als zwei Jahre zubrachte, wo man versuchte, ihr das Leben mit Tabletten und therapeutischen Maßnahmen wieder einigermaßen erträglich zu machen.
Doch trotz Tabletten und Therapie, die Bilder ihrer Kinder waren gegenwärtig, sie würde sie nie vergessen können, nie das Leid überwinden, das der Tod der beiden über sie gebracht hatte. Und die Polizei hatte nichts unternommen.
Ihr Mann hatte es in dem alten Haus nicht mehr ausgehalten, sie waren umgezogen, von dem kleinstädtischen Friedberg in das vierzig Kilometer entfernte Frankfurt, hatten sich eine Villa am Lerchesberg gekauft, von wo aus man vor allem abends einen herrlichen Blick auf das nächtliche Frankfurt hatte.
Seit drei Jahren lebte sie wieder zu Hause. Nur das Licht der Standleuchte neben dem Kamin brannte. Er bewegte sich fast lautlos über den tiefen, weichen Teppichboden auf seine Frau zu, stellte den Koffer neben dem Sessel ab, kniete sich vor sie, sah sie von unten herauf an. Für den Bruchteil einer Sekunde huschte so etwas wie ein Lächeln über ihr Gesicht, schien der Hauch eines Glanzes das sonst leere Gesicht zu überziehen, doch mit einem Mal war da wieder diese Leere, der stumpfe Blick, die Teilnahmslosigkeit. Er faßte ihre kalten Hände, legte seinen Kopf auf ihre Schenkel. Dann blickte er wieder auf, fragte: »Hattest du einen angenehmen Tag?«
»Es geht«, murmelte sie, ohne ihn anzusehen.
»Es tut mir leid, Schatz, daß ich so spät komme, aber ich hatte heute furchtbar viel zu tun. Es wird aber nicht mehr oft vorkommen, das verspreche ich dir. Ehrenwort.«