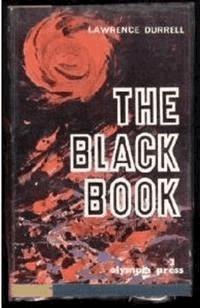Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gatsby
- Sprache: Deutsch
Nachts, wenn der Wind um die abgelegene griechische Insel tost, tastet sich der Schriftsteller Darley Glied um Glied an der Kette der Erinnerung zurück nach Alexandria. Erst jetzt, Jahre nach den Ereignissen, meint er alles zu verstehen, die schicksalhaften Begegnungen in der schillernden ägyptischen Hafenstadt, mit der Tänzerin Melissa, dem britischen Diplomaten Mountolive, der Malerin Clea, dem jüdischen Arzt Balthazar, der seine Homosexualität hemmungslos auslebt und vielen anderen, besonders aber seine tragische Affäre mit der rätselhaften, wunderschönen Jüdin Justine, der notorisch untreuen Ehefrau des wohlhabenden koptischen Bankiers Nessim. Doch was geschah wirklich, damals in den 1930er Jahrenin Alexandria, diesem Schmelztiegel der Religionen, Sprachen und Kulturen, der »großen Kelter der Liebe«? Drei weitere Figuren werden von ihren Verstrickungen in diese Geschichte erzählen, für jede von ihnen bedeutet sie etwas anderes. Gemeinsam bilden diese vier Romane einen einzigartigen Liebesreigen, ein Geflecht aus Kriminal- und Spionagegeschichten, das Porträt einer Stadt - eine so kunstvolle wie spannende Tetralogie um Täuschungen und Leidenschaften, die Literaturgeschichte geschrieben hat, in einer Prosa, deren Sog man sich nicht entziehen kann. Eine schriftstellerische Meisterleistung, sinnlich, üppig, einzigartig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1823
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lawrence Durrell
Das Alexandria-Quartett
JustineBalthazarMountoliveAus dem Englischen von Maria CarlssonCleaAus dem Englischen von Walter Schürenberg und Maria Carlsson
Gatsby
Vorwort
Diese vier Romane sollten unter dem gemeinsamen Titel Das Alexandria-Quartett als ein Werk gelesen werden; ein geeigneter beschreibender Untertitel wäre: »ein Wortkontinuum«. Bei dem Versuch, meine Form zu entwickeln, bediente ich mich, im Sinne einer groben Analogie, der Prämisse der Relativität. Die ersten drei Romane wurden so angelegt, dass sie einander ergänzen sollten, als »Geschwister«, nicht als »Fortsetzungen«; nur der letzte Roman war als regelechte Fortsetzung gedacht, um die Zeitdimension zu entfesseln. Die Grundidee war, der seriellen Form des konventionellen Romans, des zeitgesättigten Romans unserer Tage, etwas entgegenzusetzen.
Unter »Vorstudien« am Ende habe ich mögliche Wege skizziert, die Figuren und Situationen in weiteren Fortsetzungen zu entfalten – jedoch nur um zu verdeutlichen, dass selbst wenn diese vier Romane ins Unendliche erweitert würden, daraus niemals ein roman fleuve würde; gesetzt den Fall also, das Fundament ist stabil, sollte dieses Werk in jede mögliche Richtung strahlen, ohne dabei die Strenge und Kongruenz als »Kontinuum« einzubüßen.
Frankreich 1962
Justine
Vorwort
von André Aciman
»Nur die Stadt ist wirklich.« So lautet der letzte Satz der Bemerkung, die Lawrence Durrell Justine voranstellt. »Die Gestalten dieses Romans«, schreibt er, »sind ebenso wie die des Erzählers erfunden und haben keine Ähnlichkeit mit lebenden Personen.« Und dann folgen die fünf umwerfenden Wörter: »Nur die Stadt ist wirklich.«
Für jemanden wie mich, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Alexandria geboren wurde und aufwuchs, ist es schwer zu glauben, dass Durrells Stadt je existiert haben könnte. Vielleicht hat sich die Stadt in den Jahren zwischen seiner Zeit dort und meiner komplett verändert. Die Spuren des Alexandria, das er während der frühen vierziger Jahre gekannt hatte, als Britisches und Europäisches alles durchdrungen hatte, waren fast vollkommen verschwunden aus dem Alexandria, das ich in den fünfziger und sechziger Jahren kennenlernte, als der ägyptische Nationalismus alle abendländischen Überreste so rasch wie möglich beseitigte. Viele der Häuser, Theater, Cafés, Hotels, Parks und Restaurants, die Durrell gekannt und im Alexandria-Quartett erwähnt hatte, waren zwar noch da, aber sogar für den frühen Teenager, der ich damals war, war es offensichtlich, dass sie den welken Zauber einer vergangenen Welt angenommen hatten, der rasch dahinschwand, je mehr Europäer Ägypten verließen oder tatsächlich vertrieben wurden. Die multinationale, multiethnische, multi-alles Stadt, die laut Durrell »fünf Rassen, fünf Sprachen, ein Dutzend Glaubensbekenntnisse, fünf Verbindungskanäle … und mehr als fünf Geschlechter« beherbergt hatte, war bereits verschwunden. Heute steht an ihrer Stelle eine andere Stadt. Gibt man einem jungen ägyptischen Taxifahrer eine alte Adresse, wird er sich mit großer Wahrscheinlichkeit verfahren. Überall sind neue Viertel entstanden, alte Häuser und Villen wurden – mit oder ohne offizielle Genehmigung – abgebrochen, und die Schilder mit den alten Straßennamen wurden alle abmontiert und durch Schilder mit neuen Namen ersetzt. Taucht der einst europäische Name eines Viertels noch auf einem für Touristen bestimmten Stadtplan auf, ist er in der Regel dermaßen schlecht aus dem Arabischen transliteriert, dass man beim besten Willen nicht mehr erkennen kann, was einmal eine ganz gewöhnliche englische, französische oder deutsche Bezeichnung war. Lawrence Durrell würde sich in der heutigen Stadt nicht verirren, denn das Grundraster ist im Wesentlichen erhalten. Doch er würde sie nicht als das Alexandria wiedererkennen, das er gekannt hat.
Von der Existenz des Alexandria-Quartetts erfuhr ich erstmals 1964, als ich mitbekam, wie eine meiner amerikanischen Lehrerinnen in Alexandria in der Schulbibliothek mit einer anderen Lehrerin sprach. Sie hielt dabei ein Buch in der Hand, auf dessen Umschlag eine Palme vor einem dunkelroten Hintergrund zu sehen war, und empfahl ihrer Kollegin, es zu lesen, da sie schließlich beide in Alexandria lebten und unterrichteten. Auf der Stelle, und vielleicht weil ich diese Lehrerin nicht mochte, kam ich zum Schluss, dass sie von Literatur keine Ahnung habe, weshalb ich auch ihre Empfehlung in den Wind schlug. Drei Jahre später und ein Jahr nach der Vertreibung meiner Familie aus Alexandria beschloss ich eines schönen Frühlingstags in Rom, Justine zu kaufen, auf Empfehlung einer anderen Lehrerin, die gehört hatte, dass ich in Alexandria geboren sei. Sowie ich am späteren Nachmittag die ersten Abschnitte gelesen hatte, wurde ich in eine Stadt zurückgeworfen, die ich zu kennen geglaubt hatte, doch nun unvermittelt wieder besuchen wollte, und wäre es nur, um Gegenden zu erkunden, die ich vor meinem Abschied vernachlässigt hatte. Ich saß auf einer der Stufen der Spanischen Treppe, wo ich gern frisch gekaufte Bücher zu lesen begann, bevor ich zum Abendessen nach Hause ging. Das Buch zog mich vollkommen in den Bann, wobei ich nicht weiß, ob es an Durrells Stil oder dem hemmungslosen Liebesleben seiner Figuren lag, dass ich in eine Stadt zurückbefördert wurde, die ich nie wirklich gekannt und von der ich geglaubt hatte, sie sei dies auch nicht wert; nun aber entdeckte ich sie, wenn auch mit Verspätung, neu – durch die Augen eines anderen. Ich war zu jung gewesen, um all die verschlungenen Gassen und exotischen Winkel Alexandrias zu erkunden, und konnte mir auch nicht vorstellen, dass sich entlang all der Straßen, durch die ich seit meiner Kindheit gegangen war, Möglichkeiten erotischer Lustbarkeiten auftaten, die übersehen zu haben ich nun bedauerte. Jemand hatte mir schließlich gesagt, Durrells Alexandria habe es nie gegeben und hätte es auch nie geben können. Doch das konnte ich nicht glauben, jetzt nicht mehr: Da waren schlicht zu viele Dinge, die ich wiedererkannte. Das Alexandria, das ich gekannt hatte, war voll interessanter Menschen gewesen, die nett und gebildet waren, sich für Kultur begeisterten und von denen viele, höflich ausgedrückt, ein Doppelleben führten. Justine, Melissa, Clea, Balthazar, Scobie, Nessim – die musste es doch alle geben; schließlich sah ich sie vor mir. Und wo anders als in Alexandria hätte ein Dichter wie Kavafis leben können? Sein Gedicht »Die Stadt« erzählte das einzig Wahre über meine Geburtsstadt: dass man sie nie aus seinem Herzen vertreiben kann. Ich hatte in Rom geglaubt, Alexandria vergessen zu haben. Falsch. »Diese Stadt wird dir folgen«, sagte der Dichter. Sie würde mich nie verlassen, so wenig, wie ich sie verlassen würde, und so wenig, wie ich die Namen mancher Haltestellen vergessen könnte, die Durrell erwähnte: Saba Pacha, Mazloum, Zizinia, Bacos, Schutz, Gianaclis – ich kannte sie alle. Ich liebte ihre Namen. Die Stadt, ob wirklich oder unwirklich – war das nicht egal?
Am selben Abend in meinem Schlafzimmer in Rom muss ich die Hälfte von Justine gelesen haben. Es war ein Freitagabend, das weiß ich noch. Ich war sechzehn, und zum ersten Mal in meinem Leben sehnte ich mich nach meiner Stadt – der wirklichen oder der unwirklichen, mich kümmerte das nicht. Wenn es Durrells Stadt sein musste statt meiner, dann war das eben so.
Nach dieser Nacht war ich nicht mehr derselbe.
Durrell erfand eine Stadt, die sich auch anderswo hätte befinden können. Abgesehen von einigen immer wieder im Quartett aufscheinenden spezifischen Details – den nachklingenden Namen von Straßenbahnhaltestellen, Parks und zahllosen angesagten Treffpunkten – hätte man statt Alexandria leicht Venedig, Istanbul, Jerusalem oder Hongkong einsetzen können. Das sind alles Städte, die im Lauf der Jahrhunderte von so verschiedenen Kolonisten überrollt und überschrieben worden sind, dass sie nicht allein in der Gegenwart existieren und sich nicht auf eine einzige Identität festlegen lassen. Sind sie zu einem Teil auf die jenseitige Welt ausgerichtet und scheinen nach dem Kommenden Ausschau zu halten, ist ihre Kehrseite einer Vergangenheit zugewandt, die wie die Wüste ein Binnenhinterland bildet, das immer da ist und dessen Staub nachts unbemerkt hereindringt und sich auf das Bewusstsein legt, wie etwas Uraltes, Unvergängliches, das man hasst und meist verdrängt. Die beiden Seiten befinden sich in einem anhaltenden Kampf quälender Gedanken, der viel Kraft aufzehrt. Die Menschen wissen nicht mehr, wer sie sind, noch verstehen sie, was andere in ihrem Leben zu suchen haben. Liebe, wenn sie in Durrells Alexandria vorkommt, definiert niemanden, rettet niemanden und verschont niemanden, sie bleibt ihrer Volatilität zum Trotz eine entwertete Währung; die Erinnerung wiederum gilt wie eine alte Maßeinheit, die außer Gebrauch geraten ist, als nicht verlässlich und wird entsprechend wenig geschätzt.
Alexandria ist eine in sich zusammengesunkene alte Stadt, gebeutelt von zu viel Groll, Reue und ähnlichen Dingen. Sie ist immer kurz vor dem Zusammenbrechen. Und manchmal tut sie das auch.
Durrells Alexandrinerinnen und Alexandriner sind nicht anders. Ja, es ist unmöglich, die Stadt von ihren Bewohnern zu trennen. Jeder Zustand kann der Stadt zugeschrieben werden, doch projiziert sie ihn auf ihre Bevölkerung zurück in einem Möbiusband der Übertragungen zwischen Ort und Menschen. Die Stadt kümmert sich nicht um ihre Bewohner: Sie gehören nicht wirklich zur Stadt, doch sie sind da, es hat sie dorthin verschlagen, nun stützen sie sich aufeinander und schieben sich gegenseitig die Schuld zu. »Die Stadt [stürzte uns] in Konflikte, welche die ihren waren und welche wir irrtümlich für die unsren hielten«, schreibt er auf der allerersten Seite, fügt dann ein paar Sätze später allerdings hinzu: »Die Stadt sollte gerichtet werden, wenn auch wir, ihre Kinder, den Preis dafür zahlen müssen.« Wo die Stadt endet und wo ihre Liebenden anfangen, ist ein Rätsel, das nie gelöst werden wird. Alexandria mag, wie Durrell in Clea schreibt, »ein armseliger kleiner Seehafen« sein, »gebaut auf einem Sandriff, ein moribundes, rückständiges Kaff«, doch die Gehsteige, die Geräusche, selbst die Luft pulsieren vor ungehemmtem, unerforschtem Begehren.
Wenn Durrell Alexandria auch nicht erfunden hat, so hat er es jedenfalls neu erfunden. Er griff zurück auf den exotischen und esoterischen Glanz, den die Stadt am Ende der Antike hatte, er griff zurück auf den modernen griechischstämmigen alexandrinischen Dichter Konstantinos Kavafis, auf E.M. Forsters Alexandria-Stadtführer, auf den illustren Ruf der Stadt als Ort gepflegter Ausschweifungen, und da er nicht in England leben mochte, muss er sich zu Hause gefühlt haben an einem Ort, wo alle Sprachen jedermanns Muttersprache waren und wo es so viele Spielarten der Sexualität gab, dass niemand zu kurz kam. Durrells erfundenes Alexandria spiegelt des Autors Leidenschaft für den Süden Europas und das Mittelmeerbecken; er hatte auf Korfu, Rhodos und Zypern gelebt, in Alexandria, Athen, Serbien und verschiedenen Gegenden Frankreichs, wo er sich schließlich niederließ und 1990 nach vier Ehen starb.
Er stammte aus einer Familie, die sich wohl nie irgendwo wirklich zu Hause gefühlt hatte. Er wurde 1912 als Kind anglo-irischer Eltern in Indien geboren und nach England in ein Internat geschickt. Er war kein besonders guter Schüler, veröffentlichte aber mit neunzehn Jahren seinen ersten Gedichtband. Mit dreiundzwanzig war er bereits verheiratet und überredete seine Mutter, seine Geschwister und seine junge Frau, nach Korfu zu ziehen. Es gab noch weitere Umzüge, bis seine Frau und er bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Alexandria flüchteten, wo er eine Stelle als Presseattaché ergatterte. Dort verbrachte er die Kriegsjahre. Danach übernahm er allerlei Posten sonst wo in der Welt, aber Alexandria muss seine Phantasie besonders tief geprägt haben und brachte ihn dazu, Justine zu schreiben, den ersten Teil dessen, was später als Alexandria-Quartett bekannt wurde (und die Romane Justine, Balthazar, Mountolive, Clea enthielt).
Justine mit seinen mächtigen Metaphern, dem untrüglichen psychologischen Scharfsinn und einem Zeitgefühl, das alles andere als linear war, bescherte Durrell schlagartig Weltruhm und machte ihn als einen Romancier der Moderne zum Begriff. Justine ist einer der spektakulärsten englischsprachigen Romane seit den Meisterwerken von James Joyce. Durrell schrieb in der Folge noch verschiedene andere Romane, darunter auch das Avignon-Quintett.
Doch am berühmtesten ist er wegen Alexandria. Seine Stadt konnte sich einer Reihe von Plutokraten rühmen, die in den schäbigsten Vierteln abstiegen auf der Suche nach arkanen Lüsten; dicht hinter ihnen drückte sich ein Haufen verstohlen um sich blickender Degenerierter, Bürohengste, die kein Wort herausbrachten, und schlecht beschuhter Möchtegerns herum, die alle an billigere Versionen ähnlicher Exzesse heranzukommen hofften, die sie gern unter dem Namen Liebe kaschierten. Doch vor allem geht von der Stadt ein so ungewöhnlich strahlender Glanz aus, dass man heute unmöglich nach Alexandria reisen kann, ohne zu hoffen, man werde nicht im gewöhnlichen, alltäglichen Alexandria ankommen oder im historischen, sondern in Durrells Mythen gebärender Stadt, in der Menschen ihren Trieben freien Lauf lassen und wo Wetter, Landschaft und Bevölkerung eine so sonderbare Symbiose eingehen, wie es sie nirgends sonst auf unserem Planeten gibt. Wie könnte man Durrells einleitenden Worten widerstehen: »Ein heißer, nackter, perlweißer Himmel bis Mittag«; »Eine Luft voller Ziegelstaub – süßlich riechendem Ziegelstaub – und dem Geruch der heißen, mit Wasser gelöschten Pflastersteine.« Wir sind an einem anderen Ort. Manche Schriftsteller erfinden die Sprache neu; andere die Welt. Durrell tat beides.
Durrells Alexandria ist gleichzeitig sonnig, unheimlich, düster und durchtränkt von ungewöhnlicher Schönheit und Sinnlichkeit. Das größte Laster der Stadt ist nicht Sex, sondern das Streben nach etwas viel Erregenderem, das weder Körper noch Psyche und schon gar nicht das Herz verstehen, geschweige denn verschaffen könnten. Das könnte man zu guter Letzt vielleicht ebenfalls Liebe nennen – oder eben nicht. Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Doch die Moral der Geschichte könnte simpler nicht sein: Nie werden wir verstehen, wer wir sind, was wir wollen und warum wir getrieben werden, nach etwas zu suchen, das uns den größten Schaden zufügen und uns, wie Durrell sich ausdrückt, »mit tief verwundetem Sexus« zurücklassen wird. Wir sind und wir bleiben, das ist unser Schicksal, Rätsel – mehr für uns selbst als für die anderen.
Wir leben das Paradoxe. Wir lieben, kämpfen, leiden und versinken schließlich im Sog des Paradoxen. Und Alexandria ist die Mutter aller Paradoxe. Lawrence Durrell hätte sich keinen passenderen Ort für seinen Himmel in der Hölle erträumen können.
Durrells Paradoxe erlauben ihm, zwei Dinge gleichzeitig zu tun, und er kann beide außerordentlich gut. Zum einen erlaubt ihm ein Paradox, das, was gemeinhin einfach so hingenommen wird, infrage zu stellen, indem er seine unvermutete, rätselhafte Unterseite freilegt. Ein Beispiel:
Wenn ich in all den Jahren später über sie nachdachte, war ich immer wieder erstaunt und verwundert, dass mich der Gedanke, sie könne einmal zurückkehren, mit Schrecken erfüllte – und doch liebte ich sie mit jeder Faser meines Herzens, wusste, dass ich nie mehr eine andere Frau lieben könnte. Diese beiden Empfindungen vermochten einander nicht zu verdrängen. Ich sagte mir tröstend: ›Gut. Ich habe wenigstens geliebt. Das habe ich erreicht.‹ – Und mein anderes Ich antwortete: ›Erspare mir die Qualen der erwiderten Liebe zu Justine.‹
Hier liegt offensichtlich ein Widerspruch vor. Wie kann der Ich-Erzähler Darley Justine lieben und sie gleichzeitig nicht wiedersehen wollen, besonders nachdem sie weg gewesen ist? Entweder ist seine Liebe nicht echt, oder er macht sich etwas vor. Vielleicht werden wir aber auch dazu aufgefordert, einen scheinbaren Widerspruch zu übersehen, um auf einen subtileren und verstörenderen Befund zu stoßen, der die allgemeine Auffassung widerlegt: dass Darley vielleicht verliebt ist, es aber nicht sein möchte?
Doch da geschieht noch etwas anderes, das uns daran erinnert, dass Durrell nicht nur ein Moralist in der französischen Tradition ist, sondern auch ein Dichter:
»Erspare mir die Qualen der erwiderten Liebe zu Justine.« Wenn Darleys Liebe erwidert wird, woher sollen dann die Qualen rühren? Hier wird das infrage gestellt, was man normalerweise als die Freuden erwiderter Liebe bezeichnet, indem wir auf die Tatsache aufmerksam gemacht werden, dass Justines Liebe, so reizvoll sie auch sein mag, immer giftig sein und bleiben wird. Das Wort »Qualen« wirkt hier zunächst vollkommen fehl am Platz. Es hat aber zur Folge, dass der Erzähler herausgerissen wird aus seiner Einschätzung dessen, was mit ihm geschieht, und gezwungen wird zu begreifen, dass die erwiderte Liebe zu Justine schädlicher und zerstörerischer sein kann als gewöhnliche unerwiderte Liebe zu einem anderen Menschen. Um Pascal zu zitieren: »Das Herz hat Gründe, von denen die Vernunft nichts weiß.« Ein Paradox ergibt manchmal mehr Sinn als ein perfekter Syllogismus.
Was das Herz betrifft, so haben alle Alexandriner, Darley inklusive, eine Sehschärfe von 20/20. Sie sehen alle fünf Seiten jeder Medaille – was aber auch erklärt, warum sie so blind sind. Durrells Paradoxe haben eine faszinierende Dynamik. Sie verschleiern die Dinge und machen der gängigen Psychologie einen Strich durch die Rechnung, indem sie verschlungenere und verwirrendere Wege aufzeichnen, die das Herz zu gehen beliebt. Dies tun sie, indem sie zwei Gegenteile verspleißen und sie zwingen, zusammen im selben Satz zu leben. Metaphern machen genau das Gleiche: Eine Metapher schafft nicht so sehr eine Brücke zwischen zwei Begriffen, die absolut nichts miteinander zu tun haben oder sich gar widersprechen; sie faltet sie vielmehr ineinander, steckt sie zusammen in dieselbe enge Tasche, sodass sie nicht mehr getrennt werden können. Der korrekte rhetorische Begriff für einen solchen Vorgang ist Katachrese. Wir bezeichnen Durrells Prosa deshalb als poetisch, weil sie dauernd unerwartete Kombinationen völlig fremder und nicht miteinander harmonierender Begriffe bietet.
Das Paradoxe durchdringt alles, so sehr, dass Alexandrias Libido brutal roh geblieben wäre, würde sie nicht beglaubigt durch das Begehren einerseits, aber auch durch Poesie oder vielmehr die Hoffnung, im Begehren immer auch auf Poesie zu stoßen, so wie manche in verlorenen Fragmenten heiliger Schriften zum Glauben finden. So sind schließlich nicht nur die Stadt oder deren Bewohner von Libido getrieben, sondern Durrells Sprache selbst ist eine Lustmaschine, trunken von der eigenen Fähigkeit, einen wohligen Schauer zu erzeugen, wenn sie eine Emotion oder einen Seinszustand mit Begriffen benennt, die man normalerweise als nicht zutreffend empfände. Große Autoren erfinden das, was wir zu wissen glaubten, neu.
Schauen Sie sich diese Metaphern und Vergleiche an: »der schwarze, schlammige Nil, der sich gewaltig durch das Deltagebiet zum Meer hinunterwälzte«; »ihre Küsse fielen auf mich wie ungeheuer sanfte, atemlose Stiche«; und nachdem er und Justine sich geliebt haben: »Ziellos streifte ich umher – wie einer, der dem Erdbeben entronnen ist, durch die Straßen seiner Stadt wandert«; »sie presste sich auf mich wie das Messer auf eine Beule«; über die tanzende Melissa: »Bewegungen einer Gazelle, die an ein Wasserrad geschirrt ist«; »[Justine] blickte um sich wie ein halb gezähmter Panther«; der alte Cohen hatte »die tollpatschige Haltung eines dressierten Seehunds, der sich mit menschlichen Gefühlen abquält«; »den schweren, kampferduftenden Nachmittag in uns aufnehmend«; die »staubgequälten Straßen«. Oder das hier:
Sechs Uhr. Weiß verhüllte Gestalten schlurfen von den Eisenbahnwerkstätten herüber. Die Läden in der Rue des Sœurs füllen und leeren sich wie Lungen. Die blassen, länger werdenden Strahlen der Nachmittagssonne verwischen die großen Bögen der Esplanade, und geblendete Tauben schwingen sich, gleich einem Schwarm verstreuter Papierfetzen, an den Minaretten empor, um das letzte Leuchten des verlöschenden Lichtes auf ihre Flügel zu laden.
Metaphern, Metaphern, Metaphern.
Doch will ich Ihnen ein komplexeres Beispiel von etwas geben, das ein bisschen anders ist. Darleys Liebe zu seiner Geliebten Justine oder zu Melissa, seiner anderen Geliebten, zu schweigen von Darleys komplizierter Freundschaft-Rivalität mit Justines Mann Nessim; oder nehmen wir Nessims plötzliche Beziehung zu Melissa, Darleys Geliebter, mit der Nessim ein Kind zeugen wird: Sie alle bilden eine Katzenwiege zahlloser Gleit- und Kippvorgänge, die Durrell als »Verlagerungen« bezeichnet und die genügend Stoff für jegliche Seifenoper bieten würden. Oder schauen Sie sich das an: »Durch Justine sah [Darley] Melissa so, wie sie wirklich war«. Und als Melissa Nessim küsst, sucht sie »bei Nessim nur einen Mund, der dem meinen ähnlich war«, schreibt Darley; Nessim, von dem es weiter heißt, »seine Leidenschaft galt nicht Justine, sondern mir«, Darley nämlich. Und jetzt kommt die Moral der Geschichte: »Immer wendet man seine Liebe auch dem Menschen zu, dem die Liebe dessen gilt, den man liebt«, schließt Darley.
Damit sind wir jedoch nicht etwa am Ende: Melissas einstiger Liebhaber, ein alter Pelzhändler namens Cohen, der sie durch ganz Alexandria verfolgt hat, liegt im Sterben. Wer ihn aber im Krankenhaus besucht, ist nicht Melissa, sondern Darley. »Und in einem jener Paradoxe, in denen sich die Liebe gefällt, war [Darley] eifersüchtiger auf den Sterbenden, als [er] es je auf den Lebenden gewesen war.« Doch auch damit haben die vertrackten Irrungen und Wirrungen noch kein Ende. Später wird Darley Melissa im selben Krankenhauszimmer besuchen, wo sie »in demselben schmalen Eisenbett« liegt, in dem Cohen gestorben ist.
Und noch eine allerletzte Ironie: Als Justine sehr jung war, gebar sie eine Tochter, die man ihr wegnahm und die nie wieder gefunden wurde. Melissa wiederum wird Nessims Kind gebären. So wird durch eine »Verlagerung« genannte Schicksalswendung »das Kind, das Justine verloren hat, nicht ihr [seiner Frau], sondern Melissa [seiner Geliebten] zurückgegeben, von Nessim zurückgegeben«. Ja, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ist Darley derjenige, der sich um Nessims Tochter kümmern wird.
Der Kreis hat sich geschlossen, aber kaum etwas ist gelöst worden. Jeder wird zu jedem anderen, Identitäten sind kaum je stabil, unsere Identität wird die von jemand anders, und die Identität von jemand anders kann sich genauso gleitend in die unsere verwandeln. Das Kind, das deine einstige Geliebte mit dem Mann deiner anderen Geliebten hatte, ist nach alexandrinischer Logik rechtmäßig das deine!
Wenn ein Paradox aus der Koexistenz von Gegenteilen besteht, dann ist der Plot dieses Romans ein einziges riesenhaftes, promiskes Paradox. Ein Paradox ist schließlich nicht mehr als die Unfähigkeit, den endlosen Streit zwischen Sinn und dessen Gegenteil, zwischen Ordnung und Chaos aufzulösen. Im Paradox kommen Gegenteile einander entgegen und lernen miteinander zu leben. Auf ihrem Waffenstillstand beruhen Durrells Genialität und seine Poesie.
Am Schluss von Justine wird klar, dass, selbst wenn es im Universum Sinn geben sollte, dieser Sinn nur vorläufig sein kann und sich zwangsläufig als illusorisch erweisen wird. Sollte andererseits das Chaos die Oberhand gewinnen, dann hegt es eine perverse Weisheit, die keinen Zweck hat und die, wie die alten Orakel, niemand versteht – außer wenn es bereits zu spät ist. So also bestrafen uns die Götter für unsere Anmaßung, geglaubt zu haben, wir wüssten, was sie vorhaben.
In Alexandria hingegen weiß niemand, wissen nicht einmal die Götter, was sie vorhaben – was uns zurück in die Antike führt, in eine Zeit, als Alexandria noch keines Gottes Absicht war, eine Zeit, als die Götter selbst noch nicht geboren waren und die Zeit noch nicht begonnen hatte.
Aus dem Englischen von Thomas Bodmer
Die Gestalten dieses Romans, des ersten einer Reihe, sind ebenso wie die des Erzählers erfunden und haben keine Ähnlichkeit mit lebenden Personen. Nur die Stadt ist wirklich.
Ich gewöhne mich auch, jeden sexuellen Akt als einen Vorgang zwischen vier Individuen aufzufassen. Darüber wird viel zu reden sein.
S. Freud, Briefe
Wir haben nur zwei Möglichkeiten: entweder das Verbrechen, das uns glücklich macht, oder die Schlinge, die verhindert, dass wir unglücklich werden. Kann es da überhaupt ein Zögern geben, liebwerte Thérèse, und wird Ihr kleiner Kopf ein Argument finden, das dem entgegenzustellen wäre?
D.A.F. de Sade, Justine
FÜR EVE
diese Erinnerungen an ihre Geburtsstadt
Teil I
Heute ist wieder hohe See mit einer erregenden Brise. Mitten im Winter spürt man die Schöpferkräfte des Frühlings. Ein heißer, nackter, perlweißer Himmel bis Mittag, Grillen an verborgenen Plätzen; und jetzt der Wind, der die großen Platanen entblößt, der die großen Platanen plündert …
Ich bin auf diese Insel entkommen mit ein paar Büchern und dem Kind – Melissas Kind. Ich weiß nicht, warum ich das Wort »entkommen« wähle. Die Leute im Dorf sagen im Scherz, nur ein sehr Kranker könne auf den Gedanken verfallen, sich an einem so entlegenen Ort erholen zu wollen. Gut denn, wenn man so will, bin ich hier, um Heilung zu finden …
Nachts, wenn der Wind tost und das Kind ruhig in seiner kleinen hölzernen Wiege am heulenden Kamin schläft, zünde ich eine Lampe an und wandere umher und denke an meine Freunde – an Justine und Nessim, an Melissa und Balthazar. Glied um Glied taste ich mich an der eisernen Kette der Erinnerung zurück in die Stadt, in der wir nur so kurze Zeit gemeinsam wohnten: in jene Stadt, die mit uns verfuhr wie mit ihrer Flora – die uns in Konflikte stürzte, welche die ihren waren und welche wir irrtümlich für die unsren hielten: geliebtes Alexandria!
So weit musste ich es hinter mir lassen, um alles zu verstehen! Jetzt, da ich auf diesem öden Vorgebirge lebe, jede Nacht vom Arktur dem Dunkel entrissen und fern dem kalkschweren Staub jener Sommernachmittage, erkenne ich endlich, dass niemand von uns gerichtet werden kann für das, was in der Vergangenheit geschah. Die Stadt sollte gerichtet werden, wenn auch wir, ihre Kinder, den Preis dafür zahlen müssen.
Unsere Stadt: Alexandria – was verbirgt sich hinter diesem Namen? Jäh sehe ich im Geiste tausend staubgequälte Straßen. Fliegen und Bettlern gehört die Stadt heute – und denen, die es verlockt, mit ihnen zusammenzuleben.
Fünf Rassen, fünf Sprachen, ein Dutzend Glaubensbekenntnisse; fünf Verbindungskanäle winden sich ölschillernd zwischen den Hafenbecken hinter der Außenmole. Aber mehr als fünf Geschlechter; scheinbar hat nur das umgangssprachliche Griechische eigene Worte für sie. Das sexuelle Angebot ist verwirrend vielfältig. Niemand würde die Stadt je für einen glücklichen Ort halten. Die symbolischen Liebenden der freien hellenischen Welt sind durch etwas anderes ersetzt worden: durch etwas unmerklich Androgynes, Invertiertes. Der Orient kann die süße Zügellosigkeit des Körpers nicht auskosten – er ist darüber hinausgewachsen, er hat den Körper abgestreift. Ich erinnere mich, dass Nessim einmal sagte – ich glaube, er zitierte –, Alexandria sei die große Kelter der Liebe; die sich aus dieser Kelter ergössen, seien Kranke, Einsame, Propheten – ich meine all die in ihrem Geschlecht tief Verwundeten.
Farbtöne für eine Landschaft … lange Sequenzen in Tempera. Das Licht bricht sich im Gelb der Zitronen. Eine Luft voller Ziegelstaub – süßlich riechendem Ziegelstaub – und dem Geruch der heißen, mit Wasser gelöschten Pflastersteine. Helle, dunstige, erdgefesselte Wolken, aber nur selten Regen. Auf diesem staubroten, staubgrünen, kreidig-malvenfarbenen und karmesinblassen Grund. Im Sommer überzog die Meeresfeuchte die Luft mit einem leichten Firnis. Alles lag unter einer Schicht aus Gummi.
Und dann im Herbst die trockene pulsende Luft, spröde von statischer Elektrizität; sie durchdringt die leichten Kleider, taucht den Körper in Glut. Das Fleisch erwacht und rüttelt an den Stäben seines Kerkers. Eine betrunkene Hure streift durch die nächtlich dunkle Straße und streut Fetzen eines Lieds wie zerpflückte Blüten um sich her. Hat Antonius darin die herzbetäubende Melodie der großen Musik erkannt, die ihn für immer der geliebten Stadt auslieferte?
Die jungen, trägen Körper verlangen nach der Nacktheit des anderen; in den kleinen Cafés, die Balthazar oft mit dem alten Dichter der Stadt[1] aufsuchte, werden die Jungen unruhig beim Backgammon unter den Petroleumlampen – aufgestört von dem trockenen Wüstenwind, der so unromantisch ist, so spröde –, und beobachtend wenden sie sich jedem Fremden zu. Sie ringen nach Atem, und jeder Sommerkuss lässt den Geschmack von ungelöschtem Kalk auf ihren Lippen.
Ich musste hierherkommen, um diese Stadt im Geiste wieder erstehen zu lassen – melancholische Bezirke, die der Alte[2] angefüllt sah mit den ›schwarzen Trümmern‹ seines Lebens. Die Räder der Straßenbahnen rattern in den metallenen Adern, wenn sie über die jodfarbene meidan von Mazarita rollen. Gold, Phosphor, magnesiumgleißendes Papier. Wie oft haben wir uns hier getroffen! Im Sommer gab es da einen kleinen bunten Stand, wo man in Scheiben geschnittene Wassermelonen kaufen konnte und das billige, grellfarbene Eis, das sie so gern aß. Sie kam immer ein paar Minuten zu spät – vielleicht frisch von einem Zusammensein in verdunkeltem Zimmer, an das ich nicht denken darf, nicht denken will; aber so frisch, so jung, und die aufgebrochene Blüte ihres Munds fiel auf den meinen wie ein wilder Sommer. Der Mann, den sie verlassen hatte, durchlebte jetzt vielleicht in der Erinnerung noch einmal jeden mit ihr genossenen Augenblick; und sie mochte noch immer wie betäubt von den Pollen seiner Küsse sein. Melissa! Aber alles wurde bedeutungslos, wenn sich ihre biegsame Gestalt an mich schmiegte und sie mich so selbstlos offen ansah, lächelte wie ein Mensch, der keine Geheimnisse mehr hat. Es war gut, so dazustehen, unbeholfen und ein wenig verlegen, rasch atmend, weil wir wussten, was einer vom anderen wollte. Botschaften jenseits des Bewusstseins zwischen Lippen, Augen, Eis und buntem Verkaufsstand. So dazustehen, unsere kleinen Finger eingehakt, den schweren, kampferduftenden Nachmittag in uns aufnehmend, selbst Teil der Stadt …
Ich habe heute Abend meine Manuskripte durchgesehen. Einige Blätter sind in die Küche gewandert, andere hat das Kind vernichtet. Diese Art der Zensur gefällt mir, weil sie gleichgültig ist wie alles Natürliche gegenüber den Gebilden der Kunst, so gleichgültig, wie auch ich es langsam werde. Warum auch sollte man eine schöne Metapher für Melissa schreiben, wenn sie doch wie eine Mumie tief im lockeren Sand der schwarzen Meeresbucht begraben liegt?
Das Einzige, was ich sorgfältig hüte, sind die drei Bände, die Justines Tagebuchaufzeichnungen enthalten, und die Blätter, die von Nessims Wahnvorstellungen berichten. Er gab mir dies alles, als wir auseinandergingen, nickte und sagte:
»Ja, nimm es und lies es. Es steht viel über uns alle darin. Vielleicht kannst du den Gedanken an Justine dann leichter ertragen – auch ich musste es lernen.« Das war in seinem Sommerhaus, nach Melissas Tod, als er noch immer glaubte, Justine werde zu ihm zurückkehren. Ich denke oft, und nie ohne eine gewisse Angst, an Nessims Liebe zu Justine. Was hätte umfassender, fester in sich gegründet sein können? Diese Liebe gab seinem Schmerz etwas Ekstatisches, zeichnete ihn mit freudvollen Wundmalen, die man bei Heiligen erwartet, nicht aber bei Liebenden. Hätte er eine Spur Humor gehabt, so hätte er nicht so entsetzlich, so grenzenlos leiden müssen. Es ist so einfach, Kritik zu üben. Ich weiß. Ich weiß.
In der großen Stille dieser Winterabende gibt es nur eine Uhr: das Meer. Ihre dunkle Triebkraft ist in meinem Geist das Fugenthema, zu dem dieser Text geschrieben worden ist. Leere Kadenzen aus Salzwasser, das seine eigenen Wunden leckt, klagend an den Mündungen des Deltas vorüberflutet, gegen diese verlassenen Ufer kocht – leer, für immer leer unter Möwenschwingen: weiße Lineaturen auf grauem Grund, von Wolken verschluckt. Tauchen jemals Segel auf, so sterben sie, noch ehe das Land seinen Schatten auf sie wirft. Auf das Gestein der Insel gespülte Wracks, das letzte verkrustete Brett, vom Wetter zerfressen, in die Bläue der See gespießt … vorbei!
Wenn man von der alten, runzligen Bäuerin absieht, die jeden Tag auf ihrem Maulesel vom Dorf kommt, um das Haus in Ordnung zu halten, sind wir ganz allein, das Kind und ich. Trotz der ungewohnten Umgebung ist es lebendig und fröhlich. Ich habe ihm noch keinen Namen gegeben. Natürlich wird es Justine heißen – wie sonst?
Ich selbst bin weder glücklich noch unglücklich; ich schwebe wie ein Haar oder eine Feder im Gewölk der Erinnerung. Ich sprach von der Nutzlosigkeit der Kunst, aber nicht darüber, wie tröstlich sie sein kann. Der Trost einer solchen Arbeit, wie ich sie tue – mit dem Verstand und mit dem Herzen –, liegt darin, dass nur im Schweigen des Malers oder des Schriftstellers die Wirklichkeit neu ersteht, neu erschaffen wird und erst dann ihre wahre Bedeutung offenbart. Unsere alltäglichen Handlungen im realen Leben sind nur das Sackleinen, das den Goldbrokat verbirgt, den Sinn des Musters. Für uns Künstler wartet hier in der Kunst der freudige Kompromiss mit allem, was uns im täglichen Leben verwundet oder trifft; nicht, dass wir dem Schicksal entgehen wollten, wie der Mensch es gewöhnlich versucht; wir wollen es vielmehr erfüllen in seiner wahren Möglichkeit: in der Phantasie. Warum sonst tun wir einander weh? Nein, die Vergebung, die ich suche und die mir vielleicht gewährt wird, finde ich nicht in den strahlenden, gütigen Augen von Melissa oder dem dunklen, brauenüberschatteten Blick von Justine. Unsere Wege haben sich getrennt; aber dieser erste große Bruch meiner reiferen Jahre lässt mich die Grenzen meiner Kunst spüren, ich erkenne, dass mein Leben durch die Erinnerung an diese Menschen unermesslich vertieft worden ist. In Gedanken gebe ich ihnen noch einmal Gestalt; als könnte ich sie nur hier, an diesem hölzernen Tisch unter einem Olivenbaum über dem Meer so reich machen, wie sie es verdienen. Ich verknüpfe sie mit den feinen Webfäden menschlichen Erinnerungsvermögens, damit diese Niederschrift ein wenig nach den lebendigen Wesen schmecken möge – ihrem Atem, ihrer Haut, ihren Stimmen. Ich möchte, dass sie wieder leben, so sehr, dass der Schmerz darüber zur Kunst wird … Vielleicht ist es ein sinnloser Versuch, ich weiß es nicht. Aber ich muss ihn unternehmen.
Heute habe ich mit dem Kind den Herdstein des Hauses vollendet; wir haben uns bei der Arbeit ruhig miteinander unterhalten. Ich spreche mit ihm, wie ich mit mir selbst sprechen würde, wenn ich allein wäre; es antwortet in einer kräftigen, erfundenen Sprache. Wir haben die Ringe, die Cohen für Melissa gekauft hatte, in der Erde unter dem Herdstein vergraben, wie es auf dieser Insel Brauch ist. Das wird den Bewohnern des Hauses Glück bringen.
Damals, als ich Justine kennenlernte, war ich beinah ein glücklicher Mensch.
Plötzlich hatte sich mir eine Tür zur Vertrautheit mit Melissa geöffnet – zu einer Vertrautheit, die mich gerade deshalb so glücklich machte, weil sie unerwartet und völlig unverdient kam. Wie alle Egoisten kann ich es nicht ertragen, allein zu leben; mein Junggesellendasein während des letzten Jahres hatte mich ganz krank gemacht – meine Ungeschicklichkeit in häuslichen Dingen, meine Hilflosigkeit in allem, was Kleider und Essen und Geld betrifft, hatten mich an den Rand der Verzweiflung getrieben. Krank gemacht hatten mich auch die von Kakerlaken wimmelnden Räume, in denen ich damals mit dem einäugigen Hamid hauste, dem Berberdiener, der mich versorgte.
Melissa hatte meine kümmerliche Abwehr nicht durch eine jener Eigenschaften durchbrochen, die man sonst an einer Geliebten rühmt – nicht durch Charme, außergewöhnliche Schönheit, Klugheit –, nur durch die Kraft dessen, was ich nicht anders als ihre Güte zu nennen vermag, ihre chareis im griechischen Sinne des Wortes. Ich weiß noch, wie sie mir damals immer begegnete, wenn sie ihren kleinen Hund in den winterlichen Straßen spazieren führte: blass, schmal, in einen schäbigen Sealmantel gehüllt. Blau geäderte, schwindsüchtige Hände; die Brauen künstlich nach oben gezogen, damit die schönen, unerschrockenen, freimütigen Augen größer erschienen. So sah ich sie viele Monate hindurch Tag für Tag, aber ihre schwermütige Anilin-Schönheit rief keine Empfindung in mir wach. Täglich ging ich an ihr vorbei auf meinem Weg zum Café Al Aktar, wo Balthazar mit seinem schwarzen Hut auf mich wartete, um mir »Instruktionen« zu geben. Nie träumte es mir, dass ich je ihr Liebhaber werden könnte.
Ich wusste, dass sie früher an der Akademie Modell gewesen war – kein beneidenswerter Beruf – und jetzt als Tänzerin arbeitete; außerdem, dass sie die Geliebte eines älteren Pelzhändlers war, eines dicken, ungeschlachten Kaufmanns aus der Innenstadt. Ich mache diese Aufzeichnungen nur, um von einem Stein aus dem Gebäude meines Lebens zu berichten, der im Meer versunken ist. Melissa! Melissa!
Ich denke zurück an jene Zeit, da für uns vier die reale Welt kaum existierte; die Tage waren nur noch Pausen zwischen Träumen, Pausen zwischen den sich verschiebenden Stufen der Zeit, des Handelns, des üblichen Lebens … Eine Flut bedeutungsloser Ereignisse schob sich an der toten Ebene der Dinge entlang, keiner Religion verhaftet, führte uns nirgendwohin, verlangte von uns nichts außer dem Unmöglichen – wir selbst zu sein. Justine würde sagen, wir waren gefangen im Plan eines Willens, der zu stark, zu überlegen war, um von menschlicher Art zu sein – in dem Gravitationsfeld, in das Alexandria all jene hineinzog, die es zu seinen Opfern erwählt hatte …
Sechs Uhr. Weiß verhüllte Gestalten schlurfen von den Eisenbahnwerkstätten herüber. Die Läden in der Rue des Sœurs füllen und leeren sich wie Lungen. Die blassen, länger werdenden Strahlen der Nachmittagssonne verwischen die großen Bögen der Esplanade, und geblendete Tauben schwingen sich, gleich einem Schwarm verstreuter Papierfetzen, an den Minaretten empor, um das letzte Leuchten des verlöschenden Lichts auf ihre Flügel zu laden. Klingendes Silber auf den Zahltischen der Geldwechsler. Das Eisengitter vor der Bank immer noch zu heiß zum Anfassen. Trappeln von Pferdegespannen: die Wagen, in denen Verwaltungsbeamte mit roten Blumentöpfen auf dem Kopf zu den Cafés am Meer fahren. Dies ist die am schwersten zu ertragende Stunde; unerwartet erhasche ich von meinem Balkon aus ihren Anblick: noch halb im Schlaf, in weißen Sandalen, schlendert sie stadteinwärts. Justine! Die Stadt streckt sich wie eine alte Schildkröte und äugt umher. Für einen Moment lässt sie ab von den auseinandergezerrten Fleischfetzen: aus einer abseits gelegenen Gasse beim Schlachthaus heben sich über das Stöhnen und Brüllen des Viehs mit nasaler Stimme gesungene Liedfetzen eines damaszenischen Liebesgesangs: schrille Vierteltöne – als würde eine Stirnhöhle zu Pulver zermahlen.
Nun stoßen verschlafene Menschen die Läden ihrer Balkone auf und treten blinzelnd in das fahle weiße Licht hinaus – blasse Blumen, den zerwühlten Betten und den Albträumen dieser zermürbenden Nachmittage entsprossen. Ich bin einer dieser armseligen Sklaven des Gewissens geworden: ein Bürger von Alexandria. Sie geht unter meinem Fenster vorbei und lächelt, als denke sie an etwas, das ihr Freude bereitet hat, und fächelt sich leicht mit einem kleinen Binsenfächer die Wangen. Es ist ein Lächeln, das ich wahrscheinlich nie wiedersehen werde, denn in Gesellschaft lacht sie nur und zeigt dabei ihre herrlichen weißen Zähne. Dieses kleine, wehmütige, aber doch lebhafte Lächeln zeigt eine Eigenschaft, die man ihr nicht zugetraut hätte: Schalkhaftigkeit. Eigentlich sollte man annehmen, sie wäre ein zum Tragischen neigender Mensch, dem Humor im üblichen Sinn fremd ist. Aber die hartnäckige Erinnerung an dieses Lächeln lässt mich in der kommenden Zeit daran zweifeln.
Ich hatte Justine schon oft gesehen, und ihr Anblick war mir schon vertraut, als wir uns kennenlernten: Unsere Stadt erlaubt einem Menschen mit einem Einkommen von mehr als zweihundert Pfund im Jahr keine Anonymität. Ich begegne ihr am Meer; sie ist allein, liest in einer Zeitung und isst einen Apfel; oder in der Halle des Cecil Hotel, unter staubigen Palmen: ihren Körper umschließt ein Futteral aus silbrigen Tropfen, sie hat den kostbaren Pelz über eine Schulter geworfen und hält ihn, wie ein Bauer seinen Mantel, mit ihrem langen Zeigefinger an der Schlinge fest. Nessim ist unter der Tür des licht- und musikdurchwogten Tanzsaals stehen geblieben. Er sucht sie. Unter Palmen in einer tiefen Nische sitzen ein paar alte Männer und spielen Schach. Justine verhält den Schritt und sieht ihnen zu. Sie versteht nichts von dem Spiel, aber sie ist fasziniert von der Atmosphäre der Stille und Konzentration in der Nische. Sie steht lange so da – auf der einen Seite die rauschende Musik, auf der anderen die Spieler, die alles um sich vergessen haben. Es ist, als wüsste sie nicht, in welche Welt sie tauchen will. Nessim geht auf sie zu, nimmt zärtlich ihren Arm, und dann stehen sie eine Weile nebeneinander, sie beobachtet die Spieler, er beobachtet sie. Endlich tritt sie weich, zögernd, vorsichtig Schritt für Schritt und mit einem leisen Seufzer in die laute Helligkeit.
Und dann zu anderer Zeit – einer ohne Zweifel für sie und uns alle unguten –, wie rührend, wie weiblich-fügsam konnte diese männlichste und wendigste aller Frauen sein. Sie erinnerte mich an die furchtbaren Königinnen, die den Ammoniakgeruch ihrer Inzestlieben zurückließen, einen Geruch, der wie eine schwere Wolke über dem Unterbewusstsein Alexandrias lastet. Die riesigen, männerverschlingenden Katzen wie Arsinoë waren Justines Verwandte. Doch hinter ihren Handlungen lag etwas anderes, geboren aus einer tragischen Philosophie späterer Zeit, in der die Moral mit den persönlichen Leidenschaften im Gleichgewicht gehalten werden musste. Sie war das Opfer wahrhaft heroischer Zweifel. Dennoch sehe ich nach wie vor eine direkte Beziehung zwischen dem Bild von Justine, wie sie sich über den Fötus im schmierigen Ausguss beugt, und der armen Sophia des Valentinus[3], die sterben musste um einer ebenso vollkommenen wie starrköpfigen Liebe willen.
In dieser Zeit teilt Georges-Gaston Pombal, ein kleiner Konsulatsbeamter, in der Rue Nebi Daniel eine winzige Wohnung mit mir. Er ist eine bemerkenswerte Figur unter den Diplomaten, denn er scheint Rückgrat zu besitzen. Die zermürbende Tretmühle der Protokolle und Empfänge – sie gleichen einem surrealistischen Albtraum – ist für ihn voll exotischen Zaubers. Er sieht die Aufgabe der Diplomatie mit den Augen Rousseaus des Zöllners. Er gibt sich ihr begeistert hin, achtet jedoch streng darauf, dass nicht sein ganzer Verstand und alle Vernunft von ihr absorbiert werden. Ich glaube, das Geheimnis seiner Erfolge liegt in seiner grenzenlosen, fast übernatürlichen Faulheit.
An seinem Schreibtisch im Generalkonsulat ist er ständig umflattert von den Visitenkarten seiner Kollegen. Er ist ein riesiges, dickes, träges Faultier, ein hingebungsvoller Anhänger ausgedehnter Nachmittagssiestas und eines Crébillon fils. Seine Taschentücher duften wunderbar nach Eau de Portugal. Sein Lieblingsthema sind die Frauen, und zweifellos spricht er aus Erfahrung, denn der Besucherinnenstrom in der kleinen Wohnung nimmt kein Ende, und selten sieht man zweimal dasselbe Gesicht. »Für einen Franzosen ist die Liebe hier höchst interessant. Hier handelt man, noch ehe man nachdenkt. Und wenn der Augenblick kommt, da man zweifeln, Gewissensbisse empfinden müsste, ist es zu heiß, hat niemand die Kraft dazu. Diesem Animalismus mangelt es zwar an finesse, aber er gefällt mir. Herz und Hirn sind bei mir von der Liebe schon genügend strapaziert worden, ich will meine Ruhe haben – vor allem, mon cher, vor dieser jüdisch-koptischen Neigung zur dissection, zum Analysieren. Ich möchte mit heilem Herzen zu meinem Bauernhaus in der Normandie zurückkehren.«
Die längste Zeit des Winters ist er auf Urlaub, und ich habe dann die kleine nasskalte Wohnung für mich allein und bleibe lange auf und korrigiere Schulhefte; der schnarchende Hamid ist mein einziger Gesellschafter. In diesem letzten Jahr habe ich den toten Punkt erreicht. Ich besitze nicht genügend Willenskraft, um etwas mit meinem Leben anzufangen, meine Situation durch harte Arbeit zu verbessern, zu schreiben – nicht einmal, mit einer Frau zu schlafen. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es ist das erste Mal, dass mein Selbsterhaltungstrieb versagt. Manchmal werfe ich einen Blick in ein Manuskriptbündel oder in alte Korrekturbogen eines Romans oder eines Gedichtbandes, tue es angewidert, gleichgültig, mit der leisen Wehmut eines Menschen, der in einem alten Pass blättert.
Hin und wieder verirrt sich eines von Georges’ Mädchen, wenn es in die Wohnung kommt und ihn nicht antrifft, in meine Netze, aber das verschärft für eine Weile mein taedium vitae nur noch. Georges ist in dieser Beziehung großzügig und äußerst entgegenkommend; bevor er wegfährt, bezahlt er oft (weil er weiß, wie arm ich bin) eine der Syrerinnen aus Golfos Taverne im Voraus und ordnet an, dass sie gelegentlich eine Nacht in unserer Wohnung verbringt, en disponibilité, wie er es nennt. Ihre Aufgabe ist es, mich aufzuheitern; ohne Zweifel ein mühsames Unterfangen, obwohl es mir äußerlich keineswegs an Heiterkeit zu mangeln scheint. Als nützlich hat sich stets eine kleine Plauderei erwiesen, die sich ganz von selbst, fast automatisch entwickelt und die noch andauert, wenn eine Unterhaltung schon gar nicht mehr erforderlich ist; wenn es sein muss, kann ich auch einmal mit einer Frau ins Bett gehen und das durchaus als angenehm empfinden, da man hier ja ohnehin schlecht schläft; aber ich tue es ohne Leidenschaft, ohne Interesse.
Manche dieser Begegnungen mit den armen, verlebten Geschöpfen, die durch ihre Notlage zum Äußersten getrieben werden, sind recht aufschlussreich, ja sogar rührend, aber es liegt mir längst nichts mehr daran, mich mit Gefühlen herumzuschlagen, und so sind diese Geschöpfe für mich nicht mehr als wesenlose, wie auf eine Leinwand projizierte Gestalten. »Es gibt nur drei Dinge, die man mit einer Frau machen kann«, hat Clea einmal gesagt: »Man kann sie lieben, an ihr leiden oder sie in Literatur verwandeln.« Ich habe in allen dreien dieser Gefühlssphären versagt.
Ich berichte dies nur, um das unergiebige menschliche Material zu beschreiben, das sich Melissa zur Bearbeitung ausgesucht hatte, dem sie ein wenig Lebensodem einhauchen wollte. Es muss sehr schwer für sie gewesen sein, die doppelte Bürde zu tragen – da sie doch selbst arm und krank war. Meine Sorgen zu den ihren auf sich zu nehmen, erforderte wahren Mut. Vielleicht war es der Mut der Verzweiflung, denn auch sie hatte den toten Punkt erreicht. Wir waren beide Bankrotteure.
Wochenlang folgte mir ihr Liebhaber, der alte Pelzhändler, durch die Straßen – mit einer Pistole in der Manteltasche. Es tröstete mich, durch einen von Melissas Freunden zu erfahren, dass sie nicht geladen war, aber dennoch war es beunruhigend, von diesem alten Mann verfolgt zu werden. In Gedanken haben wir uns wohl an jeder Straßenecke der Stadt niedergeknallt. Ich konnte es nicht ertragen, in das schwere, pockennarbige Gesicht mit dem finsteren, animalischen Gewirr zerquälter Furchen zu blicken, konnte es nicht ertragen, an seine plumpen Vertraulichkeiten mit Melissa zu denken, an diese kleinen, schweißigen Hände, auf denen dicht die schwarzen Haare sprossen wie die Borsten eines Stachelschweins. Lange Zeit ging es so fort, bis unversehens nach einigen Monaten ein seltsames Gefühl der Vertrautheit zwischen uns zu keimen schien. Jedes Mal, wenn wir uns begegneten, nickten und lächelten wir einander zu. Einmal stand ich fast eine halbe Stunde lang neben ihm an einer Bar; wir waren nahe dran, einander anzusprechen, aber dann hatte doch keiner von uns den Mut dazu. Wir hätten kein Gesprächsthema gehabt außer Melissa. Als ich ging, sah ich ihn in einem der langen Spiegel; er starrte mit gesenktem Kopf in sein Weinglas. Etwas in seiner Haltung – der tollpatschigen Haltung eines dressierten Seehunds, der sich mit menschlichen Gefühlen abquält – traf mich tief, und ich erkannte zum ersten Mal, dass er Melissa vermutlich in demselben Maß liebte wie ich. Ich hatte Mitleid mit ihm um seiner Hässlichkeit, um des quälenden Unvermögens willen, sich mit einer so neuen Empfindung wie der Eifersucht abzufinden und dem Verlust einer angebeteten Geliebten.
Später, als man seinen Nachlass durchsah, entdeckte ich in seiner Jackentasche unter den üblichen Kleinigkeiten ein leeres Parfumfläschchen der billigen Sorte, die Melissa benutzte; ich nahm es mit nach Hause; einige Monate lang stand es auf dem Kaminsims, bis Hamid es beim Frühjahrsputz fortwarf. Ich habe Melissa nie davon erzählt; aber oft, wenn ich nachts allein war, während sie tanzte, vielleicht auch aus Not mit ihren Bewunderern schlief, betrachtete ich dieses Fläschchen und dachte voll leidenschaftlicher Trauer an die Liebe des hässlichen alten Mannes und wog sie gegen die meine ab; und ich kostete dabei an seiner Statt die Verzweiflung, mit der man sich an einen winzigen, unwesentlichen Gegenstand klammert, dem noch immer die Erinnerung an die Ungetreue anhaftet.
Ich fand Melissa an den trostlosen Küsten Alexandrias, ans Land gespült wie ein halb ertrunkener Vogel, fand sie mit tief verwundetem Sexus …
In den Straßen, die zu den Docks führen, drängen sich die verkommenen, zerfallenen Häuser dicht aneinander, sie hängen vornüber, ihr fauler Atem fließt ineinander. Mit Läden verschlossene Balkone, Rattengewimmel, alte Frauen, deren Haar verklebt ist vom Blut der Zecken. Bröckelnde Mauern, ohne Halt, schwanken trunken nach Ost und West um ihren Schwerpunkt. Schwarze Streifen von Fliegen kleben an den Mündern und unter den Augen der Kinder – überall feucht glänzende Tropfen: die Sommerfliegen; sie reißen mit ihrem Gewicht die alten Insektenfänger herunter, die in den violetten Türen der Buden und Cafés hängen. Schweißtriefende Berber verströmen einen Geruch wie modrige Teppiche. Und dann die Geräusche der Straße: das Kreischen des Wasser tragenden Saidi, der, um Kunden anzulocken, klappernd seine Metallbecher aneinanderschlägt; klagende Schreie, die ungehört im Wirrwarr ersterben; Schreie irgendeines kleinen, zartgliedrigen Tieres, dem man die Gedärme ausnimmt. Wunden wie Teiche – menschliches Elend in so erdrückendem Ausmaß, dass man erstarrt und alles Mitgefühl in Ekel und Entsetzen umschlägt.
Ich wollte, ich hätte die unbekümmerte Selbstsicherheit, mit der Justine sich den Weg durch diese Straßen bahnte zu dem Café, in dem ich auf sie wartete: El Bab. Unter zerfallenem Bogen ein Torweg, wo wir in aller Unschuld saßen und sprachen, aber unsere Unterhaltung war bereits von einem gegenseitigen Verstehen durchdrungen, wir hielten es nur für ein glückliches Zeichen der Freundschaft. Auf diesem schmutzig-braunen Lehmboden, wo wir spürten, wie sich der rasch erkaltende Zylinder der Erde in die Dunkelheit wälzte, waren wir nur von dem Wunsch besessen, einander unsere Ansichten und Erfahrungen mitzuteilen. Unsere Gespräche besaßen größere Tiefe, umschlossen weit mehr, als es sonst bei Unterhaltungen üblich ist. Sie sprach wie ein Mann, und ich sprach mit ihr wie ein Mann. Ich erinnere mich nur noch an die Form und das Gewicht dieser Gespräche, nicht mehr an ihren Inhalt. Und wenn ich dann, selbstvergessen auf den Ellbogen gestützt, dasaß und den billigen Arrak trank und ihr zulächelte, sog ich den Duft ihres warmen, sommerlichen Parfums ein, der sich um ihr Kleid und ihre Haut wob – ein Parfum, das, ich weiß nicht warum, Jamais de la vie hieß.
Das sind die Augenblicke, die sich dem Schriftsteller, nicht dem Liebenden, einprägen und die ewig fortleben. Man kann in der Erinnerung immer wieder zu ihnen zurückkehren oder sie als das Fundament benutzen, auf dem man einen Teil seines Lebens aufbauen kann: das Schreiben. Man kann sie mit Worten zwar verderben, aber nicht vernichten. In diesem Zusammenhang fällt mir ein anderer solcher Augenblick ein: Ich lag neben einer schlafenden Frau in einem armseligen Zimmer nahe der Moschee. In der früh hereinbrechenden Morgendämmerung dieses Frühlingstages mit seinem dichten Tau, der über dem Schweigen lag, das die ganze Stadt befällt, bis sie von den Vögeln aufgeweckt wird, hörte ich die melodische Stimme des blinden muezzin von der Moschee herunter den Ebed rezitieren – eine Stimme, die wie ein Haar in der palmengefächelten Luft über Alexandria schwebte. »Ich preise die Vollkommenheit Gottes, des ewig Seienden« (er wiederholte dies dreimal – immer langsamer, in immer singenderem Tonfall). »Die Vollkommenheit Gottes, des Ersehnten, des Lebendigen, des Einzigen, des Erhabenen: die Vollkommenheit Gottes, des Einen, des Einzigen: die Vollkommenheit dessen, der neben sich keinen männlichen noch weiblichen anderen duldet, noch jemand, der Ihm gleich ist, noch jemand, der sich gegen Ihn auflehnt, noch einen Abgesandten oder Gleichgestellten oder Nachkommen. Seine Vollkommenheit sei gepriesen.«
Das mächtige Gebet bahnte sich seinen Weg in mein schlafbefangenes Bewusstsein wie eine Schlange – Wortgeringel um Wortgeringel, schimmernd, glänzend. Währenddessen wurde die Stimme des muezzin leiser und leiser, bis der ganze Morgen eingehüllt war in diese herrliche, heilende Kraft, erfüllt von der Verkündung einer unverdienten, unerwarteten Gnade, die auch den ärmlichen Raum durchdrang, in dem Melissa schlief, leicht atmend wie eine Möwe, gewiegt auf der ozeanischen Pracht einer Sprache, die sie nie verstehen würde.
Wer wollte behaupten, dass Justine nicht auch ihre schwachen Seiten hatte? Ihre Vergnügungssucht, ihre kleinen Eitelkeiten, das Besorgtsein um die gute Meinung ihr Untergebener, ihre Arroganz. Sie konnte schon aufreizend anspruchsvoll sein. Ja, ja. Aber all dies Unkraut bewässerte ihr Reichtum. – Ich will nur sagen, dass sie in vielem wie ein Mann dachte und auch in ihren Handlungen etwas von der freien Unabhängigkeit männlicher Anschauungsweise bewies. Unsere Intimität war von merkwürdig geistiger Art. Sehr bald stellte ich fest, dass sie, ohne sich zu irren, Gedanken lesen konnte. Oft kamen uns dieselben Einfälle zur selben Zeit. Ich erinnere mich noch, wie sie sich einmal mit einem Gedanken beschäftigte, der soeben auch mir gekommen war: »Unsere Intimität sollte nicht weitergehen, denn wir haben all ihre Möglichkeiten in unserer Phantasie bereits erschöpft; hinter dem dunklen Gewebe der Sinnlichkeit werden wir eine Freundschaft von solcher Tiefe entdecken, dass jeder von uns für immer zum Sklaven des anderen wird.« Es war, wenn man so will, ein Kokettieren zweier Geister, die durch die Erfahrung vorzeitig erlahmt waren – es schien weitaus gefährlicher zu sein als eine Liebe, die dem körperlichen Verlangen entspringt.
Weil ich wusste, wie sehr sie Nessim liebte und weil ich ihn selbst so sehr liebte, konnte ich diesem Gedanken nicht ohne Entsetzen nachgehen. Sie lag leise atmend neben mir und starrte mit den großen Augen zur engelverzierten Decke empor. Ich sagte: »Das kann doch zu nichts führen, diese Affäre zwischen einem armen Lehrer und einer Dame der alexandrinischen Gesellschaft. Es wäre bitter, wenn alles in dem üblichen Skandal endete, wir wären dann völlig allein, und du stündest vor der Frage, was du mit mir anfangen sollst.« Justine hasste es, die Wahrheit zu hören. Sie stützte sich auf den Ellbogen, senkte den strahlenden, unruhigen Blick und schaute mich lange an. »Wir haben keine Wahl«, sagte sie mit der rauen Stimme, die ich so sehr lieben gelernt hatte. »Du sprichst, als hätten wir eine Wahl. Wir sind weder stark noch schlecht genug, um wählen zu können. All dies ist Teil eines Experiments, das ein anderer unternommen hat, die Stadt vielleicht, oder irgendein Element in uns selbst. Wie soll ich das wissen?«
Ich erinnere mich noch, wie sie vor dem mehrteiligen Spiegel beim Schneider saß, sich ein Sommerkostüm anprobieren ließ und sagte: »Schau! Fünf verschiedene Bilder von derselben Gestalt. Wenn ich ein Schriftsteller wäre, würde ich versuchen, eine vieldimensionale Wirkung der Charaktere zu erreichen, eine Art Prismenansicht. Warum sollten die Menschen nicht mehrere Profile gleichzeitig haben?«
Sie gähnte jetzt und zündete sich eine Zigarette an; sie richtete sich im Bett auf, umschlang ihre schmalen Fesseln mit den Händen, und langsam und unsicher rezitierte sie die herrlichen Zeilen des alten griechischen Dichters über eine Liebe vergangener Zeit – in der Übersetzung würde ihre Schönheit verloren gehen. Und als ich sie diese Zeilen sprechen hörte, jede Silbe des klugen, ironischen Griechen betonte sie mit Zärtlichkeit, empfand ich erneut die merkwürdig doppelsinnige Macht der Stadt – mit ihrer flachen Schwemmlandschaft und ihrer verbrauchten Luft – und wusste, dass Justine ein echtes Kind Alexandrias war, dieser Stadt, die weder griechisch noch syrisch noch ägyptisch ist, sondern ein Bastard, ein Konglomerat.
Und als sie an die Stelle kam, wo der Greis den alten Liebesbrief, der ihn so bewegt hat, fortwirft und ausruft: »Traurig trete ich hinaus auf den Balkon; unterbräche doch etwas diese Gedankenkette, und sei es nur ein klein wenig Leben in der Stadt, die ich liebe, in ihren Straßen und Läden!«, stieß auch sie die Türen auf und trat auf den dunklen Balkon über einer Stadt vielfarbiger Lichter, spürte den Abendwind, der sich an Asiens Grenzen erhob, und vergaß für einen Augenblick ihren Körper.
Die Bezeichnung ›Prinz‹ Nessim war natürlich ein Scherz; die Ladenbesitzer und die schwarzröckigen commerçants nannten ihn so, wenn sie ihn in dem großen silbernen Rolls mit den blassgelben Radkappen die Straße nach Canopus hinuntergleiten sahen. Zunächst einmal war er ein Kopte, kein Moslem. Seinen Spitznamen trug er zu Recht, denn er glich wahrlich einem Prinzen in seiner Großzügigkeit. Er war frei von der üblichen Habgier, die bei den Alexandrinern – auch wenn sie noch so reich waren – alle guten Regungen überwucherte. Man sagte von ihm, er sei exzentrisch, aber jemand, der nicht immer nur in der Levante gelebt hatte, sah nichts Außergewöhnliches in seinen beiden in dieser Umgebung so sehr hervorstechenden Eigenschaften: Geld interessierte ihn nicht, er wollte es nur ausgeben; und dann hatte er keine garçonnière, er schien Justine wirklich treu zu sein – ein geradezu unerhörter Zustand. Was das Erstere betrifft: trotz seines unermesslichen Reichtums empfand er einen ehrlichen Abscheu vor dem Geld und trug niemals welches bei sich. Er zahlte nach arabischem Brauch: Er gab den Kaufleuten handgeschriebene Schuldscheine; in den Nachtclubs und Restaurants nahm man seine unterzeichneten Schecks ohne Weiteres an. Seine Verpflichtungen wurden auch immer pünktlich erledigt: Selim, sein Sekretär, musste jeden Morgen in die Stadt fahren und alle Schulden bezahlen, die sich am vergangenen Tag angesammelt hatten.
Dieses Verhalten wurde von den Leuten in der Stadt als überspannt und anmaßend bezeichnet, denn ihre primitiven überlieferten Ansichten, ihre kleinlichen Vorurteile und ihre mangelhafte Bildung erlaubten ihnen nicht, einen Lebensstil in europäischem Sinne zu erkennen, zu verstehen. Nessim jedoch war für solch eine Haltung geboren, nicht nur erzogen; deshalb fand er in dieser kleinen Welt abgefeimten, lustvollen Gelderwerbs keinen Raum für seinen empfindsamen und grüblerischen Geist. Er war alles andere als selbstbewusst, und doch forderte er ständig Kritik heraus durch Handlungen, die den Stempel seiner starken Persönlichkeit trugen. Man war allgemein geneigt, seine Sitten einer fremdländischen Erziehung zuzuschreiben, in Wahrheit jedoch hatten Deutschland und England nichts weiter vermocht, als ihn zu verwirren und für das Leben in dieser Stadt untauglich zu machen. Das eine Land hatte den Hang zu metaphysischen Spekulationen in seinen ursprünglichen mediterranen Geist gepflanzt, während Oxford versucht hatte, aus ihm einen Mann von Welt zu machen, seinen geistigen Horizont zu weiten, aber lediglich erreicht hatte, dass sein Hang zur Philosophie immer stärker wurde, bis er sich unfähig fühlte, die ihm liebste Kunst auszuüben: die Malerei. Er grübelte viel, er litt, aber er unternahm nichts; er hatte keinen Wagemut, das erste Erfordernis für einen Mann der Tat.
Nessim passte nicht in diese Stadt; und die hier ansässigen Kaufleute, mit denen ihn sein großes Vermögen täglich in Berührung brachte, wurden ihrer Befangenheit dadurch Herr, dass sie ihn mit humorvoller Nachsicht behandelten – mit einer Leutseligkeit, wie man sie jemandem, der etwas schwach im Kopf ist, entgegenbringt. Es war keineswegs etwas Ungewöhnliches, dass er, wenn man ihn in seinem Büro besuchte – in diesem Sarkophag aus Stahlrohr und erleuchtetem Glas –, wie ein Waisenkind an dem riesigen, mit größtem technischem Raffinement ausgerüsteten Schreibtisch saß, Schwarzbrot mit Butter aß und Vasari las und dabei geistesabwesend Briefe oder Quittungen unterschrieb. Er hob dem Eintretenden dann das helle, mandelfarbene Gesicht fast bittend entgegen, zurückhaltend verschlossen der Blick. Und doch spannte sich in seiner Sanftmut eine unsichtbare Stahlsaite; seine Mitarbeiter waren immer wieder darüber erstaunt, dass ihm trotz all der scheinbaren Gleichgültigkeit bei seinen Geschäften nicht die geringste Kleinigkeit entging; und bei nahezu jeder seiner Transaktionen stellte sich heraus, dass sie ein Ergebnis seiner starken, sicheren Urteilskraft war. Er war eine Art Orakel für seine Angestellten – und doch (sie seufzten und zuckten mit den Schultern) schien er überhaupt keinen Wert darauf zu legen. Nicht am Gewinn interessiert sein: das gilt in Alexandria als heller Wahnsinn.
Vom Sehen kannte ich die beiden schon viele Monate, bevor wir uns kennenlernten – so, wie ich eben jeden in der Stadt kannte. Vom Sehen und Hörensagen; ihre großzügige, unkonventionelle Lebensweise hatte ihnen unter den spießbürgerlichen Städtern eine gewisse Berühmtheit eingebracht. Sie stand in dem Ruf, viele Liebhaber gehabt zu haben, und er wurde als ein mari complaisant betrachtet. Ich hatte sie einige Male miteinander tanzen sehen; er schlank, mit der schmalen Taille einer Frau und langen, biegsamen, auffallend schönen Händen; Justines bezaubernder Kopf – die geschwungene arabische Nase und die durch Belladonna vergrößerten, strahlenden Augen. Sie blickte um sich wie ein halb gezähmter Panther.
Eines Tages hatte man mich dazu überredet, über den in dieser Stadt geborenen Dichter einen Vortrag zu halten. Er solle im Atelier des Beaux Arts stattfinden, einem Club, in dem sich begabte Laienkünstler treffen und Ateliers mieten konnten. Ich hatte zugesagt, denn es bedeutete Geld für Melissas neuen Mantel – der Herbst stand schon vor der Tür. Aber es war mir peinlich, überall die Nähe des alten Mannes zu spüren, der die umliegenden düsteren Straßen mit dem Duft jener Verse zu durchdringen schien, die er aus seinen armseligen, aber ergiebigen Lieben geschöpft hatte; aus käuflichen Lieben vielleicht, die nur wenige Minuten gewährt hatten, aber in seinen Versen fortleben – so bewusst und zärtlich hatte er den flüchtigen Augenblick eingefangen und in all seinen Farben festgehalten. Wie anmaßend, über diesen Ironiker zu reden, der mit solcher Natürlichkeit und solch sicherem Instinkt seine Themen den Straßen und Bordellen Alexandrias entnommen hat! Und dies obendrein nicht vor einem Auditorium von Kurzwarenverkäufern und kleinen Angestellten – seinen Unsterblichen –, sondern vor einem erlesenen Kreis von Damen der Gesellschaft, die in der von ihm repräsentierten Kultur eine Art Blutbank sahen: Sie waren zu einer Transfusion gekommen. Viele hatten sich tatsächlich eine Bridgeparty entgehen lassen, obwohl sie wussten, dass sie keineswegs erbaut, sondern schockiert sein würden.
Ich erinnere mich nur noch, dass ich sagte, ich würde von seinem Gesicht verfolgt – diesem entsetzlich traurigen, sanften Ausdruck auf seiner letzten Fotografie; und als die ehrbaren Ladys die Steintreppe hinunter auf die nasse Straße getrippelt waren, wo ihre erleuchteten Wagen sie erwarteten, und in dem dunkel gewordenen Raum einen Hauch ihrer Parfums zurückgelassen hatten, entdeckte ich, dass eine Studentin der Leidenschaften und der Künste von ihnen vergessen worden war. Sie saß nachdenklich, eine Zigarette im Mund, hinten im Saal, die Beine wie ein Mann übereinandergeschlagen. Sie sah mich nicht an, sondern starrte vor sich auf den Boden. Ich schmeichelte mir mit dem Gedanken, dass vielleicht doch ein Mensch meine Nöte begriffen haben könnte. Ich nahm meine feuchte Aktentasche und den alten Gummimantel und ging hinunter auf die Straße; ein fadendünnes, durchdringendes Geriesel fegte vom Meer herauf. Ich schlug den Heimweg ein; Melissa würde schon erwacht sein und das Abendbrot auf dem mit Zeitungspapier gedeckten Tisch bereitgestellt haben, nachdem sie Hamid zum Bäcker geschickt hatte, den Braten zu holen – wir besaßen keinen eigenen Herd.
Es war kalt auf der Straße, ich strebte dem Lichterglanz der Läden in der Rue Fuad zu. Im Fenster eines Lebensmittelgeschäfts sah ich eine kleine Büchse Oliven, auf der Orvieto stand, und da überkam mich solche Sehnsucht, auf der richtigen Seite des Mittelmeeres leben zu können, dass ich den Laden betrat: sie kaufte: sie auf der Stelle öffnen ließ: und dann saß ich in diesem grauenhaften Licht an einem Marmortisch und schlang Italien in mich hinein, schlang sein dunkles, sonnengereiftes Fleisch, die handbearbeitete Frühlingserde, die geweihten Reben. Ich ahnte, dass Melissa dies nie verstehen könnte. Ich würde so tun müssen, als hätte ich das Geld verloren.