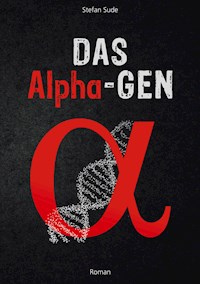
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jakob wird von seinem Jugendfreund zu einem Besuch eingeladen. Als er sich bereit erklärt, diesem und seiner Wissenschaftscrew einen Gefallen zu tun, ahnt Jakob noch nicht, in welche Gefahr er sich begibt. Seine Aufgabe besteht darin, Unterlagen über einen neu entdeckten Parasiten einem Biologen in Houston zu überbringen. Doch ein mächtiges Konsortium will Jakob mit allen Mitteln daran hindern. Ein Wettlauf auf Leben und Tod beginnt, in dem Jakob sich den Mächtigen dieser Welt gegenübersieht und keine Möglichkeit hat, diesem Katz-und-Maus Spiel zu entkommen. Um selbst zu überleben und die Wissenschaftler und seinen Freund zu schützen, entschließt er sich dazu, die Hintergründe über die Krankheit, die der Parasit verursacht, selbst zu recherchieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS:
Prolog
Offenbarung
Träume
Erwachen
Venedig
Hugenpoet
Labor
New York
Verbindungen
Puzzlestücke
Überraschungen
Spekulationen
Erkenntnis
Befreiungsversuche
Glaube
Enttäuschungen
Entscheidung
Epilog
PROLOG
Glühende Hitze breitete sich über der Hochebene an diesem frühen Nachmittag aus. Dörr und vertrocknet waberte der spärliche Bewuchs in der flimmernden Luft über dem sandigen Boden.
Ife stand mit einer kleinen Gruppe unter dem einzigen Baum, der an diesem trostlosen Ort etwas Schatten spendete und wartete auf die Dämmerung, um endlich weiterziehen zu können.
Sie führte mit Ad zusammen die kleine Gemeinschaft an, die sie dazu gebracht hatte, ihnen zu folgen.
Mittlerweile waren sie schon viele Tage und so manche Nacht unterwegs. Wenn die Sonne früh am Morgen aufging, bestimmten sie ihre Richtung, liefen in einer Reihe hintereinander her, dem Licht entgegen, sorgsam darauf achtend die Gefahren der Steppe im Blick zu behalten.
Ife war anders als die anderen ihrer Rasse, größer und beim Laufen durchaus so schnell wie die Männer. Allerdings, und das brachte ihr ihren Namen ein, der eigentlich ein Zeichen der Verwunderung und Abscheu war, wurde ihr Körper kaum von Haaren bedeckt. Einzig Ad, der Mann an ihrer Seite, hatte sie als Kind schon akzeptiert und die vielen Ausflüge mit ihr bestritten, die sie unternahm, wenn ihr die Schubsereien und Ausgrenzungen wieder einmal auf die Nerven gingen.
Ad war stark und schnell. Er hätte durchaus das Zeug dazu, einen Familienclan zu führen. Was Ife jedoch besonders an ihm liebte war seine Zärtlichkeit. Sie mochte es, wenn er sich hinter sie setzte und ihr den Kopf und die Schultern kraulte, in dem schwachen Flaum nach Ungeziefer suchte und sich an ihr rieb.
Jetzt jedoch befand sie sich allein mit den sieben anderen unter dem Baum und wartete. Ad war zum Rand der Ebene vorgelaufen, um hinunter zu schauen und auszukundschaften, ob sich in der dahinterliegenden Senke vielleicht ein Platz finden würde, an dem sie eine Zeitlang verweilen konnten.
Ihr ursprünglicher Clan war mit dem Zuwachs der letzten Generationen zu groß geworden. Das Nahrungsangebot wurde durch eine nun schon einige Jahre anhaltende Trockenheit knapp und das Wasser des kleinen Tümpels in der Nähe ihres Stammplatzes hatte mittlerweile seinen erfrischenden Geschmack verloren.
Streitereien und Gerangel nahmen überhand und bestimmten mit fortwährenden Machtkämpfen den Tagesablauf. Es wurde Zeit sich auf den Weg zu machen und neue Lebensräume zu erkunden.
Zuerst hielten Ife und Ad sich eine Zeitlang etwas abseits der anderen auf, aßen und schliefen einige Tage vor dem schutzbietenden Wall, hinter dem der Clan sein zuhause hatte, um zu zeigen, dass sie bereit waren eigene Wege zu gehen. Nach und nach gesellten sich einzelne Männer und Frauen um das Paar herum und als sie der Meinung waren, die Gruppe sei nun groß genug, brachen sie auf.
Ad kam zurück. Mit gleichmäßigen, großen Sätzen lief er auf die Gemeinschaft zu und der mittlerweile lange Schatten, der ihm folgte, zeigte Ife das es spät genug wäre, weiterzuziehen.
In den Nächten, in denen der Mond genug Licht spendete, um das Umfeld im Auge zu behalten, wanderte die kleine Gruppe gerne in der Dunkelheit. Dann war es kühler und der Durst hielt sich in Grenzen.
Nachdem Ad sie erreicht hatte, erzählte er mit den einfachen Worten, die ihm in diesem frühen Stadium der Menschwerdung zur Verfügung standen, und unter Zuhilfenahme einer ausgeprägten Gestik von einem großen See und dichtem Wald, die sich in der Senke befanden. Das waren vielversprechende Neuigkeiten.
Ife war zufrieden und so setzte sich die kleine Gruppe nach kurzer Zeit in Bewegung, um die fünfeinhalb Kilometer zum Rand der Hochebene hinter sich zu bringen.
Als sie einige Zeit später am schroffen Abhang ankamen, hatte sich bereits Dunkelheit über das Land gelegt und den Blick auf nähere Einzelheiten in tiefe undurchdringliche Schwärze getaucht.
Konnte man bei diesen Lichtverhältnissen zwar noch über die Steppe ziehen, wäre ein Abstieg an der Felswand ein lebensgefährliches Unterfangen geworden.
Staunend standen die Neun am Rande des Plateaus und blickten auf die unendliche Weite des sich tief unten im Mondlicht spiegelnden Wassers. Glitzernd tanzte das Mondlicht auf den flachen Wellen. Noch niemals hatten sie das Meer gesehen, nie die Macht der rauschenden Brandung gehört. Ife war überwältigt. Dichtes Buschwerk säumte den Strand und fremde Tierstimmen erfüllten aus weiter Ferne die Luft.
Hier würden sie heute übernachten, ein wenig absteigen und im Schutz eines Felsvorsprunges zur Ruhe kommen.
Es dauerte nicht lange, bis sie einen passenden Rastplatz gefunden hatten. Erschöpft und voller euphorischer Vorfreude legten sich die Teilnehmer der Gefolgschaft auf den warmen Boden und schliefen bald darauf ein.
Nur Ife saß noch am flachen, sandigen Rand des kleinen Vorsprunges, den sie sich ausgesucht hatten und blickte verträumt aufs Meer. Hinter ihr ließ sich Ad nieder und streichelte ihr sanft über Schultern und Kopf. Sie genoss die Berührungen und voller freudiger Erregung richteten sich ihre Nackenhaare auf. Streichelnd und kraulend wanderten seine warmen Hände an ihrem drahtigen Körper hinunter. Mit sanfter Kraft wurde sie von seinem starken Arm umschlossen. Zärtlich streichelte Ad ihre Brust, spielte an den dunklen, festen Brustwarzen. Mittlerweile schien ihr ganzer Körper vor Lust zu vibrieren, feucht und offen präsentierte sich ihre Vagina, als Ad die Finger seiner freien Hand in die Öffnung gleiten ließ. Sein mächtiges, erregtes Glied rieb an ihrem Rücken, pochte voller Erwartung im Rhythmus ihres Herzschlages gegen die empfindliche Haut ihres Steißbeins.
Bereit von ihm bestiegen zu werden, beugte sich Ife nach vorn, ohne den Blick von dem rauschenden Meer unter ihnen abwenden zu können.
Sein steifer, leicht gekrümmter Penis drang tief in sie ein und Ife konnte seinen schweren Atem auf ihrem Nacken spüren, als er im schneller werdenden Takt vor und zurückglitt. Die tanzenden Lichter des Wassers verschwammen vor ihren Augen als seine Finger gekonnt ihre Klitoris rieben und sie spürte, wie sich sein Saft in ihr ergoss. Auf unbändige Lust folgte wohlige Befriedigung. Entspannt ließ Ad sein nun nicht mehr so hartes Glied in ihr noch einige Zeit hin und her gleiten, als sich plötzlich am Himmel zwischen den abertausenden Sternen ein leuchtender Punkt bewegte, einen Streifen hinter sich herzog und fortwährend heller und leuchtender wurde.
Gebannt sahen die beiden zum Himmel, nicht in der Lage den Blick von diesem seltsamen Naturschauspiel zu wenden. Immer noch stieß Ad sein Glied in langsamen, rhythmischen Bewegungen in Ife, ohne sich dessen bewusst zu sein. Der Komet kam näher, schien direkt auf sie zuzufliegen. Mittlerweile konnte man das sich zu einem Kreischen verstärkende Pfeifen nicht mehr überhören. Kein Tier im Dickicht am Meeresufer wagte noch einen einzigen Ton von sich zu geben. Näher und näher kam das strahlende Gebilde.
Fasziniert und ängstlich zugleich blickten Ad und Ife auf das Etwas, das auf sie zukam. Dann beschrieb es einen kleinen Bogen, flog jetzt steiler auf den Boden zu und, das erkannte Ife mit einem Mal, würde sie nicht treffen, sondern am nahen Strand zu Boden gehen.
Kurz vor dem Aufschlag konnte man die riesige Dimension des Lichtstreifens erkennen, den das kleine Gestein hinter sich herzog, dann schlug es mit einem dumpfen Dröhnen auf dem Sandboden ein und schleuderte diesen meterhoch in die Luft. Die Erde schien leicht zu vibrieren und ein gelbrotes Glühen schimmerte durch die Wolke herunterrieselnden Sandes. Ad saß mittlerweile neben Ife und fasste ihre Hand. Mit einer Kopfbewegung zeigte er auf den rotglühenden Punkt am Strand und sah sie fragend an. Ife bedeutete ihm, dass sie morgen bei Tagesanbruch hinuntergehen und den Neuankömmling untersuchen würden. Dann legten sie sich mit den anderen, die mittlerweile unentdeckt neben ihnen standen, wieder zum Schlafen auf den Boden der kleinen Nische.
Am nächsten Morgen machte sich die Gruppe an den Abstieg. Unten angekommen umliefen sie das Waldstück, das sich um einen seichten Zufluss gebildet hatte.
Ife beschloss eine kurze Erfrischungspause einzulegen, in der sie sich am fließenden Wasser labten und nach Früchten suchten, die an den Bäumen und Büschen wuchsen.
Danach setzten sie ihre Suche nach der Absturzstelle des Kometen fort.
Geschmolzener Sand, hart und milchig glänzend, wies ihnen den Weg zu einem tiefen Loch, in dem sie ein weiß glänzendes, aufgesprungenes Ei fanden.
Vorsichtig arbeitete sich Ife vor, den gläsernen Boden hinab zu dem Straußeneigroßen Gebilde, sorgsam darauf achtend, dass sie sich nicht an den scharfen Kanten des Untergrundes schnitt oder die Temperatur noch so hoch war, dass sie sich verbrannt hätte. Endlich war der Abstieg geschafft und Ife blickte voller Verwunderung auf den Gegenstand. Eine sauber in zwei Teile gespaltene Schale in reinstem Weiß lag im Zentrum des Kraters und offenbarte einen dunklen Stein mit kleinen Ausbuchtungen. Auch er war in zwei Teile zerfallen und enthielt eine milchige Flüssigkeit, die sämig in den Steinkuhlen lag.
Vorsichtig hob sie das Gestein auf, roch daran und stupste ihren Finger in die leicht klebrige Flüssigkeit. Sie roch süßlich und verrieb sich ölig zwischen den Fingern. Vorsichtig leckte Ife ihren Finger ab. Der Geschmack erinnerte sie an etwas, doch sie konnte nicht sagen was es war, süßlich schmeckte es und war doch leicht pelzig am Gaumen. Etwas beherzter nippte sie noch einmal an der Flüssigkeit, sammelte dann die Gegenstände ein und trug sie vorsichtig nach Oben an den Rand des Kraters, wo die anderen auf sie warteten.
Es war der erste Gegenstand, den Ife auf ihrer Reise mitnahm. Der erste, den sie für wertvoll genug erachtete, ihn nicht nach einer gründlichen Untersuchung irgendwo liegenzulassen und zu vergessen.
Die kleine Gruppe entschloss sich schließlich am Meer mit dem Wasser, das man nicht trinken konnte, entlang zu gehen, bis sie einen Platz fänden, an dem sie ihren eigenen Familienclan ansiedeln konnten.
OFFENBARUNG
Meine Arbeit war getan und die wenigen Sachen, die ich meinte für den kurzen Wochenendtrip zu benötigen, hatte ich in mein kleines Cabriolet, einen 2002er MX5, geladen.
Jan hatte mich eingeladen, ihn über Nacht in Münster zu besuchen. Nun saß ich im Auto, folgte der Autobahn bei strahlendem Sonnenschein, sang hin und wieder voller Inbrunst ein Duett mit den Interpreten im Radio oder hing meinen Gedanken nach.
Die Fahrt würde etwa drei Stunden in Anspruch nehmen, das war genug Zeit sich zu fragen, warum Jan nach all den Jahren ausgerechnet mich konsultiert hatte.
Vor vielen Jahren habe ich den damals jungen Mann in einer Kneipe in Castrop-Rauxel kennengelernt. Ich hatte dort über das Wochenende eine Messe besucht und mir den Abend mit einem kleinen Kneipenbummel vertrieben.
An der Theke kamen wir ins Gespräch, unterhielten uns über Gott und die Welt und spürten schon nach kurzer Zeit, dass wir auf der gleichen Wellenlänge lagen. Der hochgewachsene, schmale Mann mit den sympathischen Gesichtszügen und dunkelblonden, zu einem Zopf zurückgebundenen Haaren hatte erst vor kurzem sein Biologiestudium beendet und sprühte vor Tatendrang in der Forschung tätig zu werden. Er erzählte mir euphorisch von den Möglichkeiten, die die Biologie in sämtlichen Bereichen der Forschung bereithielt und man spürte das Jan, der jugendliche Typ in durchgewetzten Jeans und einem eher knittrigem, bunten Kurzarmhemd, in seinem Beruf aufging.
Seine Eltern lebten in Norddeutschland und er war für das Studium zu den Großeltern gezogen. Als wir uns kennenlernten, hatte er bereits in Castrop eine eigene, kleine Wohnung und durch seinen neugewonnenen Arbeitsplatz auch kein sonderliches Interesse mehr daran, wieder zurück nach Hamburg zu ziehen.
Nachdem wir uns bis in die frühen Morgenstunden angeregt unterhielten, tauschten wir die Telefonnummern und Adressen aus und hielten auf diese Weise über einige Jahre regen Kontakt zueinander.
Doch wie das Leben so spielt, nahmen Alltäglichkeiten, Familie und Freunde zu viel Platz ein, als dass die Verbindung eine dauerhafte Stellung hätte einnehmen können. Der Schriftverkehr wurde rar und kam schlussendlich vollends zum Erliegen. Mittlerweile hatte ich über fünfzehn Jahre nichts mehr von ihm gehört und ihn schon fast aus meinem Gedächtnis gestrichen.
Umso mehr wunderte ich mich darüber, dass er mich vor kurzem anrief und mich bat ihn zu besuchen.
Es brauchte sogar eine ganze Weile, bis ich am Telefon wusste, mit wem ich es am anderen Ende der Leitung zu tun hatte.
Als ich mir endlich gewahr wurde um wen es sich handelt, freute ich mich umso mehr über den unverhofften Anruf.
Jan erzählte mir, dass er mittlerweile in Münster lebt und in der dortigen Universität arbeitet. Seine Arbeit mit einigen Kollegen hätte ihm eine außergewöhnliche Entdeckung beschert, über die er gern einmal mit mir sprechen würde.
Ich willigte ein, ihn am Wochenende zu besuchen, da ich Münster noch nie gesehen hatte und mir gehaltvolle Gespräche erhoffte. Auch wenn ich nicht die geringste Ahnung hatte, warum er ausgerechnet mich, der ich wirklich keine vertieften Kenntnisse von Biologie besaß, zu dieser Unterredung einlud.
Es war Freitagabend, als ich gegen etwa 21.00 Uhr vor dem angegebenen Wohnblock stand und im faden Licht der Eingangsbeleuchtung nach seinem Namen auf den Klingelschildern suchte.
Endlich hatte ich es gefunden und schellte. Die Beleuchtung im Flur wurde eingeschaltet und gab den Blick auf ein kahles Treppenhaus frei, dessen blass ockerfarbene Wände im harten Kontrast zu den dunklen, gesprenkelten Bodenfliesen stand.
Ein Summen signalisierte mir, dass ich die Glastür nun öffnen konnte.
Schnell hatte ich die zwei Etagen bis zu seiner Wohnung erklommen und stand vor Jan, der vor der geöffneten Wohnungstür strahlend auf mich wartete.
Er begrüßte mich herzlich, auch wenn ich die in den letzten Jahren eingetretene Entfremdung zwischen uns deutlich spüren konnte. Wir hatten uns beide verändert, nicht nur äußerlich, jeder von uns war seiner Wege gegangen und hat den jeweils anderen daran nicht teilhaben lassen.
Er hatte mich in der Zwischenzeit wahrscheinlich genauso vergessen, wie ich ihn.
Ein erster, verhaltener Blick über den kurzen Flur, in dessen Ecke ein Staubsauger mit ausgerolltem Stromkabel stand und in dem ausschließlich Männerschuhe unter der hellen Garderobe zu sehen waren, verleitete mich zu dem Schluss, dass er selbst jetzt, mit 45 Jahren, noch Junggeselle war.
Er hatte etwas zu essen gemacht und bei einem Gläschen Wein entspannte ich in der praktisch eingerichteten Küche von der zum Teil mühseligen Fahrt.
Während des Essens, er hatte Pizza aufgetischt, die er selbst zubereitet hatte, unterhielten wir uns darüber wie es uns in den letzten Jahren ergangen war, was wir so getrieben haben und wie wir uns die Zukunft vorstellten. Immernoch war Jan ein charmanter Unterhalter und nicht selten überraschte er mich mit seiner erstaunlichen Allgemeinbildung. In dieser Beziehung war er mir haushoch überlegen, auch wenn ich mich selbst nicht als ungebildet bezeichnen würde. Die Themen wanderten von unserem eigenen Lebensweg zur aktuellen politischen Lage im In- und Ausland, umfassten gesellschaftliche Probleme und verwegene Prognosen, die wir uns gegenseitig auf Grundlage der überbordenden, technischen Entwicklung ausmalten.
Mit der Zeit spürte ich, dass wieder ein Hauch der alten Vertrautheit zwischen uns aufkeimte.
„Jakob,“ begann er zu vorgerückter Stunde und wurde wieder ernster, „du fragst dich sicher warum ich mit dir reden möchte und nicht mit jemanden anderen, der mir vielleicht nähersteht.“
„Gefragt habe ich mich das schon.“ antwortete ich in dem Bemühen der Frage, die ich mir selbst noch auf der Herfahrt gestellt hatte, nicht übermäßig viel Bedeutung anmerken zu lassen.
Mir wurde mit einem Mal wieder bewusst, dass er bei unserem Telefonat ein biologisches Problem angedeutet hatte und es mich überraschte, dass er auf diesem Feld offensichtlich keinen kompetenteren Gesprächspartner als mich fand.
„Um die Wahrheit zu sagen, ich könnte ein wenig Hilfe von einer außenstehenden Person gebrauchen.“ begann er das Thema und ich spürte, wie er sich bemühte, Worte zu finden, die mir glaubwürdig erklären sollten, warum er ausgerechnet mich ausgewählt hatte.
Ich grinste ihn an. Der mittlerweile reife Mann, der mir gegenübersaß, war mir in den wenigen Stunden unseres Zusammenseins schon wieder vertraut geworden. Zwar war der Zopf, mit dem ich ihn damals kennengelernt hatte, einem Kurzhaarschnitt gewichen und Geheimratsecken ließen das ohnehin schmale Gesicht mittlerweile noch etwas länger wirken, doch die freundlichen, wachen, blauen Augen versprühten immer noch den gleichen Scharm, der mich damals bewog, ihn anzusprechen, um den Abend nicht wortlos zu verbringen.
„Leg einfach los,“ sagte ich einen Augenblick später, „wenn ich helfen kann, tue ich das natürlich gerne. Wenn nicht, dann musst du dir eben doch einen anderen Gesprächspartner suchen.“
Jan gewann seine Sicherheit wieder, gemütlich lehnte er sich in seinem Stuhl zurück. Es schien als suche er nach einem geeigneten Einstieg, um das Thema auf sein Problem zu lenken.
Gedankenverloren schob er die letzten kleinen Reste seiner Pizza auf dem Teller mit der Gabel von einer Seite auf die andere, sah mich abschätzend an, nur um einen Augenblick später wieder auf seinen Teller zu sehen.
„Was denkst du können Parasiten alles bewirken?“ fragte er schließlich trocken und musterte mich dabei ernst.
Ich überlegte einen Augenblick, während seine Augen auf mir ruhten und eine Antwort zu fordern schienen.
Schon die Beantwortung dieser einen Frage würde meine Ahnungslosigkeit zur Gänze offenlegen und ihm verdeutlichen, dass ich ihn in Sachen Biologie wahrlich keine Hilfe sein würde.
Ich entschied mich offen und ehrlich meine Grenzen aufzuzeigen, eine Wahl hätte ich sowieso nicht.
„Ich denke sie können uns, schließlich sind es ja Parasiten, entziehen was sie zum Überleben brauchen.“
Jan nickte, offensichtlich hatte er nicht mehr von mir erwartet.
„Jakob, dann nehme ich an, sagt dir der Begriff `Toxoplasma Gondii` auch nichts?“ Wieder ließ ich mir mit einer Antwort Zeit. Es wäre müßig gewesen zu raten oder zu spekulieren.
Natürlich tat ich es trotzdem, ich hatte Mut gefasst und fühlte mich sogar ein klein wenig geneigt auszutesten, wie weit ich mit dem zur Schau stellen meiner Unwissenheit gehen konnte.
Ich versuchte mein Glück mit einer Übersetzung, ohne mich jedoch mit dem altgriechischem auszukennen. Also riet ich ziemlich intuitiv.
Bei dem Wortteil Toxo-, dachte ich fälschlicherweise an Gift. -plasma übersetzte ich spekulativ als Gel oder träge Flüssigkeit, weil meine Gedanken dabei um die Erinnerung an Blutplasma kreisten. Gondii? Mein Blick wanderte zur Decke, von der ein gläserner Lampenschirm herabhing, den eine einsame Fliege umkreiste. Egal, dachte ich, Gondii hört sich irgendwie nach venezianischer Gondel an, also ein Schiff.
„Giftiger Schiffchenschleim?“
„Naja,“ Jan grinste schief, „mit ganz viel Fantasie könnte man eine Verbindung ziehen. Allerdings übersetzt Toxo- sich als `bogenförmig` und -plasma meint ein `Gebilde`.“
Offensichtlich hatte er meine Herleitung richtig interpretiert.
`Mit viel Fantasie könnte man…` erinnerte mich daran, dass es im Physikforum, in dem ich mich vor Jahren hin und wieder herumtrieb, immer hieß, wenn jemand absoluten Humbug schrieb, es wäre so weit vom Thema entfernt, dass man es nicht einmal falsch nennen könnte.
„Toxoplasma Gondii ist ein Parasit,“ klärte mich Jan endlich auf, „der sich bei Mäusen ins Gehirn einnistet und sie dort darauf programmiert, ihre natürliche Angst vor Katzen zu verlieren. Die armen Mäuse werden quasi ferngesteuert, um von Katzen gefressen zu werden.
Denn erst in Katzen kann sich der Parasit weiterentwickeln und vermehren.“
„Aha,“ mehr fiel mir auf Anhieb nicht ein. Ich führte mir das Szenario vor Augen.
Ein Parasit, der das Gehirn einer Maus so manipulieren kann, dass diese Dinge macht, die sie sonst nicht tun würde?!
Eine voll funktionsfähige, am Leben erhaltene Hülle, die von einem winzigen Parasiten wie eine Marionette geführt wird, nur um sie dazu zu benutzen, in den Körper eines anderen Wesens zu gelangen.
Unweigerlich schoss mir der Gedanke von der Verhältnismäßigkeit der Mittel in den Sinn. Wie absurd erschien es mir, einen solchen Aufwand zu betreiben, nur um den Wirt zu wechseln. Oder noch schlimmer, wie leicht musste es sein, ein Wesen, ein Säugetier sogar, derart zu manipulieren?
Was mich jedoch einen Augenblick später am meisten entsetzte, war, dass es sich bei dem Wesen, das die Kontrolle über diese Maus übernimmt, nicht um einen hochintelligenten Organismus handelt, sondern um eine der einfachsten Lebensformen die die Erde zu bieten hat.
Ich bemühte mich den Schauder, der mir unwillkürlich über den Rücken lief, zu überspielen.
„Und was willst du mir damit sagen?“ fragte ich ihn also, „Das die Mäuse jetzt aussterben werden, wenn ihr kein Heilmittel findet?“
„Nein!“ Jan wirkte ernst. Seine dünnen Augenbrauen zogen sich leicht zusammen und er überhörte meinen aufgesetzten Sarkasmus geflissentlich.
„Wir haben einen Parasiten entdeckt, der auf ähnliche Weise wirkt.“
Das war sicher noch nicht alles, dachte ich und schaute ihn erwartungsvoll an.
„Er sitzt im menschlichen Gehirn!“
Für einen Augenblick herrschte angespannte Stille, unterbrochen nur von dem Summen der Fliege an der Lampe.
Jan hatte den Satz in einer Betonung ausgesprochen, die mir der Tragweite ihrer Entdeckung bewusstwerden lassen sollte, soviel hatte ich gemerkt.
Dennoch beschloss ich, die Ernsthaftigkeit wie einen zugespielten Ball vor mir her zu kicken und auf Abstand zu halten.
„Naja,“ gab ich nach einer Weile zu bedenken, „aber warum sollten sich Parasiten die Mühe machen uns ferngesteuert vor irgendwelche Katzen zu stellen, oder was weiß ich machen zu lassen?“
Mit einem Mal war ich mir unsicher, ob mein Einwand zu provokativ war, die Erkenntnisse vielleicht zu sehr ins lächerliche zog. Ich wartete ab.
Jan nahm sein Glas Wein und trank einen Schluck, schüttete sich nach und hielt auch mir die Flasche hin. Es war ein roter Supermarktwein, günstig und halbtrocken, genau wie ich ihn mag, also griff ich zu.
Jan zuckte mit den Schultern. Wenn er beleidigt war, ließ er sich zumindest nichts anmerken.
„Wir haben keine Ahnung. Bei Toxoplasma Gondii ist die Katze der eigentliche Wirt, der Hauptwirt, in dem sich der Parasit weiterentwickeln und fortpflanzen kann. Einfach gesagt verbringt er in der Maus seine Kindheit, während er in der Katze erwachsen werden kann, um Kinder zu bekommen. Uns fehlt dazu bei der Menschlichen Version der Hauptwirt, die Katze sozusagen.“
„Also ist das Verhalten der Parasiten völlig sinnlos?“ fragte ich, in gewisser Weise froh, dass Jan meinen unqualifizierten Einwand nicht aufnahm.
„Nein, kein Lebewesen macht etwas nur so, ohne einen Sinn dahinter, nicht einmal ein Einzeller. Wir haben allerdings noch nicht herausgefunden warum unser Parasit diese Verhaltensänderung beim Menschen provoziert.“
Ich nahm einen Schluck von dem Wein, lehnte mich in dem nur bedingt bequemen Küchenstuhl zurück und streckte die Beine weit unter den Tisch. Noch hatte mir Jan nicht verraten, welche Verhaltensanomalie die Krankheit beim Menschen hervorruft. Das war eine der Eigenschaften, die ich von Jan noch allzu gut kannte. Er verstand es, den Höhepunkt seiner Geschichten ganz ans Ende zu legen und so bei dem Zuhörer bis zum Schluss eine gewisse Aufmerksamkeit aufrecht zu halten.
Ich wartete ab, doch Jan redete nicht weiter.
Ok, dachte ich, so einfach wird’s dann doch nicht.
„Was löst denn Gondii beim Menschen aus?“
Ohne weiter auf meine Frage einzugehen stand Jan auf, räumte das Geschirr ab und ging zu einem kleinen Schrank, der unter dem Küchenfenster stand. Abwartend sah ich ihm nach.
Nach einem Augenblick des Herumkramens kam er zurück und stellte ein paar Erdnüsse auf den Tisch.
„Er schaltet im weitesten Sinne die Selbstkontrolle aus, schaltet Bereiche aus, die für die Arterhaltung zuständig sind“ Jan machte eine kurze Pause, griff in die Schale mit Erdnüssen und schob sich ein paar in den Mund.
„Der Selbsterhaltungstrieb bezieht sich in einer Gesellschaft im Allgemeinen auf das Kollektiv. Nur in absoluten Stresssituationen reduziert er sich ausschließlich auf die eigene Person. Durch diesen Parasiten jedoch wird das Kollektivverhalten von vornherein ausgeschaltet oder zumindest unterdrückt.“ erklärte er.
Ich stutzte.
„Der Selbsterhaltungstrieb folgt der Arterhaltung? Seit wann das?“ fragte ich erstaunt.
Für mich war der Selbsterhaltungstrieb der ureigenste Instinkt, sich gegen den Tod zu schützen, also vor einem Löwen zu fliehen oder nicht von einem Kirchturm zu springen nur um zu sehen, was dann passiert.
Jan nickte zaghaft mit dem Kopf, als wolle er seine Behauptung damit untermauern, „Ohne Stress, wenn es nicht ums nackte Überleben geht, arbeitet die Gemeinschaft an der Befriedigung der Bedürfnisse aller. Jedes Individuum bemüht sich zwar eine übergeordnete Rolle zu übernehmen oder im Zweifelsfalle auch einen unliebsamen Gegner aus dem Weg zu räumen, aber niemals nur um der eigenen Befriedigung Willen, den Anderen besiegt zu haben. Es geht immer darum in einer Gesellschaft einen Vorteil zu generieren.“
„Ach so,“ ich begann zu erahnen was Jan damit sagen wollte. Für ihn war die Selbsterhaltung das Bedürfnis, Durst und Hunger zu stillen und Kinder zu zeugen. So bemühte ich mich seinen Ansatz aufzugreifen, „ohne funktionierende Gesellschaft ergibt sich kein Vorteil für mich, wenn ich jemand Anderen besiege. Also ist die Gesellschaft die Grundlage für dominantes Verhalten in der Gruppe. Quasi um mehr Nahrung aus dem gemeinsamen Lager zu bekommen oder mehr Nachwuchs zeugen zu können. Im ursprünglichen Sinne meine ich jetzt.“ versuchte ich mich einzubringen und mein Verständnis zu signalisieren.
„Genau,“ stimmte Jan zu, „Grundlage dafür ist die Gesellschaft, die erhalten werden muss, um die Sinnhaftigkeit im Verhalten des Einzelnen nicht zu verlieren. Natürlich ist sich das Individuum nicht darüber bewusst, dass es für die Gemeinschaft arbeitet, weil jede Leistung für die Gesellschaft auch einen persönlichen Vorteil generiert, aber die Natur hat es so eingerichtet, dass ein Grenzwert des Egoismus negative Folgen für die Gemeinschaft auf Dauer ausschließt.“
„Und was schaltet jetzt der Parasit genau aus?“ eigentlich erschien mir meine Frage fast überflüssig. Ich griff ebenfalls in die Schale mit Erdnüssen und erahnte schon die Antwort als ich geistesabwesend Nuss für Nuss in den Mund steckte.
„Das Kollektivverhalten, eben genau diesen Grenzwert. Die Menschen, bei denen der Parasit aktiv wird, verlieren den Überblick über das Wohl der Gruppe. Eine Art `Tunnelblick` lässt nur noch den eigenen Vorteil, oder den einer minimalen Gruppe zu. Das wäre, als würde ein Soldat im Kampf nicht nur den Feind bekämpfen, sondern auch im eigenen Schützengraben um sich schießen, damit er als einziger Gewinner aus dem Krieg gehen kann.“
Jan stützte sich mit den Ellenbogen auf den Tisch und sah mich eindringlich an.
„Für den einzelnen Befallenen wirkt es so, als würde er zu seinem Vorteil handeln.“ schloss er.
„Denken das Mäuse nicht auch, wenn sie keine Angst mehr vor Katzen haben?“ warf ich ein.
„Nein, nicht direkt, Jakob. Die Mäuse haben einfach nur keine Angst mehr vor Katzen, fühlen sich ihnen eher hingezogen.“ berichtigte er mich, „Bei Menschen ist das anders. Sie scheinen tatsächlich erst einmal einen Vorteil zu haben. Allerdings entpuppt dieser sich als Nachteil für die Menschheit im Allgemeinen.“
Jan machte eine Pause und musterte mich wieder.
Er wusste, dass er mir da etwas vor die Füße geworfen hatte, das für mich erst einmal schwer zu verdauen wäre. Zu subtil und großflächig erschien mir die Aussage, als dass ich hätte den tieferen Sinn in seinen Ausführungen erkennen können.
„Ich hoffe, ich werde dir nach weiteren Erklärungen wieder folgen können.“ stellte ich fest und wartete darauf, eben diese von ihm zu erhalten.
„Dieser Parasit wird nur bei Alphatypen aktiv.“ ergänzte Jan und schien der Meinung, es müsste bei mir jetzt `klick` machen.
Das tat es aber nicht.
Ich wartete noch einen Augenblick auf die Erklärung für Dummies, aber es geschah nichts.
Die Fliege, die es mittlerweile offensichtlich leid war, um die künstliche Lichtquelle herumzufliegen, landete auf dem Tisch und putzte sich genüsslich mit den Vorderbeinen über ihre Facettenaugen. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie erschlagen, oder es bei der Beobachtung belassen sollte.
„Also nochmal,“ ich riss mich von ihrem Anblick los und bemühte mich selbst darum in Jans Worten Klarheit zu finden.
„Alphatypen haben einen Parasiten im Kopf, der ihnen Vorteile verschafft und der Menschheit schadet, richtig?“
„Richtig!“ bestätigte Jan.
„Die Größen der Gesellschaft, ich nehme an, das sind die Alphatypen, über die du redest, zerstören also die Menschheit?! Ich sage einmal so, das ist keine wirklich neue Erkenntnis. Dafür brauchen diese Menschen keine Fernsteuerung im Kopf. Da reicht ein roter Knopf oder `ne Menge Kohle.“
Ich schüttete mir noch ein Glas Wein nach.
„Kannst du das beurteilen?“ fragte mich Jan, und anders als die Worte es vermuten ließen, schien es mir keine Beleidigung zu sein.
Mit dem Glas in der Hand stand ich auf und wanderte in der kleinen Küche umher, um mir die Beine etwas zu vertreten. Jan blieb sitzen und folgte mir mit den Augen. Er beobachtete mich und ich hatte den Eindruck als versuche er abzuschätzen, ob ich wirklich der richtige für dieses Gespräch war.
Immer noch hatte ich keine Ahnung warum er ausgerechnet mich angerufen hatte. Meine Gedanken kreisten um seine Erzählungen und suchten einen Zusammenhang zwischen seiner wissenschaftlichen Arbeit und dem Nutzen, den ich dazu beisteuern könnte.
„Um die Wahrheit zu sagen,“ an die Spüle gelehnt nahm ich das Gespräch wieder auf, „das scheint mir doch ziemlich suspekt, also wie kommst du darauf? Um ehrlich zu sein, frage ich mich auch immer noch, wieso du mich kontaktiert hast und nicht irgendwen, der deinen Ausführungen fachlicher entgegnen kann?“
„Morgen,“ entgegnete Jan und erst jetzt fiel mir auf, was für einen erschöpften Eindruck er mittlerweile machte, „ich bin jetzt müde.“
Tatsächlich war es schon nach eins und auch ich fühlte mich nach der langen Fahrt, dem Wein und dem Essen ziemlich kaputt.
Jan brachte mir ein Kissen und eine Decke aus dem Schlafzimmer.
Als wir einige Minuten später ins Wohnzimmer gingen entschuldigte er sich ausgiebig dafür, dass ich mit der Couch vorliebnehmen müsse.
Die Couch war schmal und ein wenig zu kurz für mich.
Sie stand in einem fast quadratischen Wohnzimmer, das mit modernen Schränken und recht wertigen elektrischen Geräten bestückt war.
Nachdem ich mich eingerichtet hatte und in Unterwäsche gekleidet bemüht war, eine einigermaßen bequeme Schlafposition zu finden, ging ich in Gedanken noch einmal unsere abendliche Unterhaltung durch.
Hatte Jan mich gerufen, um einen fachlichen Rat zu bekommen? Sicher nicht. Um die Meinung eines außenstehenden Zuhörers einzuholen?
Warum sollte er? Dafür hätte er jeden beliebigen Bekannten aus der Nachbarschaft befragen können.
Also warum hatte er es nach all den Jahren auf mich abgesehen? Ich blieb mir eine Antwort schuldig. Es würde mir nichts anderes übrigbleiben als abzuwarten, in welche Richtung sich die Situation entwickeln würde.
Ich sah auf die Uhr meines Handys: viertel nach zwei. Krampfhaft bemühte ich mich einzuschlafen. Irgendwann sank mein Bewusstsein in eine tiefere Ebene, ohne dass ich im Nachhinein hätte sagen können, ob ich eingeschlafen war, oder nur dahindöste.
Hin und wieder, wenn ich aus den kurzen Schlafphasen in umnebeltes Bewusstsein auftauchte, bereute ich, nicht doch ein Hotelzimmer genommen zu haben.
Die Geräuschkulisse der nahen Hauptstraße tat ein Übriges, um mich am Schlaf zu hindern.
Warum? fragte ich mich. Warum bin ich hierhergekommen? Warum zum Teufel habe ich kein Hotelzimmer gebucht?
Egal, morgen Abend würde ich zurückfahren und in meinem bequemen Bett nächtigen.
Viel später, gefühlt fünf Minuten vor dem munteren „Moin“ von Jan, muss ich wohl doch tief eingeschlafen sein. Ich rappelte mich auf und jeder Knochen tat mir weh, als ich endlich vor dem Spiegel eines Badezimmers stand, das keine Außenmauer besaß, und somit gänzlich fensterlos war.
Nach einer Tasse heißen Kaffee am Frühstückstisch fühlte ich mich ein wenig besser.
Jan hatte offensichtlich, während ich noch schlief, schon Brötchen besorgt und frisch gekochte Eier und Müsli auf den Tisch gestellt.
Er war Frühaufsteher und entsprechend gut gelaunt.
Aus einem kleinen Radio erklang Musik und pfeifend huschte Jan zwischen Kühlschrank und Tisch hin und her, um noch mehr Frühstückszutaten bereitzustellen.
Die Sonne schien und so beschlossen wir den Tag im Freien zu verbringen.
Nach dem ausgiebigen Frühstück fuhren wir mit dem Bus in den botanischen Garten der Universität. Eine Flasche Wasser im Gepäck und einige mit Wurst und Käse belegte Brötchen sollten uns vor dem plötzlichen Hungertod bewahren, der ja überall lauern kann und völlig unvermittelt kommt.
Auf einer Parkbank machten wir es uns bequem und beobachteten die vorbei spazierenden Familien, auf der Wiese liegende Jugendliche und sich eifrig unterhaltende Studenten.
„Vor ein paar Jahren,“ begann Jan, „sezierten wir Gehirne von einigen verstorbenen Alphatypen, in der Hoffnung einen Unterschied zwischen ihnen und Gammatypen, Mitläufern, zu finden.“
„Jau,“ antwortete ich spontan, „das kenne ich. Den Unterschied zwischen der Herrenrasse und den Untermenschen anhand eines Sklavenareals auf der Schädelrückseite finden. Ich dachte die Wissenschaft sei mittlerweile weiter?!“
Jan lachte kurz freudlos auf.
„Sind wir auch, heute suchen wir den Unterschied in den Botenstoffen, Synapsen, der DNA und RNA“
Er wandte den Blick von dem jungen Pärchen ab, das vor einer großblättrigen Pflanze stand und sich mit einem Buch in der Hand über deren Blüten unterhielt und schaute mich direkt an.
„Alphatiere gibt es in jedem sozialen Verband, egal ob Mensch oder Tier.
Man kann das Verhalten komplett psychologisch erklären und doch wird ein Verhaltensmuster durch Botenstoffe und Verknüpfungen im Gehirn materialisiert.“ Sein Blick wanderte zum Boden als suche er zwischen den kleinen Kieselsteinen nach einer Metapher, die mir seine Andeutung klarer machen sollte.
„Wenn du etwas lernst oder eine Geschichte erzählt bekommst, bilden sich neue Synapsen und zusätzliche, physische Verbindungen im Gehirn.
Dein Verstand baut mit Hilfe von organischen Stoffen dein Gehirn an.
Mit anderen Worten: Deine Software erweitert, quasi selbstständig, die Hardware in deinem Kopf.“ Er schien zufrieden mit seiner Erklärung und lehnte sich zurück.
„Ok,“ irgendwie versuchte ich eine Brücke zu schaffen, mit der ich den vielleicht beleidigenden Satz über die Suche nach der Herrenrasse wieder ein wenig abmildern konnte.
„Ihr habt also in den Hirnen der Alphatypen nach dem Ergebnis dieser Hardwareerweiterung gesucht?!“
„Einfach gesagt ist das etwa so, ja“.
„Und? Habt ihr was gefunden?“
„zuerst nicht,“ antwortete Jan und sein Blick fiel auf eine ältere Frau, die sich auf die Parkbank ein paar Schritte entfernt von uns gesetzt hatte und nun ihr Handy zückte.
„Ich könnte noch einen Kaffee vertragen, wollen wir zum Schloss gehen?“ fragte er unvermittelt und stand auf, noch ehe ich antworten konnte.
Überrascht folgte ich seinem Blick. Die Frau auf der anderen Parkbank sah mich einen Augenblick lang an und widmete sich dann wieder ihrem Smartphone.
Zuerst dachte ich sie trüge Handschuhe, doch dann erkannte ich, dass sie einen großen Leberfleck auf der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger hatte, der sich fast über den ganzen Daumen zog.
Wir wandelten vom Botanischen Garten in Richtung Schloss, an der Orangerie vorbei zum Schlossgarten-Café.
Die Bedienung ließ einige Zeit auf sich warten, bis wir unsere Bestellung aufgeben konnten.
Für die Wartezeit wurden wir mit den optischen Reizen der jungen Blondine entschädigt, die sich ausgesprochen freundlich für ihr spätes kommen entschuldigte und uns entwaffnend anlächelte.
Ich beschloss, mich ausgiebig über die vorrätigen Heißgetränke zu informieren, bevor ich einen schnöden Cappuccino bestellte.
Wir hatten unterwegs das Thema gewechselt und Jan erzählte mir auf unserem Weg einiges über die Geschichte des Schlossgartens und der Universität.
Jetzt, da wir wieder zur Ruhe kamen, nahm er den Faden seines eigentlichen Anliegens abermals auf.
„Zuerst fanden wir nichts.“ wiederholte er den letzten Satz zu diesem Thema und breitete achselzuckend die Arme aus.
„Das Zusammenspiel ist komplex, da spielt der Hormonhaushalt mit herein, kindliche und frühkindliche Erfahrungen, die körperliche Konstitution und noch einiges mehr. Wir haben parallel mit Ärzten und Psychologen gearbeitet, die ihrerseits Interesse am Verständnis um das Zusammenspiel aller Komponenten hatten. Es gab einen lockeren, internen Verbund, keine Forschungsgruppe oder einen Auftrag aus Wirtschaft oder Politik. Manchmal ist es einfach so, dass man sich bei einer Fortbildung oder nach einer Vorlesung abends noch zusammensetzt und gemeinsame Interessen findet.“
Die attraktive Bedienung kam mit den bestellten Getränken an den Tisch, servierte uns das Gewünschte und verschwand mit einem fröhlichen Grinsen auf dem Gesicht wieder zwischen den Kaffeehaustischchen.
Jan schlürfte an seinem Café au Lait und ich riss das kleine Tütchen auf, das neben meinem Cappuccino lag, um an den Keks zu kommen, der darin verborgen war.
Ich betrachtete Jan aus den Augenwinkeln, er war mit seinen fünfundvierzig Jahren in einem Maße mit seiner Arbeit verheiratet, dass er immer noch keine Frau fürs Leben gefunden hatte.
Offensichtlich machte er sich keine Gedanken darüber, ob er seinen Lebensabend eventuell einsam verbringen würde. Vielleicht fühlte er sich noch jung genug, um die Familienplanung auf später zu verschieben oder hatte erst überhaupt nicht vor, eine zu gründen.
Mein Leben war derweil völlig anders verlaufen. Mit vierundzwanzig Jahren wurde ich überraschend Vater und richtete fortan meine Entscheidungen zu einem Großteil auf die Familie aus.
Mittlerweile war ich fünfzig Jahre alt, geschieden, hatte einen kleinen Handwerksbetrieb und drei Kinder großgezogen.
Es gab Leute, die behaupteten, man sähe mir mein Alter nicht an. Ich litt nicht unter Haarausfall und die grauen Strähnen zwischen den fast schwarzen Haaren ließen mich eher reif denn alt wirken. Die sich langsam tiefergrabenden Falten gaben meinem Gesicht einen männlicheren Ausdruck als das in der Jugend der Fall war. Die kleine, runde Brille, die ich tragen musste, stand mir und der Sport, dem ich nach der Scheidung wieder regelmäßiger nachging, tat meinem Körper gut. Grundsätzlich war ich nicht unzufrieden mit mir und der Situation, in der ich mich derzeit befand. Auch wenn ich die zuweilen einsamen Abende auf lange Sicht lieber mit einem festen Partner teilen würde.
Der Cappuccino konnte Zucker vertragen, ich rührte zwei Löffel ein und probierte ihn erneut.
„Wie wird man denn zum Alphatypen?“ fragte ich in nebensächlichem Tonfall, während mich wieder die Frage beschlich, was ich damit zu tun hätte.
„Nun, wir haben gemeinsam eine ganze Weile damit verbracht uns zu überlegen, was ein Alphatyp hat, das dem Rest fehlt,“ antwortete Jan, „einfach auch um erst einmal einen Ansatz für Untersuchungen zu finden. Was glaubst du, wie man einer wird?“
Ist das pädagogisch wertvoll? fragte ich mich. Er bezog mich bei jeder Antwort mit ein, fragte nach meiner Meinung und korrigierte mich dann.
Einige Zeit hatte ich in der Berufsschule Unterricht gegeben und wusste wie wichtig es ist, die Schüler während der Schulstunden in den Arbeitsstoff mit einzubeziehen, damit sie bewusst am Unterricht teilnahmen.
Aber dies war keine Schulstunde. Ich hätte auch ohne Hinterfragen mehr Input aufnehmen können.
Vor allen Dingen jedoch hätte ich mir nicht allzu oft die Blöße geben müssen, meine Unwissenheit zur Schau zu stellen. Doch diesen Gedanken hegte ich nur sehr tief in meinem Inneren, kaum dass er mir, während ich mich ärgerte, bis ins Bewusstsein vorgedrungen wäre.
„Also ich denke,“ antwortete ich schließlich nach kurzem Überlegen, „körperliche Überlegenheit nützt da was. Überzeugung von dem was man tut und Durchsetzungsvermögen. Dann vielleicht noch die Fantasie sich vorstellen zu können was man erreichen will. Allerdings sehe ich da, außer bei der körperlichen Überlegenheit, keinen Ansatzpunkt für physische Untersuchungen. Das ist alles psychologisch, wird vielleicht auch erst im Laufe des Lebens eines Menschen durch Erfahrungen gebildet.“
Jan nickte, er wusste, dass ich die Antwort aus der Hüfte schießen musste und wenig Zeit zum Nachdenken hatte.
„Genau das haben wir auch gedacht, aber es gibt zu jedem Attribut ein Gegenargument. Nicht jeder, der Fantasie hat, Durchsetzungsvermögen oder einer Überzeugung ist, wird ein Alphatyp.
Wir überlegten, dass es einen Grundmechanismus geben muss, der einen Alphatypen von den anderen Personengruppen unterscheidet. Etwas, das er von Anfang an mitbekommt.“
Jan machte eine Pause und blickte sich suchend um. Dann winkte er der Bedienung.
„Bei all unseren Überlegungen gingen wir erst davon aus, dass ein Alphatyp etwas hat, das dem Rest fehlt. Aber dann drehten wir den Spieß einfach um und fragten uns, was ihm fehlen könnte. Dieser Ansatz erwies sich dann als erheblich produktiver.“
Ich dachte an eine Diskussion, die ich einmal mit einem Mitarbeiter in meinem Betrieb geführt hatte. Es ging um eine Farbe die leuchtender werden sollte und er war der Meinung wir müssten mehr von der leuchtenden Komponente hinzugeben. Nach einigem probieren am vorgemischten Farbton entschied ich mich von vorn zu beginnen und anstatt zu der Grundmischung Komponenten hinzu zu geben, von vornherein einige heraus zu lassen.
Manchmal sind Lösungen so naheliegend, wenn man nur die Perspektive wechselt.
Die junge Blondine mit dem enganliegenden, grünen T-Shirt des Schlossgarten-Cafés kam zu uns und fragte nach unseren Wünschen. Jan zahlte.
„Du bist ganz schön unruhig,“ bemerkte ich, „ist das bei dir immer so?“
Jan tat, als hätte er mich nicht gehört, legte mir seine Hand auf die Schulter und fragte ob ich nicht noch ein-zwei Tage bleiben könnte.
„Jan, ehrlich,“ gab ich zurück, „ich habe einen Betrieb und so spannend wie ich Psychologie und Biologie auch finde, ich suche vergeblich den roten Faden, der mich mit eurer Entdeckung verbindet.“
Immer noch war ich mit dem Versuch eine Verbindung herzustellen nicht weitergekommen. Jan musste bemerkt haben, dass ich beim besten Willen den Zusammenhang zwischen seiner Geschichte und meiner Person nicht erkennen konnte.
Doch ich suchte vergeblich nach der Endtäuschung in seinem Gesicht, derer ich mir so sicher war.
Stattdessen strahlte er mich milde an, stand auf und bedeutete mir, ihm zu folgen.
„Jakob, gib mir noch ein bis zwei Tage Zeit, dann kannst du entscheiden ob du eine Verbindung findest, bei dem was ich dir erzähle oder ob du ein paar Tage deines Lebens vergeudet hast, die du hättest sinnvoller mit Arbeiten verbringen können.“ Er blinzelte mir zu und grinste breit.
Ich ließ mich breitschlagen und einen Anruf bei der Tochter, die mit mir im Betrieb arbeitet, später, machten wir uns auf den Weg ein Hotelzimmer für mich zu finden.
Während wir die Straßen entlangliefen telefonierte Jan ein paarmal mit verschiedenen Hotels.
Ich fand es erstaunlich und irgendwie auch erfrischend durch eine Universitätsstadt zu gehen.
Der Altersdurchschnitt und die damit verbundene Vitalität war hier eine ganz andere als ich das von meiner Heimatstadt kannte. Straßencafés, die vor Leben überschäumten, Gruppen junger Menschen, die sich über den Fußweg schlendernd angeregt unterhielten und lachten. Ich fühlte mich mit einem Male um Jahre verjüngt und hatte das Gefühl, das Buch des Lebens hätte vielleicht doch noch einige unbeschriebene Seiten für mich parat.
„Und was fehlt so einem Alphatypen jetzt?“ eröffnete ich die Fortführung unseres Gespräches.
Jan grinste „Empathie und Mitgefühl“
„Na,“ ich guckte ihn mit gespielter Entrüstung an, „das ist ja wohl ein bisschen zu hart und wohl auch ziemlich flach“
„Wer flach schaut, sieht keine Berge,“ lachte Jan, „nein, im Ernst. Uns ist aufgefallen, dass ein echtes Alphatier seine Bedürfnisse und Ziele über die Bedürfnisse anderer stellt. Im Allgemeinen könnte man annehmen, die Ursache wäre ein erhöhter Testosteronspiegel. Doch das würde Frauen als Alphatypen zwischen Männern ausschließen. Aber wir sehen oft genug, dass das nicht der Fall ist. Egal aus welcher sozialen Schicht und in welchem Alter, völlig unabhängig von Lebenserfahrung oder höheren Zielen, erkennt man Alphatiere am Mangel an Mitgefühl.“ Jan machte eine kurze Pause, beobachtete mich, als könne er sehen, ob ich schon verinnerlicht habe, was er mir gerade erzählt hatte.
„Es ist nicht so, dass sie sich nicht in eine andere Person hineinversetzen können, nicht erkennen würden was der andere gerade empfindet oder nicht ahnen könnten, was er als nächstes tun wird.
Ganz im Gegenteil, das unterscheidet sogar die erfolgreichen von erfolglosen Führungspersönlichkeiten. Aber es ist die Härte, mit der Alphatypen sich gegen Konkurrenten durchsetzen und Mitläufer ausnutzen. Könnten sie sich nicht in die Lage des Gegenübers versetzen oder würden sie nicht wissen welches seelische Leid sie anderen unter Umständen antun, könnte man von mangelndem Einfühlungsvermögen sprechen. Aber genau das ist es ja nicht. Sie wissen es ganz genau und tun trotzdem ohne Rücksicht auf Verluste was dem nutzt, das sie als ihr Ziel auserkoren haben.“
„Und das war euer Ansatz.“ schloss ich, während ich noch überlegte ob ich bereit war, diese Annahme unhinterfragt zu akzeptieren.
Jan wirkte zufrieden, „Ja, zumindest hatten wir eine Basis, an der wir versuchen konnten, auch physisch anzusetzen.“
„Ist für das Mitgefühl nicht dieses Hormon Oxytocin zuständig?“ fragte ich.
Irgendwann einmal hatte ich im Internet und bei diversen Recherchen über das Hormon gelesen, das bei den Wehen und in der Beziehung von Mutter zum Kind, dem Partner und der Familie eine ausschlaggebende Rolle in der sozialen Bindung spielen soll.
„Das ist zwar richtig,“ gab Jan zu bedenken, „allerdings hat Oxytocin auch eine entscheidende Nebenwirkung.“
Fragend schaute ich Jan an.
Nebenwirkung? Nach meinem Wissen war das gerade einer der Vorteile dieses Hormons, dass eben keine Nebenwirkungen bekannt waren.
„Ein Hormon, das die Bindung in der Gruppe stärkt und darin Mitgefühl hervorruft, grenzt natürlich auch zu anderen Gruppierungen oder Personen außerhalb der eigenen Gruppe ab.“ erklärte er.
„Eine Eigenschaft, die für die Durchsetzung der eigenen Interessen einer Führungspersönlichkeit nicht unerheblich ist. Unter diesen Umständen wäre es also zu einfach gedacht, einen Mangel an Oxytocin für das Phänomen des Alphatypen verantwortlich zu zeichnen. Schließlich gehört gerade die Abgrenzung zu anderen Gruppen und damit die Bindung in der eigenen Gruppe zu einer wichtigen Eigenschaft von Alphatypen.“
Schweigend liefen wir weiter in Richtung Hotel. Ich hing meinen Gedanken nach.
Es war schon ein ausgeklügeltes System, über Jahrmillionen der Evolution zusammengestellt und verfeinert. Hormone und Neurotransmitter verursachen Gefühle und Emotionen, die teils durch physische oder psychische Einflüsse ausgelöst werden. Ein Wechselspiel, bei dem man nie sicher sein kann, wo die Ursache und wo die Wirkung angesetzt ist.
So filigran gestaltet, dass die Dosierung eines Transmitters entweder über die eine oder andere Verhaltensweise entscheidet.
Vor einigen Jahren hatten Wissenschaftler geglaubt, sie hätten mit ein paar Hormonen und dem Wissen um ihre Wirkung die Gefühlswelt des Menschen analysiert und ihn zu einem mechanischen Wesen, einem Roboter der Hormone, deklassieren können. Weit gefehlt. Schließlich musste man erkennen, dass Neurotransmitter nicht nur Gefühle verursachen, sondern auch, genau andersherum, durch Emotionen freigesetzt werden.
Wir erreichten das Hotel.
Jan hatte während des Telefonierens nach Zimmern in der Altstadt gefragt, da er der festen Überzeugung war, wir sollten am Abend noch einen kleinen Kneipenbummel machen.
Mein Auto stand noch bei Jan und Gepäck hatte ich ja eh nicht viel dabei.
Da war es jetzt auch egal, dass das bisschen, was ich mitgenommen hatte, nicht bei mir war.
Wie fast alle Gebäude, die an den engen Gassen aus Pflasterstein in die Höhe ragten, war auch dieses aus rotem Ziegelstein gemauert. Der Eingang befand sich in einer Nebenstraße und verhieß nicht gerade überschwänglichen Luxus. Aber ok, ich wollte hier schlafen und nicht das Ambiente genießen.
Vor dem Hotel verabschiedete sich Jan mit einer freundschaftlichen Umarmung von mir, bedankte sich noch einmal dafür, dass ich mir die Zeit nahm, ihm weiter zuzuhören und verabredete sich für den späteren Abend mit mir.
Mein Zimmer war klein und das Bad so winzig, dass man mit ausgestreckten Armen an jede Badezimmerarmatur kam, ohne einen Schritt gehen zu müssen, Naja, vielleicht nicht ganz. Zumindest waren die Räume frisch renoviert und das Personal sehr freundlich.
Ich zahlte für die nächsten zwei Nächte, machte mich im Bad frisch und legte mich aufs Bett, um ein wenig zu ruhen.
Es war noch lang bis zum Abend und ich war froh darüber, jetzt ein wenig Zeit für mich zu haben.
Gähnend sah ich auf die Uhr: 14.05 Uhr. Eine halbe Stunde wollte ich mir gönnen, dann würde ich in die Stadt gehen und mir ein wenig Kleidung und Waschzeug für den Abend und den nächsten Morgen besorgen.
Grundsätzlich war es eh einmal wieder an der Zeit für eine neue Hose und vielleicht ein schickes Hemd. Zwar war der Schrank zuhause voll, aber er war wohl eher mit einem Sammelsurium aus Oberwäsche gefüllt, die sich in den letzten fünfzehn Jahren durch Spontankäufe, Geschenken meiner Mutter oder meiner Exfrau und veralteter Notwendigkeiten zusammensetzte.
Auf dem frisch gemachten Bett liegend verschränkte ich die Arme hinter den Kopf und genoss die Einsamkeit, an die ich mich die letzten zwei Jahre gewöhnt hatte.
Meine Gedanken kreisten um den eigenen Betrieb, wurden verdrängt von den Bildern des Schlossgartens und kratzten an Jans Erzählungen.
Geräusche von lachenden und plappernden Menschen vermischten sich mit dem hin und wieder tönenden Geläut des nahen Doms.
Ich schlief ein.
Als ich wieder aufwachte war es schon fast halb vier und ich musste einen Augenblick überlegen, bis mir wieder einfiel, wo ich mich befand.
Nach einer schnellen dusche huschte ich aus meinem Zimmer die enge Treppe des Flurs hinunter auf die Straße und suchte nach ein paar Läden, in denen ich mir etwas Frisches zum Anziehen kaufen konnte.
Ich bin keine Frau, habe keinen eigenen Willen und schon gar keine genaue Vorstellung davon wie das, was ich kaufen will, aussehen soll. Ein sicheres Zeichen dafür, dass ein solcher Einkaufsbummel maximal eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Und siehe da, das Vertrauen in den Geschmack von Verkäuferinnen wurde mit einem schicken, grob karierten und mit Aufschriften verziertem Langarmhemd und einer Chinohose belohnt. Strümpfe, Unterwäsche, Zahnputzzeug, fertig.
Alles in allem war ich dann doch eine gute Stunde unterwegs.
Ein Café zu finden, vor dem ich die Leute beobachten und gemütlich ein kleines Eis genießen und eine Tasse Kaffee trinken konnte, war kein Problem. Einen Platz dort zu bekommen, schon.
Mir fiel ein kleiner, runder Tisch ins Auge. Eine Frau, etwa vierzig, saß allein an dem Tischchen und werkelte an ihrem Smartphone.
„Darf ich mich zu ihnen setzen?“ fragte ich und vermutete eher ein `tut mir leid, aber der Platz ist schon besetzt`.
„Ja klar“ sagte sie, blickte auf und grinste mich freundlich an. Ihre roten Haare wippten in krausen Locken um das schmale, hübsche Gesicht. Die Haare reichten bis auf ihre Schultern und federten bei jeder Bewegung auf und ab.
Sie legte das Telefon zur Seite und betrachtete mich aufmerksam.
„Danke, Jakob mein Name“ sagte ich und nahm neben ihr Platz.
„Joha,“ stellte auch sie sich vor, „eigentlich Johanna, aber alle nennen mich Joha. Außer jemand will Ärger mit mir, der nennt mich Hanni.“ Sie grinste.
Wir unterhielten uns ein Weilchen über Gott und die Welt, unsere Hobbys und darüber was uns hierher verschlagen hat. Wie ich, war sie geschieden, kam aus Arnsberg und hatte ihren Sohn hier besuchen wollen. Der hatte aber offensichtlich gerade am Wochenende ihres Überraschungsbesuches einen Auswärtstermin in Amsterdam.
„Tja,“ bilanzierte sie, „das Hotel hatte ich ja bereits bezahlt, also habe ich mir gedacht, warum nicht ein paar Tage Auszeit nehmen und das schöne Wetter hier genießen.“ Sie lachte wieder ihr ansteckendes Lachen und da auch ich über das Wochenende in Münster Quartier bezogen hatte, verabredeten wir uns für den nächsten Tag zu einer gemeinsamen, lockeren Sightseeingtour durch Münster.
Es war nicht so, dass ich auf der Suche nach einem Flirt war, aber die attraktive, humorvolle Frau hatte mich in ihren Bann gezogen und das Leuchten in ihren ausdrucksstarken, braunen Augen machten mir Glauben, auch sie hätte etwas für mich übrig.
Ein leichtes Knistern lag in der Luft als wir uns verabschiedeten und ich hatte nichts gegen ein wenig Abwechslung in meinem eher monotonen Junggesellenleben einzuwenden.
Zwei Stunden später stieß Jan zu mir.
Ich saß gegenüber dem Hotel in dem Biergarten der Kneipe, in der wir uns verabredet hatten. Der Abend war bereits angebrochen und Hunger und Durst ließen mich schon vor dem vereinbarten Zeitpunkt die Gaststätte aufsuchen, um ein Schnitzel zu essen und eine Kleinigkeit zu trinken.
„Hi Jakob, du hast dir etwas Neues zum Anziehen besorgt, wie ich sehe. Chic.“ konstatierte Jan, als er mich sah.
Er selbst trug einen legeren Sakko über einem karierten Hemd zur klassischen Jeanshose. Lässig zog er den Stuhl neben dem meinen zurück und setzte sich zu mir.
„Yep, ich kann ja nicht das ganze Wochenende in den gleichen Klamotten rumlaufen“ rechtfertigte ich mich und nippte an dem Bier, das ich mir bestellt hatte.
Jan winkte der Bedienung und bestellte sich ebenfalls etwas zu trinken. Der junge Mann, der uns bediente, begrüßte Jan freundlich und sprach ihn mit Vornamen an. Offensichtlich kam Jan öfter hierher.
Selbst hier im Biergarten, bei noch angenehmen Temperaturen und einer gemütlichen Atmosphäre im Sonnenuntergang, konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Jan etwas aufgedreht war, fast machte er einen gehetzten Eindruck, ohne dass ich dieses Gefühl an irgendwelchen bestimmten Begebenheiten hätte festmachen können.
So dauerte es auch nicht allzu lange, bis wir uns wieder mit dem Thema beschäftigten, wegen dem er mich hergebeten hatte.
Wir unterhielten uns über die Gruppe, mit der er gemeinsam an dem Projekt arbeitete.
Wie er schon am Vorabend angedeutet hatte, entstand diese Forschungsgruppe zufällig aus einer Laune heraus vor etwa fünf Jahren. Jan betonte wie sehr er die interdisziplinäre Arbeit genieße. Mit Forschern aus unterschiedlichen Themengebieten würde man immer etwas dazulernen und, vor allen Dingen, einer Aufgabe breiter gefächerte Lösungsansätze entgegenbringen können.
Zugegebenermaßen hätte ich mir an so einem Abend auch etwas anderes vorstellen können als über Wissenschaft zu reden, aber andererseits glaube ich nicht, dass ich mit Jan viele Gesprächsthemen gefunden hätte, wenn dieses Thema nicht gewesen wäre. Zu unterschiedlich verliefen unsere Lebenswege, als dass man genügend Gemeinsamkeiten gefunden hätte, die man abendfüllend erörtern könnte, zumal wir uns schon am Vorabend ausgiebig ausgetauscht hatten.
Darum war ich nicht böse über seinen Enthusiasmus.
„Wir wussten schon, dass es wenig sinnvoll ist über die Menge des Hormons Oxytocin auf die Besonderheiten des Alphatypen zu stoßen. Es gibt viel zu hohe Variationen und Wechselwirkungen als dass hieraus eine aussagekräftige und belastbare Prognose oder These entwickelt werden könnte“ Jan war wieder in seinem Element.
„Aber interessanter war die Untersuchung des Teiles im Gehirn, an dem Oxytocin andockt. Der Botenstoff selbst ist Mittel zum Zweck, aber wo führt er hin und was bewirkt er, das war das interessante daran und der Ansatzpunkt für unsere Untersuchungen.“
Jan nippte an seinem Radler, grüßte einen vorbeigehenden Passanten und widmete sich dann wieder mir und seinem Projekt.
„Oxytocin koppelt an den Mandelkernkomplex, die Amygdala. Das ist der Teil im Gehirn, der in erster Linie für die Emotionen und grundlegenden Bedürfnisse zuständig ist.“ erklärte er.
„Er ist schon von Geburt an mit einer Menge Verbindungen in die anderen Hirnregionen ausgestattet. Auch ohne, dass der Mensch durch Erfahrungen geprägt wurde, oder sich durch äußere Einflüsse bereits Synapsen gebildet hätten. Daher vermuten wir, dass sie mit ihren natürlichen Variationen einen Einfluss darauf hat, wie sich ein Mensch individuell entwickelt. Schon bevor äußere Einflüsse einen Charakter bilden.“
„Ok, wenn ich dich richtig verstehe,“ unterbrach ich ihn, um Struktur in mein Verständnis zu bringen und nicht irgendwann abgehangen und verständnislos den Ausführungen zuzuhören, wie man dem Plätschern eines Brunnens zuhört, „der Mandelkernkomplex bildet durch die Stärke und Struktur seiner Verknüpfungen mit dem Rest des Gehirns die Basis für den Charakter, ohne dass Erlebnisse oder äußere Einflüsse schon ein Gedächtnis prägen?!“
„Genau!“ bestätigte Jan.
„Wie Erlebnisse aufgenommen und gespeichert werden ist zwar von Mensch zu Mensch ziemlich ähnlich, aber die Intensität der Verarbeitung unterliegt natürlichen Variationen. Diese werden durch Erlebtes auch verstärkt oder abgemildert und in Verbindung einer Gruppendynamik in der Gesellschaft kulturellen Gepflogenheiten unterworfen. Aber grundsätzlich hat jeder Mensch sein eigenes Startprogramm.“
Die milde Abendsonne verschwand in der schmalen Straße hinter den Häusern und es wurde langsam kühler. Ich streifte mir die Jeansjacke über, die ich mitgebracht hatte.
Jetzt endlich hatte es sich bezahlt gemacht, sie den ganzen Tag irgendwo mit mir herum geschleppt zu haben.
Endlich kamen wir bei Jans Erzählungen an einen Punkt, an dem es konkreter wurde. Zwar hatte ich immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Ganzen zu tun haben sollte, aber zumindest hatte ich langsam das Gefühl zu begreifen, an was die Wissenschaftler arbeiteten.
„Gut,“ setzte ich ein, „aber da hast du an verstorbenen Politikern und Wirtschaftsgrößen nach dem Tod ja nicht mehr so viel zu finden, denke ich. Da sind doch Hirnstrommessungen und Blutuntersuchungen sinnvoller, oder?“
Jan lachte, „Das ist wohl wahr, aber an die Jungs kommst du so ja nicht dran. Wir haben erst einmal durch eine neue Technik, die wir zum Messen der Hirnaktivitäten entwickelt haben, an ganz durchschnittlichen Menschen, wie Studenten, Vagabunden, Handwerkern und Hausfrauen Daten gesammelt und diese ausgewertet.“
Ich konnte mir schon denken warum: Wenn die Gruppe ohne einen Forschungsauftrag in einem einigermaßen repräsentativen Umfang Daten sammeln wollte, benötigte sie Freiwillige, die entweder aus Spaß, für ein Fläschchen Schnaps, ein paar Euro, oder vielleicht auch unter Vortäuschung falscher Umstände ihre Daten zum Besten gaben.
Ich verkniff mir die Frage.
„Hi Jan,“ ein Mann, um die dreißig Jahre alt, unterbrach uns, klopfte Jan kräftig auf die Schulter und setzte sich wie selbstverständlich an unseren Tisch.
„Wo sind denn die anderen?“ fragte er, und drehte sich suchend nach allen Seiten um.
Er schien mich gänzlich zu übersehen und ich fragte mich, was ich wohl verpasst hatte.
Habe ich vielleicht bei all dem Geplänkel nicht richtig zugehört und ein `wir ziehen heute Abend mit ein paar Kumpels von mir um die Häuser` überhört?
„Hi“ machte ich mich bemerkbar.
„Hi“ antwortete der ziemlich robuste Kerl, grinste mich breit an und streckte mir dann seine Pranke entgegen, „Karl.“
„Angenehm, Jakob“ antwortete ich und nahm seine ausgestreckte Hand entgegen.
Sicherheitshalber schon einmal tief einschlagend, damit ich kein allzu leichtes Opfer seines Händedrucks werden konnte.
„Welche anderen?“ fragte ich, denn ich konnte mich wirklich nicht daran erinnern, etwas von einem Gruppentreffen gehört zu haben.
Karl, der ungefähr zwei Meter maß und auch sonst ziemlich kräftig wirkte, antwortete bevor Jan es tun konnte, „Wir haben uns hier mit der Clique verabredet und wollen für ein kleines Experiment nochmal ins Labor fahren.“ seine tiefe Stimme klang etwas rau und ich hatte das Gefühl einen sehr schwachen russischen Akzent gehört zu haben.
Die kurzen, blonden Haare gaben ihm ein militärisches Aussehen. Mit den stahlblauen Augen war er an Klischee kaum zu übertreffen. Dolf Lundgren, schoss es mir in den Sinn und ich war schon gespannt, ob sich noch mehr aus der, sich offensichtlich noch einfindenden, Gesellschaft in irgendwelche Vorurteile pressen lassen würden.
„Willst du mit, Jakob?“ fragte er und schaute erwartungsvoll zu mir herüber.
Die zunehmende Kühle schien ihm nichts auszumachen. Mit seinem T-Shirt und einer sommerlichen, hellen Hose schien er mir etwas zu dünn gekleidet.
„Och,“ antwortete ich mehr aus Reflex, „Experimente finde ich gut, aber ihr müsstet mir schon wirklich dumme Fragen beantworten, wenn ich etwas verstehen will.“
Ich grinste blöd.
Einer meiner Fehler war, dass ich schneller reden als abwägen konnte, manchmal zumindest.
Aber wahrscheinlich hatte ich es mir nur noch nicht abgewöhnt, weil mir das bislang keine Nachteile bereitete.
„Kein Problem, damit kommen wir schon klar.“ Er lachte. Ein ehrliches und zutiefst amüsiertes lachen.
Es bereitete mir Unbehagen. Ich musste daran denken, in welcher Weise Jan akzeptierte, dass ich meine Unwissenheit zum Teil provokativ zur Schau stellte. Wieder überlegte ich, welche Rolle ich bei diesem Zusammentreffen spielte.
Es verging nicht viel Zeit, bis ein weiteres Pärchen den Weg zu uns fand.
Diesmal handelte es sich um einen Mann, den ich auf Ende zwanzig schätzte und der arabischer Abstammung zu sein schien.
Er stellte sich mir als Sharim vor, setzte sich an den Tisch und erklärte, er sei Physiker und schon gespannt darauf, mich endlich kennenzulernen.
Ich sah ihn überrascht an und blickte dann, um eine Erklärung heischend, zu Jan.
Dieser jedoch überhörte die Aussage geflissentlich, wie er schon so manches in den letzten zwei Tagen überhört hatte.
Die zweite Person, die zu uns stieß, hieß Nadja. Ihre rabenschwarzen Haare fielen glatt auf die Schultern, die sie mit einem ebenso schwarzen, engen Rollkragenpullover bedeckt hatte.
Ihre dichten Augenbrauen und der dunkle Teint ließen mich annehmen, dass sie ebenfalls südländischer Herkunft war.
Sie strahlte mich freudig an und gab mir die Hand mit einem ungewöhnlich schwachen Händedruck. Fast schien es mir wie eine sanfte, rituelle Berührung.
Sie sei Psychologin und das wäre in dieser Gruppe mit Abstand der härteste Job. Wieder lachte sie und sah sich, auf Gegenwehr wartend, in der Runde um. Niemand widersprach ihr.
Einige Minuten später stieß ein einzelner, junger Mann mit fadem, blassem Gesicht, schlaksiger Figur und roten Haaren, dessen Seitenscheitel ihm in die Augen fiel, zu uns, entschuldigte sich für die Verspätung und stellte sich mir als Tom vor.
Nadja ergänzte, dass es sich bei Tom um einen Biochemiker handelte und er ein Genie sei.
Tom jedoch schien dieses Lob peinlich zu sein. Strafend sah er zu Nadja herüber, als hätte sie in der Gruppe verlautbaren lassen, dass er ein Bettnässer sei.
Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und blickte von einem zum anderen.
Nun saß ich zwischen der Clique aus Wissenschaftlern, von denen mir Jan seit gestern Abend erzählte.
Mein Blick fiel auf Karl. Hatte er mir auch erzählt, welchen Beruf er hatte?
Als die Bedienung wieder zu uns kam, bestellten alle ein Getränk. Mir fiel auf, dass keines alkoholisch war und so fühlte ich mich ein wenig unwohl mit dem Bier vor meinem Sitzplatz.
„Ich glaube, ich habe vergessen, was dein Beruf ist.“ wendete ich mich schließlich an Karl und sah ihn fragend an.
„Mediziner, ich bin Arzt. Aber das habe ich noch nicht erwähnt.“ gab Karl kühl zurück.
Ich sparte mir einen Kommentar und nickte nur.
Nadja bemühte sich, die Atmosphäre, in der niemand recht wusste was er sagen sollte, etwas zu entspannen indem sie mich fragte, wie meine Anreise gewesen sei und was Jan und ich heute so getrieben hätten.
Bereitwillig erzählte ich von unserem Ausflug zum botanischen Garten der Universität, der zu kurzen Couch, auf der ich schlafen musste und unserer Unterhaltung.
Während meiner Erzählung beobachtete ich die Reaktionen der Anwesenden.
Sharim hörte aufmerksam zu, lachte hin und wieder herzlich und warf ab und zu einen humoristischen Zwischensatz ein.





























