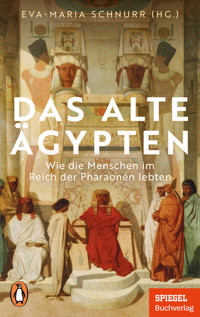
Das Alte Ägypten E-Book
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pharaonen, Pyramiden, Hieroglyphen: Eine Zeitreise ins alte Ägypten
Die Erzählungen der ersten Entdecker Ägyptens prägten lange unseren Blick auf das Land am Nil, dessen geheimnisvolle Welt der Pharaonen und Pyramiden uns bis heute fasziniert. Doch Klischees verdecken, wie differenziert Forschende die frühe Hochkultur heute verstehen. Wie entstand das Reich, das um 2900 v. Chr. greifbar wird und bis zur Zeitenwende existierte? Warum blieben die Hieroglyphen so lange ein Rätsel? Und wie lebten die Menschen damals? Historikerinnen und SPIEGEL-Autoren zeigen in diesem Buch, dass nicht Sklaven, sondern spezialisierte Handwerker die Pyramiden einst erbauten. Sie geben ungekannte Einblicke in den Alltag und die religiösen und naturwissenschaftlichen Vorstellungen der alten Ägypter und beleuchten die politische Rolle von Frauen und Pharaoninnen wie Hatschepsut und Kleopatra. So entsteht ein vielschichtiges Porträt einer der größten Zivilisationen dieser Erde, das uns das Leben der alten Ägypter nahebringt und ihrem antiken Erbe bis heute nachspürt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eva-Maria Schnurr, geboren 1974, ist seit 2013 Redakteurin beim SPIEGEL und verantwortet seit 2017 die Heftreihe SPIEGEL Geschichte. Zuvor arbeitete die promovierte Historikerin als freie Journalistin, unter anderem für Zeit und Stern. Sie ist Herausgeberin zahlreicher SPIEGEL-Bücher. Zuletzt erschienen Deutschland, deine Kolonien und Das Zeitalter der Hexenverfolgung (beide 2022) sowie Kriegsgefangene (2023) und Die letzten Tage von Pompeji (2025).
www.penguin-verlag.de
Eva-Maria Schnurr
Das Alte Ägypten
Wie die Menschen im Reich der Pharaonen lebten
Mit Beiträgen von Felix Bohr, Angelika Franz, Hauke Friederichs, Renate Germer, Alexandra Gittermann, Ruth Hoffmann, Katja Iken, Uwe Klußmann, Julia Köppe, Kathrin Maas, Joachim Mohr, Frank Patalong, Martin Pfaffenzeller, Tanja Pommerening, Johannes Saltzwedel, Eva-Maria Schnurr, Frank Thadeusz, Andreas Wassermann
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Texte dieses Buches sind erstmals in dem Magazin »Das alte Ägypten. Eine versunkene Zivilisation wird neu entschlüsselt« (Heft 2/2020) aus der Reihe SPIEGEL Geschichte erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: akg-images/Erich Lessing
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33181-8V001
www.penguin-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Pharaonenglanz für Preußen
1842 reiste ein junger Forscher von Berlin an den Nil. Damit begründete Karl Richard Lepsius die deutsche Ägyptologie.
Von Ruth Hoffmann
»Die Welt war von Göttern durchdrungen«
Wie entstand die Hochkultur am Nil? Und wie sahen sich die Ägypter selbst? Friederike Seyfried, Direktorin des Ägyptischen Museums Berlin, erläutert, was Forscher heute wissen.
Interview geführt von Johannes Saltzwedel
Wie genau kennen wir ägyptische Daten?
Im Jahresrhythmus des Abendsterns
Ein himmlischer Herrscher auf Erden
Wie regierten Ägyptens Könige ihr Land? Der früheste, von dem man mehr weiß als den Namen, wurde gleich einer der größten: Djoser.
Von Renate Germer
Mit vereinten Kräften
Die Schrift der Ägypter blieb jahrhundertelang rätselhaft. Denn Sprachforscher gingen die Entschlüsselung völlig falsch an.
Von Eva-Maria Schnurr
Immer höher
Pyramiden: Lange waren sie die größten Bauwerke der Welt, wurden bestaunt, geplündert, erforscht. Ein Rätsel aber bleibt: Wie wurden die Monumente errichtet?
Von Frank Patalong
»Die Nofretete gehört nach Ägypten«
Der Historiker Jürgen Zimmerer sagt, viele ägyptische Schätze in deutschen Museen seien Diebesgut aus der Kolonialzeit.
Interview geführt von Eva-Maria Schnurr
Vortrefflich
Nach einem Anschlag auf seinen Vater musste der junge Prinz Sesostris I. den Thron verteidigen. Dann wurde er zum wichtigsten Pharao des Mittleren Reiches.
Von Hauke Friederichs
Unsterblich
Die Mythen der alten Ägypter erzählen vom Verrat der Menschen am Sonnengott und vom Streben nach ewigem Leben. Der Kult sicherte die Macht der Pharaonen.
Von Julia Köppe
Eine mythische Familie
Die wichtigsten ägyptischen Götter und ihre Aufgaben
Von Julia Köppe
Bildanalyse: Relief mit Baumgöttin
Das Grabbild des Oberpriesters Niay beeindruckt durch seine filigranen Symbole. Was sahen die Ägypter in diesen Motiven?
Von Kathrin Maas
Stille Post
Mythen und religiöse Vorstellungen Ägyptens beeinflussten den jüdischen Glauben. Einige finden sich sogar noch heute im Christentum.
Von Felix Bohr
Der Weg aus dem goldenen Käfig
In der Bibel führt Mose das Volk Israel aus Ägypten. Ist die Flucht historisch belegt?
Von Felix Bohr
»Sind unsere Herzen aus Kupfer?«
Das Leben der Menschen wurde von der Natur bestimmt – und von harter Arbeit.
Von Martin Pfaffenzeller
Bis in alle Ewigkeit
Die Konservierung des Leichnams war der Schlüssel zum Leben nach dem Tod. Bisweilen jedoch schlampten die Balsamierer.
Von Angelika Franz
So arbeiteten die Balsamierer
Mumifikation hatte ihren Preis
Debatte: Darf man Mumien ausstellen?
Ägyptische Mumien waren nie dafür gedacht, in Glasvitrinen zur Schau gestellt zu werden. Fachleute diskutieren seit einiger Zeit, ob es ethisch vertretbar ist, sie dennoch zu zeigen. Wir haben zwei Museumsdirektorinnen nach ihrer Meinung gefragt.
Mit Bart und Brüsten
Fast alle Könige Ägyptens waren Männer. Bis Hatschepsut kam: Sie erhob sich selbst auf den Thron und erfand einen neuen Titel für das höchste Amt im Staat.
Von Joachim Mohr
»Wir schafften das Gold und das Silber beiseite«
Im Reich der Pharaonen wurden Plünderer grausam gepfählt. Gerichtsakten von damals verraten, wer die Diebe waren.
Von Frank Thadeusz
Im Glanz der Sonne
Er wollte die ägyptische Götterwelt radikal umbauen. Fortan sollte das Volk nur noch einen Gott verehren. Eine Revolution.
Von Alexandra Gittermann
»Du lebende Sonne«
Wie beteten die alten Ägypter? Ein berühmtes Zeugnis ist der »Große Sonnenhymnus« des Echnaton.
Der Ruf des Pharao
Der englische Autodidakt Howard Carter wollte unbedingt ein unberührtes Grab entdecken. Er traf auf den britischen Lord Carnarvon – und eines der größten Abenteuer der Archäologie begann.
Von Andreas Wassermann
»Sprung in eine andere Welt«
Welche Vorstellungen hatten die altägyptischen Gelehrten von ihrer Umwelt? Welches Wissen haben sie uns überliefert?
Von Tanja Pommerening
Ohne Sieg zu Weltruhm
Als Bauherr und Feldherr wurde Ramses II. zu einem der wichtigsten ägyptischen Herrscher. Und als erster Regent überhaupt schloss er einen Friedensvertrag mit seinen Feinden.
Von Uwe Klußmann
Meisterin der Macht
Sie war gottgleiche Pharaonin, skrupellose Politikerin, hochintelligente Verführerin. Mit allen Mitteln versuchte die Königin Kleopatra, ihre Herrschaft zu sichern.
Von Katja Iken
Anhang
Chronik
Empfehlungen: Bücher, Film und Museen
Autor*innenverzeichnis
Dank
Personenregister
Bildnachweis
Vorwort
Ein paar hingeworfene Namen reichen, und schon tauchen Bilder im Kopf auf: Tutanchamun. Nofretete. Echnaton. Kleopatra. Sehen Sie sie auch schon vor Ihrem geistigen Auge – die Pyramiden, das Gold, die Grabkammern mit Hieroglyphen an den Wänden, dazu geheimnisvolle Mumien? Mindestens ein paar Wissensbrocken über das Alte Ägypten gehören in Europa fest zum Bildungskanon. Selbst der Spielwarenhersteller Playmobil bot lange eine Plastikpyramide für Kinder ab sechs an, inklusive Falltür und prächtigem Sarkophag.
Sie ist ja auch faszinierend, die Kultur jener Welt, in der Pharaonen und Pharaoninnen herrschten, die mehr als 6000 Jahre zurückreicht und so eindrucksvolle Zeugnisse hinterlassen hat. Schon in der Antike galten die Pyramiden von Giseh als Weltwunder, heute sind sie das einzige der einst sieben derart gerühmten Monumente, das noch existiert. Die Handwerkskunst der Goldschmiede von einst beeindruckt ebenso wie die erstaunlichen Fähigkeiten der Einbalsamierer oder das komplexe System der altägyptischen Schrift.
Dabei schwankt die Sicht auf das Land am Nil zwischen zwei Extremen: Einerseits gilt die altägyptische Kultur als fremd und geheimnisvoll. Schon die griechisch-römischen Geschichtsschreiber schildern das Reich auf der anderen Seite des Mittelmeers als das »Andere«, als das Gegenteil der europäischen Kultur. Und auch als das Alte Ägypten rund um die Expedition von Frankreichs Herrscher Napoleon am Ende des 18. Jahrhunderts – aus europäischer Perspektive – wiederentdeckt wurde, gerieten vor allem jene Aspekte in den Mittelpunkt, die man damals »exotisch« fand und als besonders fremdartig wahrnahm.
Andererseits vereinnahmte Europa seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts die ägyptische Hochkultur auch als Vorläufer der eigenen Zivilisation. Daraus leitete man das Recht ab, sich daran zu bedienen. Westliche Staatsleute importierten Obelisken als Schmuck für prächtige Plätze in ihren Hauptstädten, verschleppten Kunstwerke in ihre Museen und Goldschmuck in ihre Schatzkammern. Erfüllt von kolonialem Zeitgeist ignorierte man, dass die altägyptische Welt eine afrikanische war, und deutete sie zu einer »weißen« Kultur um. All das wirkt in heutigen Vorstellungen über das Alte Ägypten nach. Noch immer etwa hält sich die Behauptung, Sklaven hätten die Pyramiden erbaut – dabei waren es spezialisierte Handwerker.
Inzwischen ist die Forschung weg davon, das Alte Ägypten nur aus europäischer Sicht zu betrachten. Ägyptologinnen und Ägyptologen stellen vielmehr die eigene Logik der damaligen Zeit in den Mittelpunkt. Sie tragen beispielsweise erstaunliche Details über die Regierungszeit der verschiedenen Pharaonen zusammen. Sie rekonstruieren den Alltag der einfachen Menschen oder können zeigen, wie Wissenschaftler damals arbeiteten. Auch ist inzwischen klar, dass Frauen politisch in Ägypten eine weit größere Rolle spielten als im antiken Europa.
Dieses Buch erzählt davon, wie Europa das Alte Ägypten für sich entdeckte und was man derzeit über die Kultur am Nil weiß. Und es wirft Fragen auf, die es angesichts der Geschichte der Ägyptenrezeption in Europa zu beantworten gilt – etwa, ob die berühmte Büste der Nofretete nicht eigentlich Raubkunst ist und zurückgegeben werden sollte oder ob es ethisch vertretbar ist, Mumien auszustellen. Die Welt von damals wird durch solche Diskussionen nicht weniger faszinierend, eher im Gegenteil: Nur wenn man Ägyptens Kultur als eigenständig sieht und aus sich selbst heraus betrachtet, wird man ihr wirklich gerecht.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Eva-Maria Schnurr
Hamburg im März 2025
Pharaonenglanz für Preußen
1842 reiste ein junger Forscher von Berlin an den Nil. Damit begründete Karl Richard Lepsius die deutsche Ägyptologie.
Von Ruth Hoffmann
Über der Wüste steht bereits die Mittagssonne, als sich die preußische Forschergruppe daranmacht, die Cheops-Pyramide zu erklimmen – »mithilfe der höchst lästigen Araber, deren wenigstens 20 uns umschwirren«, wie einer von ihnen später schreibt. »Man wird mit unaufhaltsamer Eile hinaufgestoßen und gezogen (…) hinter sich zu blicken, ist nicht ratsam, denn die Höhe ist erstaunlich und man wird ganz schwindlig.« Der Aufstieg ist eine mühsame Kraxelei, schnaufend erreichen die Forscher die abgeflachte Spitze, so hat es der Teilnehmer notiert. Unter ihnen breitet sich die felsige Weite von Giseh mit den anderen Pyramiden aus. Dahinter schimmert grün das Niltal, in der Ferne erkennt man Kairo.
Expeditionsleiter Karl Richard Lepsius holt eine Fahne aus dem Marschgepäck. Kurz darauf flattert der preußische Adler über einem der ältesten Bauwerke der Welt, begleitet von drei Hochrufen auf den König: Es ist der 15. Oktober 1842, der Geburtstag Friedrich Wilhelms IV. »Nach Süden fliegend, wendete der Adler sein gekröntes Haupt der Heimat zu gen Norden«, schreibt Lepsius am nächsten Tag nach Berlin. »Auch wir schauten heimwärts und ein jeder gedachte (…) derer, die er dort (…) zurückgelassen hatte.«
Nach dem Abstieg meißelt er eine Hieroglypheninschrift in den Stein oberhalb des Eingangs zum Pharaonengrab, eine Huldigung im Stil altägyptischer Stelen: »Heil (…) dem Sohne der Sonne, die das Vaterland befreite, Friedrich Wilhelm dem Vierten (…) dem Lieblinge der Weisheit und der Geschichte, dem Hüter des Rheinstroms (…) dem Lebenspender allezeit.« Es war der feierliche Auftakt zu einer Unternehmung, die wissenschaftliche Maßstäbe setzte und Lepsius zum Vater der deutschen Ägyptologie machte. Sein Team und er dokumentierten archäologische Denkmäler vom Mittelmeer bis Khartum und gewannen dabei Daten und Erkenntnisse, die noch Generationen später Bedeutung und Gültigkeit haben sollten. Nicht zuletzt brachte die Expedition für das damals noch im Bau befindliche Neue Museum Hunderte von Objekten nach Berlin, die es zu einer der größten und umfassendsten Sammlungen Europas aufsteigen ließen – schon vor der Abreise hatte Lepsius eine lange, auf diesen Zweck zugeschnittene Liste erstellt.
Der Sohn eines Landrats aus Naumburg hatte in Leipzig, Göttingen und Berlin Philologie, Archäologie und Linguistik studiert; als er nach Ägypten aufbrach, war er 32 Jahre alt. 1833 promovierte er noch über die Iguvinischen Bronzetafeln, die Texte in Umbrisch und Latein enthalten, doch ein Aufenthalt in Paris hatte bereits seine Leidenschaft für Ägypten entzündet. Er lernte Koptisch und Altägyptisch und versuchte sich anhand der Schriften des Geschichtsschreibers Manetho (circa 3. Jahrhundert v. Chr.) an einer Chronologie der alten Kultur am Nil. Parallel dazu vertiefte er sich in die Hieroglyphen: Der preußische Diplomat Carl Josias von Bunsen, selbst Historiker und Gründer des Archäologischen Instituts in Rom, hatte ihn bestürmt, die Arbeit des französischen Sprachwissenschaftlers Jean-François Champollion fortzusetzen. Dieser hatte eine Entzifferungsmethode entwickelt, war dann aber 1832 im Alter von nur 41 Jahren gestorben.
Bunsen wurde nicht enttäuscht: Lepsius machte sich mit Feuereifer an die neue Aufgabe. Es gelang ihm tatsächlich, Champollions Vorarbeit entscheidend zu erweitern und so das Rätsel der Hieroglyphen weitgehend zu lösen. Anschließend überprüfte er seine Methode anhand von Museumsexponaten, Abbildungen und Abschriften. Als er fast alle in Europa befindlichen Aegyptica kannte, entstand in ihm der Wunsch, selbst vor Ort zu forschen. In Bunsen und dem schon damals berühmten Alexander von Humboldt fand er dafür einflussreiche Unterstützer. Und so stellte er am 20. Dezember 1840 beim König den Antrag für eine Expedition an den Nil.
Der Zeitpunkt hätte besser kaum sein können: Friedrich Wilhelm IV., ein klassisch gebildeter, kunstinteressierter Mann, hatte ein halbes Jahr zuvor den Thron bestiegen. Er kannte die kulturgeschichtliche Bedeutung Ägyptens. Und anders als sein Vater sah er in der Förderung von Wissenschaft und Kunst eine Möglichkeit, der preußischen Monarchie Prestige zu verschaffen. Ihm war bewusst, dass die Franzosen und Engländer in der Ägyptologie deutlich weiter waren und die Museen von Paris und London bereits über wertvollere Sammlungen verfügten. Berlin musste sich sputen, wenn es den Anschluss nicht verlieren wollte.
Der Fürsprache Humboldts und Bunsens bei Hof hätte es also wohl gar nicht bedurft: Der König bewilligte die Expedition nur wenige Tage später und stellte dafür die stattliche Summe von knapp 45 000 Talern aus seiner eigenen Schatulle zur Verfügung – mehr als das Vierfache dessen, was der gut bezahlte preußische Kultusminister im Jahr verdiente. Für die Veröffentlichungen kamen später noch einmal 50 000 Taler hinzu. Während seiner gesamten Regierungszeit förderte Friedrich Wilhelm IV. kein anderes Wissenschaftsprojekt auch nur annähernd so großzügig.
Das Forschungsvorhaben, das Lepsius der Akademie der Wissenschaften im Mai 1842 zur Begutachtung vorlegte, hätte für ein ganzes Leben gereicht. Der Ägyptenbegeisterte, inzwischen außerordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, veranschlagte dafür zwei Jahre. Sein Ziel sei es, die Geschichte und Kultur Ägyptens zu erhellen, und zwar »nicht nur für sich allein, sondern auch in ihrem Zusammenhange mit den übrigen Völkern und mit der Weltgeschichte«.
Dafür wolle er unter anderem das Gebiet um Memphis erkunden, das Peträische Arabien, das Fayyum und die Gräber im Westen Thebens; in Nubien und Vorderasien nach den Spuren der Feldzüge von Ramses II. suchen und schließlich in »Äthiopien« (heute Sudan) nachweisen, dass die dortige Kultur aus der ägyptischen hervorgegangen sei, nicht umgekehrt, wie allgemein angenommen.
Als »Reisepersonal«, das ihm bei der Dokumentation der Funde helfen sollte, gab er den Architekten Georg Erbkam an, die Maler Max und Ernst Weidenbach, Johann Jakob Frey als Hieroglyphen- und Skulpturenzeichner und den Gipsformer Carl Franke – wie er selbst allesamt junge Männer um die dreißig.
Anderthalb Jahre vergingen mit Vorbereitungen. Mitte September 1842 traf die Gruppe in Alexandria ein, wo ihre Geduld erneut auf die Probe gestellt wurde: Es wäre leichtsinnig gewesen, ohne Genehmigung des ägyptischen Machthabers Mehmet Ali Pascha mit Forschungen zu beginnen. Lepsius und Erbkam machten ihm mehrfach ihre Aufwartung, erklärten den Zweck der Reise und überreichten ihm einen Brief Friedrich Wilhelms IV. nebst Vasen aus der Königlich-Preußischen Porzellanmanufaktur als Geschenk. Am Ende sagte ihnen Mehmet Ali jede Unterstützung zu.
Selbst mit Abbau und Ausfuhr ägyptischer Altertümer war er einverstanden. Bisher hatte er das kategorisch ausgeschlossen, jetzt aber lag ihm viel an der Verbindung zu Europa. Zwei Jahre zuvor hatte Mehmet Ali versucht, sein Land aus der Herrschaft des Osmanischen Reiches zu befreien. England, Frankreich und Preußen hatten ihn daraufhin militärisch unter Druck gesetzt, die Macht des osmanischen Großwesirs wiederhergestellt und den Pascha selbst auf den Posten des Statthalters zurückgestutzt. Nun hoffte er, durch sein Entgegenkommen den preußischen König als Fürsprecher Ägyptens zu gewinnen.
Ausgestattet mit einem Geleitschreiben Mehmet Alis, reiste das Expeditionsteam im Oktober nach Kairo und brach am 9. November nach Giseh auf. Neun Kamele waren mit Zelten, Proviant und Ausrüstung beladen, ein Pferd und sechs Esel dienten als Reittiere und Lastenträger. Lepsius hatte außerdem Kameltreiber und einige Helfer angeheuert. Als die Männer in flachen, schaukelnden Booten den Nil überquerten, spürten sie erstmals, dass ihre Reise auch Gefahren barg: Es herrschte heftiger Wind, eine der Barken kenterte, die Esel ertranken, die Küchenausrüstung ging verloren. Bis man im nächsten Dorf neue Tiere und Kochgeschirr auftreiben konnte, vergingen Stunden. So war es schon dunkel, als die Gruppe die Anhöhe vor dem Pyramidenfeld erreichte. »Wunderbarer Anblick auf die Wüste im Mondschein«, schwärmte Erbkam in seinem Tagebuch, »wie eine einzige See, oder fast wie ein Schneefeld.«
Karl Richard Lepsius (Kupferstich um 1850).
Die erste Nacht verbrachten die Männer in einer leeren Totenkammer. Erst am nächsten Morgen suchten sie nach einem dauerhaften Lagerplatz und entschieden sich für eine Talsenke nahe dem Sphinx. Die Küche richteten sie in einem alten Grab ein; zwischen Ausrüstungskisten und Zelten wehte die preußische Flagge.
Drei Monate lang untersuchten sie das Gelände, Erbkam zeichnete die Pläne. Bei Strecken, die sich nicht mithilfe optischer Geräte wie Teleskop oder Theodolit errechnen oder mechanisch messen ließen, behalf er sich mit dem eigenen Schrittmaß. Johann Jakob Frey und die Weidenbach-Brüder kopierten Inschriften und Malereien und nahmen mit feuchtem Papier Abklatsche von Relieffiguren und -texten. Mithilfe einer Camera lucida, eines Geräts, das die Umrisse eines Objekts auf Papier projiziert, gelangen Ansichten von fast fotografischer Genauigkeit, die Frey zu breiten Panoramen zusammensetzte.
Einmal ereilte sie ein Unwetter mit Sturm und Hagel, das ihnen die Zelte niederriss und ihre Ausrüstung wegschwemmte. Von da an hatten sie stets ein Auge auf den Himmel und sicherten schon beim ersten Tröpfeln Notizbücher, Skizzenblöcke und die empfindlichen Geräte. Immer wieder, oft tagelang, berichtete Lepsius in einem Brief, hüllte starker Wind die Ebene in Staub, der sich auf Zeichenpapier, Farben und Lungen legte. Er »dringt durch alle Kleider (…) füllt Nase, Ohren, Haare und ist die unvermeidliche Zutat zu allen Speisen und Getränken«.
Doch die Mühsal wurde belohnt: Insgesamt 87 Gräber konnten sie ausmachen, bei gut der Hälfte fanden sie Inschriften mit Namen und Titeln – wertvolle Quellen für Lepsius’ Chronologie der ägyptischen Geschichte und Dynastien. »Noch immer hier!«, notierte er am 2. Januar 1843. »Es ist zu verwundern, wie wenig dieser besuchteste Ort von ganz Ägypten untersucht worden ist. Ich will jedoch, da wir die Früchte dieses Versäumnisses ernten, mit unsern Vorgängern nicht rechten.«
Mitte Februar 1843 ging es weiter nilaufwärts, wo sie ebenso akribisch die Nekropolen von Sakkara, Abusir und Dahschur dokumentierten. Lepsius war der Erste, der nicht nur nach dem Wozu des Pyramidenbaus fragte, sondern auch nach dem Wie. Seiner Hypothese zufolge, die er anhand der Pyramide von Meidum nachwies, ließ der Pharao gleich bei der Machtübernahme eine kleine Pyramide errichten. Im Laufe seiner Regentschaft wurde sie dann nach und nach erweitert, wobei alle sichtbaren Fronten jedes Mal fertiggestellt und poliert wurden.
Im Mai 1843 der nächste Triumph: Bei Hawara stieß das Team auf die Reste des von Herodot beschriebenen und bisher verschollenen »Labyrinths«, eines Totentempels am Fuße einer Pyramide, der in der Antike als Weltwunder galt. In den umliegenden Dörfern heuerte man Einheimische an, die dabei helfen sollten, den geheimnisvollen Komplex freizulegen. »Diese lasse ich (…) auf der Nordseite der Pyramide lagern und die Nächte zubringen«, schrieb Lepsius mit zeittypischer Überheblichkeit. Die Männer füllten Körbe mit Schutt, die von Kindern, »welche die große Mehrzahl bilden, (…) auf dem Kopfe weggetragen« wurden. »Jeden Morgen werden sie gezählt und jeden Abend bezahlt.«
Über Luxor und Abu Simbel reiste die Expedition im August weiter und weiter nach Süden. Dabei machten sie immer wieder halt, um antike Denkmäler zu dokumentieren; kopierten Inschriften, fertigten Abklatsche und Gipsgüsse. Schließlich passierten sie die Grenze zu »Äthiopien«, wie das Gebiet im heutigen Sudan damals hieß – und betraten damit endgültig Terra incognita.
Zwei Wüsten mussten sie durchqueren, um zu den von Lepsius anvisierten Tempeln und Ruinenstädten zu gelangen. Es waren lange, zermürbende Touren. »Noch vor wenigen Tagen glaubte ich (…) ganz sicher, (…) Nilwasser zu sehen, und ritt darauf zu, fand aber nur (…) Wasser des Satan, wie es die Araber nennen«, heißt es in einem von Lepsius’ Briefen – Luftspiegelungen auf dem heißen Sand. Doch dieser Teil der Reise lag ihm besonders am Herzen. Schon in Berlin hatte er sich in den Kopf gesetzt, seinen Fachkollegen entgegenzutreten, die den Ursprung der ägyptischen Kultur hier, im sagenhaften Königreich Meroe, vermuteten. Durch seine Funde und sprachwissenschaftlichen Forschungen konnte er tatsächlich belegen, dass die Kultur im Sudan jünger war als die ägyptische.
Erst Anfang August 1844 kehrte das Team nach Abu Simbel zurück und untersuchte dort, was frühere Forscher unbeachtet gelassen hatten – wie die Inschriften, die Besucher vergangener Jahrhunderte in die Beine der riesigen Pharaonenfiguren eingeritzt hatten. Auch im Tal der Könige, wo sie von November an ihr Lager aufschlugen, erfassten sie noch ein halbes Jahr lang bisher nicht Dokumentiertes. Im Laufe des Sommers 1845 verließen sie alle nach und nach das Land. Zurück in Berlin, begann Lepsius im Februar 1846 mit der wissenschaftlichen Aufbereitung der Reise.
Einige Wochen zuvor hatte der preußische Frachter Friederike den Hafen von Alexandria verlassen, beladen mit mehr als 1500 Objekten, die Lepsius in den knapp drei Jahren seiner Expedition zusammengetragen hatte. Darunter eine zentnerschwere Widderstatue aus Granit, die 92 ägyptische Helfer drei Tage lang durch die Wüste gezogen hatten; zwei reich verzierte Opferkammern und ein Altar, gewaltige Felsbrocken mit Königskartuschen und Wasserständen des Nils, eine tonnenschwere beschriftete Grenzstele, ganze Tempelwände, etliche Pfeiler, Skulpturen, Inschriften, Wandbilder und Reliefs. Ein Schatz von unermesslichem Wert.
Schon während der Reise hatte sich Lepsius mit eigenen Vorstellungen in die Planung der Ägyptischen Abteilung des Museums eingemischt, das gerade auf der Spreeinsel entstand. Nach seiner Rückkehr wurde er Vizedirektor und entwarf mit königlichem Segen, zusammen mit Erbkam und den Weidenbach-Brüdern, spektakuläre Rauminszenierungen für die neuen Exponate – samt Wand- und Deckenmalereien nach ägyptischen Vorlagen. Ab 1850 durfte auch Publikum die Sammlung bestaunen.
150 Jahre später, nach Umbau, Bombenhagel und DDR-Leerstand, waren von dem einst so prächtigen »Mythologischen Saal«, dem »Säulenhof« oder »Hypostyl« nur noch Reste übrig. Sie sind nun selbst gewissermaßen archäologische Funde – und seit der Renovierung Teil des 2009 wiedereröffneten Neuen Museums in Berlin.
Schnelles Wissen
Was ist ein »Abklatsch«?
Mit dieser Methode kopiert man noch heute Inschriften: Dickes, saugfähiges Papier wird über die Schriften gelegt, mit einem Schwamm befeuchtet und mit Bürsten angedrückt. Ist das Papier trocken, wird es abgenommen. Die Schrift zeichnet sich dann dreidimensional darin ab.
»Die Welt war von Göttern durchdrungen«
Wie entstand die Hochkultur am Nil? Und wie sahen sich die Ägypter selbst? Friederike Seyfried, Direktorin des Ägyptischen Museums Berlin, erläutert, was Forscher heute wissen.
Interview geführt von Johannes Saltzwedel
SPIEGEL: Frau Professor Seyfried, vor vielen Jahrtausenden siedelten sich im Niltal Menschen an. Daraus entwickelte sich die ägyptische Hochkultur. Wann begann die Entwicklung dahin?
Seyfried: Die ersten Spuren stammen aus der Steinzeit. In der Jungsteinzeit, etwa um 6000 v. Chr., wurde die nordafrikanische Savanne mit ihren Oasen, die heutige Sahara, immer unwirtlicher und trockener. Jäger und Viehzüchter, die dort lebten, kehrten ihrer Heimat den Rücken. Ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. sind dann im Niltal mehrere jungsteinzeitliche Siedlungszentren nachweisbar, die neben Keramik und Alltagsgegenständen auch erste Kunstwerke herstellten.
SPIEGEL: Wie groß war der Einfluss aus weiter südlich gelegenen Gebieten, etwa dem heutigen Äthiopien?
Seyfried: Eher gering, jedoch bestanden sicherlich Verbindungen nach Süden, vor allem in den heutigen Sudan. Aber kulturell ist eine Trennung zu erkennen. Eine natürliche Grenze war und blieb der erste Katarakt, die für Schiffe unpassierbaren Stromschnellen des Nil bei Elephantine.
SPIEGEL: Am Nil trafen also verschiedene Stämme aufeinander. Entstand bald eine neue politische Einheit?
Seyfried: Es ging nicht so schnell. Weit von Südwesten, aus Nordafrika, zogen also die Rinderhirten an den Nil – das kann mein Kollege, der Archäologe Miroslav Barta, an Höhlenbildern eindrucksvoll belegen. Und aus der Levante, dem nordöstlich gelegenen Syrien/Palästina, kamen Bevölkerungsgruppen, die hauptsächlich mit Schafen und Ziegen wirtschafteten. Nach und nach begann auch der Ackerbau.
SPIEGEL: Aber von einem Reich darf man noch nicht reden?
Seyfried: Nein, es waren jungsteinzeitliche Dorfgemeinschaften mit Häuptlingen, die sich vielleicht von Fall zu Fall verbündeten. Diese Gemeinschaften wuchsen an der Flussoase des Nil ganz allmählich zusammen, auch kulturell. Zwischen 3200 und 3000 v. Chr. war der Vorgang abgeschlossen. Die Ägypter sahen darin den Anfang ihrer Kultur und nannten es später »Reichseinigung«.
SPIEGEL: Heute denkt man bei dem Wort eher an Karl den Großen oder Otto von Bismarck. Lässt sich, was die ersten Pharaonen taten, damit vergleichen?
Seyfried: Kaum. »Reichseinigung«, das ist mythische Geschichtsschreibung, Gründungssage Ägyptens, rückprojiziert aus späteren Jahrhunderten. Auf Reliefs tragen die Herrscher dieses neuen, einigen »Reiches« häufig zwei Kronen ineinander: die weiße, die Oberägypten zugeschrieben wird, und die rote, die man mit Unterägypten verbindet. Beide ließen sich gut kombinieren. Vielleicht symbolisierten die Kronen neben der regionalen Bindung auch zwei theologische Aspekte, aber die heute bekannten Quellen geben da keine klare Auskunft.
SPIEGEL: Und nun brach die Hochkultur in die Dorfgemeinschaften hinein?
Seyfried: Gemessen an den früheren Zeiträumen scheint es uns, als wäre die Kultur explodiert. Göttervorstellungen und Kulte gab es aber seit langer Zeit, das kann man an zahlreichen Funden dokumentieren. Auch die Nutzung der jährlichen Nilüberschwemmung für den Ackerbau entwickelte sich allmählich. Entscheidend für das Entstehen einer Hochkultur war die Arbeitsteiligkeit: Handwerker und natürlich auch eine wachsende Priesterschaft brauchten Nahrung; Bauern und Viehhirten mussten deshalb mehr erwirtschaften, als sie selbst benötigten. Das erforderte Vorausplanung, zum Beispiel um das Getreide angemessen zu verteilen. Diese Aufgaben machten eine gut funktionierende Verwaltung notwendig.
SPIEGEL: Und so gab es die ersten Schriftstücke: Akten.
Seyfried: Genau. Die Schrift entstand zunächst als Bürokratiehilfe, ganz simpel: Auf einem Gefäß sollte zu lesen sein, was drin war. Parallel zu den Hieroglyphen wurde auch Papyrus als Beschreibmaterial entwickelt. In den vergangenen Jahren hat man am Roten Meer sehr alte Papyri entdeckt, in denen der Bau der Cheops-Pyramide um 2600 v. Chr. erwähnt ist. Es gibt sogar noch ältere.
SPIEGEL: Wie eng waren Religion und Politik miteinander verflochten?
Seyfried: Sehr eng. Kulturanthropologisch ist erwiesen, dass Stammesführung stets auch religiös fundiert ist. Alle frühen Kulturen haben eine Weltdeutung mit Gottheitsvorstellungen und entsprechenden Riten. Das gilt in hohem Maß für das Alte Ägypten. Stammesführer und später die Pharaonen waren zugleich geistliche Oberhäupter von besonderem magisch-spirituellem Rang. Für die Ägypter war die Welt von Göttern durchdrungen; dadurch fühlte man sich in ihr aufgehoben.
SPIEGEL: Schon von der 3. Dynastie an begannen die Ägypter, repräsentative Steingebäude zu errichten, vor allem auch Pyramiden. Was steckte dahinter – religiöser Brauch, Herrscherkult, nationaler Ehrgeiz oder schlichter Machtwille?
Seyfried: Das dürfen wir uns wohl nicht anmaßen zu entscheiden. Schon die ersten Steinbauten, etwa seit der Stufen-Mastaba des Djoser, sind in der Tat gleich sehr eindrucksvolle Monumente. Wie sie zustande kamen, darauf habe ich nur eine etwas kompliziert klingende Antwort: Wir sehen die Reste der gesellschaftlich gewollten Demonstration dessen, was für den König als notwendig galt. Es waren nicht die Herrscher allein, die entschieden, solche Bauen zu errichten, es war die ganze Gesellschaft, die sich darin einig war. Ohne Bereitschaft der einfachen Leute zur Mitarbeit hätte es die Pyramiden und Tempel ja nie gegeben. Ohne sehr effiziente Beamte natürlich auch nicht – das waren meisterliche Planer.
SPIEGEL: Weiß man etwas darüber, wie eng das frühe Ägypten mit benachbarten Kulturen verkehrte?
Seyfried: Die Kontakte waren eher eingeschränkt. Handelsverbindungen nach Mesopotamien gab es durchaus. Aber die exklusive Lage des Niltals führte doch zu einer Konzentration auf das Eigene; die Ägypter des Alten Reiches fanden gewissermaßen ihren Weg. So entwickelten sie ein beachtliches Selbstbewusstsein …
SPIEGEL: … das dann über drei Jahrtausende hinweg zahllose politische Krisen, Bürgerkriege, Spaltungen und Umbrüche überdauerte.
Seyfried: Ja, diese Stabilität hielt vor.
SPIEGEL: Empfanden die alten Ägypter sich eigentlich als eine Nation?
Seyfried:





























