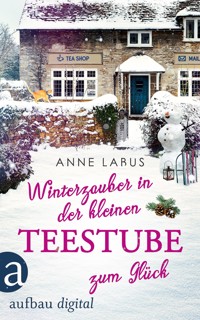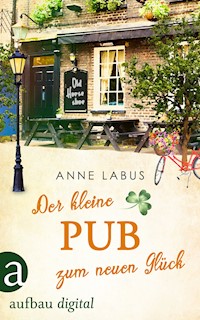8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jersey-Träume
- Sprache: Deutsch
Drei Schwestern, ein Gästehaus, unzählige Herausforderungen.
Die drei Schwestern Lilly, Rose und Jasmin stehen vor einer unerwarteten Herausforderung: Sie erben das kleine Gästehaus ihrer Mutter auf der malerischen Insel Jersey. Doch es gibt eine Bedingung: Jede von ihnen muss die Pension mindestens drei Monate allein führen, bevor sie das Haus verkaufen dürfen.
Lilly übernimmt als Erste und findet sich bald in einem Strudel aus unerwarteten Ereignissen und Emotionen wieder. Während sie sich verzweifelt durch den Hotelalltag kämpft, trifft sie auf Simon, den Mann, der ihr einst das Herz brach. Um die aufkeimenden Gefühle für ihn zu verdrängen und sich abzulenken, beginnt sie, mit dem attraktiven Arzt George zu flirten. Doch als Lilly glaubt, alles im Griff zu haben, droht ihr Leben plötzlich aus den Fugen zu geraten. Kann sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen und gleichzeitig das Gästehaus retten?
In dieser berührenden Geschichte über Liebe, Verlust und die Kraft der Familie müssen die Schwestern lernen, dass wahres Glück oft dort verborgen liegt, wo sie es am wenigsten erwarten. Begleiten Sie Lilly auf ihrer emotionalen Reise, und entdecken Sie die Geheimnisse des Gästehauses – ein Ort voller Erinnerungen und neuer Chancen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Drei Schwestern, ein Gästehaus, unzählige Herausforderungen.
Die drei Schwestern Lilly, Rose und Jasmin stehen vor einer unerwarteten Herausforderung: Sie erben das kleine Gästehaus ihrer Mutter auf der malerischen Insel Jersey. Doch es gibt eine Bedingung: Jede von ihnen muss die Pension mindestens drei Monate allein führen, bevor sie das Haus verkaufen dürfen.
Lilly übernimmt als Erste und findet sich bald in einem Strudel aus unerwarteten Ereignissen und Emotionen wieder. Während sie sich verzweifelt durch den Hotelalltag kämpft, trifft sie auf Simon, den Mann, der ihr einst das Herz brach. Um die aufkeimenden Gefühle für ihn zu verdrängen und sich abzulenken, beginnt sie, mit dem attraktiven Arzt George zu flirten.
Doch als Lilly glaubt, alles im Griff zu haben, droht ihr Leben plötzlich aus den Fugen zu geraten. Kann sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen und gleichzeitig das Gästehaus retten?
Auftakt der Reihe "Jersey-Träume" von Anne Labus.
Über Anne Labus
Anne Labus, Jahrgang 1957, lebt mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Udo Weinbörner, in der Nähe von Bonn. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau arbeitete sie unter anderem als selbstständige Fitness- und Pilatestrainerin. Die Leidenschaft für das Reisen hat sie an ihren Sohn vererbt, der auf Hawaii seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat. Die Autorin entspannt sich beim Kochen, liebt Bergtouren und lange Strandspaziergänge. Inspirationen für ihre Romane findet sie in Irland und Italien oder auch auf Spiekeroog.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Anne Labus
Das alte Kapitänshaus – Inselsehnsucht
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Liebe Leserinnen und Leser,
Danksagung
Impressum
Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!
Kapitel 1
Der Wind hatte gedreht. Veränderung lag in der Luft. Sie konnte es förmlich riechen. Äußerlich die Ruhe selbst arbeitete Lily die Bestellungen ab. Doch innerlich kochte sie vor Wut. Wo blieb die versprochene Aushilfe, wo der zusätzliche freie Tag?
»Ihr Sandwich ist sofort fertig«, vertröstete sie einen ungeduldigen deutschen Urlauber. Vor Sam’s Seafood Fisheries herrschte der übliche Mittagsandrang. Arbeiter aus den Docks, Touristen, die sich im Hafen von St. Peter Port die Zeit bis zur nächsten Fähre vertrieben, und Angestellte der Reedereien warteten auf Fish und Chips oder Hummersandwiches.
Lily warf einen wütenden Blick Richtung Bürotür, hinter der ihr Chef sich verschanzte und über seinen Geschäftsunterlagen brütete. Lange würde sie sich das nicht mehr gefallen lassen. Seit Helen vor zwei Wochen fristlos gekündigt hatte, schmiss sie den Imbiss quasi allein. Ihr Chef kümmerte sich um den Einkauf und den lästigen Schreibkram. Falls das Gedränge am Ausgabefenster überhandnahm, half er widerwillig. Aber das war leider die Ausnahme. Nur weil sie mietfrei bei ihm wohnte und ab und zu das Bett mit ihm teilte, war das noch lange kein Grund, sie schamlos auszunutzen.
Dank ihres Engagements war der unscheinbare Imbiss gegenüber dem Trockendock inzwischen eine Institution. Stets frischer Fisch, dazu faire Preise. Und seit Lily selbst gebaute Sitzbänke aus Paletten vor das Haus gestellt hatte, avancierte die Fischbude zu einem angesagten Treffpunkt. Sie hätte zufrieden sein können. Doch eine innere Unruhe setzte ihr zu. Es war Zeit, weiterzuziehen. Mit achtundzwanzig verlangte sie mehr vom Leben als einen Aushilfsjob in einer Fischbraterei. Das war ihr endlich klar geworden.
Das mit ihr und Sam war nie wirklich ernst gewesen. Sie waren ein gutes Team, aber mehr als Zuneigung empfanden sie nicht füreinander. Sie hatte von Anfang an mit offenen Karten gespielt, und er wusste, dass sie nicht ewig bei ihm bleiben würde. Heute Abend würde sie sich nach einem anderen Job und einer günstigen Wohnung umschauen. Suchte der Golfclub nicht eine neue Servicekraft? Die Vorstellung, demnächst in schwarzem Minirock und Seidenstrümpfen in den noblen Räumen des Clubhauses Sekt zu servieren, statt mit Gummilatschen und Schürze vor der heißen Fritteuse zu schuften, zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht. In Gedanken kaufte sie sich schon das passende Outfit für den neuen Job, da flog die Bürotür auf.
»Telefon für dich.« Sam warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu. »Deine Schwester Jasmin.« Wenn er über seiner Buchführung brütete, duldete der groß gewachsene Mann nicht die geringste Störung. Sam hasste den leidigen Papierkram.
Lily wischte sich mit einer Papierserviette den Schweiß von der Stirn. »Sag ihr, ich rufe später zurück.« Schwungvoll wendete sie zwei Fischfilets gleichzeitig auf der Grillplatte. »Du siehst doch, dass ich alle Hände voll zu tun habe.« Die Vorhaltungen ihrer Schwester konnten warten. Sicher wollte Jasmin sie nur überreden, endlich mal wieder nach Jersey zu kommen.
Ihr Chef wedelte mit dem Handy vor ihrer Nase. »Geh schon ran. Sie sagt, es sei wichtig. Die klang richtig panisch«, betonte er. »Komm schon, ich mache hier weiter.« Er nahm ihr den Pfannenwender aus der Hand und drängte sie vom Herd weg. »Verzieh dich zum Telefonieren gerne in mein Büro.«
»Wie du willst.« Mit spitzen Fingern griff Lily nach dem Smartphone. »Pass auf, dass die Pommes nicht zu dunkel werden, und setz ein freundlicheres Gesicht auf, wenn du bedienst«, brummelte sie und verzog sich in das Kabuff, das Sam großspurig als Büro bezeichnete. Sie zwängte sich zwischen den Getränkekisten zum Klapptisch vor dem Fenster, kauerte sich auf den durchgesessenen Bürostuhl. »Was ist los, Jasmin? Warum rufst du mitten in der Rushhour an? Hat das nicht Zeit bis heute Abend?«
»Ma hatte einen Schlaganfall. Nimm die nächste Fähre und komm, so schnell du kannst, ins Krankenhaus«, japste ihre Schwester.
Lilys Herzschlag setzte einen Moment lang aus, dann beschleunigte sich ihr Puls. »Die Ärzte irren sich bestimmt. Letzte Woche hat sie mir am Telefon noch vorgeschwärmt, wie fit sie ist.«
»Rose sitzt schon im Flieger von London«, entgegnete ihre Schwester kurzatmig. »Nimm die Sechzehn-Uhr-Fähre.« Ohne ein Wort des Abschieds beendete sie das Gespräch.
Lily klammerte sich an das Handy, starrte auf das schwarze Display, unfähig, sich zu bewegen. Erst als Sams markantes Gesicht im Türspalt auftauchte, kam wieder Leben in sie.
»Wo bleibst du? Ich schaffe das hier vorne nicht allein.« Zerknirscht schaute er sie an.
Sie zuckte nur kraftlos mit den Schultern und schüttelte den Kopf. »Ma liegt im Krankenhaus. Ich muss nach Jersey.« Wie in Trance erhob sie sich und schob sich an dem kräftigen Mann vorbei. »Ich gehe hoch, mich umziehen«, sagte sie mehr zu sich selbst. Sie band sich die Schürze ab und drückte sie ihm in die Hand. »Du schaffst das schon. Bist ja früher auch ohne mich klargekommen.«
Sam raufte sich die blonden Haare. In seinen braunen Augen blitzte es auf. »Die nächste Fähre geht erst in drei Stunden.« Er verlegte sich aufs Betteln, streichelte ihr über die Wange. »Hilf mir wenigstens noch, den Mittagsansturm zu bewältigen. Bitte, Lily.«
Sofort regte sich ihr Gewissen. Sam hatte sie vor einem Jahr aus dem schäbigen Hotel an der Costa Brava geholt, wo sie ausgebrannt und vollkommen pleite als Zimmermädchen jobbte. Er hatte ihr auf Guernsey eine neue Perspektive und ein Heim geboten. Das war sie ihm jetzt schuldig. »Okay. Unter einer Bedingung.« Lily deutete mit dem Kopf auf den Tresen. »Du nimmst die Bestellungen entgegen und kassierst ab.« Wortlos nahm sie ihm die Schürze aus der Hand, band sie sich wieder um und stellte sich an den Herd. Wie ein seelenloser Roboter hantierte sie an der Grillplatte, holte frische Fischfilets aus der Kühlung, schnitt Zwiebeln und belegte Sandwiches.
Sam warf ihr hin und wieder einen besorgten Blick zu. Doch sie nickte nur und arbeitete stur weiter, bis der letzte Kunde abgefertigt war. In ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Was, wenn Ma nach dem Schlaganfall nicht mehr auf die Beine kam, schlimmstenfalls ein Pflegefall würde? Jasmin war die einzige der drei Schwestern, die auf Jersey lebte. Als alleinerziehende Mutter eines sechsjährigen Jungen, die halbtags in der Stadtverwaltung arbeitete, konnte sie sich unmöglich allein um Ma kümmern. Rose, die älteste der Brown-Töchter, würde wohl kaum ihren hochdotierten Job bei einer angesehenen Bank in London kündigen, um wieder in der kleinen Filiale in St. Helier zu arbeiten und ihr zur Seite zu stehen. Was würde aus dem Alten Kapitänshaus, wenn Ma …?
Lily schnappte nach Luft. So weit würde es hoffentlich nicht kommen. Ihre Mutter hatte die Konstitution eines Ackergauls. Groß und kräftig, mit Händen, die zupacken konnten, hatte sie nach dem frühen Tod ihres Mannes die drei Töchter allein großgezogen. Als die Mädchen auf eigenen Beinen standen und nach und nach auszogen, baute sie das Wohnhaus zu einem Gästehaus um, öffnete den weitläufigen Garten für Fremde. Sie liebte es, Touristen aus aller Welt zu beherbergen. Schon bald genoss das Alte Kapitänshaus oberhalb der Bucht von St. Aubin einen ausgezeichneten Ruf.
»Ich schließe jetzt ab.« Sam klopfte ihr auf die Schulter. »Danke, Lily.«
Sie zuckte zusammen. »Was sagst du?« Mit dem Handrücken fuhr sie sich über die Augen, versuchte, die Bilder, die sich ihr aufdrängten, zu verscheuchen.
»Geh hoch, mach dich reisefertig. Heute putze ich den Herd.« Sam schob sie energisch Richtung Flur zu der schmalen Stiege, die in die Wohnung führte. »Vergiss nicht wieder, dein Handy einzustecken«, mahnte er. »Das liegt sicher noch auf dem Küchentisch.« Er war zwar nur vier Jahre älter, aber bisweilen spielte er sich auf wie ihr Vater.
»Jaja«, murmelte sie und tapste die Treppe hinauf. »Wo auch sonst?« Die letzten zwei Stufen nahm sie auf einmal, hastete den langen, schmalen Flur entlang in ihr Zimmer. In eineinhalb Stunden legte die Commodore Clipper der Condor Ferries ab. Wenn sie sich mit dem Duschen beeilte und ihre kurzen braunen Locken an der Luft trocknen ließe, reichte die Zeit, den leidigen Fischgeruch aus den Haaren zu waschen und die Kleidung zu wechseln. Sie riss wahllos eine Jeans und ein T-Shirt aus dem Regal. Statt eines Schranks hatte Sam ihr ein ausrangiertes Metallregal neben die Schlafcouch gestellt. Das reichte aus, um ihre wenigen Habseligkeiten aufzubewahren.
Seit sie vor zehn Jahren, mit achtzehn, Jersey Hals über Kopf verlassen und begonnen hatte, kreuz und quer durch Europa zu trampen, reiste sie im wahrsten Sinne des Wortes mit leichtem Gepäck. Ihre gesamte Kleidung passte locker in den Trekkingrucksack. Die unbändige Reiselust hatte sie von ihrem Dad geerbt. Als Kapitän eines Handelsschiffes hatte er alle Weltmeere bereist. Das große weiße Landhaus auf dem grünen Hügel war sein sicherer Heimathafen gewesen. Hier hatte er für seine Frau und die Mädchen ein komfortables Heim geschaffen. Hier hatte er seinen Lebensabend genießen wollen. Doch der Krebs hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Lily seufzte, als sie an Dads qualvolles, langes Leiden dachte. Sie war damals erst elf gewesen, aber die Erinnerung schmerzte sie noch heute.
In Windeseile duschte sie und trocknete sich flüchtig ab. Die Angst vor dem, was ihr bevorstand, schnürte ihr die Kehle zu. Unfähig, nur einen klaren Gedanken zu fassen, stopfte sie alles, was ihr unter die Finger kam, in den Trekkingrucksack.
»Du kommst aber schon wieder?« Sam lehnte grinsend im Türrahmen und deutete auf den prall gefüllten Rucksack. »Lass wenigstens den Winterpullover hier. Den wirst du Ende Mai wohl kaum auf Jersey brauchen.«
Sie folgte seinem Blick und starrte fassungslos auf ihr Gepäck. »Ich bin komplett durch den Wind.« Hastig legte sie die Hälfte der Kleidungsstücke zurück ins Regal. »Weißt du, wo mein Portemonnaie ist?«
»Wahrscheinlich steckt das noch in der Jeans, die du gestern Abend anhattest«, entgegnete er prompt. »Du warst doch mit Sandy im Pub.«
»Oje«, stöhnte sie und rollte mit den Augen. »Man merkt, dass ich schon viel zu lange unter deinem Dach lebe. Du kennst mich zu genau.« Sie biss sich auf die Zunge, wich seinem Blick aus. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, Sam ihre Umzugspläne zu beichten. »Ruf deine Tante Edith an. Die hilft dir bestimmt gern im Imbiss aus«, schlug sie eilig vor und angelte ihre Geldbörse aus der Gesäßtasche der Jeans.
Den Rucksack über eine Schulter gehängt, flitzte sie an Sam vorbei in die Wohnküche und grapschte sich das Handy vom Tisch. Sie zuckte zusammen, als Sam hinter sie trat, ihr die Hände auf die Hüften legte und sie zu sich umdrehte. Lily stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn flüchtig auf den Mund. »Ich rufe dich an«, versprach sie halbherzig.
Er wuschelte ihr durch die feuchten Locken. »Nun hau schon ab, kleine Streunerin. Sonst werde ich noch sentimental.« Sam schniefte theatralisch und wischte sich eine imaginäre Träne von der Wange. Er versetzte ihr einen Klaps auf den Po und verschwand schnurstracks in seinem Schlafzimmer. Kurz darauf hörte Lily ihn mit seiner Tante telefonieren. Im Vorbeilaufen nahm sie die Regenjacke von der Garderobe und hetzte die Treppe hinunter aus dem Haus.
Geblendet von dem gleißenden Sonnenlicht, zerrte sie ihre Baseballkappe aus dem Seitenfach des Rucksacks und setzte sie auf. Gerade noch rechtzeitig erreichte sie das Fährterminal am Südkai, erstand ein Ticket für die Überfahrt und sprintete die wenigen Meter zum Anlegeplatz der Commodore Clipper. Soeben waren die letzten Autos im Bauch der Fähre verschwunden. Kaum hatte Lily das Oberdeck betreten, wurde die Ladeklappe geschlossen, und das Schiff legte ab. Sie blieb eine Weile an der Reling stehen, beobachtete das Treiben im Hafen.
Als die Commodore auf die offene See zusteuerte, ließ sie den Blick über die lang gezogene Uferpromenade schweifen, hinter der das Land steil anstieg. Von der Ferne sah es aus, als stapelten sich die Häuser übereinander. St. Peter Port wurde nicht zu Unrecht als eine der schönsten Städte der Kanalinseln bezeichnet. Mit seiner quirligen Strandpromenade, den verwinkelten Altstadtgassen und den vielen alten Wohnhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert zog es Touristen aus aller Welt an. Nie hätte Lily gedacht, dass sie als waschechte Jersianerin eines Tages unter den ›Donkeys‹, den sturen Eseln, wie ihre Landsleute die Bewohner von Guernsey scherzhaft nannten, leben würde. Dabei war es für sie nur ein weiterer Zwischenstopp auf ihrer Reiseroute.
»Wovor läufst du weg?«, hatte ihre Mutter sie Weihnachten bei ihrer letzten Stippvisite auf Jersey gefragt. »Welche Geister der Vergangenheit quälen dich?«
»Nur einer, Ma«, murmelte sie und eilte in das Bordbistro, um die aufkommende Übelkeit mit einem Becher Tee zu bekämpfen. »Nur einer.«
Kapitel 2
Eine Stunde später legte die Fähre im Elizabeth Harbour an.
»Sorry, wenn ich störe«, entschuldigte sich Lily bei einer Reisegruppe, die sich vor dem Ausgang des Bordbistros um ihren Reiseführer versammelte. »Darf ich bitte durch? Ich werde im Hospital erwartet.« Sofort bildeten die älteren Herrschaften eine Gasse.
»Alles Gute«, rief ihr eine grauhaarige Dame zu. »Sie sind ja ganz blass um die Nase. Soll ich Sie begleiten?«
»Nein, nein. Ich bin okay«, versicherte Lily eilig. »Nur ein bisschen seekrank. Ich möchte meine Mutter im Krankenhaus besuchen.« Sie schenkte der hilfsbereiten Frau ein warmherziges Lächeln und eilte zur Gangway.
Selbst mit verbundenen Augen hätte sie ihre Heimatinsel am Geruch wiedererkannt. Es duftete nach Meer, salzig und frisch. Sogar ein Hauch von Lavendel ließ sich erahnen. Vom Hafen aus waren es mindestens zwei Meilen Fußmarsch zum General Hospital in der Gloucester Street. Da ihre Füße vom stundenlangen Stehen am Herd schmerzten, steuerte sie kurz entschlossen ein Taxi vor dem Terminal an.
»Wohin soll die Reise gehen?« Der Fahrer sprang hilfsbereit aus dem Wagen und nahm ihr den Rucksack ab. Er bemühte sich, ein gepflegtes Englisch zu sprechen, doch der Zungenschlag verriet den waschechten Jersianer. Zuvorkommend hielt er ihr die Wagentür auf und lächelte sie an.
Das hatte sie auf ihren Reisen am meisten vermisst, diese unverstellte Freundlichkeit. An kaum einem Ort in Europa hatte sie es erlebt, dass sich Teenager beim Fahrer bedankten, wenn sie den Bus verließen. Hier war es noch selbstverständlich, dass ein jüngerer Mensch aufstand, um einem älteren seinen Platz anzubieten.
Der Taxifahrer schaute sie fragend an. »Wohin darf ich Sie bringen?«
»Wie? Ach so, natürlich«, murmelte sie und besann sich auf ihre guten Manieren. »Entschuldigen Sie. Ich war in Gedanken. Bitte zum General Hospital.«
Seit Dads Tod hatte sie diesen tristen Kasten nicht mehr betreten. Ihr Magen erinnerte sie schmerzhaft daran, dass ihre letzte Mahlzeit Stunden zurücklag. Wenn sie jetzt nicht wenigstens ein Croissant aß, quälten sie die Magenschmerzen den ganzen Tag. Selber schuld, dachte sie. Warum hast du dir kein Sandwich eingesteckt?
Für einen Zwischenstopp beim Bäcker fehlte ihr die Zeit. Sie durchwühlte ihre Jackentaschen nach etwas Essbarem und förderte einen steinharten Schokoriegel zutage, an dem sie lustlos herumkaute, während sie aus dem Seitenfenster des Taxis schaute. Im Schritttempo fuhren sie an den verglasten Fassaden der modernen Geschäftshäuser und Hotels vorbei, die Esplanade entlang.
»Der übliche Feierabendverkehr«, entschuldigte sich ihr Fahrer. »Aber wir sind gleich da.« Hinter dem Opernhaus bog er auf die Zufahrt zum General Hospital ein und hielt vor dem Seiteneingang.
Lily drückte ihm zehn Pfund in die Hand und winkte ab, als er ihr rausgeben wollte. »Bitte behalten Sie den Rest.«
Ein breites Lächeln huschte über das faltige Gesicht des alten Mannes. »Thank you very much«, sagte er und reichte ihr den Rucksack aus dem Kofferraum. »Alles Gute für Sie.«
Lily nickte ihm zu und eilte über den Parkplatz auf die Glastür zu. Automatisch wanderte ihr Blick zu einem der Fenster in der zweiten Etage. Ihr Magen krampfte sich zusammen, sie presste eine Hand darauf und stöhnte leise. Dort oben hatte ihr Vater wochenlang gelegen und gekämpft. Zitternd klammerte sie sich an den Rucksack.
»Soll ich Sie in die Notaufnahme bringen?« Ein schlanker junger Mann im weißen Arztkittel berührte sie zaghaft am Arm. »Ich bin Dr. Santé.« Besorgt schaute er ihr ins Gesicht und tastete nach ihrem Puls.
Irritiert von seinen stahlblauen Augen, wandte sie den Blick ab. »Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich meine Mutter finde?« Sie knetete ihre Hände. »Ida Brown. Sie hatte einen Schlaganfall.«
»Sehr gern.« Der Arzt fischte ein Handy aus seiner Kitteltasche. »Ich frage rasch nach.« Er trat einen Schritt zur Seite, um ein Mädchen, das an Krücken humpelte, vorbeizulassen. Dann sprach er leise in sein Smartphone, nickte.
»Kommen Sie, ich bringe Sie hoch«, wandte er sich wieder an Lily, nachdem er das Gespräch beendet hatte. »Das liegt auf meinem Weg.« Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, fasste er sie am Arm und führte sie durch die offen stehende Eingangstür zum Aufzug. »Darf ich fragen, woher Sie kommen?« Er tippte auf ihren Trekkingrucksack. »Muss eine weite Reise gewesen sein. Der sieht ziemlich mitgenommen aus.«
Lily nickte traurig. »Wahrscheinlich nicht nur der«, murmelte sie, zog sich die Kappe vom Kopf und fuhr sich mit den Fingern durch die Locken. »Ich bin lange durch Europa getrampt. Seit einem Jahr lebe und arbeite ich auf Guernsey.« Sie war dankbar, dass der junge Arzt sie ablenkte. Seufzend nahm sie im Aufzug den Rucksack von den Schultern, stellte ihn vor ihre Beine und rieb sich den schmerzenden Nacken.
»Sie leben auf meiner Heimatinsel.« Dr. Santé strahlte sie an. »Was für ein Zufall. Hat es uns also beide ins gegnerische Lager verschlagen«, witzelte er. »Wie kommen Sie mit den Donkeys zurecht?«
»Ich mag Esel«, sagte sie und versuchte sich an einem Lächeln. »Nein, im Ernst. Ich fühle mich sehr wohl in St. Peter Port.«
Mit einem Ruck hielt der Lift auf der dritten Etage. Die Aufzugtür fuhr lautlos zur Seite. In großen Lettern prangte »Intensivstation« auf der gegenüberliegenden Wand. Sofort krampften sich Lilys Hände um den Haltegriff. Die Beine verweigerten ihr den Dienst. »Ich glaube, ich kann das nicht«, stammelte sie.
Dr. Santé schnappte sich ihren Rucksack und legte ihr einen Arm um die Schultern. »Ich begleite Sie«, sagte er und führte sie zu einer Glastür.
»Ich habe Ihre Zeit schon viel zu lange in Anspruch genommen. Werden Sie denn nicht auf Ihrer Station vermisst?«, wandte Lily halbherzig ein. Sie hoffte inständig, dass ihn das nicht davon abhalten würde, ihr weiterhin zur Seite zu stehen.
»Kein Problem. Falls ich gebraucht werde, piepst mich die Oberschwester an.« Dr. Santé drückte auf einen Klingelknopf neben der Glastür. Kurz darauf tauchte das blasse Gesicht einer Krankenschwester im Türspalt auf. »Ah, George, du bist es.« Sie musterte Lily streng. »Und Sie sind?«
»Lass uns bitte rein, Iris. Miss Brown möchte zu ihrer Mutter.« Dr. Santé schob sich an der blassen Frau vorbei, woraufhin die mit wehendem Kittel davonrauschte. »Sie meint das nicht so. Zu den Patienten ist sie die Liebe selbst«, erklärte er und hielt Lily die Tür auf.
»Danke«, murmelte sie und drückte kurz seinen Arm. Der Geruch von Desinfektionsmittel und Krankheit stieg ihr in die Nase. Längst verdrängte Erinnerungen tauchten vor ihrem inneren Auge auf. Am liebsten hätte sie auf der Stelle kehrtgemacht, wäre zurück zum Hafen und auf die nächste Fähre gegangen. Das alles hier war sicher nur ein Albtraum, aus dem sie hoffentlich bald aufwachen würde.
»Verrätst du mir deinen Vornamen, Miss Brown?« Der Arzt brachte sie zu einer Garderobe. Aus einem Wandschrank reichte er ihr einen grünen Kittel, nahm ihr die Jacke ab. »Dass ich George heiße, hast du ja bereits gehört.« Ihren Rucksack stellte er mit der Bemerkung: »Hier ist er gut aufgehoben«, in einen Schrank, in den er auch ihren Anorak hängte.
Sie schaute an ihm vorbei den Flur hinunter, wo Rose und Jasmin an einem weißen Resopaltisch saßen und die Köpfe zusammensteckten. »Lily. Mein Name ist Lily«, sagte sie leise. »Das da vorn sind meine Schwestern.«
George folgte ihrem Blick, nickte, als die beiden sie bemerkten und hektisch winkten. In diesem Moment piepste es in seiner Kitteltasche. »Sorry, die Pflicht ruft. Ich werde auf der Inneren gebraucht. Aber falls du später …«
»Dann weiß ich ja jetzt, wo ich dich finde«, unterbrach sie ihn. »Danke für deine Unterstützung, George.« Eilig desinfizierte sie sich die Hände unter einem Dosierspender, zog sich den grünen Kittel über und lief zu ihren Schwestern. »Wie geht es Ma? Warum seid ihr nicht bei ihr?«
Jasmin sprang auf, fiel ihr in die Arme. »Ich bin so froh, dass du da bist. Ma hat immer wieder deinen Namen gestammelt, bevor sie …« Sie schluchzte. Tränen liefen über ihre Wangen. In ihrem grünen Kittel sah die große, kräftige Frau klein und verloren aus. »Martha hat Mutter nur durch Zufall zwischen den Hortensien gefunden. Ihr Kater war mal wieder ausgebüxt, und sie hat ihn in unserem Garten gesucht. Ma lag reglos im Gras und lallte unzusammenhängende Sätze. Gott sei Dank hat unsere Nachbarin sofort auf Schlaganfall getippt und den Krankenwagen gerufen.«
»Die Ärztin hat uns rausgeschickt«, erklärte Rose mit belegter Stimme. Zusammengesunken hockte die älteste der Brown-Töchter wie ein Häufchen Elend auf dem gelben Plastikstuhl. Ihr Kittel klaffte auf. Die elegante weiße Bluse, die sie darunter trug, war aus der dunkelblauen Anzughose gerutscht. Aus ihrem strengen Zopf hatte sich eine Strähne gelöst und hing in ihrem Gesicht. Ihre sonst so taffe große Schwester kämpfte mit den Tränen.
Lily löste sich aus Jasmins Umarmung, trat neben Rose. Der vertraute Duft ihres teuren Parfums tröstete sie. Behutsam streichelte sie ihr über den Kopf, wie früher ihre Ma, wenn eines der Mädchen traurig war. Lilys Augen brannten, aber sie weinte nicht. »Unsere Ma ist stark. Die wird das schaffen«, beteuerte sie. »Fünfundsechzig ist doch kein Alter.«
»Was, wenn nicht?«, stöhnte Jasmin und hockte sich vor ihre große Schwester.
»Daran darfst du gar nicht erst denken.« Lily wiederholte die Worte, die ihre Mutter zu ihnen gesagt hatte, als sich der Zustand des Vaters verschlechterte: »Wir müssen nur ganz fest daran glauben. Dann wird alles gut.«
Sie legte jeder eine Hand auf die Schulter, rang sich ein aufmunterndes Lächeln ab. Sie musste und wollte jetzt für ihre älteren Schwestern da sein. Längst war sie nicht mehr das Küken in der Familie, das von allen bemuttert wurde. Auf ihren Reisen hatte sie gelernt, sich allein durchs Leben zu boxen. Dieser Kampf hier war noch lange nicht verloren. Sie reckte entschlossen das Kinn und redete sich Mut zu. Doch ohne Vorwarnung krallte sich die Angst in ihren Nacken.
Lily stöhnte auf und krümmte sich vor Schmerz. »Wie lange dauert das denn noch da drin?« Sie starrte auf die weiße Tür, hinter der ihre Mutter lag. »Ich möchte endlich zu ihr. Vielleicht, wenn ich mit ihr rede …« Ihr Schutzwall aus Selbstbeherrschung brach endgültig zusammen. Wimmernd verbarg sie das Gesicht in den Händen und wandte sich ab. »Warum habe ich sie all die Jahre allein gelassen?«
»Hör auf, dir Vorwürfe zu machen, Kleine«, hörte sie Rose wie aus weiter Ferne sagen. Dann wurde sie von vier Armen umschlungen, und die Wärme ihrer Schwestern hüllte sie ein.
Jemand räusperte sich hinter ihnen. »Sie dürfen gleich wieder zu Ihrer Mutter«, sagte eine Frau.
Rasch befreite sich Lily aus der Umarmung und drehte sich um. Vor ihr stand eine etwa fünfzigjährige Ärztin und gähnte verstohlen. Tiefe Sorgenfalten zogen sich über ihre Stirn. Leise schloss sie die Tür des Krankenzimmers hinter sich, deutete auf eine Sitzgruppe am Ende des Flurs. »Nehmen wir einen Moment Platz. Ich möchte gern in Ruhe mit Ihnen reden.« Sie nickte Lily zu. »Ich bin Dr. Anna Guiton. Sie sind sicher die jüngste der Brown-Schwestern.«
Wie in Trance folgte ihr Lily an der Seite von Rose und Jasmin. Sie quetschte sich zwischen die beiden auf die Zweisitzer-Couch. Dr. Guiton nahm ihnen gegenüber in einem Sessel Platz. »Ich möchte nicht lange drum herumreden. Ihre Mutter hatte einen Schlaganfall. Wir nehmen an, dass sie schon eine ganze Zeit im Garten gelegen hat, bevor sie gefunden wurde. Dadurch kam es zu einer Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Sie hat das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt und wird künstlich beatmet.«
»Aber sie erholt sich doch wieder?« Lily sprang auf, tigerte herum. »Die richtige Medizin, ein paar Tage Ruhe – dann wird sie bestimmt wieder gesund.«
Die Ärztin trat neben sie, legte ihr eine Hand auf den Arm. »Wir tun unser Menschenmögliches. Das müssen Sie mir glauben. Noch lässt sich nicht absehen, welchen bleibenden Schaden der Sauerstoffmangel angerichtet hat. Lassen Sie uns diese Nacht abwarten.«
»Bitte sagen Sie uns die Wahrheit.« Rose erhob sich aus der Couch, stellte sich vor die Ärztin und schaute ihr fest in die Augen. »Müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen?«
Dr. Guiton nickte. »Es hat keinen Zweck, sich etwas vorzumachen. Selbst wenn Ihre Mutter diesen schweren Schlaganfall überlebt, wird sie ein Pflegefall sein.« Ihr linkes Augenlid zuckte, sie seufzte hörbar. »Manchmal hasse ich meinen Job«, murmelte sie.
»Ich möchte jetzt zu ihr«, hörte Lily sich sagen. »Begleitet ihr mich?« Sie warf ihren Schwestern einen flehenden Blick zu.
»Geh erst mal allein zu Ma«, entgegnete Rose. »Wir kommen gleich nach.«
Jasmin strich ihr über die Wange. »Rede mit ihr. Deine Stimme wird ihr guttun.«
»Ich komme mit«, sagte Dr. Guiton und eilte vorweg zum Krankenzimmer. Fast lautlos, als fürchtete sie, die Patientin zu wecken, öffnete sie die weiße Tür.
»Mein Gott!«, stöhnte Lily beim Anblick der blassen Gestalt in dem Bett. »Sie sieht so klein und zerbrechlich aus.« Die Frau, die dort an Maschinen und Monitoren hing, hatte so gar nichts mehr von der großen, starken Ida Brown, die sie kannte. »Kann sie mich hören?« Kraftlos zog sie sich einen Hocker an das Kopfende des Bettes und kauerte sich darauf. »Ma?« Lily umfasste die linke Hand der Mutter, die nicht verkabelt war. »Ich bin da. Deine Kleine ist wieder bei dir.« Bildete sie sich das nur ein, oder hatten sich die eiskalten Finger bewegt?
»Reden Sie nur weiter mit ihr. Der Klang einer vertrauten Stimme hat eine beruhigende Wirkung«, sagte die Ärztin. Sie kontrollierte die Werte auf dem Monitor. »Ich bin sofort wieder bei Ihnen«, flüsterte sie. »Soll ich Ihre Schwestern jetzt reinschicken?«
»Einen Moment noch.« Lily schmiegte ihre Wange an das kühle Gesicht der Kranken. »Bitte bleib bei mir, Mummy. Ich brauche dich«, flehte sie leise. Sie fuhr erschreckt zurück, als die Mutter die Augen aufschlug und sie anstarrte. Dann ertönte ein lang gezogener Piepton aus dem Monitor. »Nein, bitte nicht«, stöhnte Lily und warf sich über ihre Mutter.
Die Tür flog auf. Dr. Guiton und ein anderer Arzt stürzten ins Zimmer. »Warten Sie bitte draußen«, herrschte er sie an.
Zwei kräftige Hände packten sie an den Schultern und zogen sie von dem Bett. »Lassen Sie die Ärzte bitte ihre Arbeit erledigen«, sagte die Krankenschwester und drängte sie aus dem Zimmer.
Sofort waren Jasmin und Rose an ihrer Seite. Die Schwestern fassten sich bei den Händen. »Wir stehen das gemeinsam durch«, bekräftigte Lily, obwohl sie sich nie einsamer gefühlt hatte als in diesem Moment.
»Warum kommt denn keiner der Ärzte raus und redet mit uns?« Lily lief zur Tür des Krankenzimmers, drückte ein Ohr an das Holz und lauschte angespannt. »Nichts. Nicht das geringste Geräusch. Diese Stille bringt mich um.« Längst waren die anderen Besucher nach Hause gegangen. Hin und wieder huschte eine Nachtschwester wie ein Schatten an ihnen vorbei und verschwand in einem der Zimmer. Lily knetete ihre Hände, lief im Stechschritt zum Fenster und starrte in die einbrechende Dunkelheit. »Wo hast du Tim untergebracht?« Erst jetzt registrierte sie, dass Jasmin ihren sechsjährigen Sohn nicht bei sich hatte.
»Martha hat ihn zu sich genommen. Ich habe erst vorhin, als du bei Mutter warst, mit ihr telefoniert. Es geht ihm gut. Er schläft bereits«, versicherte ihre Schwester. Die Nachbarin und beste Freundin ihrer Ma war wie eine Tante für sie. Als Kinder hatten sich die Brown-Mädchen darum gedrängelt, bei Martha zu übernachten. Denn stets durfte nur eine am Wochenende in ihrem Himmelbett schlafen.
Rose stopfte die Bluse in die Hose und strich sich eine lose Haarsträhne hinter das Ohr. »Ich besorge uns Kaffee und etwas Süßes. Hilfst du mir tragen?«, wandte sie sich an Lily. »Du hältst hier die Stellung«, sagte sie zu Jasmin. Sie hatte jetzt wieder die Rolle der taffen großen Schwester übernommen. Nur das leichte Zittern in ihrer Stimme zeugte von ihrer inneren Anspannung. Mit durchgedrücktem Kreuz marschierte sie zum Getränkeautomaten am Ende des Flurs.
Kopfschüttelnd folgte Lily ihr. »Weißt du, dass du Ma immer ähnlicher wirst?« Sie schaute der um einen Kopf größeren Schwester ins Gesicht. »Sogar diese kleine Falte zwischen den Augenbrauen hast du von ihr.« Seufzend gestand sie: »Ich habe Jasmin und dich immer darum beneidet, dass ihr Mas Aussehen und ihre Stärke geerbt habt.« Sie selbst hatte die Statur und die krausen braunen Haare vom Vater.
»Glaub mir, Kleine. Das ist auch nicht immer das reinste Zuckerschlecken. Gerade wegen meiner vermeintlichen Stärke halsen mir die Bosse die meiste Arbeit auf.«
»Denk nicht, weil ich kleiner bin und mehr Hüftschwung habe, tragen mir die Kerle alles hinterher«, erwiderte Lily vehement. »Ich musste auf meinen Reisen oft genug die Ellbogen benutzen.« Sie griff nach dem Kaffeebecher, den Rose ihr reichte, und riss den Kopf herum, als am Ende des Flures eine Tür geöffnet wurde. Mit wehendem Kittel rauschte der Doktor aus dem Zimmer der Mutter und verschwand im Ärztezimmer. Kurz darauf verließ auch Dr. Guiton den Raum. Sie schloss die Tür hinter sich und trat auf Jasmin zu.
»Die Ärztin …«, stammelte Lily und warf den vollen Kaffeebecher in den Mülleimer. Fast gleichzeitig liefen Rose und sie los. Gerade noch rechtzeitig, um ihrer Schwester im wahrsten Sinne des Wortes unter die Arme zu greifen. Jasmin war kreidebleich. Sie zitterte am ganzen Körper. Lily und Rose nahmen sie in ihre Mitte, und jede legte ihr fürsorglich einen Arm um die Taille.
Mit trauriger Miene schaute Dr. Guiton von einer zur anderen. »Es tut mir aufrichtig leid.« Bedauernd schüttelte sie den Kopf. »Ein zweiter schwerer Schlaganfall. Wir haben wirklich alles versucht, aber das Herz Ihrer Mutter war zu schwach.«
»Das kann nicht sein«, presste Lily mühsam hervor. »Sie lag doch am Tropf. Ihre Werte wurden kontinuierlich überwacht.« Um nicht laut loszuschreien, biss sie sich auf die Unterlippe. Ihre Finger krallten sich an die grünen Kittel der Schwestern.
»Können wir zu ihr?«, fragte Rose mit belegter Stimme.
Die Ärztin nickte. »Moment bitte. Ich schaue nur rasch nach, ob Schwester Iris alles vorbereitet hat.« Sie öffnete die Tür einen Spaltbreit und linste ins Zimmer. Leise redete sie mit jemandem.
Selbst wenn sie geschrien hätte, wäre es Lily nicht möglich gewesen, ihre Worte zu verstehen, denn ihr Puls rauschte laut in den Ohren. Rose und Jasmin drängten sich enger an sie. Keine wagte sich zu bewegen.
Dann wurde die Tür weit geöffnet. Schwester Iris bedeutete ihnen, einzutreten. »Herzliches Beileid«, murmelte sie und stellte eine Reisetasche vor den Nachttisch. »Darin sind die persönlichen Sachen Ihrer Mutter. Nehmen Sie sie bitte mit. Und …« Sie senkte die Stimme. »Falls Sie später noch die Kraft dazu haben, schauen Sie doch bitte im Schwesternzimmer vorbei, damit wir die Formalitäten erledigen können. Ich bin noch eine Stunde im Haus. Gern können wir das aber auch morgen Vormittag erledigen.«
»Sie finden mich im Ärztezimmer«, erklärte Dr. Guiton und deutete den Flur hinunter. Wortlos reichte sie den Brown-Töchtern die Hand. »Ich wünsche Ihnen viel Kraft für das, was vor Ihnen liegt. Falls Sie unsicher über die einzuleitenden Schritte sind, steht Ihnen unser Sozialdienst gern mit Rat und Tat zur Seite.«
»Ich denke, das wird nicht nötig sein. Aber trotzdem vielen Dank für das Angebot«, erwiderte Rose mit versteinerter Miene. Sie war die Erste, die das Zimmer betrat und sich neben das Bett der Mutter stellte. Lily fasste Jasmin an der Hand, und gemeinsam traten sie an die andere Kopfseite.
Die Monitore waren verstummt. Auf dem Nachttisch stand ein Holzkreuz, vor dem eine Kerze brannte. Bleich und um Jahre gealtert lag ihre Ma mit gefalteten Händen vor ihnen.
»Jetzt ist sie wieder mit Dad vereint«, dachte Lily laut und klammerte sich an diese Vorstellung wie an einen Rettungsring. Mit aller Kraft versuchte sie, einen schützenden Wall aus Distanz um sich zu errichten, doch es gelang ihr nicht. Als Jasmin neben ihr wimmerte und Rose sich vor das Bett kniete, um zu beten, konnte sie nicht länger an sich halten. Stöhnend hockte sie sich vor das Totenbett, legte den Kopf auf die Brust der Mutter und ließ ihren Tränen freien Lauf.
»Wollen wir zusammen das Abschiedsgebet sprechen?«, fragte Rose leise.
Lily schluckte ihre Tränen hinunter und nickte. Jasmin faltete die Hände. Gemeinsam sprachen sie die Worte, die sie am Sterbebett des Vaters gehört hatten: »Gehe hin in Frieden, schlafe in Gottes Hand und bleibe in unseren Herzen lebendig für immer.« Mit zitternden Fingern zeichnete Lily ein Kreuz auf der Stirn der Mutter, küsste sie ein letztes Mal auf die Wange.
Reglos sah sie zu, wie ihre Schwestern der Verstorbenen über die Haare strichen und ihr etwas zuraunten.
»Bye, Ma«, murmelte Lily. »Ich hab dich lieb.« Fröstelnd zog sie den Kittel enger um ihren Körper, klammerte sich an die abgewetzte Ledertasche, die schon ihren Dad auf seinen Reisen begleitet hatte. Auf Zehenspitzen schlich sie aus dem Zimmer. Im Flur lehnte sie sich schwer atmend an die Wand und wartete, bis Rose und Jasmin ihr schweigend zum Schwesternzimmer folgten.
Eine halbe Stunde später verließen sie das Krankenhaus. Jasmin führte sie zu ihrem Polo am hintersten Ende des Parkplatzes. »Wo wollt ihr wohnen? Bei mir ist es zu eng, in der Pension sind alle Zimmer belegt. Ihr könntet in Mas Zimmer übernachten.«
»Wer kümmert sich jetzt um die Gäste?«, dachte Lily laut nach. Ihr graute es davor, in Mas Bett zu schlafen ohne das gleichförmige leise Schnarchen der Mutter neben sich. »Ist unser Mädchenzimmer etwa auch vermietet?«
Jasmin zuckte bedauernd mit den Schultern. »Ich fürchte, ja. Dort hat Ma ein Ehepaar mit einem Kind untergebracht. Bleibt Rose und dir wohl nichts anderes übrig, als euch das Ehebett zu teilen.« Sie schloss den Wagen auf und rutschte hinter das Lenkrad.
Da ihre große Schwester wie üblich den Beifahrersitz belegte, zwängte sich Lily samt Rucksack und Reisetasche auf die Rückbank. »Wehe, du sprichst wieder im Schlaf«, sagte sie und knuffte Rose von hinten in die Seite.
Die warf ihr einen strengen Blick zu und kramte ein Notebook aus ihrer voluminösen Handtasche, auf dem sie hektisch herumtippte. »Keine Ahnung, ich höre mich ja selbst nicht«, brummelte sie.
»Ma ist noch nicht unter der Erde, und du makelst schon wieder mit deinen Kunden«, fuhr Lily sie an. Doch als sie einen Blick auf das Geschriebene erhaschte, sagte sie zerknirscht: »Sorry, war nicht so gemeint.« Denn ihre Schwester schrieb an einer langen To-do-Liste.
»Schon okay. Bei dir liegen genau wie bei uns die Nerven blank, Kleine«, winkte Rose ab. »Wenn ich mich nicht mit irgendwas Nützlichem beschäftige, übermannt mich das heulende Elend«, erklärte sie. »Ich schlage vor, wir teilen die Arbeit auf.« Sie wartete, bis Jasmin den Wagen aus der engen Parkplatzausfahrt rangiert hatte. »Du rufst als Erstes deinen Chef an und nimmst dir die nächsten Tage frei«, teilte sie ihr mit. »Lily kümmert sich um die Gäste. Ich fahre gleich morgen früh zum Bestatter.« Sie schrieb erneut etwas in ihr Notebook. »Wenn ich zurückkomme, gehen wir gemeinsam die Buchungen durch und versuchen, die Gäste in anderen Hotels und Pensionen unterzubringen. Dann sehen wir weiter.« Tränen liefen über ihre Wangen.
»Danke, dass du das alles in die Hand nimmst«, murmelte Jasmin schniefend und bog auf die Küstenstraße nach St. Aubin ein. »Mir graut davor, morgen früh mit Tim zu sprechen. Wie soll ich ihm den Tod seiner Granny erklären? Er hängt doch so an ihr.«
»Wir reden gemeinsam mit ihm«, bot Lily sofort an und erntete ein dankbares Lächeln der Schwester. Sehnsüchtig schaute sie auf das Meer. In der Bucht spiegelte sich das Mondlicht auf dem Wasser. Die Uferpromenade war hell erleuchtet. Junge Leute schlenderten den Strand entlang Richtung St. Aubin. Jersey war ihre Heimat. Hier kannte sie jeden Küstenabschnitt, die besten Plätze für ein Picknick und zum Schwimmen. Mit dem klapprigen Damenrad ihrer Mutter war sie als Kind die begrünten Gassen, die Green Lanes, entlanggesaust. Am Strand von Plémont hatte sie unter dem Sternenhimmel getanzt. Doch seit dieser einen Nacht … Die schmerzliche Erinnerung verblasste angesichts der Trauer, die ihr den Atem verschlug. Ihre Augen brannten, doch sie konnte nicht weinen.
Der Polo passierte das Ortsschild von St. Aubin. Als sie am Anwesen der Familie Le Grande vorbeifuhren, hob sie die Reisetasche auf ihren Schoß und kauerte sich in die dunkelste Ecke des Wagens. Im Rückspiegel fing sie Jasmins Blick auf und seufzte laut. »Müssen wir die auch zur Beerdigung einladen?«
»Selbstverständlich«, murrte Rose. »Kathrin war eine Schulfreundin unserer Ma. Die wird es sich nicht nehmen lassen, ein paar Worte zum Abschied zu sprechen.«
»Simon lebt inzwischen auch wieder auf der Insel«, mischte sich Jasmin ein. »Er ist jetzt geschieden.«
Die Nachricht traf Lily wie ein Fausthieb in die Magengegend. Sie krümmte sich und stöhnte. »Warum musstest du mir das jetzt sagen? Wie weit muss ich denn diesmal fliehen, um dem arroganten Mistkerl nicht mehr zu begegnen?«
»Meinst du nicht, es wäre an der Zeit, endlich mit der Vergangenheit abzuschließen?« Rose langte nach hinten und tätschelte ihr den Arm. »Du bist jetzt eine erwachsene, selbstbewusste Frau. Simon ist ein erfolgreicher Anwalt. Sicher hat er längst bereut, was er dir damals angetan hat.«
»Ach ja?«, schnaubte Lily. »Und warum hat er sich dann nicht bei mir entschuldigt? Es wäre für ihn doch ein Leichtes gewesen, Ma nach meiner Handynummer zu fragen.«
»In der Bibliothek brennt noch Licht«, wunderte sich Lily, als der Wagen vor dem Haus hielt. »Ich hatte gehofft, dass die Gäste schon im Bett sind.«
»Da müssen wir jetzt durch.« Rose seufzte. »Je eher wir mit ihnen reden, desto besser.«
Die Haustür wurde geöffnet, und eine zierliche Frau schaute fragend in ihre Richtung.
»Gil ist da.« In Jasmins Stimme schwang Erleichterung mit. »Unsere ehemalige Grundschullehrerin hilft Ma regelmäßig in der Küche. Lieb von ihr, dass sie sich spontan um die Gäste gekümmert hat.« Geschickt parkte sie den Wagen nah genug an der Hausmauer, sodass auf der engen Straße andere Fahrzeuge passieren konnten. »Ich hole Tim von nebenan ab, dann fahren wir zurück nach Helier.«
»Du willst doch deinen Sohn nicht aus dem Tiefschlaf reißen?«, warf Lily besorgt ein. »Das Kind braucht seine Nachtruhe. So wie ich Martha kenne, hat sie dir vorsorglich einen Schlafplatz auf der Couch gerichtet.« Sie wartete, bis Rose ausgestiegen war und den Sitz nach vorn klappte, damit sie aus dem Wagen krabbeln konnte. Den Rucksack in der rechten, die Reisetasche mit Mutters Habseligkeiten in der linken Hand, stand sie unschlüssig unter der Laterne.
»Wahrscheinlich hast du recht. Ich bin auch viel zu müde, um heimzufahren.« Jasmin gähnte hinter vorgehaltener Hand. »Seid mir nicht böse, wenn ich nicht mehr mit reinkomme. Wir sehen uns morgen früh.« Sie reichte Rose ihren Trolley aus dem Kofferraum, schloss die Wagentür ab und trottete mit hängenden Schultern zum angrenzenden Grundstück. Kaum hatte sie an das schmale Fenster neben dem Eingang geklopft, ging das Licht im Hausflur an, und Martha öffnete die Tür. Sie nahm Jasmin in die Arme und schob sie in den Flur. Dann eilte sie zu Lily und Rose und drückte sie an sich.
»Ma ist tot«, stammelte Lily.
Tröstend strich Martha ihr über den Rücken. Die Nachbarin kämpfte mit den Tränen. »Das mag in dieser Situation banal klingen, aber es zerreißt mir das Herz, wenn ich daran denke, dass meine beste Freundin nie mehr auf eine Tasse Tee herüberkommt.« Ihre Augen schimmerten feucht, und sie schluckte schwer. »Ich bin für euch da, Mädchen. Morgen früh komme ich rüber, und wir besprechen alles.« Die große, hagere Frau strich beiden über den Kopf, als wären sie Kinder. Seufzend wandte sie sich ab und kehrte zurück in das gelbe Haus mit den roten Windladen.
»Danke«, murmelte Rose und sah ihr hinterher. Energisch klemmte sie sich ihre überdimensionale Handtasche unter den Arm und schaute ihre jüngere Schwester fragend an. »Hast du auch so einen Hunger wie ich?«
Lily schüttelte den Kopf. »Das nicht. Aber mir klebt vor Durst die Zunge am Gaumen. Ein Tee oder besser noch eine Tasse Kakao wäre nicht schlecht.«
»Steht alles in der Küche bereit«, meldete sich Gil in der offenen Haustür. »Kommt rein. Die Gäste sind längst schlafen gegangen.« Mit sorgenvoller Miene musterte sie die beiden. »Als ich den Krankenwagen vor eurem Haus gesehen habe, bin ich sofort rübergekommen und habe mich um die Gäste gekümmert.« Mit den Worten: »Das sind sicher die Sachen aus dem Krankenhaus«, nahm sie Lily die Reisetasche aus der Hand, durchquerte den Hausflur und eilte die Treppe hinauf. »Ich richte euch das Ehebett, dann verschwinde ich nach Hause. Mein Victor vermisst mich sicher schon.« Auf dem Treppenabsatz drehte sie sich um und warf den Schwestern einen strengen Blick zu. »Und morgen früh kümmere ich mich um das Frühstück für die Gäste. Ihr habt im Moment wirklich andere Probleme.« Energisch straffte sie die Schultern und drehte sich um. »Lasst den Kakao nicht kalt werden. Und versucht zu schlafen.«
»Vielen Dank, Gil«, riefen die Schwestern ihr nach und verzogen sich in die Küche im Untergeschoss, wo ein gedeckter Tisch auf sie wartete.
»Ich fasse es nicht. Mrs Delaney ist noch genauso resolut wie zu unserer Schulzeit.« Lily kauerte mit angezogenen Beinen auf der Eckbank und schlürfte Kakao. »Sie muss doch schon Ende sechzig sein.«
Rose bestrich sich ein Scone mit Clotted Cream. »Soviel ich weiß, feiert sie im Sommer ihren Siebzigsten.« Sie schob Lily die Etagere mit den Sandwiches und kleinen Gebäckstücken zu, die Gil ihnen vorsorglich hergerichtet hatte. »Iss wenigstens ein halbes Käsesandwich. Die nächsten Tage wirst du deine Kräfte brauchen.«
»Ja, Rosie«, brummelte Lily und brach sich ein Stück Brot ab. Lustlos kaute sie darauf herum. »Sag mir bitte, dass das alles nur ein böser Traum ist, aus dem wir gleich aufwachen. Jeden Moment taucht Ma in der Küchentür auf und mahnt uns, endlich ins Bett zu gehen.« Ihr Magen registrierte die Nahrung mit lautem Kollern. Hinter ihren Schläfen pochte es. Verwundert beobachtete sie, wie ihre große Schwester sich ein Sandwich nahm und herzhaft hineinbiss. »Das ändert sich wohl nie. Du warst schon früher eine Frustesserin«, sagte sie. »Bei mir macht der Magen dicht, sobald ich Stress habe.«
»Was soll ich machen? Meine Nerven gieren nach Kohlehydraten.« Rose wischte sich den Mund mit einer Papierserviette ab, entfernte einen Brotkrümel von ihrer Bluse. »Versuchen wir, wenigstens ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Das werden harte Tage. Ich darf gar nicht an die Trauerfeier denken. Sicher wird, wie bei Dads Beerdigung, der halbe Ort zum Friedhof kommen. All die Trauerreden und dann noch die Beileidsbekundungen.« Sie starrte vor sich auf den leeren Teller. »Ich wünschte, wir hätten die Beerdigung schon hinter uns.«
»Ja, ich auch.« Lily zuckte zusammen, als ihr Handy den Eingang einer WhatsApp meldete. Alles in Ordnung bei dir?, wollte Sam wissen. Sofort regte sich ihr Gewissen. »Ich schreibe meinem Chef nur schnell eine Nachricht und komme dann nach«, murmelte sie.
»Tu, was du nicht lassen kannst.« Rose schlurfte gähnend aus der Küche. »Ich schlafe am Fenster.«
»War ja klar«, winkte Lily ab und griff nach dem Smartphone. Ma ist tot. Ich weiß noch nicht, wann ich zurückkomme, melde mich bei dir, teilte sie Sam mit. Dann schnappte sie sich den Rucksack, den sie gedankenlos auf dem Herd abgestellt hatte, und trottete die zwei Stockwerke hinauf ins elterliche Schlafzimmer.
Mas Eau die Toilette, eine Mischung aus Lavendel und Orange, hing noch in der Luft. Ordentlich zusammengefaltet, wartete ihr Nachthemd auf dem Kleiderbutler nur darauf, dass sie hineinschlüpfte. Überwältigt von ihren Erinnerungen, ließ Lily den Rucksack fallen und stürzte nach nebenan ins Bad. Dort riss sie das Fenster auf und sog begierig die kühle Nachtluft ein, bis sie sich beruhigt hatte. Ihr Blick fiel auf den kleinen Porzellanengel, der sie von der Ablage unter dem Spiegel schelmisch angrinste. Lily hatte den frechen Kerl auf einem Flohmarkt in Lissabon erstanden und Ma zum Geburtstag geschickt. Hätte sie damals geahnt, wie wenig Zeit der Mutter bliebe, wäre sie auf der Stelle nach Jersey zurückgekehrt. Hätte, wäre …! Zu spät! Stöhnend raufte sie sich die Haare.
»Wie lange brauchst du denn noch?«, meldete sich Rose aus dem Schlafzimmer. »Ich möchte endlich das Licht ausmachen.«
Lily riss sich vom tröstenden Anblick des kleinen Engels los und tapste zu ihr. Mit angestellten Füßen kauerte ihre Schwester am Kopfende des französischen Bettes und schnäuzte sich geräuschvoll die Nase. Ihre Augen schimmerten feucht. Eine schwarze Spur von Wimperntusche zog sich über ihre Wangen. »Zum Duschen und Abschminken bin ich zu müde«, erklärte sie und rollte sich auf den Bauch.
»Dito«, murmelte Lily und knipste die Deckenleuchte aus. Im Halbdunkel streifte sie die Sneakers von den Füßen, schlüpfte aus Jeans und T-Shirt. Eine Zeit lang stand sie reglos vor dem Fenster und linste durch den offenen Spalt des Vorhanges auf die Bucht von St. Aubin. Es war Ebbe. Die Boote und Jachten lagen auf Schlick im Hafen. Dort, wo sich bei Flut die Wellen an der Kaimauer brachen, breitete sich jetzt ein mehr als hundert Meter tiefer Strand aus. Der Fußweg zur vorgelagerten Festungsinsel lag trocken.
Als Teenager waren sie und ihre Freundinnen oft bei Ebbe hinübergelaufen, um hinter den schützenden Festungsmauern unbemerkt zu rauchen und Alkohol zu trinken. Mehr als einmal waren sie von der einbrechenden Flut überrascht worden und mussten mit einem der Boote, die für solche Fälle immer dort vertäut waren, zurückrudern.
Seufzend schloss sie die Übergardine, schlüpfte in Hemd und Höschen unter die Bettdecke und legte sich neben ihre Schwester. »Schläfst du schon?«, fragte sie leise.
»Kann nicht«, brummte Rose und drehte sich auf die Seite. »Sobald ich die Augen schließe, sehe ich Mom vor mir. Wie sie mit den Schläuchen und Kabeln im Bett lag.«
Lily rückte näher an sie heran und kraulte ihr den Nacken. »Lass uns so lange über alte Zeiten reden, bis wir einschlafen. Wie früher«, schlug sie vor. »Erinnerst du dich noch an Tomas?«
»Du meinst doch nicht etwa den pickligen Jungen, der jeden Morgen vor dem Haus auf dich wartete, um dich zur Schule zu begleiten?« Rose setzte sich im Bett auf und löste ihren Zopf. »Der handelt heute mit Luxuswagen. Bentleys und Rolls Royce, wie ich gehört habe.« Sie lachte bitter. »Ob er immer noch so mollig ist?«
Kichernd stemmte sich Lily auf die Unterarme und blinzelte sie an. »Mir läuft heute noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke, wie er mir auf dem Schulweg einen feuchten Schmatzer auf die Wange verpasst hat. Igitt!«
»Da war Erik einfallsreicher«, sagte Rose. »Mit zehn hat er mir aus Alufolie einen Ring gebastelt und in der großen Pause an den Finger gesteckt.« Seufzend sank sie wieder in die Kissen. »Leider war er so gar nicht mein Typ. Viel zu lang und dünn.« Ein lauter Schluchzer drang aus ihrer Kehle. Zitternd zog sie die geblümte Bettdecke bis unter das Kinn und kuschelte sich an Lily. »Wie sollen wir ohne Ma nur auskommen? Sie war unser sicherer Hafen.«
»Was wird aus dem Kapitänshaus? Ich habe nicht vor, wieder nach Jersey zu ziehen. Denkst du, Jasmin wird das Gästehaus weiterführen?« Lily schaute ihre Schwester nachdenklich an. Doch die war, anscheinend vor Erschöpfung, schon eingeschlafen. Sie lag mit offenem Mund auf dem Rücken und schnarchte leise. Hin und wieder zuckten ihre Mundwinkel, und sie stöhnte.
»Gute Nacht, Große«, flüsterte Lily und hauchte einen Kuss auf ihre Wange. »Ich bin froh, dass du da bist.« Sie rollte sich auf die Seite, zog die Knie zum Bauch und knuddelte das Kissen unter den Kopf. Mit dem festen Vorsatz, wenigstens zwei, drei Stunden zu schlafen, schloss sie die Augen und versuchte, sich an die schönsten Stationen ihrer Reisen zu erinnern. Doch vor das Bild des Eiffelturms schob sich das Krankenzimmer ihrer Mutter. Und statt der meergrünen Augen des lebenslustigen Pierre aus Bordeaux sah sie das bleiche Gesicht ihrer Ma, hörte ihren letzten Seufzer. Wimmernd presste sie eine Faust an den Mund und biss sich auf die Knöchel. Es schmerzte, doch nicht so sehr wie der Verlust, den sie erlitten hatte.
Vor dem Fenster kreischte eine Möwe. In der Etage unter ihr knackten die alten Dielen. Kurz darauf rauschte die Toilettenspülung. Totenstille umgab sie, und endlich übermannte sie die Müdigkeit.
Im Schlaf schreckte sie auf, als jemand über ihre Wange strich. »Ma?«, wisperte sie heiser und riss die Augen auf. Doch es war nur ihre Schwester, die im Traum wild gestikulierte und laut stöhnte. Vorsichtig rutschte Lily aus dem Bett und schlich zum durchgesessenen Ohrensessel am Fenster. Dort hatte ihr Vater abends gern gesessen und sehnsuchtsvoll auf das Meer geschaut. Sie hüllte sich in die karierte Wolldecke, die er stets über seine Beine gelegt hatte, schnupperte an der kratzigen Wolle. Der Gedanke, dass ihre Eltern jetzt wieder vereint waren, tröstete sie. Doch die Angst vor dem, was auf sie zukam, hüllte sie in eine dunkle Wolke.
Kapitel 3
Jeans und T-Shirt waren ein No-Go auf einer Trauerfeier. Das sah sie ein. Zumal sogar der Bailiff, der oberste Richter und Präsident von Jersey, sein Kommen angekündigt hatte. Deshalb hatten Jasmin und Rose sie am Vortag überredet, sich für die Beerdigung neu einzukleiden. Lily schlich um das schwarze Kleid, das wie ein Fremdkörper im lichtdurchfluteten Schlafzimmer ihrer Eltern wirkte. Nur widerwillig hatte sie nachgegeben und das schlichte Etuikleid und ein Paar flache Pumps gekauft. Dass Rose, großzügig wie immer, die Rechnung für sie bezahlt hatte, machte die Sache nicht leichter. »Ich will mich aber nicht verkleiden«, hatte sie gekontert. »Und mich schon gar nicht von dir aushalten lassen.« Doch dann war ihr eingefallen, wie viel Wert ihre Mutter auf angemessene Kleidung gelegt hatte. Schweren Herzens hatte sie nachgegeben.
»Du bist ja noch in Unterwäsche.« Jasmin stand in der offenen Schlafzimmertür und schaute sie vorwurfsvoll an. Sie trug einen schlichten schwarzen Hosenanzug und eine graue Bluse. »Wir wollen in spätestens einer Stunde nach St. Brélade.« Schon eilte sie wieder die Treppe hinunter.
»Keine Sorge, das schaffe ich locker«, rief Lily ihr hinterher. Mit spitzen Fingern nahm sie das Kleid vom Bügel und streifte es über. Beim Blick in den Ankleidespiegel streckte sie sich die Zunge raus.