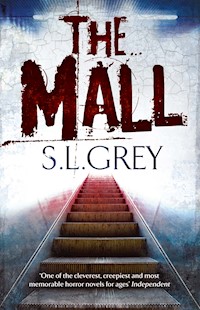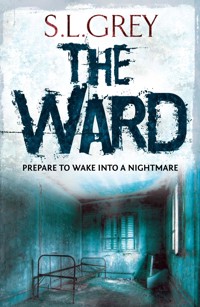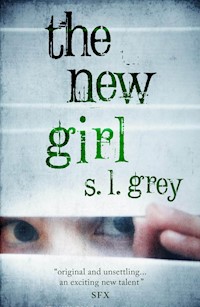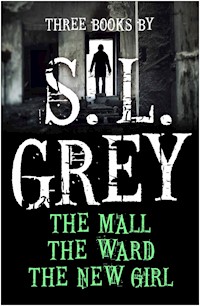12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Ehe von Mark und Steph bröckelt. Um wieder Romantik in ihr Leben zu bringen, machen sie einen Häusertausch per Internet. Steph findet eine Unterkunft in Paris, die auf den Fotos traumhaft aussieht. Doch ihr Apartment entpuppt sich als böse Überraschung. Die Zimmer scheinen seit Jahren nicht mehr bewohnt zu sein, schwere Jalousien lassen kaum Tageslicht herein. Sie beschließen zu bleiben. Doch dann entdeckt Mark mehrere Plastikeimer – gefüllt mit Frauenhaar. Ihm wird klar, dass sie verschwinden müssen. Sofort. Doch der Albtraum hat bereits begonnen … und wird sie nicht mehr loslassen … nie mehr!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Die Ehe von Mark und Steph bröckelt. Um wieder Romantik in ihr Leben zu bringen, machen sie einen Häusertausch per Internet. Steph findet eine Unterkunft in Paris, die auf den Fotos traumhaft aussieht. Doch ihr Apartment entpuppt sich als böse Überraschung. Die Zimmer scheinen seit Jahren nicht mehr bewohnt zu sein, schwere Jalousien lassen kaum Tageslicht herein. Sie beschließen zu bleiben. Doch dann entdeckt Mark mehrere Plastikeimer – gefüllt mit Frauenhaar. Ihm wird klar, dass sie verschwinden müssen. Sofort. Doch der Albtraum hat bereits begonnen … und wird sie nicht mehr loslassen … nie mehr! …
Die Autoren
Hinter S.L. Grey verbergen sich die Bestsellerautoren Sarah Lotz und Louis Greenberg, die ihr Debüt mit dem Bestseller Under Ground vorlegten. Beide Autoren leben in Südafrika, Sarah in Capetown, Louis in Johannesburg. Als S.L. Grey beschäftigen sie sich mit der Frage, was passiert, wenn der Mensch in Extremsituationen geworfen wird.
S.L. GREY
DAS APARTMENT
Thriller
Aus dem Englischen von Jan Schönherr
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe THE APARTMENT erschien 2016 bei Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, London
Vollständige deutsche Erstausgabe 11/2017Copyright © 2016 by S.L. GreyCopyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Lars ZwickiesUmschlaggestaltung: © Nele Schüz Design, München, unter Verwendung von shutterstock/SeDmiSatz: Fotosatz Amann, MemmingenISBN: 978-3-641-20218-7V001www.heyne.de
1MARK
Der Wein ist mir zu Kopf gestiegen, wie mir auffällt, als ich Nachschub aus der Küche hole. Ich bin angenehm beschwipst, fühle mich wattig und warm, vergesslich. Carla schmettert ihr Carla-Lachen – dieses herzhaft hexenhafte Gackern, vor dem selbst Geister Reißaus nähmen. Irgendwo unter diesen Eselsschreien lacht leise und zaghaft auch Steph – gefühlt zum ersten Mal seit Wochen. Seit damals.
Ohne zu viel an die geronnene Vergangenheit in der Speisekammer zu denken, schnappe ich mir eine Tüte Chips und trete schnell zurück in die Küche. Carlas Verabredung hat teuren Rotwein mitgebracht und mir die Flasche mit dem Hinweis in die Hand gedrückt, dass wir ihn für eine besondere Gelegenheit aufsparen sollten. Allerdings erfüllt das Zeug bestimmt auch heute seinen Zweck. Ich reiße die Chipstüte auf, stopfe mir eine Handvoll in den Mund und will gerade den Wein von der Küchentheke nehmen, als der Bewegungsmelder das neue Flutlicht im Garten aktiviert. Vor Schreck greife ich daneben und werfe die Flasche um, sodass sie in einen Haufen schmutziges Geschirr scheppert und ein paar Messer und Gabeln klirrend von einem Tellerstapel rutschen.
Einen Augenblick lang ist mir der Lärm zu viel; Scherben und Besteck rasseln mir auf die Füße und auf den Boden. Trotzdem kann ich die Augen nicht vom Fenster lassen, starre gebannt hinaus. Als könnte ein Flutlicht die Monster fernhalten.
Es dauert aber doch etwas länger als einen Augenblick, denn als das Licht endlich wieder erlischt, ohne etwas gezeigt zu haben, herrscht Stille um mich. Dann höre ich, wie jemand sich hinter mir bewegt.
»Mark?« Stephs Stimme. »Alles in Ordnung, Schatz?«
Ich reiße mich zusammen. »Ja. Entschuldige. Hab nur … was fallen lassen.«
Steph tappt auf mich zu, bewegt sich barfuß durch die Scherben.
»Nicht«, sage ich. »Du schneidest dich.«
Sie hört nicht auf mich, kommt auf Zehenspitzen näher und blickt hinaus in den dunklen Garten. »Hast du was gesehen?«, fragt sie leise. »Jemanden?«
»Bestimmt nur ’ne Katze.«
»Und es ist echt alles in Ordnung?«, fragt sie und drückt meinen Arm.
»Alles gut«, versichere ich. Doch mein Benehmen ist mir peinlich, also nehme ich den Wein und führe Steph durch die Scherben zurück ins Wohnzimmer. Als wäre sie auf meine Führung angewiesen. In Wahrheit fühle ich mich selbst in diesem Augenblick, neben dieser starken, jungen Frau, blind und verletzlich. »Trinken wir den Wein, solange wir noch können.«
Steph sieht mich von der Seite an. »Klingt ja bedrohlich.«
»Ich meinte … solange wir ihn noch wertschätzen können.«
»Hm ja, vielleicht spart ihr ihn wirklich besser auf.« Den Namen von Carlas neuestem »Freund«, der gerade sein Handy in die Dockingstation steckt und irgendeinen langsamen, zynischen Song startet, habe ich vergessen. »Sonst entgeht euch der berühmte schokoladige Abgang.«
»Berühmt?«, fragt Carla vom Tisch aus, wo sie das Malheur in der Küche geflissentlich überhört hat. »Wohl eher berüchtigt. Mit diesem Duiwelsfontein wickelt man doch bloß dilettantische Hipster um den Finger. Nicht böse gemeint, Damon, Schätzchen.«
»Weiß ich doch, Carla, Mäuschen.«
Ich setze mich, sehe zu, wie Damon zum Tisch zurückschlurft, und frage mich, was zwischen Carla und ihm eigentlich läuft. Weiß er, dass er nur das neueste Objekt in ihrer Sammlung jugendlicher Liebhaber ist? Was findet sie bloß an ihm? Und er an ihr? Er ist bestimmt fünfundzwanzig Jahre jünger als sie. Andererseits bin ich ja selbst dreiundzwanzig Jahre älter als Steph. Das vergesse ich andauernd. Aber ich fühle mich eben auch nicht wie siebenundvierzig, nicht wie ein Mann mittleren Alters. Ich darf mir gar nicht vorstellen, wie ich für sie aussehen muss: dickbäuchig, schlaff, erbärmlich, kaputt, gescheitert, erledigt. Sonderbarer Fetisch, den sie da hat.
Steph steht hinter mir und massiert meine Schultern. Jetzt beugt sie sich über mich, und ihr nach Kräutershampoo und Gewürzen duftendes Haar fällt mir ins Gesicht und erlöst mich von diesen Gedanken.
»Ich sehe mal nach Hayden«, sagt sie.
»Die schläft bestimmt selig. Das Babyfon ist ja an. Hätten wir doch gehört, wenn was wäre.«
»Will nur auf Nummer sicher gehen.«
»Ja, okay. Danke.«
»Wenn Carlas Lachen sie nicht geweckt hat, kriegt sie gar nichts wach«, scherzt Damon. Als würde er sie kennen. Carla verdreht lächelnd die Augen. Ich kapiere es einfach nicht.
Ich nehme einen kräftigen Schluck Wein – von Schokolade keine Spur – und lausche der einschläfernden Musik, konzentriere mich darauf, mir den leichten Schwips von vorhin wieder anzutrinken.
»Wie geht’s dir eigentlich?«, fragt Carla. »Ganz ehrlich, meine ich.«
Seufzend zucke ich die Achseln und schiele zu Damon.
»Keine Sorge, ich weiß Bescheid«, sagt er. »Tut mir echt leid. Meinem Bruder ist das auch passiert.«
Steph kommt zurück, lässt mich mit einem Blick wissen, dass bei Hayden alles in Ordnung ist. »Lass gut sein, Damon«, mahnt Carla, doch Damon quasselt unbeirrt weiter.
»Dieses Land geht vor die Hunde, echt. Ist ja nicht überall so. Wenn woanders einer was klaut, meint er deshalb nicht, er muss dich auch noch foltern und …«
»Du«, unterbreche ich. »Ich will darüber wirklich nicht reden.«
»Aber du musst ihm auch nicht mir zuliebe den Mund verbieten, Carla«, fügt Steph hinzu. »Ich bin schon ein großes Mädchen.«
»Ja«, pflichte ich bei. »Steph geht richtig toll mit der Sache um.« Besser als ich. Doch statt das zuzugeben, lege ich Steph unterm Tisch nur meine Hand auf den Oberschenkel. Sie umfasst meine Finger.
»Sorry«, schmollt Damon. »Geht mich nichts an.«
»Schon okay. Es ist bloß … Na, du weißt schon.«
»Ich meinte ja nur, dass ich euch verstehe«, sagt er. »Diese Scheiße passiert hier so oft. Ist einfach scheiße.«
»Ja. Ja, das stimmt.«
»Damon, Schätzchen, vielleicht hältst du freundlicherweise mal deinen mitfühlenden Schnabel, während mein Freund redet.«
»Ich geh mal vor die Tür, eine rauchen. Da kann ich auch besser den Mund halten.« Er steht auf und geht zur Haustür. Ich unterdrücke den Drang, ihn aufzuhalten, dafür zu sorgen, dass wir alle sicher hier drin eingeschlossen bleiben. Von ihrem Platz am Kopfende des Tisches aus stupst Carla mir die nackten Zehen ans Schienbein und streicht hinab zum Knöchel. Keine Ahnung, was das soll. Ich gehe mal davon aus, dass sie damit eine Umarmung oder ein Schultertätscheln ersetzen möchte, ohne extra aufzustehen. Davon gehe ich aus, weil zwischen Carla und mir körperlich schon ewig nichts mehr läuft. Steph hat nichts bemerkt.
»Macht ihm das nichts aus, wenn du so mit ihm redest?«, frage ich Carla.
Sie zuckt die Achseln. »Er wird’s überleben. Höchste Zeit, dass er lernt, sich zu benehmen.«
»Ich verstehe dich nicht«, erwidere ich.
Sie ignoriert das. »Gehst du wenigstens zu einem Therapeuten?«
»Ich?«, frage ich.
»Ihr beide, eigentlich. Ihr drei. So ein Trauma nagt auch an Kindern. Hayden könnte zur Kunsttherapie gehen.«
»Das könnten wir uns nicht leisten«, erwidert Steph, »selbst wenn wir’s für sinnvoll hielten.«
»Aber die Polizei hat euch doch sicher Traumatherapie angeboten, oder?«
»Ja«, sage ich. Das hat sie in der Tat. Am Tag nach dem Überfall schlüpften wir in die billigen neuen Klamotten, die ich im Supermarkt besorgt hatte, und fuhren zum Polizeirevier von Woodstock. Die Cops waren überraschend freundlich und mitfühlend, obwohl wir inmitten des erbärmlichen Haufens aus Männern mit eingeschlagenen Schädeln und muskulösen Frauen im Empfangsbereich wie Außerirdische wirken mussten. Durch einen langen Flur führte man uns zu einem kleinen Büro. Durchs Fenster sah ich die Zellen auf der anderen Seite des Hofs: lamellierte Fenster, behängt mit zerrissenen Laken, bröckelnder und rissiger Putz, so als kochte das Gebäude selbst über vor Bosheit und löste sich von innen her in giftigen Schlamm auf. Der Trauma-Therapeut war ein netter Kerl und mit Herzblut bei der Sache, einer dieser Menschen, die sich vom tagtäglichen Ansturm der grausigen Realität nicht unterkriegen lassen. Er ließ uns alle Zeit der Welt. Hayden stapelte auf dem Teppich Bauklötze, und ich wünschte, ich hätte ein Desinfektionsmittel für ihre Hände mitgebracht. Während der Berater Steph bei einer meditativen Visualisierungsübung anleitete, starrte ich in die schmuddelige Duschkabine und auf die Plastikbox voll Spielzeug und Puppen, die für den nächsten Fall bereitlag. Von dem Anblick brach mir der kalte Schweiß aus, und doch konnte ich die Augen nicht davon lassen. »Ich hatte den Eindruck, dass die sich mit schlimmeren Traumata herumzuschlagen haben als mit denen einer Mittelschichtsfamilie, bei der eingebrochen wurde.«
»Mein Gott, Mark. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen wichtiger nehmen.«
»Mich? Wichtiger? Wieso?«
Steph schweigt, dreht nervös den Stiel ihres Glases zwischen den Fingern. Da beugt sich Carla über mich hinweg, wobei sie angeberisch ihren Schmuck klimpern lässt, und legt Steph die Hand auf den Arm. »Ihr solltet mal raus aus allem. Euch erholen. Das würde euch guttun, garantiert.«
»Und wohin?«, fragt Steph.
»Irgendwas Exotisches. Bali, Thailand. Oder was Romantisches. Barcelona, Ägäis … Paris.«
»Oooh, Paris!«, quietscht Steph. »Mensch, Mark, wäre das nicht großartig?«
»Mit einer Zweijährigen? Ja, wahnsinnig romantisch.«
Carla blickt nachdenklich auf den Tisch. »Ich könnte … Ach nein, besser nicht. Ich sollte dem Kind nicht meinen inexistenten Mutterinstinkt aufzwingen.«
»Wir könnten uns das sowieso nicht leisten. Herrje, wir haben ja nicht mal das Geld, um Stephs Auto reparieren zu lassen.«
Steph seufzt. »Ja, hast recht«, sagt sie, und als das kurz aufgeflackerte Leuchten in ihren Augen erlischt, stirbt auch ein kleines Stück von mir. Steph sollte bekommen, was immer sie sich wünscht. Sie verdient etwas Besseres … etwas Besseres als mich, als das, was ich ihr bieten kann. Was im Grunde genommen gar nichts ist. Alles, was ich irgendwann mal hatte, ist längst ausgegeben.
»Wir lassen uns was einfallen«, sagt Carla. »Das muss sein. Ihr beide braucht …«
Als das Kreischen ertönt, bin ich schon halb durchs Zimmer, ehe ich überhaupt begreife, was ich höre. Die Alarmanlage eines Autos, draußen. Bloß eine Alarmanlage, aber meine Muskeln haben sich am Hirn vorbei kurzgeschlossen, und bevor ich mich beruhigen kann, habe ich bereits die Haustür aufgerissen und spähe mit geweiteten Pupillen und gespitzten Ohren ins Halbdunkel. Damons Zigarettenrauch holt mich wieder auf den Boden zurück.
»Junge! Alles okay, Mark?«
»Ich … ja. Wollte nur schauen, wegen des Alarms.« Der ist inzwischen verstummt – der Typ aus Nummer siebzehn lässt gerade seinen Wagen an und fährt los. Ich rufe Steph was Beruhigendes zu.
»Nerven liegen blank, hm?«, sagt Damon und hält mir seine Zigaretten hin.
Ich nehme eine, obwohl ich weiß, dass die mich nur noch nervöser machen wird. Eigentlich rauche ich nicht, davon wird mir schlecht. Aber vielleicht hilft die Übelkeit mir ja, an was anderes zu denken als an diese verdammten unsichtbaren Monster.
Damon gibt mir Feuer, ich ziehe und blase den Rauch in den Wind, spüre die heiße Brise vom Tafelberg in den Haaren. »Hast du so was auch mal erlebt?«
»Nein, zum Glück nicht, aber ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Ist so vielen passiert, die ich kenne. Macht einen fertig, was?«
Ich nicke, atme langsam aus. Der Therapeut im Polizeirevier riet uns, aufgestaute negative Energie durch heilsame Frischluft zu ersetzen, die giftige Angst einfach wegzuatmen. Aber ich fürchte mich davor, meine Angst aufzugeben – ich brauche sie: Sie hält mich wachsam.
Als wir unsere Kippen neben der toten Topfpflanze ausgedrückt haben und wieder reingehen, sagt Steph gerade: »Ich wollte schon immer mal ins Musée d’Orsay, aber das ist eben zu teuer. Kann man nichts machen.«
»Was ist zu teuer?«, fragt Damon, der den Anfang des Gesprächs nicht mitbekommen hat.
»Carla findet, wir sollten verreisen, um unser Trauma zu heilen«, erkläre ich. »Aber wir haben kein Geld.«
»Hm, habt ihr schon mal an einen Wohnungstausch gedacht?«, fragt er. »Letztes Jahr hab ich das mit ein paar Freunden gemacht. Da gibt’s ’ne Website. Du wohnst in der Wohnung anderer Leute, und die wohnen so lange in deiner. Wir waren in einem total abgefahrenen Haus in Boston, und die Besitzer waren hier – fanden’s super. So zahlt man keinen Cent für die Unterkunft. Billig essen kann man auch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, also ist es eigentlich umsonst.«
»Aber man hat fremde Leute im Haus«, sage ich. »Was, wenn die alles verwüsten? Oder klauen?«
»Die Mitglieder sind registriert, und es gibt Bewertungen und Kommentare. Das amerikanische Paar, das hierherkam, hatte schon achtmal getauscht, und alle vorigen Tauschpartner hatten sie bewertet. So sieht man, wie sie bei anderen waren, und weiß, ob man ihnen trauen kann.«
Steph lächelt. »Hmm, klingt interessant. Findest du nicht, Mark?« Der Typ macht ihr zu große Hoffnungen. Das Netteste, was ich tun kann, ist, sie im Keim zu ersticken.
»Ja, keinen Cent zahlt man«, sage ich. »Bloß für Kleinigkeiten wie Flugtickets, Visa, Transport- und Einreisegebühren, überteuerten Kaffee und für Gott weiß was in Paris noch alles anfällt.« Betroffen sehe ich zu, wie die Euphorie aus Stephs Gesicht weicht. Jungen Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, das habe ich drauf. Im College mache ich das jeden Tag. Eine meiner wenigen verwertbaren Fähigkeiten. Steph nickt ernüchtert, und ich wünschte, ich hätte den Mund gehalten. Immer unterschätze ich die Macht meines depressiven Zynismus, vergesse, dass sie noch jung ist, noch was vom Leben will.
»Aber interessant klingt’s schon«, füge ich halbherzig hinzu. »Jedenfalls machbarer als alles andere.« Ich will sie wieder lächeln sehen, doch es ist zu spät.
In der Nacht wache ich auf, stehe mit heftig schlagendem Herzen und zitternden Beinen im Flur, das Handy fest umklammert. Auf der roten Anzeige des Weckers steht 2:18. Der Deutsche Schäferhund von nebenan bellt, und ich könnte schwören, ich habe ein Poltern – noch eins? – auf unserer Seite der Mauer zwischen den Grundstücken gehört.
Ich sollte wohl aus dem Fenster im Arbeitszimmer schauen, ob in der Gasse etwas – jemand? – ist, aber die Alarmanlage ist scharf, und das Zimmer wird von einem passiven Transponder überwacht. Abstellen will ich die Anlage nicht – genau darauf warten die womöglich nur –, also bleibt mir bloß, mitten im Haus auf dem Flur zu stehen, mich ganz langsam im Kreis zu drehen, damit Hayden nicht von den knarzenden Dielen wach wird, und in die Dunkelheit zu lauschen und zu spähen, als hätte ich Ultraschallohren, als wäre ich Superman mit Röntgenblick. Bin ich aber nicht; ich bin unbeweglich und machtlos.
Wenn da draußen jemand wäre, würde er die Lichtschranken auslösen, sage ich mir. Kann gar nichts passieren, sage ich mir.
Der Hund beruhigt sich, alles andere bleibt still, niemand löst die Lichtschranken aus. Ich gehe zurück ins Bett. Steph liegt auf dem Rücken und blickt resigniert zur Decke.
Ich bleibe auf dem Teppich vor dem Bett stehen. »Ich sollte den Bewegungsmelder im Arbeitszimmer abschalten, aber durch das Bleiglasfenster kämen die leicht rein.«
»Ja, lass ihn besser an.«
»Dann kann ich aber nicht rausschauen.«
»An den Lichtschranken kommt doch eh keiner vorbei.«
»Hast recht.« Ich lege mein Handy wieder auf den Nachttisch. »Toll, unsere nächtlichen Unterhaltungen. Unser Bettgeflüster.« Sie schweigt, lacht auch nicht. Warum sollte sie auch? Ich betrachte die roten Ziffern auf dem Wecker. »Versuch zu schlafen. Ist noch zu früh, um aufzugeben.«
»Und du?«
Ich sage nicht, dass ich gar nicht erst hätte einschlafen sollen, dass einer von uns immer wach bleiben sollte, falls sie wiederkommen. Das würde auch nichts helfen. »Muss noch ein bisschen runterkommen, bin gleich bei dir.«
»Manchmal hasse ich dieses Haus.«
»Ich weiß.«
»Könntest du über Paris nicht wenigstens mal nachdenken? Meinst du nicht, das wäre schön?«
»Ich weiß einfach nicht, wie das gehen soll. Solchen Luxus können wir uns nicht leisten.«
Steph setzt sich auf und seufzt. »Wenn du mich fragst, ist das kein Luxus, sondern notwendig. Ich glaube, es würde uns guttun. Dir ganz besonders.«
»Mir?«
»Ja, dir.« Jetzt lacht sie doch, wenn auch trocken. »Ich glaube, wenn du mal rauskämst, sähe die Welt für dich vielleicht endlich anders aus. Vielleicht würdest du dann etwas ruhiger. Wer weiß, vielleicht sogar glücklich.«
Es fühlt sich falsch an, das auszudiskutieren, während ich vor ihr stehe, als hätte ich alleine hier das Sagen. Also setze ich mich ans Fußende, von ihr abgewandt, sehe nur einen Teil von ihr im Spiegel auf der Kommode. »Selbst wenn wir’s uns leisten könnten, würde ich das nicht machen wollen, weil du denkst, ich hätte es nötig. Ich will kein Pflegefall sein, der dich zwingt, Geld auszugeben, das wir nicht haben. Ich breche schon nicht zusammen. Mir geht’s gut. Ich komm schon klar.«
Steph macht sich gar nicht erst die Mühe, meiner Selbstdiagnose zu widersprechen; sie kennt mich zu gut. »Ich hab viel darüber nachgedacht, und ich denke, Hayden ist alt genug. Sie schläft schon viel besser. Carla meint, man kann da Kinderwagen leihen. Stell dir nur mal vor, wir könnten durch die Parks spazieren wie eine französische Familie.«
Das würde niemals funktionieren, nie im Leben, aber im Spiegel sehe ich ihr verträumtes Lächeln und will ihre Seifenblase nicht schon wieder platzen lassen. Aus der Reise wird nichts, das ist bloß Träumerei. Allerdings eine, die sie wieder lächeln lässt, also gönne ich sie ihr.
2STEPH
Ich hätte mehr Stunk machen sollen, als Mark mir mitteilte, dass Carla sich an jenem Abend selbst zum Essen eingeladen hatte. Er bot an, ihr abzusagen – er wusste ja, dass ich seit dem Einbruch höchstens meine Eltern ertrug –, aber ich wollte es lieber hinter mich bringen. Ohnehin war es langsam Zeit, dass ich mich der Außenwelt wieder stellte. Meine Freunde wollten zwar für mich da sein, aber ich hatte die Nase voll von Sprüchen wie »Zumindest hat Hayden geschlafen und du wurdest nicht vergewaltigt« und ähnlich bescheuerten Plattitüden. Mark flehte mich an, nicht zu großen Aufwand zu treiben, doch wie üblich stand ich wieder mal viel zu lange in der Küche, schrubbte das Haus wie eine neurotische Hausfrau aus den Fünfzigern, und warf Geld, das wir nicht hatten, für teure Zutaten aus dem Fenster. Wie immer, wenn Carla zu Besuch kam.
Carla schüchterte mich ein. So, jetzt ist es raus. Sie war eine bekannte Dichterin und Wissenschaftlerin und überhaupt all das, was ich nicht war: selbstbewusst, elegant, charismatisch und spindeldürr. Insgeheim fand ich ihre Texte selbstgefällig und unlesbar, doch sie hatte damit diverse Preise eingeheimst, wohingegen meine Veröffentlichungsliste sich damals noch auf ein paar unbezahlte Rezensionen auf einer obskuren Literatur-Website beschränkte. Wie viele Linke ihrer Generation trug sie stolz ihr tadelloses Führungszeugnis aus dem Struggle vor sich her und erzählte bei jeder Gelegenheit, wie sie mal von der Polizei verhaftet worden war. Allerdings gibt – abgesehen von meinen Eltern – heutzutage ohnehin kaum noch ein mittelalter Weißer zu, im Kampf gegen die Apartheid die Füße still gehalten zu haben.
Außerdem war da natürlich noch Carlas Vergangenheit mit Mark – vor meiner Zeit, unabhängig von mir. Er stritt ab, dass er je was mit ihr hatte, aber ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.
Ach, das ist unfair. Gut, ich mochte Carla nicht besonders, aber so übel war sie auch wieder nicht. In der Zeit, als Hayden dauernd Koliken hatte und Mark und ich vom Schlafmangel überreizt und zänkisch waren, brachte sie uns einmal die Woche Linsen-Moussaka vorbei. Gegessen haben wir die nie; sie stapelte sich nur in der Tiefkühltruhe, wo sie womöglich heute noch liegt.
An jenem Abend servierte ich brav Hühnchen mit Ofenkartoffeln und sündhaft teure Schokomousse und lächelte dabei wie eine Geisha. Nur ab und zu verschaffte ich mir eine Verschnaufpause, indem ich vorgab, nach Hayden sehen zu wollen. Ich machte Dienst nach Vorschrift, klinkte mich innerlich jedoch aus der Unterhaltung aus, die Carla und der Typ, den sie mitgebracht hatte, völlig an sich rissen (komisch, ich erinnere mich an jede Einzelheit dieses Abends, aber nicht an seinen Namen). Erst als es um eine Reise ging, merkte ich auf: Carla schlug ganz unbekümmert vor, wir sollten mal für eine Weile raus aus allem. Normalerweise nickte Mark immer alles ab, was Carla sagte, weshalb mir seine spontane Ablehnung erst guttat, aber dann … Paris … Paris!
Ich sah vor mir, wie Mark und ich die Champs-Élysées entlangschlenderten, während Hayden auf seinem Arm schlief und schicke Franzosen uns freundlich anlächelten. Ich malte mir aus, wie wir unter dem Schirm eines bezaubernden Cafés ein Päuschen mit Kaffee und Croissants einlegten. Wie wir in einem malerischen Bistro Crêpes und Zwiebelsuppe aßen. Ein Klischee nach dem anderen jagte mir durch den Kopf. Doch nicht nur Paris war verlockend: Auch der Gedanke an einen Wohnungstausch gefiel mir. Seit dem Einbruch fühlte sich unser Haus irgendwie verändert an. Merkwürdig düster, fast, als fände die Sonne nicht mehr herein. Die hastig installierten Sicherheitsmaßnahmen machten den Eindruck nicht besser: Die Gitter vor den Fenstern warfen Schattenfinger auf den Boden, und der Alarm piepste jedes Mal, wenn jemand eine Tür öffnete, was uns ständig unter Hochspannung hielt. Wahrscheinlich glaubte ich, wenn jemand anderer hier wohnte – irgendjemand außer uns –, würde das die schlechten Schwingungen vielleicht vertreiben.
Während Mark und Carlas Lover über Jacob Zuma diskutierten, schlüpfte ich aus dem Zimmer, um Kaffee zu kochen, doch zu meiner Überraschung und meinem Unmut folgte Carla mir in die Küche. Ich ahnte sofort, dass sie was im Schilde führte. »Mark braucht Hilfe«, sagte sie, sobald wir außer Hörweite waren. »Er muss mit jemandem reden. Mit einem Therapeuten.« Ein leiser Vorwurf lag in ihrer Stimme, als hätte ich ihn bisher davon abgehalten. Als wäre alles meine Schuld. Als wäre ich an jenem Abend besser als er davongekommen, obwohl objektiv das Gegenteil der Fall war. Ich wandte mich zur Spüle, damit sie mein Gesicht nicht sah, und schwenkte unnötigerweise die Stempelkanne aus. »Du bist stark, Steph«, fuhr Carla fort. »Du steckst das gut weg, das sieht man. Aber Mark ist anfällig für PTBS. Es ist noch nicht lange her, dass Zoë … du weißt schon. Eine Geschichte wie die könnte allerlei latente Traumata heraufbeschwören …« Bla, bla, bla. Ich schwieg, rührte den Kaffee um und konzentrierte mich darauf, ihr meine zitternden Hände nicht zu zeigen.
Nachdem Carla gegangen war, konnte ich erst stundenlang nicht einschlafen und wurde dann um halb drei geweckt, als Mark aus dem Bett sprang. Nichts Ungewöhnliches. Seit dem Einbruch reißt uns das leiseste Geräusch – eine Motte, die gegen die Badezimmerlampe fliegt, das Bellen eines Nachbarhunds – sofort aus dem Schlaf. Ich wartete darauf, dass er von seinem Rundgang wiederkam, mit trockenem Mund, das Schlimmste befürchtend – einen Schuss, einen Schlag auf den Kopf, schwere Schritte auf dem Weg zum Schlafzimmer … Aus Erfahrung wusste ich, dass ich vor Sonnenaufgang ohnehin kein Auge mehr schließen würde, also wartete ich, bis Mark wieder einschlummerte, schnappte mir das billige Ersatz-Notebook und ging in Haydens Zimmer, den einzigen Ort im Haus, an dem ich mich wahrhaft sicher fühlte. Wie üblich klang das Knarren und Ächzen des sich nach einem heißen Tag abkühlenden Hauses viel zu sehr wie das Kratzen eines Schraubenziehers in einem Schloss oder verstohlene Schritte auf dem Flur. Dass Mark Schlösser und Alarmanlage mindestens zwei- oder dreimal überprüft hatte, konnte ich mir einreden, so oft ich wollte: Die Männer, die in unser Heim eingedrungen waren, hatten es mit ihren Schatten besudelt. Als ich am Bad vorbeiging, verwandelte sich das über der offenen Tür hängende Handtuch in eine Gestalt mit Messer; der am Treppenabsatz vergessene Wäschekorb wurde ein angriffsbereiter Buckliger. Haydens Zimmer erreichte ich als reines Nervenbündel.
Hayden lag wie immer quer im Bett – die Beine zur Seite, die Decke weggestrampelt –, und ich deckte sie behutsam wieder zu, bevor ich zu ihr kroch und das Notebook auf die Knie nahm. Mark mochte sich gegen die Reise sträuben, aber ich wollte die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Er hatte recht, wir konnten uns das niemals leisten, aber ein bisschen träumen durfte ich doch wohl. Wohnungstauschbörsen gab es im Internet massenweise – zumindest da hatte Carlas Freund recht behalten. Ich entschied mich für eine mit dem Foto einer Berghütte auf der Startseite und registrierte mich für dreißig Tage kostenlos auf Probe. Drei Wunschziele sollte ich angeben, in absteigender Reihenfolge – »Sei flexibel!«, hieß es in den FAQ. Ich trug Paris ein, dann Irland, wo wir kein Visum brauchen würden, und drittens die USA. In Europa bräuchten wir so gut wie überall ein Touristenvisum, aber ich hatte mir fest Paris in den Kopf gesetzt. Während ich die schmeichelhaftesten Fotos unseres Hauses hochlud – die, die wir gemacht hatten, als wir es im Jahr zuvor fast zum Verkauf angeboten hätten –, fühlte ich mich, als täte ich was Verbotenes. Als schriebe ich eine Mail an einen Liebhaber.
Danach gab ich eine Beschreibung ein, von der ich hoffte, sie würde Pariser Wohnungstauscher ansprechen: »Gemütlicher, historischer Altbau im sonnigen Kapstadt!« »Historisch« war ein wenig übertrieben, auch wenn in unserer Straße hauptsächlich viktorianische Reihenhäuser standen. Dann fügte ich das Wörtchen »sicher« hinzu, fühlte mich aber augenblicklich schuldig und löschte es wieder. Dabei war es nicht mal eine richtige Lüge. Am Morgen nach dem Einbruch war Dad aus Montagu gekommen, bewaffnet mit seinem Schweißgerät und einem Pick-up voll Betonstahl, und unsere Fenster waren inzwischen mit schweren Stahlgittern versehen. Mark hatte irgendwas von »hässlich« gegrummelt, Dad aber nicht daran gehindert, das Haus in Alcatraz zu verwandeln. Das hätte er nicht gewagt. Er hatte Dad den ganzen Tag lang gemieden, um dem stillen Vorwurf zu entgehen, der in der Luft hing: »Du hättest deine Familie besser beschützen müssen, du Arschloch.«
Als Nächstes googelte ich Flüge. Bei Air France gab es einen Sonderpreis für Februar, sofern wir innerhalb der nächsten drei Tage buchten – alles schien sich wie von selbst zu ergeben. Ich beschloss, nicht sofort jemanden auf der Website anzuschreiben. Stattdessen würde ich das Schicksal entscheiden lassen und warten, bis jemand sich bei mir meldete. Eine selige Stunde lang fiel ich in tiefen Schlaf. Um sechs Uhr weckte mich Hayden.
Um keinen Streit zu riskieren, erzählte ich Mark an diesem Morgen noch nichts von meiner Anmeldung. Von der schlimmen Nacht gereizt, verabschiedete er sich zur Arbeit mit einem knappen »Schließ das Tor hinter mir ab.« Ich stellte Hayden ihre Cornflakes hin und setzte sie vors Kinderfernsehen. Obwohl ich keinen Hunger hatte, holte ich den halbleeren Topf Schokomousse aus dem Kühlschrank und löffelte ihn aus, während ich meine Mails checkte. Zwei von der Bank – wir hatten mal wieder unser Kreditlimit ausgereizt –, doch von der Tauschseite nichts außer einem Dank für meine Anmeldung.
Wie jeden Vormittag rief meine Mutter an, um zu hören, wie es uns ging. Nachdem ich mir ihr übliches Drängen angehört hatte, Hayden doch für ein paar Tage zu ihr zu bringen, erzählte ich ihr von der Sache mit dem Wohnungstausch. Sie war sofort Feuer und Flamme, hauptsächlich, weil sie uns unbedingt aus Kapstadt raushaben wollte, das sie inzwischen für lebensfeindlich und viel zu gefährlich hielt. »Was hält Mark denn davon?«
»Nicht besonders viel. Wir können uns das eigentlich auch gar nicht leisten.« Darauf, dass wir das vermutlich könnten, wenn ich mir endlich einen Job suchen würde, wollte ich lieber nicht näher eingehen.
»Du musst ihn überreden. Wir leihen euch auch das Geld für die Flüge, nicht wahr, Jan?«
Dad brummte irgendwas im Hintergrund.
»Das kann ich nicht annehmen, Mom.« Das Bed & Breakfast der beiden lief nicht besonders, und zwar bereits seitdem sie es vor zwei Jahren gekauft hatten.
»Wir kratzen das schon zusammen. Es ist höchste Zeit, dass Mark dich mal an die erste Stelle setzt.«
»Es war für uns alle schwer, Mom. Mark tut sein Bestes.«
Sie murmelte etwas Unverständliches, ließ es dabei jedoch bewenden. Konflikten ging sie lieber aus dem Weg.
»Wie läuft das Geschäft? Habt ihr Buchungen?«
»Diese Woche haben wir zwei Holländer. Schwule.«
»Und Dad weiß, dass sie schwul sind?«
»Mein Gott, Steffie, er lebt doch nicht komplett hinterm Mond. Danach steht alles leer bis März.« Pause. »Wenn ihr fahrt, könnten wir auf Hayden aufpassen.«
»Die würde ich schon mitnehmen.«
»Wir hätten sie furchtbar gern bei uns, das weißt du.«
Ich ließ sie weiter auf mich einreden, während ich die »Zehn besten Unternehmungen in Paris im Februar« googelte und hin und wieder Gmail checkte. Da entdeckte ich die Mail von der Website: HALLO STEF198, PETIT08 HAT DIR EINE NACHRICHT GESCHICKT! KLICKE HIER, UM SIE ZU LESEN … Ich beendete das Gespräch mit meiner Mutter und öffnete die Mail: BONJOUR STEPHANIE ET MARK! EURE HAUS IST SEHR SCHÖN! SEHT UNSERE, WIR KÖNNEN KOMMEN, WANN SIE WOLLEN ;-) A BIENTOT!!! MAL ET JUNIE PETIT.
Ich klickte auf den Link zum Profil der Petits, auf dem das Foto eines Paares um die dreißig zu sehen war. Sie hatten sich zu einem Doppelselfie zusammengedrängt, Sonnenbrillen im Haar, zweimal strahlend weiße Zähne. Der Traum eines jeden Werbers: blond und glücklich. Die sechs Bilder der Wohnung waren größtenteils von außen aufgenommen – die einzige Innenaufnahme zeigte eine freistehende, viktorianische Badewanne, über deren Rand ein burgunderrotes Handtuch hing. Darunter die kurze und bündige Beschreibung: »Stilvoller Luxusapartment in Traumlage für Stadt der Liebe!!! 2 oder drei personnes.« Das Gebäude wirkte verwittert, vornehm und typisch französisch, mit einer großen, schweren Holztür und schmalen Fenstern hinter verschnörkelten Metallgeländern. Bewertungen gab es nicht. Na und? Wir hatten ja auch keine. Vielleicht tauschten die beiden ebenfalls zum ersten Mal.
Ich fackelte nicht lange. BONJOUR!, tippte ich. FREUT MICH, EUCH KENNENZULERNEN!
3MARK
Der Wagen hinter mir hupt, kaum dass die Ampel auf Grün springt, und reißt mich aus einem diffusen Tagtraum von maskierten Männern, die Befehle bellen. Absichtlich langsam löse ich die Handbremse und fahre an. Der Schnösel hinter mir – höchstens fünfundzwanzig, Porsche Cabrio – fuchtelt wütend mit den Händen. Ich spiele den tatterigen Opa. Früher galt Kapstadt als ruhig und gemütlich, inzwischen wurde es überrannt von verkrampften Managertypen, die wünschten, sie wären in L.A.
Der Kerl klebt mir bis zur Ampel an der Buitengracht an der Stoßstange. Ich spüre seinen bösen Blick im Rückspiegel. Gar nicht lange her, da hätte ich ihn erwidert; heute weiche ich ihm aus. Noch ein, zwei Tiefschläge vom Leben, dann löse ich mich womöglich einfach auf.
Ich bin hundemüde. Lustigerweise schlief Hayden in den letzten Wochen besser als je zuvor. Sie wacht nur noch einmal auf, schläft sogar ab und zu durch, aber ich kriege dennoch kein Auge zu – oder ich erlaube es mir nicht. Rational gesehen ist mir schon klar, dass wir auch nicht sicherer sind, wenn ich die ganze Nacht wach bleibe. Es nützt weder mir noch Steph noch Hayden, wenn jede kleine Aufmerksamkeit oder Hilfe, die sie von mir bräuchten, zu einem riesigen Gefallen wird, weil ich so übermüdet bin. Ich reagiere gereizt und weiß, dass ich das nicht sollte. Trotzdem, schlafen kann ich nicht. Was, wenn sie wiederkommen? Solange ich wach bin, kommen sie an Steph nicht ran.
Zur Ablenkung schalte ich den iPod an. Der Zufallsgenerator wählt »I’m a Funny Old Bear«, was mich sieben Jahre zurückkatapultiert, zu Zoës Preisverleihung in der ersten Klasse. Die Aula war brechend voll von Müttern und verloren wirkenden Vätern, deren eigene Väter für eine so unwichtige Veranstaltung niemals ihre Zeit verschwendet hätten. Die Kinder sangen dieses Lied über Pu den Bären, und da begriff ich: Sie waren glücklich. Irgendwie war meine Tochter der stumpfen, griesgrämigen Vernachlässigung meiner eigenen Kindheit entgangen, und etwas an dieser banalen Tatsache traf mich mitten in den Magen. Während die Kleinen sich durch den Refrain jubelten, kamen mir die Tränen. Das war Zoës letzte Preisverleihung.
Am Schorf dieser alten Wunde zu kratzen ist eine geradezu willkommene Ablenkung von unserem jüngeren Trauma. Noch einmal blicke ich in den Rückspiegel, stelle mir Zoë auf dem Rücksitz vor. Allerdings würde sie da jetzt natürlich gar nicht mehr sitzen: Sie wäre inzwischen vierzehn und säße auf dem Beifahrersitz. Oh Mann.
Erst Monate später brachte ich es über mich, ihren Kindersitz aus dem Auto zu nehmen. Zwei Löcher im Polster zeigen noch an, wo der Sitz sich am Stoff rieb, und eine Collage aus Flecken zeugt von all dem Essen, das Zoë darauf verkleckert hat.
»Warum bist du traurig, Daddy?«, höre ich sie sagen.
»Bin ich gar nicht, Schätzchen. Nur … müde.«
»Wegen dem neuen Mädchen? Deiner anderen Tochter?«
Der Typ hinter mir hupt schon wieder, unterbricht meine Träumerei. Eine ganze Fahrzeugschlange stimmt mit ein. Diesmal hebe ich beim Anfahren entschuldigend die Hand. Noch ein Blick in den Spiegel: Der Rücksitz ist noch immer leer. Ich stelle das Frühstücksradio an, um die Stimmen in meinem Kopf zu übertönen.
Nachdem ich mich in die winzige Parklücke in der Tiefgarage gequetscht habe, schiebe ich mein Kärtchen in den Schlitz für die Aufzüge des Melbourne City Campus. Nachdem die Universität Kapstadt mich wegrationalisiert hatte – »Das Department wird in relevantere und produktivere Forschungsfelder remodularisiert, Mark, und wir brauchen keine zwei Spezialisten für viktorianische Literatur« –, wurden mir zwei andere Stellen angeboten. Ich entschied mich für die am Melbourne City Campus, weil ich da ganz klassisch unterrichten konnte. Damals kam mir das wichtig vor, aber ich hätte besser den Job bei CyberSmarts nehmen sollen; deren ergebnisorientierte Online-Crash-Kurse hätte ich bequem von zu Hause aus leiten und zwischen zwei E-Mails eine Runde pennen können.
Ich grüße Lindi am Empfang und gehe den Flur im sechsten Stock entlang zu meinem lausigen Büro. Dieser sogenannte Campus, der in Wahrheit nur ein unpersönlicher Haufen Büros und Seminarräume ist, wurde erst vor drei Jahren eingerichtet, doch schon jetzt wellt sich der Teppich, und meine Bürotür ist so verzogen, dass ich sie jeden Morgen mit der Schulter aufdrücken muss. In der Regalwand auf der einen Seite meines Büros liegen lose ein paar Unterlagen und Hausarbeiten herum. Meine Bücher habe ich immer noch nicht hergebracht, weil das hieße, dass ich mich längerfristig auf die Stelle einlasse. Das gesammelte, obskure Wissen über das viktorianische Zeitalter verstaubt zu Hause in Kartons.
In der Kaffeeküche fülle ich meine Wasserflasche. Nur zu gern hätte ich einen Kaffee, aber es gibt lediglich billiges Instantpulver, und ich hab’s noch immer nicht geschafft, mir für das Büro eine Bodum zu besorgen. Als ich mich so über den träge plätschernden Wasserhahn beuge, spüre ich, wie jemand sich hinter mich drängt. Die Küche ist so klein, dass sich laut ungeschriebenem Gesetz immer nur eine Person darin aufhalten darf. Dennoch packt mich jemand am Arm.
»Wie geht’s dir, Mark?«
Umständlich drehe ich mich zu Lindi um, die mir den Fluchtweg abschneidet.
»Danke, gut, und dir?«, erwidere ich in der Hoffnung, dass sie es damit gut sein lässt.
Tut sie aber nicht. »Nein, ehrlich, wie geht’s dir? Wirklich furchtbar, was dir und deiner wunderbaren Familie passiert ist.« Sie hat weder Steph noch Hayden je gesehen – die beiden würde ich auch kaum hierherschleifen.
»Danke. Wir kommen zurecht.« Ich hab keine Lust auf diese Unterhaltung. Meine wunderbaren Familien und wirklich furchtbare Ereignisse scheinen irgendwie zusammenzugehören. Wie würde Lindi sich wohl aufführen, wenn sie von meiner ersten Familie wüsste? Sie will nur nett sein, aber durch ihre Fragen fühle ich mich in die Ecke gedrängt, werde schnippisch, obwohl ich eine meiner wenigen Freundinnen hier nicht vor den Kopf stoßen will.
»Ich wünsche mir, dass es euch gut geht«, sagt sie.
»Mhm, danke«, wiederhole ich und drehe mich demonstrativ wieder zur Spüle. Meine Flasche ist voll, das Wasser läuft schon über.
Endlich versteht Lindi den Wink und geht.
Während ich mich zum Seminarraum C12 schleppe, fällt mir auf, wie gebückt ich mittlerweile gehe. Ich hebe die Schultern und wappne mich für die seelenraubende Qual des Einführungskurses Literaturwissenschaft. Ein gezwungenes, vor falscher Fröhlichkeit triefendes »Guten Morgen« trällernd, betrete ich den Raum. Die Gespräche werden nur minimal leiser, während ich die Folie mit Stichwörtern auf den Projektor lege. Als ich anfange, blicken mich die meisten der jungen Leute an, als wäre ich der Sand in ihrer Vaseline. Heute geht es um Kriegslyrik, aber es könnte ebenso gut jedes andere Thema sein. Früher hat mich dieses Zeug mal interessiert; vermutlich hatte ich bessere Dozenten als mich. Heute fällt mir nicht das Geringste ein, um diese Studenten zu motivieren, die mich anblitzen wie Kunden, die nicht bekommen, wofür sie bezahlt haben. Mir fällt auf, wie eintönig ich spreche, doch mit jedem weiteren Wort fühle ich mich nur noch unsicherer.
Irgendwie halte ich bis zehn Uhr durch. Zurück im Büro, checke ich meine Mails. Die Rundschreiben des Departments ignoriere ich und öffne stattdessen eine Nachricht von Steph. Selbst nach so langer Zeit hebt ihr Name im Posteingang immer noch schlagartig meine Stimmung.
Hi Mark,
Ich hab’s Dir heute Morgen nicht erzählt, weil ich Dich überraschen wollte, aber damit Du Bescheid weißt: Ich hab eine Anfrage für einen Wohnungstausch gepostet! Es hat sogar schon jemand geantwortet, siehe unten – die klingen total nett und französisch!
Mom und Dad wollen uns das Geld für die Tickets leihen, also keine Ausflüchte!
Ich weiß, dass Du das insgeheim super findest – das wird ein Riesenspaß und tut uns allen bestimmt gut.
Ich liebe Dich
S
Zu meiner Überraschung reagiere ich zunächst leicht entrüstet. Wie konnte sie das tun, wo ich doch bereits nein gesagt hatte? Allerdings spüre ich die Fäulnis in unserer Ehe, die der verdammte Einbruch ausgelöst hat, und weiß, dass ich mich um eine positive Einstellung bemühen sollte. Steph strengt sich wirklich an, so viel ist klar – außerdem weiß sie, dass sie mich mit diesem »Ich liebe Dich« noch immer sofort um den Finger wickeln kann.
Ich drehe meinen Bürostuhl Richtung Fenster und blicke hinaus zu den Klimaanlagen auf den Dächern, die verspiegelten Fassaden und den Berg, der dahinter gewaltig in den heißen, klaren Himmel aufragt. Paris. Da wollte ich schon immer mal hin. Steph kennt mich eben. Ist ja nicht ihre Schuld, dass wir finanziell am Stock gehen.
Ich wende mich zurück zum Schreibtisch und klicke auf den Link, den Steph geschickt hat. Offenbar eins dieser typischen Pariser Häuser, in einem schmalen Sträßchen, das in einen kleinen, von Bäumen gesäumten Platz mündet. Das Viertel klingt nett, ist nicht weit weg von den Sehenswürdigkeiten, aber dennoch ruhig. Bei Montmartre, wo die Künstler lebten und wo diese große weiße Kirche steht.
In einem anderen Leben wäre das fantastisch. Nicht in diesem allerdings, nicht jetzt. Selbst wenn wir von Stephs Eltern Geld für eine Spritztour um die halbe Welt annehmen könnten: Hayden durch eine fremde Stadt zu schleifen wäre weniger romantisch, als es sich anhört. Ein braves kleines Mädchen im Kinderwagen durch den Park zu schieben klingt ja ganz nett, doch Steph und ich wissen nur zu gut, wie Hayden wird, wenn sie mal muss, hungrig ist, schwitzt oder friert. Das ist nur natürlich in ihrem Alter. Steph macht sich was vor.
Vom Tausch-Profil blickt mich ein attraktives junges Paar namens Petit an. Die Beschreibung der Wohnung enthält auch ein paar Tourismus-Links. Ich überfliege eine Liste literarischer Spaziergänge, und plötzlich sind zwanzig Minuten vergangen. Wenn ich mir vorstelle, über dasselbe Pflaster zu schlendern wie Hemingway, Gauguin, Monet, Balzac und Foucault – und Woody Allen! Das wäre schon mal was anderes als immer nur die schäbigen Fliesen des Canal-Walk-Einkaufszentrums, Baujahr circa 2008. Steph hat eben ein gutes Näschen – ich wollte immer schon nach Paris, und soeben kam mir die zündende Idee, wie ich das möglich machen kann.
Ich greife zum Telefon und wähle die Nummer von Stephs Eltern. Zu meiner Erleichterung nimmt Rina ab; Jan und ich verstehen uns nicht besonders. Er ist nur fünf Jahre älter als ich und sorgt sich um seine Tochter. Zwar habe ich sie immer nur geliebt und geehrt, aber als Vater zweier Töchter verstehe ich ihn schon – ich könnte mich auch nicht leiden.
»Was hast du dir dabei nur gedacht, Mark?«
Das ging schnell. Ich komme gerade erst mit meinem Morgenkaffee wieder ins Büro. Rina muss Steph sofort angerufen haben.
»Ich wollte dich eben auch überraschen. Ich dachte, du …«
»Ich rufe Mom sofort an und sage ihr …«
»Warte, Steph. Überleg doch mal.« Ich schließe die Bürotür, muss aber trotzdem fast flüstern, damit mich durch die papierdünnen Wände niemand hört. »Du weißt doch selbst genau, dass es Quatsch wäre, Hayden mitzunehmen. Sie fände es schrecklich.«
»Manchmal bist du ihr gegenüber derart distanziert, dass ich mich frage, ob …«
»Jetzt fang nicht wieder damit an. Bitte, Liebling. Du weißt doch, dass ich sie lieb habe.« Das habe ich wirklich: sie und alles, was sie für mich bedeutet. Hayden war nicht geplant – ich dachte, Steph nimmt die Pille, sie dachte, ich sei sterilisiert –, doch ich werde nie vergessen, wie Steph mir sagte, sie sei schwanger. Meine unbändige Freude überraschte mich genauso sehr wie sie. Ausnahmsweise waren meine Gefühle mal stärker als meine Zweifel. Erst später begriff ich, was mich so glücklich machte. Ich liebte Steph so sehr, dass die Welt um sie zu leuchten schien. Sie war meine zweite Chance, an die ich längst nicht mehr geglaubt hatte und die ich definitiv nicht verdiente, und ein Kind von ihr geschenkt zu bekommen erschien mir wie ein Schritt zu meiner Erlösung. Natürlich wurde der Gedanke an ein neues Kind auch von Trauer und Schuldgefühlen überschattet, aber es half, mir auszumalen, wie sehr Zoë sich über ein Schwesterchen gefreut hätte.
»Das geht dir echt schwer über die Lippen, stimmt’s? Dass du Hayden lieb hast?«
Ich denke darüber nach, wie grundverschieden die beiden Mädchen sind. Einerseits Zoë, blond, stets gut gelaunt und für jeden Schabernack zu haben, genau wie ihre Mutter; andererseits die dunkle kleine Hayden, weinerlich, anhänglich, von Albträumen geplagt. Ich frage mich, wie viel von dieser Dunkelheit sie wohl von mir hat. Bei Zoës Geburt war ich ein anderer Mensch, randvoll mit der Zuversicht, die einem kleinen Mädchen den nötigen Mut zum Ausprobieren gibt. Bei Hayden hingegen … Trotzdem, wenn Hayden einen ihrer richtig guten Momente hat, durchschneidet das den ganzen Mist wie warme Butter. Ich habe sie wirklich lieb, aber auf Stephs Drängeln will ich mich nicht einlassen. »Deine Eltern hätten Hayden gern bei sich, und Hayden fühlt sich pudelwohl bei ihnen. Ist doch super! Außerdem ist sie schon zwei und bräuchte ein normales Flugticket. Das ersparen wir deinen Eltern so.«
Sie sagt nichts. Ich habe recht, und sie weiß es. »Du hättest erst mit mir reden sollen.«
»Du wärst niemals einverstanden gewesen.«
»Damit, meine Tochter abzuschieben, um in den Urlaub fahren können? Stimmt, wäre ich nicht.«
»Na siehst du.«
»Gut, dann scheiß drauf. Ich will gar nicht mehr hin. Du fandst die Idee ja eh blöd. Ich verstehe sowieso nicht, wieso du auf einmal so …«
»Wir können die Tickets nicht stornieren.«
»Du hast schon Tickets gekauft?! Was …«
»Nicht ich, deine Mutter. Sie wollte nicht, dass du einen Rückzieher machst. Sie glaubt, das tut uns gut – uns allen. Und ich glaube, sie hat recht. Hayden freut sich bestimmt auch, wenn sie uns mal ein paar Tage los ist.«
»Ich will nicht ohne sie fahren, Mark.«
»Du wolltest diese Reise, Steph. Rina hat mich davon überzeugt, wie dringend wir sie brauchen.« Unfair, das Rina in die Schuhe zu schieben, aber sie war wirklich dafür. »Sieh es als die Flitterwochen, die wir niemals hatten.«
»Du bist ein Arsch«, sagt sie, aber nicht sehr wütend. Sie wird es schon noch einsehen.
4STEPH
Ich fühle mich immer noch ein wenig schuldig – und sauer –, wenn ich daran denke, wie schnell ich mich von Mark überreden ließ, Hayden zurückzulassen.
Gut, zugegeben: Einem verräterischen Teil von mir gefiel durchaus der Gedanke, ein paar Tage dem Alltagstrott zu entfliehen, lange auszuschlafen und Museen und Restaurants ohne Kleinkind im Schlepptau zu besuchen. Dennoch nagte eine Frage an mir: Weshalb willst du wirklich nicht, dass unsere Tochter mitkommt, Mark? Nicht dass er je kühl zu ihr gewesen wäre. Trotzdem drängte sich mir der Eindruck auf, dass er sich seit dem Einbruch ein gutes Stück von ihr zurückgezogen hatte.
Vermutlich hat mich auch Marks plötzliche Kehrtwende bezüglich der Reise aus der Bahn geworfen. Die Aussicht schien etwas in ihm wachzurufen, das dort geschlummert hatte, seit diese Wichser in unser Haus eingedrungen waren. Ich überließ ihm die Organisation, inklusive der Chats mit den Petits, und er stürzte sich mit Feuereifer darauf: Er kümmerte sich um unsere Visa, lud Stadtpläne herunter und durchforstete TripAdvisor nach guten und günstigen Restaurants. Jeden Abend las er mir im Bett die lustigsten der anscheinend von Google übersetzten Nachrichten der Petits vor. Auf keinen Fall wollte ich etwas tun oder sagen, was ihm die Laune verderben könnte. Sogar das Haus wirkte merkwürdig erleichtert, fast so, als wüsste es, dass es bald zwei andere, weniger deprimierende Bewohner beherbergen würde. Stück für Stück fügte sich alles nahtlos ineinander. Die Visa-Interviews liefen ohne Schwierigkeiten, und Mark konnte eine Woche Urlaub einschieben, bevor Mitte Februar das Semester wieder anfing.
Carla mag nicht gerade mein Lieblingsmensch gewesen sein, doch auch sie freute sich mit und bot an, den Petits die Schlüssel zu übergeben und als Ansprechpartnerin vor Ort für sie da zu sein. Ein paar Tage vor unserer Abreise kam sie vorbei und drückte mir eine Kleiderhülle in die Hand. Ein schokoladenfarbener Kaschmirmantel war darin. »Leihe ich dir«, sagte sie. »Müsste passen, mir ist er ein paar Nummern zu groß.« Trotz des Seitenhiebs war ich ihr dankbar. Der Mantel war wunderschön.
Ich habe ihn immer noch.
Doch als der Abreisetermin langsam näher rückte, wurde ich nervös. Zwei volle Tage brachte ich damit zu, verbissen das Haus auf Vordermann zu bringen und Bedienungsanleitungen für alles von der Alarmanlage bis zur Spülmaschine zu tippen. Am Tag vor der Abreise kaufte ich Milch, Butter, Brot, Schinken und frischen Kaffee für die Petits – das teure Fair-Trade-Zeug, das ich nicht mal im Traum für Mark und mich gekauft hätte. Ich gab einen Haufen Geld für neues Bettzeug aus. Ich staubte die Wände ab, schrubbte das Bad, räumte Schubladen auf und versuchte, nicht an die finsteren, behandschuhten Finger der Einbrecher zu denken, die darin gewühlt hatten. Die Böden glänzten, und jedes Zimmer duftete nach Zedernöl. Das war natürlich Überkompensation: Ich hoffte, das lupenreine Innere des Hauses würde über die lärmenden Studenten nebenan, das Gegröle der Penner unter der Autobahnbrücke und die vergitterten Fenster hinwegtrösten, von denen auf den Fotos, die ich hochgeladen hatte, nichts zu sehen war. Schon lustig, so im Nachhinein – obwohl, eher tragisch eigentlich –, aber damals hatte ich nur einen Gedanken: Was, wenn die Petits sich beschweren, wir hätten das Haus falsch dargestellt?
Am Vormittag holten meine Eltern Hayden ab, und während ich half, sie in den Kindersitz zu schnallen, war ich plötzlich felsenfest davon überzeugt, dass ich sie nie wiedersehen würde. Als sie losfuhren, musste ich mich zwingen, ihnen nicht schreiend hinterherzulaufen, um sie aufzuhalten.
Mark legte einen Arm um mich, und das Auto verschwand um die Ecke. »Das wird schön für sie, Steph.«
»Ja, klar.«
Meine Sorge war völlig irrational, das war mir bewusst. Hayden würde nicht das Geringste passieren. Mark und ich hatten im Leben schon mehr als genug Mist abgekriegt: Zoës Tod, Haydens chronische Koliken, der Einbruch – irgendwann mussten wir doch auch mal wieder Glück haben, oder? Ich nahm zwei Urbanol gegen das Nervenflattern. Der Arzt hatte sie mir gegen meine Ängste nach dem Überfall verschrieben, was allerdings mein kleines Geheimnis war; Mark hätte sich deshalb nur unnötige Sorgen gemacht. Leicht benommen von den Pillen, half ich ihm beim Packen. Wir machten diese Reise auch seinetwegen, das durfte ich nicht vergessen. Die Flitterwochen, die wir niemals gehabt hatten, wie er meinte. Alles war damals so schnell gegangen, dass uns für derlei Romantik keine Zeit geblieben war.
Ich hatte Mark zum ersten Mal am zweiten Tag in meinem Nebenjob am Englisch-Department der Uni gesehen. Eine Mitbewohnerin hatte mir die Stelle verschafft; ich war frisch nach Kapstadt gezogen, um Englisch zu studieren, konnte aber kaum die Miete bezahlen. Als ich gerade mit Xoliswa, der Sekretärin, zum Mittagessen wollte, stolperte ein Mann, der aussah wie ein zerknautschter Robert Downey Jr. in knitterigen Hosen ins Büro, um etwas auszudrucken. Ich bot ihm meine Hilfe an, und er schenkte mir ein Lächeln – so ein richtig herzliches, nur für mich allein.
»Wer ist denn der?«, fragte ich Xoliswa, kaum dass er außer Hörweite war.
»Mark. Englischdozent. Netter Kerl.«
»Und?« Ich wartete auf mehr Details. Niemand aus dem Lehrkörper, den unser Radar einmal erfasst hatte, kam je ohne eine Fußnote aus der Gerüchteküche davon: weder der Prof, der immer die Tür auflassen musste, wenn er mit Studentinnen sprach, noch der Tutor, der mit der ziemlich verheirateten Linguistik-Professorin ins Bett ging, oder der heimlich schwule Assistent, der noch bei seiner Mutter wohnte. Über jeden gab es eine Skandalgeschichte, und Xoliswa kannte sie alle.
»Und was?«
»Na los, Xoliswa, erzähl schon!«
Sie seufzte. »Angeblich ist seine Tochter gestorben.«
»Oh. Oh Gott.«
»Ja. Sehr traurig. Sie war erst sieben, glaub ich. Seine Ehe ist daran zerbrochen.«
»Wie ist sie gestorben?«
»Ich weiß es nicht.« Sie schnalzte mit der Zunge. Ob aus Mitleid, oder weil sie betrübt darüber war, die Einzelheiten nicht zu kennen, weiß ich nicht.