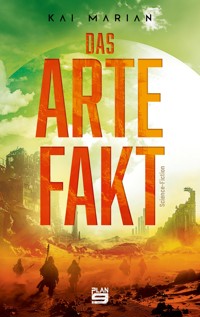
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plan9
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Königreich Tiratanga reicht von Ozean zu Ozean. Gesegnet von der Sonnengöttin Atua-Kore, fürchtet es keinen Feind. Doch als Prinzessin Mahuika vor ihrer eigenen Krönung flieht, zeigen sich Risse im Gefüge der Macht. Hohepriesterin Amokapua versucht mit rücksichtsloser Gewalt, das Auseinanderbrechen Tiratangas zu verhindern. Dafür muss sie der geflohenen Prinzessin habhaft werden. Diese aber hat auf ihrer Flucht eine Entdeckung gemacht, die weit mehr als nur Tiratanga zu vernichten droht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lucas Fassnacht
Das ARTEFAKT
Fassnacht, Lucas: Das Artefakt
Originalausgabe
ePub-eBook: 978-3-948700-90-4
Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
Print-ISBN: 978-3-948700-89-8
Lektorat: Bianca Weirauch
Satz: Sarah Schwerdtfeger, Plan9 Verlag
Umschlaggestaltung: © Christl Glatz | Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von iStock/Getty Images Plus
Umschlagabbildungen:
© Mars0hod/Adobe Stock
© VK Studio/AdobeStock
© Grandfailure/iStock/Getty Images Plus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Der Verlag behält sich das Text- and Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Der Plan9 Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
E-Mail: [email protected]
© Plan9 Verlag, Hamburg 2025
Alle Rechte vorbehalten.
https://www.plan9-verlag.de
Inhalt
PERSONENVERZEICHNIS
Prolog
Teil 1 – Der Fund
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Teil 2 – Die Zeichen
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Teil 3 – Die Grabung
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Epilog
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Navigationspunkte
Cover
Für Friederike
PERSONENVERZEICHNIS
Kumbuko, wandernder Heiler
Kidogo, sein Schüler
Haika, Königin von Tiratanga
Mahuika und Torokaha, ihre Töchter
Alandra, ihre Tante
Kohatu, Hauptfrau der Palastwache
Pehu, Offizierin
Deris, Bannerführer
Asil, Schwertmann
Amokapua, Hohepriesterin der Atua-Kore
Sokai, ihre Tochter und Sprecherin des Hohen Rates
Pawe, eine Dienerin Sokais
Hua, Mitglied des Hohen Rates
Kaïkopura, Priesterin
Wir haben uns für eine mächtige Kultur gehalten.
Diese Nachricht zu senden, war uns wichtig.
Beachte sie!
Dieser Ort ist kein Ort der Ehre.
Diese Nachricht ist eine Warnung vor Gefahr.
Die Gefahr befindet sich an einem bestimmten Ort … sie nimmt zu in Richtung eines Mittelpunkts … der Mittelpunkt der Gefahr ist hier.
Die Gefahr ist tödlich
– Auszug aus dem Sandia-Report zur Warnung künftiger Gesellschaften vor Atommüllendlagern, 1993
Prolog
Brennendes Fleisch roch anders als Holz. Der Wind trug den beißenden Gestank den Hang herauf, bevor Kumbuko den Ursprung des Feuers ausmachen konnte. Mit vor Erschöpfung zitternden Beinen erreichte er den Bergsattel, ließ sich in den Schnee sinken. Nachdem er die Handschuhe abgestreift hatte, griff er zur Hüfte und lockerte den Riemen, an dem er seinen Schlitten hinter sich hergezogen hatte. Der Schlitten wog nicht mehr viel, die Vorräte waren aufgebraucht – und trotzdem hatte Kumbuko das Gefühl, durch alle Felle hindurch schnitte ihm der Riemen in den Bauch. Er stöhnte. Einen Knoten zu öffnen, wurde zur Qual, wenn einem die Finger zu Eis gefroren waren.
Nachdem er sich den vereisten Schnee aus den Brauen gewischt hatte, wagte er endlich, den Blick zu heben.
Das Tal, das sich vor ihm öffnete, zeigte sich in verwaschenem Grau. Hilflos wie ein blindes Auge starrte die Sonne aus dem wolkenverhangenen Himmel. Dennoch glaubte Kumbuko, einen See zu erkennen, gesäumt von kleinen, kräftigen Tannen. Wo es einen See gab, konnte es auch Menschen geben. Vergeblich spähte er nach einer Rauchsäule. Hatten seine Sinne ihn getäuscht?
Er zog seinen Schlitten heran, stemmte sich an ihm hoch. Nachdem er die Kräuterbeutel zur Seite gebunden hatte, setzte er sich rittlings auf den freigewordenen Platz, nahm seine Füße auf die Kufen und brauste in die Tiefe.
Wenige Augenblicke später durchbrach er den Hochnebel, gerade noch rechtzeitig, bevor er die Baumgrenze erreichte. Indem er den Schlitten mit beiden Füßen bremste, lenkte er ihn zwischen den Tannen hindurch. Der Schwung genügte, um ihn bis zum Rand des Sees zu bringen.
Bohrlöcher im Eis.
Also gab es Menschen. Auf einmal war auch der scharfe Geruch wieder da. Kumbuko kletterte von seinem Schlitten. Keine Fußspuren – doch das musste nichts bedeuten, den ganzen Morgen hatte es geschneit. Mit neuer Kraft lehnte er sich gegen den pfeifenden Wind und stapfte los, das Ufer entlang.
Das Erste, was er von der Siedlung sah, war das Banner. Unvermittelt sprang es ihm ins Auge, ein rotes Leuchten zwischen den dunkel brütenden Tannen. Bei keinem der Stämme, denen Kumbuko so weit im Norden begegnet war, hatte er ein Banner gesehen. Beunruhigt pirschte er näher, er glaubte, das Schnauben eines Pferdes zu hören. Hier oben gab es keine Pferde. In dunkler Ahnung bemühte er sich um einen genaueren Blick auf das Wappen. Auf dem roten Hintergrund prangten drei goldene Schwerter und darüber ein goldener Kreis.
Ranu.
Gab es keinen Flecken Erde mehr, den die Krieger Tiratangas nicht ihrer blutrünstigen Göttin unterwerfen wollten? Die düstere Frage wurde Kumbuko bald beantwortet, denn die Tannen lichteten sich, gaben die Sicht frei auf ein kleines Zeltdorf. Die Öffnungen der Zelte waren auf eine gemeinsame Mitte ausgerichtet, von der Rauch aufstieg. Was genau dort geschah, war nicht zu erkennen, denn bestimmt zwei Dutzend in schwere Fellmäntel gehüllte Gestalten standen im Kreis, versperrten ihm die Sicht. Die Schnüre, mit denen sie ihre Pelzstiefel bis über die Knie gebunden hatten, deuteten darauf hin, dass es sich um einheimische Naalu handelte. Die Standarte mit der ranaischen Fahne steckte zwischen zwei Zelten im Schnee.
Kumbuko kam bis auf wenige Schritt heran, und dennoch wurde niemand seiner gewahr. »Heda«, rief er zögerlich.
Jetzt, endlich, bemerkten sie ihn. Gewöhnlich wurde er, wenn er auf eine Siedlung traf, mit Staunen und Ehrfurcht empfangen. Die Erwachsenen fielen vor ihm auf die Knie, die Kinder lärmten erst und verstummten dann scheu, die Alten reckten hoffnungsvoll die Hälse. Hier jedoch drehte man nur flüchtig den Kopf, blickte ihn mit hohlen Augen an und wandte sich wieder ab.
Aus einem der Zelte neben der Standarte drang Stöhnen.
»Ich bin Kumbuko«, murmelte Kumbuko verlegen, »und biete meine Hilfe an.« Er sagte es auf Naaluk, der Sprache des Gebirges.
»Was soll die Unruhe?«, drang es barsch aus der Mitte des Kreises, auf Ranuk. Kurz darauf wiederholte eine zweite Stimme die Frage, diesmal in brüchigem Naaluk.
Der Kreis öffnete sich und erlaubte Kumbuko den Blick auf die Mitte des Platzes. Eine Handvoll ranaischer Krieger stand dort, vollständig gerüstet mit Brustpanzer, Helm und Beinschienen. Obwohl sie die Schwerter gezückt hielten, wirkten sie ruhig, abgeklärt. Auch wenn sie sich in Unterzahl befanden, hatten sie wenig zu befürchten. Ein einzelner Krieger Tiratangas war so viel wert wie eine ganze Armee, behauptete man in Ranui, und wer sie im Kampf erlebt hatte, zweifelte nicht daran. Den Blick nach außen, umringten sie einen verkohlten Holzstoß. Neben dem Holzstoß kniete eine Naalu und drückte sich einen kleinen Jungen an die Brust. Kumbuko hatte genug Erfahrungen mit den Ranu gemacht, um sich die Geschichte zusammenreimen zu können – die Krieger Tiratangas waren vermutlich auf Tributreise gewesen; unter den hiesigen Naalu war jemand dumm oder verzweifelt genug gewesen, Widerstand zu leisten, also hatte man ihn verbrannt. Nur dass sie so weit im Norden unterwegs waren, war neu.
Der Krieger, dessen Stimme schon zuvor zu hören gewesen war, blaffte: »Was willst du?«
Bevor der Dolmetscher übersetzen konnte, ein klappriger Greis ohne Rüstung, kam Kumbuko ihm zuvor: »Ich bin Kumbuko«, wiederholte er, diesmal auf Ranuk. Mit einem Mal hoben die Ranu ihre Schwerter, beäugten ihn misstrauisch.
»Woher beherrschst du die Sprache des Reichs?«
Ein jähes Schluchzen schüttelte die Frau.
»Und ich biete meine Hilfe an«, beendete Kumbuko den traditionellen Gruß.
Die Anspannung der Krieger ließ nach, die Schwerter senkten sich. »Du bist ein Schamane?« Der raue Ton war Neugier gewichen. »Ein Wundenbrenner?«
Kein Mandrêb reinigte Wunden mit Hitze, es gab schonendere Methoden. »Ich bin ein Heiler, ja.«
»Sieh an … wenn das mal nicht was ist.« Der Krieger wandte sich seinen Kameraden zu. »Atua-Kore ist uns gnädig.«
Das Wimmern der Frau erstarb. Kumbuko spürte ihren Blick auf sich. Wider Willen sah er zu ihr hin, in ihren Augen flackerte der Verlust einer Welt. Und ein Flehen um Hilfe. Rasch wandte er sich ab.
»Hast du Mitleid?«, fragte der Krieger scharf. »Diese Wilden haben unseren Bannerführer vergiftet. Damit haben sie Atua-Kore selbst geschmäht – sie können dankbar sein, dass wir nicht ihre ganze Sippe opfern.«
Kumbuko schwieg.
Der Krieger trat an Kumbuko heran, legte ihm eine Hand auf die Schulter. Eine schamlose Geste – einen Heiler von sich aus zu berühren, war nur zum Dank gestattet. »Es heißt, ihr Schamanen mischt euch in keine Händel ein, ist das wahr?«
»So halten wir es seit Jahr und Tag, ja.«
»Und bietet jedem eure Hilfe an?«
»Jedem, der uns nicht ausdrücklich zurückweist, ja.«
»Dann handle«, der Krieger zeigte auf das Zelt, aus dem das Stöhnen gedrungen war, »und rette unseren Bannerführer.«
Der Dolmetscher hatte den Austausch nicht übersetzt. Doch die Geste des Kriegers zeigte für alle verständlich, dass er das Gespräch für beendet erachtete.
»Herr«, schluchzte die Frau mit dem Jungen, »wir sollen die Hälfte unseres Fangs abgeben. Wir werden den Winter nicht überleben.« Händeringend sah sie zu ihm hoch. »Es heißt, kein Herz ist milder als das eines Schamanen.«
Traurig schüttelte Kumbuko den Kopf. »Ich kann nichts für euch tun.«
Ihre Stimme brach vor Verzweiflung. »Seid barmherzig.«
»Wer hat der Ratte erlaubt, zu sprechen?« Der Krieger gab ihr einen Tritt. Seinem hageren Dolmetscher befahl er: »Sag der Bande, sie soll neues Holz heranschaffen. Wir verbrennen die Frau genauso wie ihren Freund, dann haben wir hoffentlich Ruhe.«
Als Kumbuko das Zelt aufsuchte, wichen die Naaluk in schweigendem Schrecken vor ihm zurück.
Der Bannerführer der Ranu wälzte sich unter Krämpfen. Kumbuko ahnte, welches Kraut man ihm in den Trank gemischt hatte; hier oben wuchs wenig – und noch weniger, was ernsthafte Vergiftungen verursachen konnte. Die Verfärbungen unter den Augen waren kein gutes Zeichen. Nachdem er sich sicher war, um welches Gift es sich handelte, holte er den Kräuterbeutel von seinem Schlitten. Auf Schritt und Tritt folgte ihm einer der Krieger. Während Kumbuko in der Hütte ein Gegengift vorbereitete, bäumte sich neben ihm der Bannerführer, und von draußen schrillten die Schreie der brennenden Frau.
Die halbe Nacht arbeitete Kumbuko an seinem Trank. Die Frau war bald verstummt, doch der Bannerführer zuckte und schrie, schlug nach unsichtbaren Monstern, überzog die eigene Verwandtschaft mit Flüchen. Endlich war der Trank fertig. Kumbuko flößte ihn dem Fiebernden ein, worauf dessen Toben nachließ. Schließlich kam der Kranke ganz zur Ruhe und schlief.
Ob er wieder erwachen würde, lag nicht mehr in Kumbukos Hand. Den Rest der Nacht saß er am Lager des Kranken und wartete. Er versagte sich jeden Gedanken an jene lange vergangene Zeit, bevor er zum Mandrêb geworden war. Er war ein anderer jetzt. Die Gefühle, die ihn einst geleitet hatten, hätten ihn fast zerstört. Er würde sie nicht wieder in sein Leben lassen. Im Rücken spürte er den Blick des Ranu, der den Zelteingang bewachte.
In der kalten Stunde des grauenden Morgens schreckte Kumbuko hoch. Der Bannerführer war erwacht, hatte sich bereits auf die Ellenbogen gestützt, sein gehetzter Blick erkundete den Raum. Ein einzelnes Talglicht hatte Kumbuko brennen lassen; holzschnitthaft kantig wirkten die ausgezehrten Züge des Kranken.
»Ihr seid in Sicherheit, Herr«, sagte der Krieger am Zelteingang, ein anderer als zuvor.
Doch der Angesprochene beachtete ihn nicht, musterte stattdessen Kumbuko. Sein Blick war klar, er würde leben. »Ein Knochenbrecher«, krächzte er heiser.
»Ich bin ein Heiler, ja.«
»Das Zeichen auf deiner Stirn …« Der Bannerführer versuchte, in die Richtung zu deuten, doch seine Muskeln gehorchten noch nicht. »Du stammst aus Orofar.«
»Das ist lange her.«
»Und du hasst uns nicht?«
Orofar war ein blühendes Reich gewesen – bis die Ranu ihre gierigen Finger nach seinen Reichtümern ausgestreckt hatten.
»Ich bin ein Heiler.« Kumbuko packte das Wenige zusammen, das er mit ins Zelt gebracht hatte. Er hatte seine Pflicht erfüllt, und von den Naalu konnte er keine Gastfreundschaft mehr erwarten. Die Nacht im Zelt hatte ihm etwas Wärme geschenkt. Es war nicht ausgeschlossen, dass er es ins Tal schaffte, bevor ihn seine Kräfte verließen.
Als er nach draußen trat, war niemand zu sehen außer einem Wache haltenden Ranu. Kumbuko war erleichtert. Auch sein Schlitten stand noch da – der Besitz eines Mandrêb war unantastbar, das galt offenbar selbst hier. Während er den Neuschnee von der Ladefläche wischte und seine Beutel verschnürte, entdeckte er den Jungen, den er vorher in den Armen der Knienden gesehen hatte. Der Junge saß reglos vor dem Aschehaufen, auf dem am Abend zuvor seine Eltern gebrannt hatten. Seine Lippen hatten sich blau verfärbt, er musste die ganze Nacht dort ausgeharrt haben.
»Heiler!«, rief der Bannerführer hinter ihm.
Kumbuko unterdrückte ein Seufzen, blieb stehen.
»Komm zurück.«
Er gehorchte, duckte sich zurück ins Zelt.
Gestützt von seinem Soldaten, war der Bannerführer bereits auf die Beine gekommen. »Letzte Nacht habe ich Atua-Kores Tempel gesehen. Er war dunkler als auf den Bildern.« Nachdem Kumbuko nichts erwiderte, fuhr er fort: »Ohne deine Hilfe wäre ich gestorben, nicht wahr?«
Kumbuko schwieg.
»Nimm das als Dank.« Der Bannerführer streckte ihm eine Hand entgegen. Zwischen den Fingern hielt er ein ranaisches Goldstück.
»Ich danke Euch für Eure Güte«, murmelte Kumbuko. »Doch ein Heiler nimmt kein Geld.«
Einen Augenblick lang starrte der Bannerführer ihn ungläubig an. Ein Goldstück aus Ranui war mehr wert als der Getreidespeicher einer Kleinstadt. »Bist du dir sicher?« Hilfesuchend sah er sich nach seinem Gefährten um, dann zurück auf seine Münze, drehte sie ratlos zwischen den Fingern. »Ich werde immer in deiner Schuld stehen.«
Ohne dass er im Nachhinein hätte sagen können, woher die Worte gekommen waren, entgegnete Kumbuko: »Gebt mir den Jungen.«
Teil 1 – Der Fund
1. Kapitel
Der Preis für das Leben war der Tod.
So hatte Atua-Kore in ihrer Weisheit es beschlossen.
Ruhig breitete die Hohepriesterin Amokapua die Arme aus. Reglos stand sie da, während ihr die Akolythinnen die schweren, goldenen Ringe über die Handgelenke streiften. Der Zeremonienmantel lag bleiern auf ihren Schultern, seine heiligen Zeichen spendeten keine Kraft. Es war das sechste Große Ritual, das Amokapua leiten würde, und wenn Atua-Kore es erlaubte, das letzte.
In den Feuerrinnen, die ringsum die Tempelwände entlangliefen, brannte das Öl zorniger als sonst. Draußen ertönten bereits die Trommeln. Sie verkündeten eine neue Zeit – und selbst die gewaltigen Felsblöcke, aus denen der Tempel errichtet war, konnten ihr Wummern nicht aufhalten.
Zügig, doch ohne Hast, eilte Sokai heran. Auf den marmornen Platten verursachten ihre nackten Füße keinen Laut. Sie kniete sich vor die Hohepriesterin, drückte die Stirn auf den Boden. »Alles ist vorbereitet.«
»Gut.«
Sokai erhob sich. Eine Akolythin reichte ihr den goldenen Reif, den Atua-Kore selbst geschmiedet hatte. Als die Welt noch jung gewesen war, war die Göttin in den glühenden Kern der Erde hinabgestiegen, und mit dem Reif war sie zurückgekehrt. Sie überließ ihn den Menschen als Versprechen – solange Sonne und Mond den Himmel durchwanderten, würde Atua-Kore ihren Kindern Halt sein und Ansporn.
Die Hohepriesterin neigte das Haupt, und die Akolythinnen begannen zu singen. Während der Gesang in die Höhe stieg, bettete Sokai den Reif auf Amokapuas schneeweißem Haar.
Es war Zeit.
Gefolgt von Sokai und den Akolythinnen, verließ Amokapua das Allerheiligste. Mit jedem Schritt dröhnten die Trommeln lauter. Als der Zug das äußere Portal erreichte, erzitterte unter Amokapuas dünnen Sohlen sogar der Boden im Rhythmus der Schläge. Auf einen Wink Sokais stemmten sich die acht Portaldiener gegen die gewaltigen Torflügel, drückten sie auf.
Ganz Ranui ließ sich von der Plattform dahinter überblicken. Zehn mit Öl gefüllte Schalen säumten die Plattform der Verkündigung, eine Brüstung gab es nicht. Rechts und links jedoch befanden sich noch zwei kleinere Plattformen, die nur dazu dienten, je einen mächtigen, schräg nach unten geneigten Trichter zu tragen. Sie waren aus golden schimmerndem Blech geschmiedet und würden die Stimmen der Herolde tausendfach verstärken. Unter ihnen wogte, so weit das Auge reichte, ein Menschenmeer. Das Reich Tiratanga erstreckte sich von Ozean zu Ozean. Zur Krönung der neuen Königin waren Hunderttausende in die Hauptstadt gekommen.
Am Fuße des Tempels wirbelten die Trommler. Sie trugen nichts als einen Lendenschurz, die Köpfe hatte man ihnen kahl geschoren. Ihre schweißnassen Körper glänzten im Fackelschein.
Als Amokapua die Verkündigungsplattform betrat, wurde das Öl in den Schalen entzündet, taghell flammte es auf. Im selben Augenblick erstarben die Trommeln. Obwohl die Trommler die Plattform über sich nicht sehen konnten, brauchte es kein Zeichen – wer dazu bestimmt war, an einem Großen Ritual mitzuwirken, war sein Leben lang darauf vorbereitet worden.
Amokapua zählte die zehn vorgeschriebenen Herzschläge, dann hob sie die Arme. »Königin Haika ist tot.«
Sie wartete, während die Herolde an die Trichter traten und das Gesagte wiederholten. Wie ein Sturm donnerten die Worte über die Menge.
»Hundert Tage hat Tiratanga ihren Tod betrauert.« Amokapua selbst hatte nicht getrauert. Die Goldene Göttin Atua-Kore hatte Haika ein langes, qualvolles Sterben bestimmt. Amokapua war froh gewesen, als es vorbei war. »Es genügt.« Sie ließ ihren Blick über die Menge streifen. Während der Trauerzeit herrschten strenge Fastgebote; Haika war eine strenge Königin gewesen, mehr gefürchtet als geliebt. In den Augen, die zu Amokapua aufsahen, flackerte sicher nicht nur Ergriffenheit, sondern auch Hunger. »Heute Nacht werden wir eine neue Königin küren, und Atua-Kores Segen wird über ihr sein.«
Der Reif drückte der Hohepriesterin in die Stirn. War er immer schon so schwer gewesen? Auf ihre Worte musste sie sich nicht konzentrieren, jedes einzelne war vorgeschrieben. Bereits fünfmal hatte Amokapua sie gesprochen. Nur die Namen waren stets andere gewesen.
»Torokaha, Tochter der Haika, tritt vor.«
Geleitet von zwei Akolythinnen, trat die Prinzessin aus dem Tempel heraus. Sie war bereits gewaschen worden, das lange Haar fiel ihr schwer auf die Schultern. Allen Schmuck hatte man ihr abgenommen. Abgesehen von einem Hemd, das ihr kaum bis zu den Knien reichte, war sie unbekleidet. Obwohl sie bereits zwanzig Sommer zählte, hatte sie die Züge eines Kindes. In ihren Händen hielt sie den goldenen Dolch, dessen Klinge mit dem Zeichen des göttlichen Dreiklangs versehen war. Ihr Gesicht glänzte bleich wie der runde Mond. Amokapua war voller Mitgefühl. Es war nicht leicht, was Atua-Kore von ihren Kindern verlangte.
»Bist du bereit«, fragte sie sanft, »Tiratanga zu dienen?«
»Ja«, murmelte die Prinzessin, kaum hörbar.
Doch aus den Trichtern der Herolde donnerte die Silbe hundertfach verstärkt. Die Prinzessin schrak zusammen, sah zu Boden.
Drei endlose Herzschläge lang war es so still, als habe sich der Letzte Tod über Ranui gesenkt. Die Hohepriesterin wurde eines Schweißtropfens gewahr, der an ihrer Stirn herunterrann. Verstohlen räusperte sie sich.
Da endlich flüsterte Torokaha: »Weil es meine Pflicht ist.«
Auch diese Worte waren vorgeschrieben. Erleichtert atmete Amokapua auf. Sie hätte dem Mädchen gerne etwas Aufmunterndes gesagt, doch das Ritual erlaubte keine Abweichung.
»Gib mir den Dolch.«
»Nehmt ihn, Hohepriesterin.« Ihre Stimme war so leise, dass selbst Amokapua sie kaum verstand. Die Herolde ließen sich davon nicht verunsichern, sie waren mit den Formeln so vertraut wie die Trommler mit ihren Stöcken.
»Bist du bereit, zu sterben?«
»Ja.«
Wieder nur ein Teil dessen, was zu sagen war. Wieder die qualvolle Pause, wieder wurde die Hohepriesterin sich der Schweißtropfen auf ihrer Stirn bewusst. Endlich hauchte die Prinzessin: »Damit Tiratanga leben kann.«
Vollbracht. Amokapua wurden die Beine schwach vor Erleichterung. Jedes Große Ritual war eine Herausforderung. Doch in ihrer Erinnerung erschien ihr keines der vergangenen so anstrengend wie dieses. Vielleicht war ihr Alter der Grund.
Der Tod war der Preis für das Leben. Aber wie war diejenige zu trösten, die ihn zahlen musste? Amokapua spürte die wartenden Blicke der Akolythinnen auf sich. »Mahuika, Tochter der Haika, tritt vor.«
Eine Königin Tiratangas war keine Herrscherin. Sie war die erste Dienerin ihres Landes, und die Einzige, die ihr gesamtes Leben allein diesem Dienst zu widmen hatte. Eine Königin Tiratangas durfte nicht einem einzigen Menschen nahe sein – nur so war sie ihrem ganzen Volk verbunden. Nur indem sie tötete, was sie liebte, war sie frei, das größte Reich der Erde zu führen. So hatte Atua-Kore in ihrer Weisheit es bestimmt.
Es war ein harsches Gesetz, Amokapua schauderte bei dem Gedanken, sie selbst wäre in Mahuikas Lage. Aber wann immer Atua-Kores Weisungen nicht beachtet worden waren, hatten über kurz oder lang menschliche Leidenschaften die Königin von ihrer Aufgabe abgelenkt; ihre Nächsten stellten ihren Herrschaftsanspruch infrage, gierten selbst nach dem Thron. Das vernachlässigte Reich war getaumelt – und im Kampf darum, wie es wieder aufzurichten sei, waren Wunden geschlagen worden, die Ranuis Kanäle auf Jahre und Jahrzehnte hinaus rot gefärbt hatten. Mehrmals hatte allein Atua-Kores Gnade verhindert, dass es nicht gänzlich zerfallen war.
Eine Akolythin erschien im Portal, gehetzt, verängstigt. Ohne Prinzessin Mahuika. Ihr verzweifelter Blick fand die Hohepriesterin. Gerade noch unterdrückte Amokapua eine Frage – ein falsches Wort hätte das Ritual zerstört.
»Mahuika, Tochter der Haika, tritt vor«, wiederholte sie in eiserner Ruhe.
Da verlor die Akolythin den Rest ihrer Fassung. »Sie ist weg«, platzte es aus ihr heraus.
2. Kapitel
Der Winter war schon alt, trotzdem war noch kein Zeichen des Frühlings zu entdecken. Seit dem Vormittag wollte es nicht aufhören zu regnen. Außerdem war es kalt geworden, ein eisiger Wind blies über die Steppe. Kidogo brannten die Ohren vor Kälte, und zugleich schwitzte er unter seinem Ranzen. Seinen Meister hingegen schien das missliche Wetter nicht zu stören, ohne ein Zeichen von Verdruss schritt er vorneweg. Die Hochstraße, der sie folgten, war von einem der versunkenen Völker gebaut worden, vermutlich war sie viele Jahrtausende alt. Sie musste einmal ein ehrfurchtgebietendes Kunstwerk gewesen sein – doch inzwischen ragten nur noch vereinzelte Trümmer aus dem Sumpf, in den der Regen den Weg verwandelt hatte.
Mit zusammengebissenen Zähnen zog Kidogo die Schulterriemen fester. Er würde sich von einem alten Mann nicht vorführen lassen. Missmutig suchte er den Horizont nach einer Siedlung ab. Die Dämmerung nahte bereits, eine weitere Nacht im Freien drohte. In der letzten Nacht hatten sie Wölfe heulen hören. Ein Blick in den Himmel half nicht, seine Stimmung zu verbessern – so leer sein Magen war, so schwer waren die Bäuche der Wolken, die über ihnen hingen. Unter ihm schmatzten seine Sandalen im Morast.
Plötzlich fiel ihm auf, dass die Landschaft sich verändert hatte; woher kamen die weißen Ablagerungen? Kalk? Aber abgesehen von den Straßentrümmern war der Boden nicht steinig. Und was noch merkwürdiger war: Die Regentropfen waren schienen auf einmal leichter, weich wie Seide. Manche blieben gräulich-weiß auf seinen Armen liegen. Erschreckt wischte er sie weg, doch sofort fielen neue.
»Keine Sorge.« Der Meister war stehen geblieben, hatte sich zu ihm umgedreht. »Das ist Schnee.«
»Schnee?« Kidogo sah gebannt auf die wirbelnden Flocken. »Ich dachte, Schnee ist weiß. Und weniger … nass.«
»Wenn wir in die Berge kommen, wirst du auch weißen Schnee sehen.«
»Es ist merkwürdig«, murmelte Kidogo, »mein ganzes Leben bin ich auf Wanderschaft, und heute sehe ich zum ersten Mal Schnee.«
Eine eigentümliche Note gelangte in den Blick des Meisters. Es schien, als wollte er etwas sagen, besönne sich dann jedoch anders.
»Was ist?«
»Du erinnerst dich wirklich nicht?«
Mit hochgezogenen Brauen zeigte er seine Verständnislosigkeit.
»Du hast bereits Schnee gesehen.«
»Sicher nicht.« Zur Bekräftigung schüttelte er den Kopf. »Das hätte ich gemerkt.«
Eine Weile musterte der Meister ihn stumm. Dann seufzte er das Seufzen, das Kidogo von ihm kannte, wenn er eine schwierige Entscheidung gefällt hatte. »Ich habe dir erzählt, wie ich dich gefunden habe …«
Denkbar knapp. Kidogo wusste nur, dass er dem Meister von einem ranaischen Soldaten überlassen worden war, als Dank für dessen Leben. Ganz gleich, wie oft er nachgebohrt hatte, nie hatte er mehr erfahren.
»Ich habe dir nicht gesagt, wo«, sprach der Meister weiter. »Du bist ein Kind der Berge, Kidogo.«
Kidogo vergaß die Kälte, vergaß auch die vom Ranzen schmerzenden Schultern, die durchgelaufenen Sandalen. Er machte einen vorsichtigen Schritt auf den Meister zu – wie auf einen Vogel, den man nicht aufschrecken will. »Erzählst du mir endlich, wer ich bin?«
»Du bist ein Mandrêb, du hast dein Leben dem Heilen gewidmet.«
»Was du nicht sagst«, rief Kidogo zornig. »Aber wo komme ich her – wann verrätst du mir das?«
»Bald.«
»Wann?«
»Nicht heute.«
Wie ein Eimer kaltes Wasser stürzte die Enttäuschung auf ihn nieder. »Wann dann?«
»Wenn du so weit bist.«
Es war aussichtslos. Seit Jahren fragte er seinen Meister nach seiner Herkunft, und seit Jahren hielt der Meister ihn hin. Zermürbt fuhr er sich durch die Haare. »Ich bin so weit! Ich kenne die Pflanzen und Tiere so gut wie du, ich habe alle deine Prüfungen bestanden – was willst du denn noch?«
»Geduld, mein Schüler.« Der Meister wies über die Ebene.
»Geduld, immer forderst du Geduld, noch auf dem Sterbebett wirst du Geduld fordern …«
»Sieh nach Westen.«
Halbherzig folgte Kidogo der Aufforderung. Licht, endlich. Eine Siedlung.
»Gehen wir«, befahl der Meister trocken.
»Und wenn wir dort sind, wirst du meine Fragen beantworten?«
»Nein. Aber ich werde zusehen, dass wir eine warme Suppe bekommen.«
Mit Einbruch der Dämmerung erreichten sie das Dorf. Inzwischen hatte sich der Schnee wie eine weiße Decke über die Steppe gelegt, doch Kidogo konnte sich nicht für das ungeahnte Naturschauspiel begeistern. Stets hatte er sich nach dem Willen des Meisters gerichtet – und was war der Dank? Er wehrte sich nicht gegen das Dasein als Mandrêb, es war eine Aufgabe so gut wie jede andere. Aber warum wollte der Meister ihm seine Herkunft nicht verraten? So vielen Regeln die Mandrêbanim sich unterwerfen mussten – seine Abstammung zu verleugnen, gehörte nicht dazu. Glaubte Kidogo zumindest. Es war ihm nur zu bewusst, wie wenig der Meister auch über die eigene Vergangenheit preisgab.
Ein Graben und ein Palisadenwall schützten das Dorf. »Was wollt Ihr?«, ertönte es von einem hölzernen Wachturm. Die Frage war auf Naaluk gestellt worden. Von allen Sprachen, die Kidogo hatte lernen müssen, war ihm Naaluk am leichtesten gefallen. Trotzdem konnte er sich nicht erinnern, sie je aus einem anderen Mund als dem seines Meisters gehört zu haben.
»Ich bin Kumbuko«, erwiderte der Meister, »und dies ist mein Schüler Kidogo. Wir bieten unsere Hilfe an.«
»Ihr seid Schamanen? Wartet.«
Nur wenige Augenblicke später wurde das Tor zur Seite geschoben und ein Brett über den Graben gelegt. Dahinter hatten sich mehrere Dutzend Leute versammelt, das ganze Dorf musste zugegen sein. Ein stämmiger Mann mit tellergroßen Händen und verhärmter Miene verneigte sich unbeholfen. »Es ist lang her, dass ein Schamane uns besucht hat. Ich bin Tuark. Ich leite dieses Dorf im Namen Ranuis und mit dem Segen Atua-Kores. Seid willkommen.« Mit einer weiten Handbewegung trat er zur Seite. Dies sahen die Kinder als Zeichen, johlend herbeizurennen.
»Sagtest du nicht, die Naalu verehren ihre eigenen Götter?«, flüsterte Kidogo seinem Meister zu.
»Ich war lange nicht mehr hier«, antwortete der Angesprochene ebenso leise. Dann wandte er sich an Tuark: »Danke, Freund. Sagt, habt Ihr einen Raum, wo wir die Nacht verbringen können?«
»Seid meine Gäste.«
Es gab tatsächlich Suppe, dazu ein Brot, das so hart war, dass man es erst einweichen musste, bevor man es kauen konnte. Tuarks Langhaus war das größte des Dorfes; dennoch bot der Hauptraum gerade ausreichend Platz für den Meister, Kidogo, Tuark selbst und dessen drei erwachsene Kinder. Die beiden Töchter hoben den Blick kaum von ihren Schalen. Der Sohn allerdings folgte dem Gespräch mit aufmerksamem Blick.
»Wie lange wollt Ihr bleiben?«, fragte Tuark den Meister.
»So lange, wie unsere Dienste benötigt werden.«
Auf der Stirnseite des Raumes gab es einen Kamin, in dem ein Feuer knisterte. Doch es war zu klein, als dass seine Wärme Kidogo erreicht hätte.
Tuark musste sein Zittern bemerkt haben, denn er hob einladend die Hand. Dankbar stand Kidogo von seinem Schemel auf, nahm seine Schale und hockte sich ans Feuer.
»So sehr wir Euer Angebot zu schätzen wissen«, hörte er Tuark hinter sich sagen, »wir brauchen Eure Dienste nicht.«
»Wie Ihr meint«, entgegnete der Meister.
»Seid Ihr sicher?« Verblüfft wandte sich Kidogo vom Feuer ab, der Gruppe zu. In jedem Dorf gab es etwas zu tun – einen Alten, der nicht mehr schlucken konnte, eine Schwangere, die so sehr ermattet war, dass sie die Geburt nicht überleben würde, ein Kind, dem die Ohren schmerzten. »Sollen wir nicht zumindest Eure Zähne ansehen?«
»Wir brauchen Eure Hilfe nicht.« Es klang überraschend grob. Inzwischen hatten auch die Töchter sich von ihrer Suppe gelöst. Groß und ängstlich blickten ihre Augen in den Raum.
»Glaubt Ihr«, rief Kidogo, »Ihr könnt für alle hier sprechen?«
»Schweig«, befahl der Meister, »und sei dankbar für die Gastfreundschaft.«
Eine unangenehme Stille trat ein. Neben dem Kamin war ein Altar aufgebaut, mürrisch betrachtete Kidogo die Holzfiguren darauf. Er wusste nicht viel über die Götter des Nordens, doch der bronzene Ring, in dem sie standen, wirkte ausgesprochen fehl am Platz. Auf einem Tuch lagen mehrere Münzen mit den Zeichen Atua-Kores – das Zubehör, mit dem die Ranu den Willen ihrer Göttin zu deuten suchten; die Münzen wurden einzeln geworfen, und abhängig davon, auf welche Stelle sie fielen und in welcher Position zueinander sie liegen blieben, offenbarte sich dem geübten Auge noch das dunkelste Geheimnis. Behaupteten die Ranu. Aberglaube, sagte der Meister. Kidogo war bereits bei einigen Münzwürfen zugegen gewesen, aber nur in den Kernprovinzen des Reiches.
»Atua-Kore umfasst uns alle.« Tuark war zu ihm getreten. »Erde und Himmel, Menschen wie Götter. Wenn genug Menschen sich vor ihr verneigen, wird sie das Goldene Zeitalter über uns kommen lassen.«
Kidogo warf dem Meister einen fragenden Blick zu, doch der schüttelte unauffällig den Kopf. Tuarks gewaltige Pranke legte sich auf Kidogos Schulter, ließ ihn zusammenzucken. Gewöhnlich wagten es nur Kinder, von sich aus einen Mandrêb zu berühren. Erwachsene fürchteten, von den Schmerzen befallen zu werden, die der Mandrêb anderen genommen hatte. Ein Aberglaube, so alt, dass selbst der Meister seinen Ursprung nicht zu erklären vermocht hatte.
»Setzt Euch«, sagte Tuark, ohne die Hand von der Schulter zu nehmen, »esst.«
»Atua-Kore wird Mutter nicht retten.« Die jüngere der beiden Töchter hatte gesprochen. Ihre Geschwister erstarrten, der Vater fuhr herum. Am erschrockensten schien das Mädchen selbst.
»Du schmähst die Goldene?«, herrschte Tuark seine Tochter an. »Willst du brennen?« Die Zurechtgewiesene beugte sich tief über den Rest ihrer Suppe, kratzte hastig die Schale aus.
»Das heißt, Ihr braucht Hilfe?«, versetzte Kidogo mit Genugtuung. Im selben Moment bemerkte er den fauligen Geruch, der aus dem Nebenraum drang. Der Geruch von Krankheit. Wie hatte der ihm bisher nicht auffallen können? Er sah zu seinem Meister. Dieser hatte die bessere Nase, musste den Gestank schon lange wahrgenommen haben. Weshalb hatte er nichts gesagt?
»Wir brauchen keine Hilfe. Nicht von Euch«, knurrte Tuark. »Atua-Kore wird entscheiden.«
»Warum habt Ihr uns dann überhaupt in Euer Haus gelassen?«
»Gäste werden vom Dorfältesten beherbergt. So verlangt es unsere Tradition.«
»Tatsächlich?« Kidogo konnte es nicht glauben. »Tradition … wie lange ist es her, dass Ihr vor Ranui das Knie gebeugt habt? Ein paar Jahre? Und das reicht Euch, um das Leben Eurer Frau einer fremden Gottheit in die Hände zu legen?« Er folgte dem Geruch, trat auf die entsprechende Tür zu.
»Zurück!«, bellte Tuark. »Schert Euch um Eure eigenen Angelegenheiten.«
»Kidogo.« Es war die Stimme des Meisters, und sie duldete keinen Widerspruch.
Die Mahlzeit wurde in Schweigen beendet.
Der Schnee hatte offenbar nur kurz vorbeigeschaut, draußen prasselte der Regen. Ruhelos wälzte sich Kidogo auf seinem Strohsack. Tuark hatte ihnen die Nachtkammer überlassen, sich mit seinen Kindern im Hauptraum schlafen gelegt. Neben Kidogo schnarchte der Meister laut genug, um den Regen zu durchdringen. Wie konnte der Alte bloß so ungerührt sein? Früher hatten die Ranu zwar mit Schwert und Feuer gewütet, aber zumindest hatte man den unterworfenen Völkern die eigene Kultur gelassen. Nun war wohl auch das vorbei.
Ein Mandrêb war zur Hilfe verpflichtet, es war nicht weniger als seine Bestimmung. Wie könnte Kidogo sich noch als Heiler bezeichnen, wenn er seelenruhig schlief, während im Nebenraum womöglich jemand starb?
Nein, er musste etwas tun.
Leise erhob er sich von seinem Lager, tastete im Dunkeln nach seinem Kräuterbeutel, schlich aus der Kammer. Horchte in den Hauptraum hinein. Ein wenig aussichtsreiches Unterfangen, der Regen trommelte gegen das Dach des Langhauses, als wolle er es zertrümmern. Im Glimmen des niedergebrannten Kaminfeuers erkannte Kidogo die Umrisse der Gastgeber, dick wie Maden lagen sie in ihre Felle gehüllt.
Fuß um Fuß näherte er sich der Tür zur Kammer der Kranken, den Blick auf die Schlafenden gerichtet. Sie zuckten und drehten sich, zweifelsohne wurden ihre Träume von Sorge zerfressen, doch niemand erwachte. Er erreichte die Tür; mit angehaltenem Atem öffnete er sie einen Spalt, spähte hinein. Ein Talglicht brannte, beleuchtete ein Lager mit einem Berg von Fellen, unter denen eine ältere Frau begraben lag. Außerdem waren zwei Schemel und ein Tisch mit einer Waschschüssel zu erkennen, ansonsten schien die Kammer leer. Kidogo hatte von dem Brauch gehört, dass man in Ranui die Sterbenden in der entscheidenden Nacht alleine ließ – so würde Atua-Kore in ihrer Entscheidung, ob sie Gnade zeigen wollte, nicht gestört. Es war haarsträubend. Wie konnte jemand an eine Gottheit glauben, die es einem verbot, Abschied von seinen Nächsten zu nehmen?
Er huschte durch den Türspalt, schloss vorsichtig die Tür hinter sich und trat an das Lager.
Nachdem er seine Hand auf die schweißige Stirn der Kranken gelegt und ihren Puls gefühlt hatte, zog er die Felle zur Seite, tastete ihren Bauch ab. Er hatte bereits eine Befürchtung, und als er die Verhärtung an ihrer Seite spürte, erlangte er Gewissheit – das Geschwür war zu groß, die Frau war nicht zu retten.
»Wird sie sterben?«
Vor Schreck setzte Kidogo das Herz aus. An der Tür stand eine dunkle Gestalt, er hatte nicht gemerkt, wie sie hereingekommen war. Einen Wimpernschlag lang dachte er, Tuark habe ihn entdeckt – doch die Gestalt war weniger stämmig, die Stimme weniger schwer. Der Sohn.
»Schließ die Tür.«
Der Bursche tat es. »Sie wird sterben, nicht wahr?« Er klang gefasst. Wahrscheinlich hatte er nur ein paar Winter weniger gesehen als Kidogo.
Was nützte es, zu lügen. »Ja.«
»Wann?«
»Wenn sie nicht schläft, ist sie dann ansprechbar?«
»Sie schreit und hat Krämpfe. Sie erkennt niemanden.«
»Wenige Tage. Vielleicht eine Woche. Es tut mir leid.«
»Eine Woche?« Die Stimme zitterte. »So lang?«
Die Reaktion überraschte Kidogo nicht. Er hatte schon häufiger miterlebt, wie Menschen daran litten, ihre Liebsten sterben zu sehen. Wie sie sich irgendwann nur noch wünschten, dass es vorbei wäre. Hilflos zuckte er mit den Schultern.
»Ihr könnt nichts tun …?« Der Bursche zögerte, wandte den Kopf ab.
»… dass es schneller geht?«, beendete Kidogo den Satz.
Ein Schweigen, das Antwort genug war.
»Ich kann ihr etwas geben, das ihre Schmerzen lindert.« Kidogo schluckte. »Und verkürzt.«
»Bitte.«
Ein Lichtblitz zerriss die Nacht, zeigte das schrecklich leere Gesicht eines jungen Mannes, der gerade um den Tod seiner Mutter gebeten hatte. Der Donner rollte heran. Wie passend, dachte Kidogo schaudernd. Wenn Leben und Tod sich begegneten, wühlte es sogar den Himmel auf.
Mit klammen Fingern griff er nach seinem Kräuterbeutel und machte sich an die Arbeit.
Erst als er wieder zurück in seine eigene Kammer geschlichen war und auf seinem Strohsack lag, spürte er das Zittern in seinen Händen. Niemand Weiteres war aufgewacht – trotz des Donners, es war kaum zu glauben. Tuark hätte ihm vermutlich, ohne zu zögern, die Kehle aufgeschlitzt. Und selbst wenn nicht – das letzte Mal, als er dem Meister nicht gehorsam gewesen war, hatte er einen Mond lang nur Wurzeln essen dürfen.
Er hörte das Schnarchen neben sich, und diesmal beruhigte es ihn. Noch immer konnte er nicht schlafen, doch je länger er auf den Regen lauschte und seine Gedanken schweben ließ, umso sicherer war er sich, das Richtige getan zu haben. Die Erkenntnis erfüllte ihn warm. Er war ein Mandrêb, und ja, er hatte das Richtige getan.
Eine Bewegung über ihm. Nicht mehr als ein Schatten. Kidogo riss die Arme hoch, war mit einem Schlag hellwach. Wollte aufspringen.
»Leise.« Schüchtern, schnell.
Kidogo hielt inne. Brauchte einen Augenblick, bis er die Stimme zuordnen konnte – Tuarks Sohn. Was wollte der? Sofort kam ihm die Sterbende in den Sinn. War etwas schiefgelaufen? Besorgt sah er zu seinem Meister hinüber, doch dessen Schnarchen rasselte so regelmäßig wie zuvor. Er wandte sich wieder seinem Besucher zu. Und erkannte erst jetzt, dass jener nackt war.
»Ich habe Angst, zu schlafen«, flüsterte der Bursche. »Könnt Ihr mich halten?«
»Na gut«, flüsterte Kidogo und schlug die Decke zurück. »Komm her.«
»War das nötig?«, fragte der Meister, während ihm Kidogo die Waschschüssel reichte. Dessen nächtlicher Gast war bereits vor dem Morgengrauen aus der Kammer geschlichen.
»Er brauchte jemanden, der ihn tröstet«, entgegnete Kidogo gereizt.
»Er war überfordert von seinem Schmerz. Gleich, welchen Halt er bei dir zu finden glaubte – nach dem Frühstück reisen wir ab, und er wird auf sich allein gestellt sein.«
»Wir können das Morgen nicht bewältigen, wenn wir uns dem Heute entziehen«, zitierte Kidogo einen der Lieblingssprüche des Meisters.
»Gib mir meinen Mantel.« Das war das Ende des Austauschs, stumm kleideten sie sich an.
Der Regen hatte sich gelegt, durch die Tür war Aufruhr zu hören. Als sie den Hauptraum betraten, waren sie die Einzigen dort. Ihre Gastgeber hatten sich in der Kammer der Kranken versammelt.
Der Meister wartete geduldig, und obwohl Kidogo hungrig war, sagte er nichts. Endlich wurden sie von der älteren Tochter bemerkt, die wiederum ihren Vater unterrichtete. Tuark eilte aus der Kammer, ein fiebriges Leuchten hatte sich über sein Gesicht gelegt. »Ha!«, rief er triumphierend. »Mandrêbanim, kommt und seht.« Er packte den Meister am Handgelenk und zog ihn in die Kammer. Winkte auch Kidogo, zu folgen. »Was sagt Ihr jetzt? Was kann Eure Kunst ausrichten im Vergleich zu den Wundern der Goldenen Göttin?« Grob schob er seine Kinder zur Seite, zog seinen Fang ans Krankenlager. »Sie ist wach. Sie wird leben. Seht. Atua-Kore hat sich erbarmt.«
Tatsächlich hatte die Sterbende die Augen geöffnet. Ihr Blick war erschöpft, aber wach. Tuark fasste mit beiden Pranken ihre Hand, kniete sich zu ihr, küsste ihre Finger.
Es war ein rührendes Bild. Obwohl Kidogo sich Tuark nicht sonderlich verbunden fühlte, presste es ihm die Brust zusammen, den Mann so erregt zu sehen, so hoffnungsfroh. Es war eine falsche Hoffnung – und Kidogo hatte sie ihm aufgebürdet. Sein Blick traf den des Burschen, versuchte ein aufmunterndes Nicken, aber sein Körper war taub.
»Wir danken Euch für Eure Gastfreundschaft«, sagte der Meister.
»Ihr wollt uns schon verlassen?« Tuark sprang auf. »Bleibt, esst, wir werden Euch Bier ausschenken. Heute ist ein Tag zum Feiern.«
»Danke, aber wir wollen weiter.«
»Wohin?«
»In die Berge.«
»In die Berge des Zorns?« Tuark machte große Augen. »Der Winter währt hier oben länger als im Süden. Es kann noch Wochen dauern, bis die Pässe gangbar sind.«
»Wir werden sehen.«
»Und der Riese ist erwacht. Unsere Jäger berichten, sie hätten seine Stiefeltritte gehört.«
»Der Riese kümmert uns nicht.«
Eine tiefe Furche bildete sich auf Tuarks Stirn, doch er verzichtete auf weitere Einwände. »Wie Ihr meint. Aber nehmt Brot und Früchte mit. Meine Kinder werden Euch eine Tasche packen.«
Sie hatten das Dorf bereits eine halbe Meile hinter sich gelassen, als Kidogo einer Eingebung folgte und einen letzten Blick über die Schulter warf. Vor dem noch immer geöffneten Tor stand Tuarks Sohn und sah ihnen nach.
»Folgt er uns?«, fragte der Meister.
Kidogo schüttelte den Kopf.
»Gut für ihn.«
Irgendwann werde ich einen Stein nehmen, dachte Kidogo, und dich erschlagen, Meister.
3. Kapitel
Abgesehen von dem Tempel Atua-Kores, war kein Gebäude in Ranui höher als der Palast der Königin. Auf seinem flachen Dach hatte man einen Rosengarten angelegt, viele Jahre später zusätzlich noch ein Bad.
»Das Bad ist bereit, Eure Hoheit.«
Torokaha ließ sich die Robe abnehmen. Der Dampf, der aus dem Becken stieg, war von Lavendelduft erfüllt. Sie stieg die Stufen hinunter ins Wasser, drehte sich auf den Rücken, stöhnte auf, als die Hitze sie umspülte. Mit geschlossenen Augen hob sie ihren Pokal, sofort füllte eine Dienerin ihn mit neuem Wein. In Torokahas Kopf summte es bereits, der Wein war schwerer als der, den sie gestern getrunken hatte.
»Bringt die Männer herauf.« Mit einem wohligen Seufzen ließ sie sich tiefer ins Becken sinken.
»Alle?«
»Habe ich gesagt, nur einen?«
Unwirsch nahm sie einen Schluck vom Wein, während sie darauf wartete, die wegeilenden Schritte der Dienerin zu hören. Doch es blieb still.
»Verzeiht, Eure Hoheit.«
»Gib mir den Namen.«
»Verzeiht, Eure Hoheit, ich verstehe nicht …?«
»Offensichtlich seid ihr daran gescheitert, meinen Auftrag auszuführen – warum sonst solltest du um Verzeihung bitten. Wer ist schuld? Nenn mir den Namen.«
»Eurem Befehl wurde nachgekommen. Die Männer sind da«, stotterte die Dienerin. »Sie warten in der Treppenhalle.«
»Dann bring sie hoch.« Langsam wurde Torokaha ungeduldig. Aber sie hatte diese Woche bereits zwei Dienerinnen aufs Feld geschickt, also zwang sie sich zur Nachsicht.
»Verzeiht«, wand sich die Dienerin, »wir dürfen nicht.«
Verfluchter Styrkurschleim. Torokaha öffnete die Augen, hob den Kopf aus dem Wasser. »Wer sagt das?«
»Die Hauptfrau der Palastwache, Eure Hoheit.«
»Kohatu? Schick sie her.«
»Sehr wohl, Eure Hoheit.«
Es brauchte für Kohatu länger, den Dachgarten zu erreichen, als für Torokaha, ihren Pokal zu leeren. Endlich näherte sich die Gerufene dem Bad. Seit Torokaha denken konnte, hatte die Kriegerin ihre Kammer bewacht, und trotzdem war sie noch immer eingeschüchtert von ihr. Wie stets war Kohatu voll gerüstet, trug Panzer, Helm und Mordaxt.
Sie nahm den Helm ab, ging auf ein Knie. »Eure Hoheit.«
»Was soll das? Schick die Männer her.«
»In der Kürze der Zeit konnten wir sie nicht genügend prüfen«, entgegnete Kohatu, ohne den Kopf zu heben, »sie alle auf einmal einzulassen, wäre leichtsinnig.«
»Leichtsinnig?« Wütend streckte Torokaha den Pokal hoch, ließ sich nachschenken. »Ich bin deine Königin.«
Ungerührt blickte Kohatu zu Boden. Dass sie sich hinter solch lächerlichen Demutsgesten versteckte, reizte Torokaha nur weiter. Auf einen Zug trank sie den Pokal aus, warf ihn in die Rosenbüsche. »Wie viele Krieger dienen meinem Schutz?«
»Im Palast einhundert, Eure Hoheit.«
»Dann sammel eben zwanzig davon ein und stell sie hier oben auf. Mit ein paar unbewaffneten Besitzlosen werdet ihr ja wohl fertig werden.«
Nun wollte die Wächterin tatsächlich den Kopf heben.
»Nein, nein«, sagte Torokaha schnell. »Kein weiteres Wort.« Sie winkte einer Dienerin nach neuem Wein.
»Eure Hoheit?«
Torokaha kämpfte sich aus dem Nebel, der sich um ihre Sinne gelegt hatte. »Was?«
»Die Männer sind da.«
»Was für Männer?« Mit Mühe gelang es ihr, die Augenlider zu heben. Mit Mühe zog sie sich am Beckenrand hoch. Ein Ring von Kriegern hatte das Becken umstellt. War irgendetwas Schlimmes passiert? Sie bemerkte Kohatu, winkte sie heran. »Was soll das?« Im selben Moment entdeckte sie die Gruppe Ungerüsteter. Wie verloren standen sie da, drehten ihre Locken; hin und wieder wagte einer einen Blick zu ihr herüber, ein unsicheres Lächeln auf den Lippen. Die Schals aus Seide, die sie um ihre Körper gewickelt hatten, verhüllten nur wenig.
»Die Männer erwarten Euren Befehl, Eure Hoheit.«
Das hatte ihr gerade noch gefehlt. »Weg«, schimpfte sie matt. »Sie sollen sich davonmachen.« Erschöpft ließ sie sich zurück ins warme Wasser sinken.
Warum konnte man sie nicht eine einzige Stunde in Ruhe lassen? Zwei Monde war es her, dass ihre Schwester Mahuika zur Königin hatte gekrönt werden sollen. Jede Nacht kehrten die Bilder zurück – die Trommler, die Hohepriesterin, der goldene Dolch. Ihr ganzes Leben war Torokaha darauf vorbereitet worden, sich für Tiratanga zu opfern. Aber offenbar hatte Atua-Kore ihr Opfer verschmäht. Nun, es sollte ihr recht sein: Lieber war sie Königin als tot. Auf die Kopfschmerzen freilich hätte sie verzichten können.
»Eure Hoheit?«
Torokaha stöhnte vor Verzweiflung. »Was?«
»Der Hohe Rat möchte Euch sprechen.«
»Sag ihm, er soll seine Zehen lutschen.«
»Prinzessin Torokaha.« Eine neue Stimme jetzt, streng, befehlsgewohnt.
Es verschlug ihr den Atem, Badewasser schwappte ihr in den Mund, sie verschluckte sich, keuchte. Als sie sich halbwegs gefangen hatte, versuchte sie blinzelnd, einen klaren Blick zu bekommen. Ja, direkt am Beckenrand stand niemand anderes als Sokai aus dem Hause Mokara, Sprecherin des Hohen Rates, Bewahrerin des Goldenen Reifes, Erste ihres Hauses.
»Warum habt Ihr keinen Boten geschickt?«, fragte Torokaha entsetzt, noch immer hustend.
Sokai hatte ihre Hände in den weiten Ärmeln ihrer Robe verborgen. »Haben wir. Mehrere, um genau zu sein. Sie wurden nicht vorgelassen. Es wurde ihnen gesagt, die Prinzessin sei in einer wichtigen Angelegenheit beschäftigt, in der sie nicht gestört werden dürfe.« Ihr Blick glitt zum Treppenturm, in dem gerade der letzte der Besitzlosen verschwand.
Das Wasser war mit einem Male lau geworden, trotzdem wäre Torokaha am liebsten ganz darin versunken. »Um was geht es?«, brachte sie hervor.
»Um die Thronfolge.«
Mit offenem Mund starrte Torokaha die Ratssprecherin an. »Das war heute?«
»Kommt Ihr?«
Schmerzlich bloßgestellt watete sie aus dem Becken. Wie konnte sie von allen Tagen ausgerechnet diesen vergessen haben? Ihre Sicht verschwamm, die Beine gaben ihr nach, eine Dienerin musste sie stützen.
»Vielleicht möchte Eure Hoheit sich ankleiden, bevor sie vor den Rat tritt?« Sokais gleichgültige Stimme erreichte Torokaha kaum. Ihr Magen zog sich zusammen, und sie erbrach sich, bis ihr Tränen in die Augen traten.





























