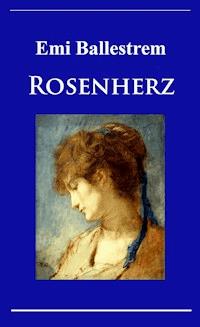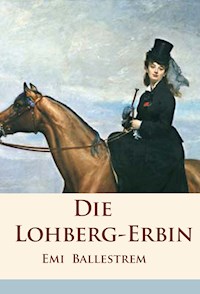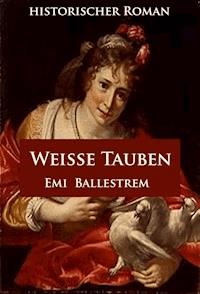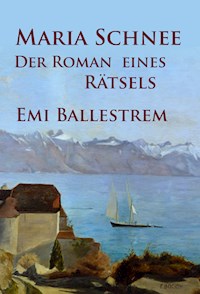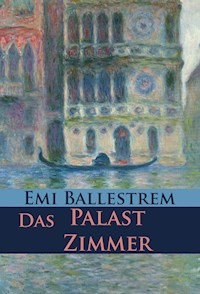Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dort hielten wir jedoch nicht an, sondern bogen an der nördlichen Ecke in eine schmale Gasse, die dem langen Seitenflügel entlangläuft, und am Ende desselben scharf rechtsherum zur Rückseite des Palastes und hielten dort vor dem mächtigen Portal, in dessen eisenbeschlagenen Torflügeln Ausschnitte zum gewöhnlichen Aus- und Eingang angebracht sind. Hier stiegen wir aus, und Frau Modesta ließ den wundervollen Bronzeklopfer, der in entzückender Modellierung die Figur eines auf einem Delfin stehenden Neptuns zeigt, schwer auf die dahinter angebrachte Bronzeplatte fallen und erweckte damit in dem Hause ein Echo, das mir dermaßen auf die Nerven ging, dass ich am liebsten wieder in den Wagen gestiegen und davongefahren wäre – trotzdem er geschlossen war. Denn dieses Echo hatte für mein Ohr etwas so – Warnendes, möchte ich sagen, wie ich es gar nicht beschreiben kann ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Bernstein-Rätsel
Emi Ballestrem
Roman
idb
ISBN 9783962242350
1. Kapitel
Auf einer Bank in den öffentlichen Gärten von Venedig, nahe der Büste des venezianischen Dialektdichters Riccardo Selvaggio, saß gegen Abend eines wunderbar schönen Septembertages eine junge Dame. Sie hatte sich auf diesem Punkte den gewiss schönsten Blick auf die herrliche alte Märchenstadt in den Lagunen auserkoren, den Blick, den der Dichter auch vor allem geliebt, und darum hat die dankbare Stadt ihm sein Denkmal an diese Stelle gesetzt mit dem Zitat aus einem seiner Gedichte: »Nein, es gibt auf dieser Welt keine schönere Stadt!« – Er hat recht, denn wie man Venedig von jener Stelle aus vor sich liegen sieht, muss es, wenn auch vielleicht nur unbewusst, der größte Reisebarbar anerkennen.
Im Westen neigte sich die Sonne schon und ließ die Umrisse der Stadt mit ihren fantastischen Türmen und Gebäuden auf einem purpurnen Hintergrunde erscheinen, der nach oben sich in leuchtendes Gold abtönte; dieses verlief allmählich in ein intensives Türkisblau, in dem eine silberne Mondsichel schwamm. Die junge Dame schien so versenkt in den wunderbaren Anblick, dass sie es längst nicht mehr bemerkte, wie die Vorübergehenden sie mit mehr oder minder großem Wohlgefallen betrachteten.
Sie war entschieden hübsch genug, um ein mehr als flüchtiges Interesse zu erregen. Nicht zu groß, aber tannenschlank und in vollkommenem Ebenmaß gewachsen, kam ihre zierliche Gestalt im einfachen, aber gut gearbeiteten Schneiderkleide von weißem Leinen zur besten Geltung, und ihr reizender Kopf mit einer Fülle natürlich fein gerippten, aschblonden Haares unter dem breiten, schwarzen Strohhut konnte keinen besseren Hintergrund finden. Das Gesicht war kein vollkommen schönes, ihre fein gebogene Nase war zu kurz abgebrochen, um mustergültig zu sein, ihr Kinn zu energisch, von wunderbarer Lieblichkeit aber war der blassrote Mund, wundervoll der pfirsichblütenartige Teint, von der größten Anziehungskraft die schönen, großen, grauen Augen mit ihren tiefdunklen Wimpern und Brauen – alles in allem: ein Rassekopf und im Ausdruck der einer Person von Bildung und Erziehung, die ihren Stempel dem geübten Auge so unzweifelhaft erkennbar aufdrückt.
Während sie so saß und westwärts in die sinkende Sonne schaute, kam ein älteres Paar den Kai entlang der Büste Selvaggios entgegen, vermutlich um sich zur nahen Schiffslände zu begeben. Die Dame bemerkte das auf der Bank sitzende junge Mädchen zuerst. Sie blieb stehen und flüsterte dann dem Herrn etwas zu, worauf dieser den Blick nach der Bank richtete und sichtlich zurückfuhr. Beide drehten dann um und gingen langsam den Weg zurück, den sie gekommen waren, indem sie rasch und leise miteinander sprachen. Die Dame schien besonders eindringlich zu reden, während der Herr wiederholt den Kopf schüttelte, dann aber achselzuckend seiner Gefährtin folgte, als diese sich zurückwandte, auf die Bank zuschritt und die dort Sitzende in deutscher Sprache verbindlich fragte, ob der Platz neben ihr frei sei.
Die junge Dame, die die Herankommende bisher weder bemerkt noch beachtet hatte, nickte bejahend und rückte nach dem Rande zu, worauf die beiden neben ihr Platz nahmen und einige Bemerkungen über die ›unvergleichliche Szenerie‹ wechselten. Sie waren, wie schon gesagt, ältere Leute und sahen vornehm aus. Beide waren groß gewachsen, er schlank und mager, sie von achtbarer Leibesfülle. Ihr rundes, großes Gesicht mit der merkwürdig kurzen, spitzen Nase, die ganz babyhaft darin aussah, dem etwas zu vollen, aber festgeschlossenen Munde, den großen, dunklen, von schweren, geraden, schwarzen Brauen überragten Augen, die durch sie etwas Finsteres bekamen, ließ darauf schließen, dass die Frau in ihrer Jugend gewiss eine pikante Schönheit besessen haben musste im Verein mit ihrem klaren, farblosen Teint, der jetzt etwas Totes hatte, weil sie eine Perücke von rötlichem Kastanienbraun trug. Sie war im Übrigen ruhig und passend in dunkle, gut verarbeitete Stoffe gekleidet und machte einen recht stattlichen Eindruck. Ihr Begleiter sah durch seine Schlankheit neben ihr wesentlich größer aus, als er tatsächlich war, trotzdem er den Kopf mit den feinen, glatt rasierten Zügen, aus denen er mit zwei sehr scharfen, sehr hellen, blauen Augen in die Welt hinaussah, etwas nach vorn geneigt trug, wie es Leute an sich haben, die ihr Leben über Bücher gebückt zubringen.
Man brauchte nicht zu raten, ob er in seiner Jugend ein schöner Mann gewesen sein mochte, denn als ein solcher konnte er heute noch zweifellos gelten mit seinen regelmäßigen, edlen Zügen, und nur gewisse Falten um seinen ganz zweifellos schönen Mund konnten darauf schließen lassen, dass sein Leben nicht ganz ruhig oder sorgenfrei gewesen sein mochte; ja, diese Falten hätten einem Menschenkenner wohl zu raten gegeben, ob sie nicht vielleicht eine Warnungstafel seien.
Dieses Paar und die junge Dame, die sich gegenseitig völlig fremd waren, saßen eine Weile zusammen, ohne Notiz voneinander zu nehmen, dann aber glitt der älteren Dame ihr Handtäschchen hinab in den Sand, und ehe sie sich danach bücken konnte, hatte es die Jüngere schon aufgehoben und ihr überreicht, wodurch sie allein schon den Beweis erbrachte, in der Tat gut erzogen zu sein.
Die ältere Dame war mit ihrem Dank für die kleine Aufmerksamkeit fast überschwänglich, sie konnte sich gar nicht genug damit tun.
»Aber ich bitte Sie – es ist doch so selbstverständlich und lohnt wirklich nicht, davon zu reden«, schnitt die Jüngere endlich den Dankesstrom in einem Tone ab, den die andere auch als endgültig anerkannte.
Sie sagte mit einem verbindlichen Lächeln, das ihr gut stand, aber nicht ganz überzeugend wirkte: »Nun, um so besser für Sie, wenn solche Dienste von Ihnen als selbstverständlich angesehen werden. Unsere Jugend von heute verwöhnt uns Alten im Allgemeinen nicht mehr. – Doch um von etwas anderem zu reden: Ich hoffe, wir haben Sie in Ihrer Betrachtung dieses unvergleichlichen Panoramas nicht gestört?«
»Gewiss nicht, denn ich kann es doch nicht für mich allein beanspruchen. Außerdem wird es wohl an der Zeit sein, sich davon zu trennen«, erwiderte die Jüngere mit einem Blick auf ihre Uhr.
»Ja, wir waren eigentlich auch auf dem Wege zum Vaporino, der uns zur Stadt zurückführen soll, aber ich war, ehrlich gesagt, etwas müde und diese Bank so ungemein verlockend«, plauderte die Ältere. »Sehen strengt doch recht an, und wir haben den Vormittag im Dogenpalast verbracht mit seinen vielen, vielen Treppen. Nun, wir dürfen uns die Ruhe schon gönnen, denn es erwartet uns niemand, während dies bei Ihnen gewiss der Fall sein wird.«
Die Jüngere lächelte ein wenig, wobei zwei reizende Grübchen in ihren weichen Wangen erschienen; es war ein gutmütig amüsiertes Lächeln über die etwas gar zu offen gezeigte Neugierde ihrer Nachbarin. »Nein«, erwiderte sie freundlich, »auch mich erwartet niemand; ich bin ganz allein hier.«
»Allein?«, wiederholte die Ältere ganz entsetzt. »Ist das – ich meine, ist das nicht – verzeihen Sie mir, aber es tut mir immer so weh, wenn ich jemand treffe, der allein und freundlos in der Welt steht«, setzte sie mit einem so herzlich-mütterlichen Ton hinzu, dass die junge Dame, sichtlich angenehm berührt, sich zum ersten Male ganz nach ihr herumwendete.
Doch ehe sie noch etwas erwidern konnte, zog der Herr mit einem ungemein gewinnenden Lächeln seines schönen, fein geschnittenen Mundes den Hut und rief mit einer Stimme, deren Wohlklang geradezu bestrickend war: »Gestatten Sie mir, mich der Bitte meiner Frau um Verzeihung anschließen zu dürfen. Das weiche, stark fühlende Herz hat sie wieder einmal fortgerissen. Im übrigen muss ich aber schon gestehen, dass ich sie verstehe und ihre Gefühle teile.«
»Ich wüsste wirklich nicht, was dabei zu verzeihen wäre, wenn einem unerwartet ein gutes Wort gesagt wird, für das man ja nur dankbar sein kann«, erwiderte die junge Dame nicht nur verbindlich, sondern tatsächlich warm berührt. »Um ehrlich zu sein: Dass ich allein in der Welt stehe, war mir eben gerade angesichts dieser purpurnen Sonnenuntergangspracht recht sehr zum Bewusstsein gekommen. Aber ich kann darum doch nicht sagen, dass ich freundlos bin. Auch habe ich ein halbes Dutzend Verwandte, die sich für verpflichtet halten, mir mehr gute Ratschläge zu geben, als ich beim besten Willen im Laufe meines Lebens befolgen könnte«, schloss sie mit einem fröhlichen Lachen.
»Ach ja – diese lieben, zärtlichen Verwandten!«, seufzte die Ältere. »Ich kenne sie, diese guten Ratschläge, die einen schön in den Sumpf führen würden, wenn man sie alle befolgen wollte. Wenn aber eine Reise nach Venedig dazu gehört –«
»Nicht eine Reise nach Krähwinkel gehört dazu!«, rief die Jüngere mit sichtlichem Vergnügen. »Ich freue mich schon wie ein König auf die brieflichen Abkanzelungen, die mir für meine Eigenmächtigkeit blühen! Aber wenn der Mensch sich nicht einmal und endgültig freimacht, dann bleibt er sein Leben lang ein Wickelkind, dessen Wiegenbänder von anderen in Bewegung gesetzt werden.«
»Mithin darf man wohl annehmen, dass Sie, meine Gnädige, Ihren werten Verwandten sozusagen – durchgebrannt sind? Das ist ja köstlich!«, rief der Herr mit lautem, sehr wohltönendem Lachen, in das die junge Dame mit rückhaltloser Heiterkeit einstimmte.
»Es wäre köstlich, wenn’s ganz dieser Auffassung entspräche«, rief sie lebhaft. »Es trifft aber nur im idealen Sinne zu, denn ich bin frei und unabhängig, und die verwandtschaftlichen Gängelbänder sind nur eine versuchte Fessel, gegen die ich einen ebenso erbitterten wie zähen Kampf zu führen entschlossen bin. Es geht nämlich wirklich keinen Menschen etwas an, was ich tue; solange ich damit in den Grenzen des Wohlanstandes bleibe, hat, meine ich, keine Seele etwas dareinzureden.«
»Bravo! In diesem Sinne wird jeder vernünftige Mensch auf Ihrer Seite stehen müssen«, lobte der Herr, beifällig seine weißen, wohlgepflegten Hände zusammenschlagend. »Es gibt da ein lateinisches Sprichwort, das man sehr gut auf Sie anwenden könnte: Quod licet Jovi, non licet bovi. Das heißt auf Deutsch: Was den Göttern erlaubt ist, ist noch lange nicht dem –«
»Ich kenne den Spruch und bedanke mich schönstens für das Kompliment«, fiel die junge Dame ein. »Woher aber wollen Sie wissen, dass ich in diesem Sinne zum Geschlecht der Götter und nicht zur Sippe der Wiederkäuer gehöre?«
»Weil ich mir einbilde, ein Paar Augen im Kopfe zu haben«, erwiderte der Herr fein.
»Nein, diese Jugend von heute!«, fiel seine Frau ein. »In meiner Jugend sah man ein junges Mädchen, das Latein lernte, für eine Art von Auswuchs ihres Geschlechtes an. Ich für meinen Teil finde es aber sehr richtig, dass man lernt, was einem geboten wird – besser zu viel als zu wenig. Ich wollte, ich hätte diese Gelegenheiten gehabt; denn als die Frau eines Gelehrten kommt man sich manchmal recht unwissend vor. – So, so! Also Sie haben sich losgeschält und sind auf Reisen gegangen! Ich finde das wundervoll; denn Reisen erweitern den Horizont. Oder ist Venedig Ihnen nur ein Versuch, um die Schwingen zu prüfen, wie weit sie tragen?«
»Ja und nein«, sagte die junge Dame nach einer kleinen Pause. »Ich bin ein impulsiver Mensch und glaube, dass einen das Glück nicht aufsucht, sondern dass man ihm entgegenkommen muss. Und so hat sich denn die felsenfeste Idee in meinem Kopfe eingekapselt, dass ich in Italien das, was ich suche, finden werde. Ich muss nun abwarten, ob dieses Vorgefühl richtig und der Wunsch nicht nur der Vater des Gedankens war, denn ich bin erst gestern Abend hier angekommen.«
Die ältere Dame wechselte mit ihrem Gatten einen raschen Blick. »Sie wollen also hier etwas finden?«, fragte sie. »Verzeihen Sie mir, bitte, wenn ich daran eine vielleicht indiskrete Bemerkung knüpfen möchte. Offen gesagt: Sie sehen nicht aus, als ob Sie eine – Stellung suchten!«
»Nein, eine eigentliche Stellung suche ich auch wirklich nicht«, erwiderte die junge Dame. »Aber irgendein Zustand, den man mit au pair annähernd bezeichnen könnte, würde mir passen. Ich spreche die Weltsprachen fließend und habe es gelernt, zu reisen, was auch eine Kunst ist; denn viele Menschen verstehen nichts davon und sind rettungslos die Beute des ersten Gepäckträgers, dem sie sich anvertrauen. Natürlich möchte ich auch nicht mit jedermann reisen wollen, nicht mit Leuten, die zwar das Geld dazu haben, denen aber die notwendigste Bildung fehlt. Das wäre dann freilich eine ›Stellung‹ und noch dazu eine sehr harte.«
Wieder wechselten der Herr und die Dame einen Blick, und dann sagte die letztere: »Wie eigentümlich sich das doch fügt! Wir selbst –«
»Wir selbst wissen nämlich zufällig, dass jemand eine solche Reisegefährtin sucht«, fiel der Herr ein, indem er die Hand auf den Arm seiner Frau legte und diesen leicht drückte. »Wer weiß, ob das nicht etwas für Sie wäre, meine Gnädigste! Wenn Sie bis morgen warten könnten, wären wir vielleicht in der Lage, die Sache in die Wege zu leiten.«
»Gewiss kann ich bis morgen warten, nachdem ich mich auf den Nimmermehrstag vorbereitet habe«, erwiderte die junge Dame lebhaft. »Wer sind denn diese vom Himmel auf mich herabfallenden Leute?«
»Darüber möchte ich vorläufig noch nicht sprechen«, entgegnete der Herr. »Zunächst würde es wohl zu einer Vorbereitung der Angelegenheit notwendig sein, die Personalien auszuwechseln – nicht wahr? Gestatten Sie mir, mich Ihnen vorstellen zu dürfen: Doktor von Eckschmidt, Privatgelehrter – meine Frau.«
»Ich heiße Dorothee von Ammerland und bin die Tochter des im vorigen Jahre verstorbenen ersten Botschaftsrates von Ammerland in London«, stellte sich die junge Dame ihrerseits vor.
»Die Tochter Friedrich von Ammerlands! Wie doch das Leben die Menschen zusammenführt!«, rief Eckschmidt aus. »Ihr Herr Vater und ich waren zusammen auf der Universität in Heidelberg, und wenn wir auch verschiedenen Fakultäten angehörten – er studierte Jura, ich Philologie –, so waren wir doch eng befreundet und er ein häufiger Gast auf meiner bescheidenen Bude. Später hat das Leben uns auseinandergeführt, wie das so zu gehen pflegt. Und er ist nun schon seit einem Jahre tot!«
»Ich erinnere mich, es in der Zeitung gelesen zu haben«, murmelte Frau von Eckschmidt teilnehmend. »Und nun stehen Sie ganz allein in der Welt, liebes Fräulein?«
Dorothee nickte. Sie hatte eine dunkle Erinnerung, als ob ihr Vater einmal etwas von einer Person dieses nicht gewöhnlichen Namens erzählt hätte, aber was es gewesen, war ihr entfallen – für den Augenblick wenigstens, und da sie nicht mehr wusste, ob das Gehörte und wieder Vergessene zum Vorteil oder zum Nachteil des Betreffenden gewesen, so sagte sie lieber nichts von dieser Erinnerung. »Gestatten Sie mir, Ihnen meine Verhältnisse klarzulegen«, fuhr sie stattdessen fort. »Mein Vater hat mich nicht mittellos zurückgelassen, und nach der Ansicht meiner Verwandten, die sich nach seinem Tode meiner annahmen, das heißt mir Ratschläge gaben, besitze ich genug, um in einer kleinen Stadt sehr bequem leben zu können, sintemalen ich ›in meinem Eigensinn‹ nicht dazu zu bringen war, mich bei einem meiner Sippe nützlich zu machen oder mit jemand zusammenzuziehen – kurz, meine goldene Freiheit aufzugeben, an die ich als meines Vaters repräsentierende Hausdame gewöhnt war. Ich habe aber trotzdem die Schwäche gehabt, mich in die kleine Stadt mit dem bequemen Leben hineinreden zu lassen, und wusste natürlich nach ein paar Monaten schon, dass es damit für mich, die ich in verschiedenen Hauptstädten Europas gelebt, nichts war. Ein Jahr hab’ich’s in dem nüchternen kleinen Neste mit seinen Klatschkaffees ausgehalten und mir überall dabei moralisch blaue Flecke gestoßen; jetzt aber habe ich, kurz entschlossen und ohne jemand um Rat zu fragen, meine Zelte dort abgebrochen und bin nun auf dem Wege nach Rom, wo ich vielleicht finden kann, was ich suche; denn dort strömt ja alle Welt zusammen. Wer weiß, ob sich nicht dort jemand findet, dem als Gegenleistung für die Reisekosten meine Kenntnisse von Wert sind – falls die Gelegenheit, von der Sie, Herr Doktor, sprachen, sich als eine Seifenblase herausstellt.«
»Ich möchte fast glauben«, erklärte Doktor von Eckschmidt nachdenklich, »dass die Sache sich machen dürfte; denn die Leute, die ich im Auge habe, suchen eine junge Dame aus guter Familie, vielseitig gebildet, heiteren Gemüts und – völlig unabhängig. Ich meine das letztere in dem Sinne, dass es der Gesuchten infolge fehlender Familienbande nichts ausmacht, wenn die Reise auch ein bisschen weit geht und sich in die Länge zieht. – Um nun eine Stunde für morgen festzusetzen: Würde es Ihnen passen, wenn wir uns – sagen wir auf fünf Uhr nachmittags verabredeten? Unser Hotelzimmer ist ein wenig beschränkt im Raume, und ich fürchte, dass es mit dem Ihrigen ebenso der Fall ist.
Aber die notwendigen Präliminarien lassen sich auch ganz gut unter freiem Himmel besprechen – nicht wahr? Natürlich nicht in der unmittelbaren Nähe zuhörender Fremder, die es nichts angeht – das wäre ja peinlich. – Könnten Sie vielleicht einen Vorschlag machen?«
»Dann treffen wir uns am einfachsten vielleicht wieder hier«, schlug Dorothee vor.
»Hier wimmelt es oft geradezu von Fremden, namentlich, wenn, wie morgen, Konzert ist«, rief Doktor von Eckschmidt abwehrend. »Aber es gibt ja noch andere Plätze in Venedig, wo man ungestört reden kann. Zum Beispiel der Klosterhof von San Stefano.«
»Gewiss – um diese Zeit ist dort selten ein Fremder zu sehen, wenn es schon ein dritter Ort sein soll«, stimmte Dorothee zu. »Mein Zimmer ist aber ganz geräumig und steht Ihnen gern zur Verfügung.«
»Lassen wir es bei meinem Vorschlag, wenn er Ihnen sonst genehm ist«, erwiderte der Doktor. »Ich möchte Sie in keiner Weise belästigen, und es wäre auch schade, bei diesem herrlichen Wetter im Zimmer zu sitzen.«
»Wie Sie wollen«, gab Dorothee nach. »Also morgen Nachmittag um fünf Uhr im Klosterhofe von San Stefano. Und, um Ihnen eventuell einen Weg zu ersparen, wenn Sie fünfzehn Minuten nach fünf Uhr nicht dort sind, dann nehme ich an, dass aus der Sache nichts werden kann und trolle mich. Ist’s Ihnen so recht?«
»Vollkommen«, sagte der Doktor verbindlich. »Aber noch eins: Bitte, reden Sie über die Angelegenheit vorläufig nicht mit Ihren Freunden oder Bekannten im Hotel –«
»Natürlich nicht – schon nach dem Grundsatz: Zu Nürnberg hängt man keinen nicht, bevor man ihn denn hätt’«, fiel Dorothee lachend ein. »Außerdem kenne ich keine Seele in dem Hotel. Die Leute, neben denen ich bei Tisch sitze, sind Banausen und Barbaren, die ganz unsprechbar sind; sie werden wohl morgen schon wieder fort sein; denn in Venedig ist ja bekanntlich für diese Leute nichts zu sehen. Und zum dritten: Ich gehöre nicht zu den Plappermäulern, die unbedingt jedem, der es hören oder nicht hören will, ihre persönlichen Angelegenheiten erzählen müssen. – So, und nun muss ich wirklich heim. Schildern Sie mich, bitte, Ihren Freunden in glühenden Farben – oder besser noch, in recht matten, damit die Enttäuschung keine zu große ist. Auf Wiedersehen morgen – oder, wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt in Venedig.«
Mit diesen Worten hatte Dorothee sich erhoben, ihren neuen Bekannten eine verbindliche, aber keineswegs untertänige Verbeugung gemacht und schritt dann der Landungsstelle für die Dampfer nach Venedig zu.
›Nein, welch drollige, kleine, spitze Puppennase in dem großen Vollmondgesicht dieser Frau!‹ dachte sie unterwegs. ›Ob die beiden morgen kommen werden? Ich glaub’s nicht. Aber es tut nichts; denn es ist sehr schön im Klosterhofe von San Stefano, auch wenn man allein dort ist.‹
2. Kapitel
Sie kamen aber doch, und zwar waren sie dort, bevor Dorothee den malerischen Hof mit den grotesk verwischten Fresken Pordenones über dem Kreuzgange betrat. Sie standen vor dem erhöhten Mittelteil des Hofes, und Frau von Eckschmidt ließ eine der stets hier anwesenden, neben dem Pozzo (Ziehbrunnen) sich sonnenden Katzen mit der Quaste ihres Sonnenschirms spielen, während ihr Gatte dabei stand und mit seinem gewinnenden Lächeln zusah.
›Der Mann muss, als er jung war, mit diesem Lächeln Eroberungen gemacht haben; es ist heut noch bezaubernd‹, dachte Dorothee, indem sie, durch die westliche Tür in den Hof tretend, das Idyll betrachtete.
»Nun dachte ich pünktlich zu sein, Sie aber haben mich übertroffen«, rief sie, näherkommend. »Offen gesagt – ich dachte nicht, dass Sie überhaupt kommen würden.«
»Warum?«, fragte Frau von Eckschmidt misstrauisch.
»Oh, ich bin doch schließlich nur eine auf der Straße aufgelesene Bekanntschaft«, meinte Dorothee harmlos. »Sie wissen nichts, reinweg nichts von mir. Man kann doch, um gerecht zu sein, solch ein Wesen kaum jemand empfehlen.«
»Nun, wir wissen, dass Sie die Tochter meines Jugendfreundes Fritz von Ammerland sind«, widersprach Eckschmidt liebenswürdig.
»Was noch zu beweisen ist«, fiel Dorothee ein. »Aber ich habe den Beweis mitgebracht – hier ist mein Reisepass, der meine Haare als ›strohblond‹ bezeichnet. Und was meinen Leumund anbelangt, so wird unser Botschafter in London gewiss gern Auskunft darüber geben«, schloss sie mit einem leisen Anflug von Hochmut.
»Die ›strohblonden Haare‹ sind eine Beleidigung schlechtweg«, meinte Doktor von Eckschmidt lächelnd, als er nach einer sehr genauen Durchsicht des Passes diesen seiner Inhaberin zurückgab. »Ferner gibt der Pass Ihnen vierundzwanzig Jahre. Das muss doch ein Irrtum sein!«
»Vierundzwanzig Jahre? Unmöglich!«, rief Frau von Eckschmidt mit ungeheucheltem Erstaunen. »Ich hätte Ihnen kaum mehr als zwanzig gegeben und muss gestehen, dass ich mich gefragt habe, was wohl Ihr Vormund zu Ihrem Ausfluge sagen würde!«
»Danke für das Kompliment«, sagte Dorothee heiter. »Dass ich ›wie höchstens zwanzig aussehe‹, ist einer der Gründe, weshalb meine Verwandten mich zu überwachen wünschen. Trotzdem ist mein Geburtsdatum kein Irrtum. Und darum –«
»Und darum –« fiel der Doktor im gleichen Tone ein, »die Leute, die sich gern Ihre liebenswürdige Gesellschaft sichern möchten, sind nämlich wir selbst!«
»Sie?«, rief Dorothee förmlich zurückprallend, denn der Gedanke war ihr nicht gekommen. Die Leute sahen anständig und gut aus, der männliche Teil sogar entschieden vornehm, aber sie hatten ihr nicht den Eindruck gemacht, als ob sie sich einen so besonderen Luxus wie eine Reisebegleitung leisten könnten. »Sie!«, wiederholte Dorothee mit einem sonderbaren Gefühl, dem sie keinen Namen geben konnte. »Darf ich fragen –«
»Wir sind gekommen, Ihnen unsere Vorschläge zu machen«, fiel Doktor von Eckschmidt ein. »Doch ehe ich dazu übergehe, sollen auch Sie wissen, dass wir wirklich die sind, als welche wir uns Ihnen vorstellten.«
Dorothee nahm ohne Ziererei und falsch angebrachter Höflichkeit die beiden Pässe entgegen, die ihr gereicht wurden, und las sie aufmerksam durch, wobei sie erfuhr, dass der Doktor mit Vornamen Kasimir hieß und seine Gattin Modesta eine geborene Taistrczinski war. Dass der Pass ihre Nase als ›auffallend klein, gerade und spitz‹ bezeichnete, hätte Dorothee fast lachen gemacht, ließ aber über die Identität der Inhaberin des Passes keinen Zweifel.
»Nach diesen Präliminarien, die notwendig waren, wollen wir nun zum Kern der Sache übergehen«, sagte Eckschmidt, indem er die Pässe wieder zu sich steckte. »Wir sind kinderlose Eheleute, Fräulein von Ammerland, und haben uns jetzt, nahe dem Abend unseres Lebens, aufgemacht, die Welt zu sehen, die uns manch ein widriges Geschick bisher verschlossen hielt. Ein Aufenthalt in Rom Ende des vorigen und Anfang dieses Jahres hat unseren Appetit auf die Wunder dieser Welt geweckt und verschärft, und nach einem kurzen Aufenthalt in der Heimat haben wir uns denn zur Reise gerüstet, auf deren Schwelle wir hier stehen. Wir denken jetzt zunächst wieder auf einige Zeit nach Rom zu gehen, dann über Neapel nach Ägypten, Indien, Japan und Amerika. Sind Sie mit von der Partie?«
»Rom, Ägypten, Indien, Japan und Amerika!«, wiederholte Dorothee überwältigt. Und dann lachte sie hellauf. »Ich müsste ja eine doppelt geflügelte Gans sein, wenn ich eine solche Gelegenheit an mir vorübergehen ließe«, sagte sie mit tiefster Überzeugung. Dann aber kam die Besinnung. »Und Ihre Bedingungen?«, fragte sie gespannt.
»Unsere Bedingungen stehen auf der Basis, die Sie gestern nannten – au pair«, erwiderte Doktor von Eckschmidt. »Wir tragen die Reisekosten, und Sie geben uns dafür Ihre jugendfrische Gesellschaft, Ihre Erfahrungen in fremden Ländern, Ihre Sprachkenntnisse und mir speziell Ihre gelegentliche Hilfe beim Ordnen meiner archäologischen Notizen. Ich will Sie damit nicht etwa ausnützen, sondern nur hin und wieder Ihren Beistand in Anspruch nehmen. Im übrigen nehmen Sie an all unseren Ausflügen und geselligen Freuden selbstverständlich teil. Sie haben nur einzuschlagen, und die Sache ist in aller Form geregelt. Wenn Sie aber Wert darauf legen, will ich gern einen schriftlichen Vertrag entwerfen, der von uns beiden unterzeichnet werden kann.«
»Herr Doktor, Ihr Vorschlag ist mehr als verlockend«, gestand Dorothee unumwunden ein. »Wenn ich Sie trotzdem um eine kleine Bedenkzeit bitte, so geschieht das im Geiste meines Vaters, der mir die Lehre gegeben hat, jeden Entschluss zweimal zu überlegen. ›Der Wahn ist kurz, die Reu’ist lang‹, hat ja auch Schiller schon gesagt. Darf ich Ihnen morgen meine Antwort bringen?«
Eckschmidt wechselte mit seiner Frau einen Blick. »Bitte, halten Sie uns nicht für ungefällig, wenn ich Ihnen erwidere, dass Sie sich heute noch entschließen müssen«, sagte er mit seinem gewinnenden Lächeln. »Wir sind nämlich durch unerwartete geschäftliche Angelegenheiten gezwungen, schon morgen früh nach Rom abzureisen, wo ich überdies auch gern sobald als möglich meine archäologischen Studien zum Abschluss bringen möchte, um beim Eintritt des Winters die Weiterreise nicht aufzuhalten. Die doppelte Überlegung eines Entschlusses ist sicherlich eine sehr weise Lehre – indes, selbst wenn Sie sich uns morgen früh schon anschließen, riskieren Sie nichts dabei. Sie sollen in keiner Weise durch Ihr ›Ja‹ an uns gebunden sein. Sagen wir Ihnen nicht zu, nun, dann sind Sie wieder frei und noch dazu in Rom, wohin Sie ja ohnedem zu reisen gedachten. Für den gleichen Fall würden wir uns aber als gebunden betrachten, eine Trennungsfrist festzusetzen, denn nichts liegt uns ferner, als Sie von heute zu morgen wie ein Findelkind auf die Straße zu setzen.«
Dorothee antwortete auf diese großmütigen Worte nicht gleich. Sie blickte hinaus in den Hof, in dessen Ecke nur noch ein letzter Sonnenstrahl fiel, und wieder kroch das unnennbare Gefühl wie vorhin durch ihre Glieder und machte sie frösteln.
Und dann sah sie all die Länder vor sich, nach denen ihre Seele sich sehnte, und der Trieb in die Ferne, der Wissensdurst, der in vielen Menschen so unwiderstehlich sich regt, überwältigte die unnennbare, namenlose Regung ihrer Seele.
»Um wie viel Uhr reisen wir morgen ab?«, rief sie heiter, indem sie dem Paar frank und frei ihre Hände reichte.
3. Kapitel
Venedig, 15. September
Für den Fall, dass meine kühne, aus dem tödlichen Einerlei der Kleinstadt entsprungene Idee, von irgendjemand auf eine Weltreise mitgenommen zu werden, Wirklichkeit werden sollte, war es von vornherein meine Absicht, ein Tagebuch zu führen. Denn ›Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen‹, heißt’s im Gedicht vom Herrn Urian. Aber um ›was erzählen‹ zu können, muss man erstens Augen haben, die da sehen können, und zweitens alles, was man sieht und erlebt, fein säuberlich aufschreiben, sintemalen man sonst vieles vergisst, vieles sich im Gedächtnis vergrößert oder verkleinert und man im ersteren Falle unwillkürlich ins Aufschneiden gerät. Aber nicht nur aus diesen Gründen habe ich ein Tagebuch geplant, sondern in erster Linie entsprang der Wunsch dem kühnen Gedanken, über meine Reise, die gestern noch eine halbe – nein, eine ganze Unmöglichkeit, eine Fantasterei zu sein schien, ein ›epochemachendes‹ Werk zu schreiben, wozu wiederum ein Tagebuch sich als eine dringende Notwendigkeit ergibt, ein Tagebuch, zielbewusst und getreu geführt, ohne sentimentalen Unsinn und blödsinnige Gefühlsergüsse, wozu ich übrigens absolut nicht neige. Amüsante und flotte Reisebeschreibungen werden immer gern gelesen, vorausgesetzt, dass der Verfasser kein Philister ist. Also habe ich mir auf dem Heimwege von San Stefano dieses Heft gekauft und beginne es am Vorabend unserer Abreise.
Unserer! Ich und zwei Menschen, die ich gestern zum ersten Male und ganz zufällig gesehen! Wirklich ganz zufällig? Mein Vater pflegte zu sagen, dass es keinen Zufall gibt, dass das, was man so nennt, immer das Glied einer Kette ist, die zu einem ganz bestimmten Ziele leitet. Nun, wenn dieses Ziel wirklich die angenehme und restlose Erfüllung meiner Reisesehnsucht bedeutet, dann will ich für das Wort ›Zufall‹ gern ›Bestimmung‹ schreiben.
Ich reise also morgen früh mit meinen – wie soll ich sie nennen? Gefährten? Herren? – Doktor Kasimir von Eckschmidt und seiner Gattin Modesta nach Rom ab. Wer sind diese Leute? Nun, ich habe ihre Pässe mit eigenen Augen gelesen, habe dabei aber ganz übersehen, wo sie ausgestellt sind. Außer diesen trockenen Angaben weiß ich nichts von ihnen, nichts über ihre berechtigten und unberechtigten Eigentümlichkeiten, nichts über ihre Lebensführung und soziale Stellung, nichts über ihren Leumund. Um gerecht zu sein: Sie wissen genau eben soviel von mir, wie ich von ihnen, aber ich habe mich doch wenigstens auf den guten Onkel Botschafter berufen, bei dem ich einen so dicken Stein im Brett habe oder doch hatte. Nein – habe, denn er ist keiner von denen, die einen Menschen nicht mehr kennen, wenn er ihnen aus den Augen gerückt ist. Er nicht! Über Herrn Kasimir und Frau Modesta erlaube ich mir jedenfalls noch kein Urteil. Der Mann ist anziehend, darüber ist keine Frage, er ist ein Gentleman und kein Philister, trotzdem er ein Gelehrter ist. Aber trotz seiner unzweifelhaften Überlegenheit an Bildung über seine im übrigen durchaus gesellschaftlich gewandte Frau habe ich den Eindruck, als ob sie von den beiden der Meistergeist wäre. Es ist wahr, sie hat ihrem Manne gestern wie heute in allem das Wort gelassen, aber vielleicht nur darum, weil er in der Beherrschung desselben gewandter ist. In ihren Augen, die gewiss schön wären, wenn ihnen die dichten, geraden, schweren Brauen nicht etwas Finsteres gäben – in ihren Augen liegt etwas, das ich schon bei jemand gesehen, den mein Vater einen Intriganten genannt, einen Menschen, der nach seinem Urteil unablässig etwas plante, krumme und gerade Wege ging und über Leichen schritt, um vorwärtszukommen. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass Frau Modesta ein solcher Mensch ist, es sind nur ihre Augen, die mich darauf gebracht. Aber dann ist’s auch ihr Mund, der zum Nachdenken anregt; er ist viel zu voll und würde sicher ordinär sein, wenn er nicht so fest geschlossen wäre. Das ist kein Mund, der die Gedanken seiner Inhaberin ausplaudert, ein Mund, der Geheimnisse verschweigen kann, und er passt durchaus zu den Augen. Dabei widerspricht die lächerliche, spitze, kleine Puppennase Augen und Mund mit einer geradezu grotesken Entschiedenheit.
Nun, die Zeit wird es schon lehren, inwiefern die Widersprüche im Gesicht der Frau Modesta zusammenklingen. Sie war übrigens heute Nachmittag ganz reizend zu mir und konnte nicht genug versichern, mit welcher Freude sie meiner ›jugendfrischen Gesellschaft‹ entgegensieht usw.
Das ›Undsoweiter‹ bezieht sich übrigens nur auf meine Bescheidenheit, die mir nicht erlaubt, alles zu wiederholen, was Frau Modesta mir gesagt, und soll gewiss keinen Zweifel in die Aufrichtigkeit des Gesagten ausdrücken. Oder doch? Weil’s mir scheinen wollte, dass weniger mehr gewesen wäre?
Für alle Fälle: Schluss für heute, denn es ist schon spät, und unser Zug geht morgen sehr früh ab.
Nein, ich muss mir noch etwas notieren, denn es ist entschieden komisch. Ich habe nicht erfahren können, wo Eckschmidts hier in Venedig wohnen. Als ich ihn danach fragte, für den Fall noch etwas zu besprechen wäre, da fiel sie mit einer anderen Frage ein; und als ich sie dann fragte, da hatte er gerade etwas anderes zu sagen, und das wiederholte sich noch ein paarmal – ob sie beide der Antwort ausweichen wollten? Und was hätte das dann zu bedeuten? Fürchten sie, dass ich ihnen in letzter Stunde noch absagen könnte? Das ist natürlich eine müßige Frage; denn da sie gar nicht wissen können, was ich ihnen leisten werde, so wäre es ganz unangebracht, mein etwaiges ›Kneifen‹ verhindern zu wollen. Auch eine andere Erklärung, dass sie vielleicht in einem so dürftigen Gasthofe wohnen, dass sie sich genieren, ihn zu nennen, zieht nicht in Anbetracht der Großartigkeit ihrer Reisepläne, die eine dritte Person mit allem, was darum und daran hängt, einschließen. Ich finde wirklich keine einleuchtende Erklärung für die Tatsache, dass Eckschmidts mir entschieden ihre venezianische Adresse nicht mitteilen wollten, aber doch scheinen sie darin mit völliger Übereinstimmung gehandelt zu haben. Nun, vielleicht komme ich noch dahinter, was das zu bedeuten hat; und wenn nicht, dann tut’s auch nichts. Sie werden wohl noch andere Eigentümlichkeiten haben, die mich mehr angehen als diese!
4. Kapitel
Rom, 16. September.
Rechtschaffen müde bin ich zwar nach der langen, heißen Fahrt, aber da ich noch nicht schlafen kann und wahrscheinlich bei dem Höllenlärm drunten auf der Straße auch sobald nicht schlafen werde, so will ich doch meine Eindrücke von der Reise niederschreiben. Als ich dieselbe Fahrt zum letzten Male nordwärts gemacht, war ich ein krasser Backfisch; Vater war nach Paris versetzt worden und schied sehr, sehr ungern von dem ihm so lieb gewordenen Rom – und ich auch. Ich dummes Mädel krankte nämlich an einem ›Schwarm‹, einem Bazillus, den ich mir auf einem ›Lämmerhüpfen‹ bei der guten alten Marchesa Aquilabianca, meiner Gönnerin, geholt. Ich war damals im Institut der Damen del Sacro Cuore auf Santa Trinitá de’Monti als Pensionärin, denn da mein Vater Witwer war, konnte er mich in diesem Alter nicht gut bei sich zu Hause haben und meine Erziehung überwachen. Ich durfte vom Institut aus, unter den Fittichen der guten Marchesa, besagtes Lämmerhüpfen mitmachen, und ich weiß noch heute, dass es wundervoll war. ›Er‹ hieß Don Ferrando Roccasanta und war entschieden zu alt für den Kreis kurzröckiger und bezopfter Mädel, übrigens trotzdem noch ein junger Mann. Er tanzte achtmal mit mir und brachte mir ebenso oft Bonbons. Aber das gehört ja eigentlich gar nicht in das Tagebuch meiner Weltreise!
Die diesmalige Fahrt von Venedig nach Rom war trotz der Hitze und ihrer Länge ein Genuss, und mir scheint, als ob mein Enthusiasmus meine Begleiter auch etwas angesteckt hätte. Schon die Fahrt durch die Apenninen, zwischen Bologna und Florenz, war trotz der vielen Tunnels köstlich durch die Blicke in diese fremde Alpenwelt mit ihren grünen Tälern und Abhängen, die im Schmuck des sie bedeckenden blühenden Ginsters wie vergoldet aussahen, bekrönt von festungsartigen Bergschlössern. Und dann, hinter der alten, an Kunstwerken so reichen Stadt Pistoja der erste Blick auf Florenz, die herrliche Blumenstadt, tief unten im Arnotal, überragt von der Kuppel des Domes und dem schlanken Campanile des Giotto, der in seiner vielfarbigen Marmorpracht am blauen Himmel steht wie eine fremdartige Riesenlilie.
Und die Strecke zwischen Florenz und Rom! Erst durch die grüne, lachende Landschaft von Toskana mit ihren Villegiaturen, dann vorbei an dem blauen See von Trasimeno, der, von der westlich sich neigenden Sonne beleuchtet, wie ein heller Saphir in seinen grünen Ufern eingebettet liegt. Bei Orvieto erreicht die Bahn dann den Tiber und folgt seinen Windungen bis zur Ewigen Stadt. Diese Strecke hat ihren eigenen Zauber durch die vielen Schlösser und Ruinen, die von einer fernen, wilden Zeit erzählen. Hinter Orvieto lässt man den Monte Amiata mit seinem Höhenzug zurück und über Civita Castellana grüßt dann der viel bestiegene Monte Soracte und weiter südlich der prachtvolle Kegel des Monte Rotondo herüber; dann endlich wird Prima Porta mit der Villa Livia sichtbar, ehe die Bahn hinter dem Bergkegel von Castello Giubileo vorüberläuft. Noch eine kurze Windung, dann erscheint der Monte Mario mit der Villa Madama wie ein Juwel an der Brust, und die Riesenkuppel von Sankt Peter steht wie eine purpurne Silhouette im letzten Dämmern des scheidenden Tages am blutroten Horizont – wir sind in Rom!
Ja, in Rom, in einem Hotel durchaus nicht ersten Ranges, und von meinem Fenster kann ich die von den elektrischen Bogenlampen fantastisch beleuchteten Ruinen der Diokletiansthermen sehen.
Herr Kasimir und Frau Modesta schlafen nebenan wohl schon längst den Schlaf der Gerechten – –
Ich aber kann wirklich nur sagen, dass sie sehr nett zu mir waren, sehr besorgt für mein leibliches Wohl. Er ist ohne Zweifel ein Mann von gründlichem, ja universalem Wissen, durch das ich nur profitieren kann. Seine Frau ist ja sehr weltgewandt, aber ich habe den Eindruck gewonnen, als ob ihr Wissen nicht nur Stückwerk, sondern ihre ganze Bildung nichts als ein glänzender Firnis ist, der etwas bedeckt, das ich noch nicht erfasst habe. Sie braucht deswegen noch lange nicht aus ungebildeten Verhältnissen zu stammen, dazu sind ihre Manieren zu gut und machen nicht den Eindruck des künstlich Erworbenen, sondern der Kinderstube, die sich nie verleugnet. Indes, die Bildung, wie ich sie verstehe, braucht jemand nicht Herzenssache zu sein, sondern eben nur ein notwendiges Übel, das man sich aneignet, ohne es in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Eben, was man halt ›Firnis‹ nennt! Ich habe viele solcher Leute kennengelernt und habe auch oft erkannt, was er bedeckte: Dummheit, die freilich bei Frau Modesta ausgeschlossen ist, Faulheit und Indolenz; es kann aber auch noch andere Faktoren geben, die ich nicht kenne; und wenn ich Frau Modesta daraufhin studieren möchte, so soll das nicht Undank sein für alles mir bisher erwiesene Gute, sondern einfach eine Bereicherung meiner Menschenkenntnisse, und weil ich dabei bleibe, dass sie von beiden der spiritus rector ist. ›Meistergeist‹ ist wohl nicht die richtige Übersetzung dieser Bezeichnung, denn Herrn Kasimirs Geist ist der größere; vielleicht könnte man’s damit umschreiben, dass sie die Fäden des Marionettenspiels in den Händen hält.
Sie war, ebenso wie ihr Gatte, sehr besorgt für mein leibliches Wohl während der ganzen Fahrt. Ihr Erstes war, dass sie mir, noch in Venedig auf dem Bahnhofe, zum Schutze meines Teints gegen Zugluft und Kohlenstaub einen dicken, blauen Schleier aufschwatzen wollte. Ich trage aber niemals einen Schleier und habe mich auch deshalb mit Händen und Füßen gegen das blaue Gazeungetüm gewehrt und bin siegreich aus dem harten Kampfe gegen ihre gutmütige Fürsorge hervorgegangen.