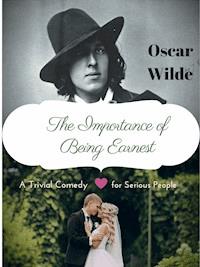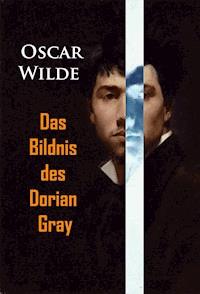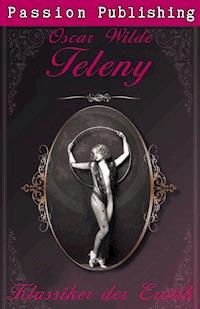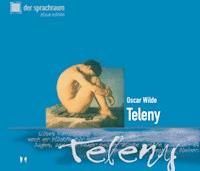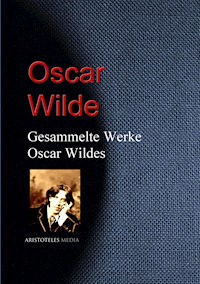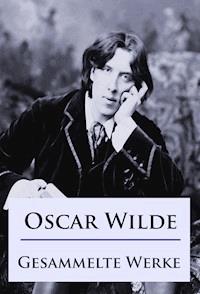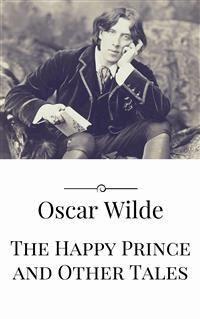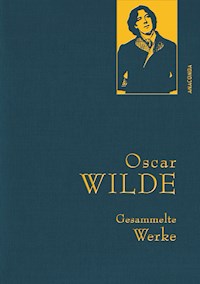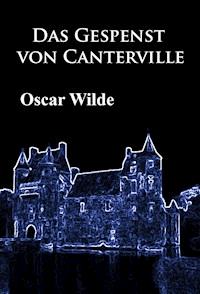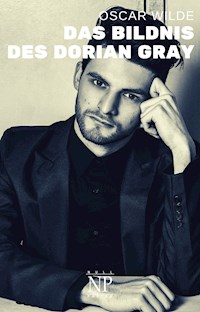
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Horror bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Für den Müßiggänger Dorian Gray wird der ewige Menschheitstraum wahr: Er kann nicht altern. Stattdessen altert sein gemaltes Porträt. Sein Aussehen ebnet ihm den gesellschaftlichen Erfolg, Jahr ums Jahr zieht ins Land, aber Dorian Gray bleibt der begehrenswerte, blendend aussehende Jüngling. Während er immer maßloser und grausamer wird, bleibt sein Äußeres jung und makellos schön. Nur der Maler seines Bildes schöpft Verdacht, zu wunderlich scheint ihm Grays Alterslosigkeit. Das Geheimnis droht entdeckt zu werden. "Das Bildnis des Dorian Gray" ("The Picture of Dorian Gray") ist der einzige Roman des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Das seinerzeit als anrüchig geltende Werk war auch Gegenstand des Unzuchtprozesses gegen Wilde. Der Roman gilt als Oscar Wildes Hauptwerk und ist ein Klassiker der Weltliteratur. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Oscar Wilde
Das Bildnis des Dorian Gray
Oscar Wilde
Das Bildnis des Dorian Gray
(The Picture of Dorian Gray)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: J. SchulzeÜbersetzung: Gustav Landauer, Hedwig Lachmann EV: Insel-Verlag, Leipzig, 1914 4. Auflage, ISBN 978-3-954180-84-4
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zu Dorian Gray
Das Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Horror bei Null Papier
Vampire - Tödliche Verführer
Frankenstein
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Dracula
Das Bildnis des Dorian Gray
Der Golem
Japanische Geistergeschichten
Die vergessene Welt
Das Ende der Welt
Horror
und weitere …
Vorwort zu Dorian Gray
Der Künstler ist der Schöpfer schöner Dinge.
Die Kunst zu offenbaren und den Künstler zu verstecken ist die Aufgabe der Kunst.
Der Kritiker ist der, der seinen Eindruck von schönen Dingen in eine neue Form oder ein neues Material übertragen kann. Die höchste wie die niederste Form der Kritik ist eine Art Selbstbiografie.
Wer hässlichen Sinn in schönen Dingen findet, ist verderbt, ohne Anmut zu haben. Das ist ein Fehler.
Wer schönen Sinn in schönen Dingen findet, gehört zum Reiche der Kultur. Für ihn ist Hoffnung.
Die sind die Auserwählten, denen schöne Dinge einzig Schönheit bedeuten.
So etwas wie ein moralisches oder unmoralisches Buch gibt es nicht. Bücher sind gut geschrieben oder schlecht geschrieben, weiter nichts.
Das Missfallen des neunzehnten Jahrhunderts am Realismus ist die Wut Kalibans, der sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht.
Das Missfallen des neunzehnten Jahrhunderts an der Romantik ist die Wut Kalibans, der sein eigenes Gesicht nicht im Spiegel sieht.
Das moralische Leben des Menschen bildet einen Teil des Stoffgebiets des Künstlers, aber die Moralität der Kunst besteht im vollkommenen Gebrauch eines unvollkommenen Mittels.
Kein Künstler will etwas beweisen. Selbst Wahrheiten können bewiesen werden.
Kein Künstler bat ethische Sympathien. Eine ethische Sympathie bei einem Künstler ist eine unverzeihliche Manieriertheit des Stils.
Kein Künstler ist je dekadent. Der Künstler kann alles ausdrücken.
Denken und Sprechen sind für den Künstler Mittel einer Kunst.
Laster und Tugend sind für den Künstler Material einer Kunst.
Vom Standpunkt der Form ist das Urbild aller Künste die Kunst des Musikers. Vom Standpunkt des Gefühls ist das Handwerk des Schauspielers das Urbild.
Alle Kunst ist zugleich Oberfläche und Symbol. Wer unter die Oberfläche geht, tut es auf eigene Gefahr.
Wer das Symbol deutet, tut es auf eigene Gefahr.
Den Beschauer und nicht das Leben spiegelt die Kunst in Wahrheit.
Meinungsverschiedenheit über ein Kunstwerk zeigt, dass das Werk neu, vielfältig und bedeutend ist.
Wenn die Kritiker uneins sind, ist der Künstler einig mit sich selbst.
Wir können einem Menschen verzeihen, dass er etwas Nützliches gemacht hat, solange er es nicht bewundert. Die einzige Entschuldigung dafür, dass einer etwas Nutzloses gemacht hat, ist, dass man es sehr bewundert.
Alle Kunst ist völlig nutzlos.Oscar Wilde
Das Buch
Für den Müßiggänger Dorian Gray wird der ewige Menschheitstraum wahr: Er kann nicht altern. Stattdessen altert sein gemaltes Porträt.
Sein Aussehen ebnet ihm den gesellschaftlichen Erfolg, Jahr ums Jahr zieht ins Land, aber Dorian Gray bleibt der begehrenswerte, blendend aussehende Jüngling. Während er immer maßloser und grausamer wird, bleibt sein Äußeres jung und makellos schön.
Nur der Maler seines Bildes schöpft Verdacht, zu wunderlich scheint ihm Grays Alterslosigkeit. Das Geheimnis droht entdeckt zu werden.
»Das Bildnis des Dorian Gray« (»The Picture of Dorian Gray«) ist der einzige Roman des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Das seinerzeit als anrüchig geltende Werk war auch Gegenstand des Unzuchtprozesses gegen Wilde.
Der Roman gilt als Oscar Wildes Hauptwerk und ist ein Klassiker der Weltliteratur.
Informationen über Gratisangebote und Neuveröffentlichungen unter:
www.null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel
Starker Rosenduft durchströmte das Atelier, und als ein leichter Sommerwind die Bäume im Garten hin und her wiegte, kam durch die offene Tür der schwere Geruch des Flieders oder der feinere Duft des Rotdorns.
Von dem Perserdiwan, auf dem er lag und nach seiner Gewohnheit unzählige Zigaretten rauchte, konnte Lord Henry Wotton gerade die süßduftenden und honigfarbenen Blüten eines Goldregenstrauchs gewahren, dessen zitternde Zweige die Last einer so flammenden Schönheit kaum tragen zu können schienen; und hie und da flitzten die fantastischen Schatten vorbeifliegender Vögel über die langen bastseidenen Vorhänge des großen Fensters und brachten eine Art japanische Augenblickswirkung hervor, sodass ihm die blassen, nephritfarbenen Maler Tokios einfielen, die vermittelst einer Kunst, die nicht anders als unbeweglich sein kann, den Eindruck der Raschheit und Bewegung hervorzurufen suchen. Das summende Murren der Bienen, die in dem langen ungemähten Gras hin und her taumelten oder mit eintöniger Hartnäckigkeit die staubiggoldenen Blütentrichter des wuchernden Geißblatts umkreisten, schienen die Stille noch drückender zu machen. Das dumpfe Getöse Londons klang wie das Schnarrwerk einer entfernten Orgel.
In der Mitte des Gemaches stand auf einer hoch aufgerichteten Staffelei das lebensgroße Porträt eines ungewöhnlich schönen jungen Mannes, und ihm gegenüber, etwas entfernt davon, saß der Künstler, der es gemalt hatte, Basil Hallward, dessen plötzliches Verschwinden vor einigen Jahren das Publikum erregt und so viele seltsame Vermutungen erweckt hat.
Als der Maler auf die anmutige Gestalt blickte, die er so schön in seiner Kunst gespiegelt hatte, überflog ein Lächeln der Freude seine Züge und schien auf ihnen verweilen zu wollen. Aber er fuhr plötzlich auf, schloss die Augen und drückte die Lider mit den Fingern zu, wie wenn er einen absonderlichen Traum, dessen Erwachen er fürchtete, im Hirne gefangen halten wollte.
»Es ist deine beste Arbeit, Basil, das Beste, was du je gemacht hast«, sagte Lord Henry mit müder Stimme. »Du musst es bestimmt nächstes Jahr ins Grosvenor schicken. Die Akademie-Ausstellung ist zu groß und zu gewöhnlich. Jedes Mal, wenn ich hinging, waren entweder so viele Menschen da, dass ich die Bilder nicht sehen konnte, und das war schrecklich, oder so viele Bilder, dass ich die Menschen nicht sehen konnte, und das war noch schlimmer. Das Grosvenor ist wirklich der einzige Ort, der in Frage kommt.«
»Ich denke nicht daran, es überhaupt auszustellen«, antwortete der Maler und warf den Kopf in der besonderen Art zurück, über die seine Freunde in Oxford so oft gelacht hatten. »Nein, ich stelle es nirgends aus.«
Lord Henry zog die Brauen hoch und blickte ihn durch die dünnen blauen Rauchgirlanden, die sich in fantastischen Windungen aus seiner schweren, opiumgetränkten Zigarette emporkräuselten, erstaunt an. »Nirgends ausstellen? Mein Lieber, warum? Hast du einen Grund? Was ihr Maler für kuriose Kerle seid! Ihr tut alles in der Welt, um berühmt zu werden. Sowie ihr es seid, scheint ihr des Ruhms überdrüssig. Das ist dumm von dir, denn es gibt nur ein Ding in der Welt, das schlimmer ist, als dass über einen geredet wird, nämlich, dass nicht über einen geredet wird. Ein Porträt wie dieses muss dich weit über alle jungen Leute in England heben und die Alten ganz neidisch machen – wenn alte Leute überhaupt einer Gemütsbewegung fähig sind.«
»Ich weiß, du wirst mich auslachen«, erwiderte jener, »aber ich kann es wirklich nicht ausstellen. Ich habe zu viel von mir selbst hineingebracht.«
Lord Henry streckte sich auf dem Diwan aus und lachte. »Ja, ja, das wusste ich, aber es ist völlig wahr, trotzdem.«
»Zu viel von dir soll darin sein! Auf mein Wort, Basil, ich wusste nicht, dass du so eitel bist; ich kann wahrhaftig nicht die geringste Ähnlichkeit zwischen dir mit deinem eckigen strengen Gesicht und deinen kohlschwarzen Haaren und diesem jungen Adonis finden, der aussieht, als sei er aus Elfenbein und Rosenblättern gemacht. Nein, lieber Basil, er ist ein Narcissus, und du – nun, natürlich hast du geistigen Ausdruck und so weiter. Aber Schönheit, wahre Schönheit hört auf, wo geistiger Ausdruck anfängt. Geist ist an sich eine Art Übertriebenheit und zerstört das Ebenmaß jedes Gesichts. Sowie man sich ans Denken macht, wird man ganz Nase oder ganz Stirn oder derart Grässliches. Betrachte die Männer, die in irgendeinem gelehrten Beruf Erfolg hatten. Wie vollendet hässlich sind sie! Ausgenommen natürlich die Männer der Kirche. Aber in der Kirche denken sie eben nicht. Ein Bischof bleibt dabei, mit achtzig Jahren dasselbe zu sagen, was man ihm als achtzehnjährigem Jungen beigebracht hat, und die natürliche Folge ist, dass er immer ganz wonnig aussieht. Dein geheimnisvoller junger Freund, dessen Namen du mir nie gesagt hast, dessen Bild mich jedoch wahrhaft bezaubert, denkt niemals. Das ist mir ganz sicher. Er ist so ein hirnloses, schönes Geschöpf, das wir im Winter immer haben sollten, wenn es keine Blumen gibt, auf die wir blicken können, und immer im Sommer, wenn wir etwas zur Abkühlung unseres Geistes brauchen. Schmeichle dir nicht, Basil: du hast nicht die mindeste Ähnlichkeit mit ihm.«
»Du verstehst mich nicht, Harry«, antwortete der Künstler. »Natürlich habe ich keine Ähnlichkeit mit ihm – das weiß ich sehr wohl. Ich wäre sogar traurig, wenn ich so aussähe wie er. Du zuckst die Achseln? Ich sage dir die Wahrheit. Es schwebt ein Verhängnis um alle körperliche und geistige Auszeichnung; die Art Verhängnis, die in der ganzen Geschichte den schwankenden Schritten der Könige auf dem Fuße zu folgen scheint. Es ist besser, sich nicht von seinen Genossen zu unterscheiden. Die Hässlichen und die Dummen sind in dieser Welt am besten daran. Sie können behaglich dasitzen und sorglos dem Spiel zuschauen. Wenn sie nichts von Siegen wissen, so ist ihnen dafür auch erspart, Niederlagen kennen zu lernen. Sie leben, wie wir alle leben sollten: sorglos, gleichgültig und ohne Unruhe. Sie bringen über andere kein Verderben und empfangen es auch nicht aus fremden Händen. Dein Rang und dein Reichtum, Harry; mein Hirn, wie es nun schon ist – meine Kunst, sie mag wert sein, was sie will – Dorian Grays schönes Äußere: wir werden alle drei unter dem leiden, was uns die Götter gegeben haben, schrecklich leiden.«
»Dorian Gray? So heißt er?« fragte Lord Henry und ging durch das Atelier auf Basil Hallward zu.
»Ja, so heißt er. Ich wollte dir den Namen nicht nennen.«
»Aber warum nicht?«
»Oh! Ich kann das nicht erklären. Wenn ich einen Menschen unmäßig lieb habe, sage ich nie jemandem seinen Namen. Es ist, als übergäbe man damit einen Teil von ihm. Ich bin dazu gekommen, das Geheimnis zu lieben. Das scheint allein imstande zu sein, das Leben unserer Zeit für uns zum Mysterium oder zum Wunder zu machen. Das gemeinste Ding ist voller Schönheit, wenn man es nur versteckt. Wenn ich die Stadt verlasse, sage ich den Menschen nie mehr, wohin ich gehe. Täte ich es, so büßte ich all meinen Genuss ein. Es ist eine törichte Gewohnheit, ich gebe es zu, aber irgendwie scheint dadurch viel Romantik ins Leben zu kommen. Vermutlich hältst du mich darum für schrecklich verrückt?«
»Nicht im geringsten«, erwiderte Lord Henry, »nicht im geringsten, lieber Basil. Du scheinst zu vergessen, dass ich verheiratet bin, und die Ehe hat den einen Reiz, dass sie beiden Teilen ein Leben der Täuschung völlig zur Notwendigkeit macht. Ich weiß nie, wo meine Frau ist, und meine Frau weiß nie, was ich treibe. Wenn wir zusammen sind – wir sind manchmal zusammen, wenn wir miteinander eingeladen sind oder zum Herzog aufs Land fahren –, erzählen wir uns die verrücktesten Geschichten mit der ernsthaftesten Miene. Meine Frau versteht sich trefflich darauf – eigentlich besser als ich. Sie bringt ihre Daten nie durcheinander; und ich immer. Aber wenn sie mich ertappt, macht sie keinen Lärm darüber. Ich wünschte manchmal, sie täte es; aber sie lacht mich bloß aus.«
»Die Art, wie du über dein Eheleben sprichst, ist mir verhasst, Harry«, sagte Basil Hallward und ging langsam zu der Tür, die in den Garten führte. »Ich glaube, du bist in Wahrheit ein sehr guter Ehemann, schämst dich jedoch heftig über deine eigene Tugendhaftigkeit. Du bist ein absonderlicher Bursche. Du sagst nie etwas Moralisches, und du tust nie etwas Schlechtes. Dein Zynismus ist lediglich Pose.«
»Natürlichsein ist lediglich eine Pose, und die ärgerlichste, die ich kenne«, rief Lord Henry und lachte; und die beiden jungen Leute gingen miteinander in den Garten und setzten sich in dem Schatten eines großen Lorbeerbusches auf ein langes Bambussofa. Das Sonnenlicht glitt über die glänzenden Blätter. Im Grase zitterten weiße Gänseblümchen. Nach einer Pause zog Lord Henry seine Uhr. »Ich fürchte, ich muss gleich gehen, Basil«, brummte er, »und ehe ich gehe, bestehe ich darauf, dass du mir die Frage beantwortest, die ich vorhin an dich richtete.«
»Was denn?« fragte der Maler, ohne aufzublicken.
»Du weißt schon.«
»Nein, Harry.«
»Nun, dann will ich dirs sagen. Du sollst mir erklären, warum du Dorian Grays Bildnis nicht ausstellen willst. Ich verlange den wirklichen Grund zu wissen.«
»Ich sagte dir den wirklichen Grund.«
»Nein, das tatest du nicht. Du sagtest, der Grund sei, weil zu viel von dir in dem Bilde sei. Nun, das ist kindisch.«
»Harry«, sagte Basil Hallward und schaute ihm gerade ins Gesicht, »jedes Porträt, das mit Empfindung gemalt ist, ist ein Porträt des Künstlers, nicht dessen, der ihm sitzt. Der ist bloß der Anlass, die Gelegenheit. Nicht er wird vom Maler offenbart; es ist eher der Maler, der auf der farbigen Leinwand sich selber offenbart. Der Grund, warum ich dieses Bild nicht ausstellen will, ist, dass ich fürchte, ich habe in ihm das Geheimnis meiner eigenen Seele aufgedeckt.«
Lord Henry lachte. »Und das wäre?« fragte er.
»Ich will es dir erklären«, sagte Hallward; aber ein Ausdruck der Ratlosigkeit legte sich über seine Züge.
»Ich bin ganz Erwartung, Basil«, fing sein Gefährte wieder an und sah zu ihm hin.
»Oh! Es ist wirklich nicht viel zu erzählen, Harry«, antwortete der Maler, »und ich fürchte, du wirst es kaum verstehen. Vielleicht wirst du es kaum glauben.«
Lord Henry lächelte; dann bückte er sich, pflückte ein rot gefärbtes Gänseblümchen aus dem Gras und betrachtete es. »Ich bezweifle gar nicht, dass ich es verstehen werde«, gab er zurück und blickte anhaltend auf das kleine goldene, weißgefiederte Rund in seiner Hand; »und was das Glauben angeht, so kann ich alles glauben, vorausgesetzt, dass es unwahrscheinlich genug ist.«
Der Wind schüttelte ein paar Blüten von den Bäumen, und die schweren Sternenbüschel des Flieders schwankten in der schwülen Luft hin und her. Eine Grille fing an der Mauer zu zirpen an, und wie ein blauer Faden schwebte eine lange, dünne Libelle auf ihren braunen Gazeflügeln durch die Luft. Lord Henry war es, als könnte er Basil Hallwards Herz klopfen hören, und war gespannt, was er hören sollte.
»Die Geschichte ist einfach die«, sagte der Maler nach einer Weile. »Vor zwei Monaten ging ich einmal zu einem Gesellschaftsrummel bei Lady Brandon. Du weißt, wir armen Künstler müssen uns von Zeit zu Zeit in der Gesellschaft sehen lassen, bloß um dem Publikum ins Gedächtnis zu rufen, dass wir keine Wilden sind. Mit einem Gesellschaftsanzug und einer weißen Binde, wie du mir einmal sagtest, kann jeder, selbst ein Börsenmakler, in den Ruf eines Gebildeten kommen. Nun, ich war etwa zehn Minuten da und plauderte mit umfangreichen, überladenen, vornehmen Witwen und langweiligen Akademikern, als mir plötzlich ins Bewusstsein kam, dass mich jemand ansah. Ich drehte mich halb um und erblickte zum ersten Mal Dorian Gray. Als unsre Augen sich trafen, fühlte ich, dass ich blass wurde. Ein seltsames Gefühl des Bangens überkam mich. Ich spürte, ich stand einem von Angesicht zu Angesicht gegenüber, dessen bloße Erscheinung so bezaubernd war, dass sie, wenn ich es ihr gestattete, meine ganze Natur, meine ganze Seele und sogar meine Kunst an sich reißen musste. Ich brauchte in meinem Leben keinerlei Einwirkung von außen. Du weißt selbst, Harry, wie unabhängig ich von Natur aus bin. Ich bin immer mein eigener Herr gewesen; war es zum mindesten gewesen, bis ich Dorian Gray getroffen habe. Dann – aber ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Ich hatte ein Vorgefühl, dass ich unmittelbar vor einer furchtbaren Krise in meinem Leben stehe. Ich hatte die seltsame Empfindung, das Schicksal halte erlesene Freuden und erlesene Schmerzen für mich in Bereitschaft. Mich schauderte, und ich wandte mich zum Gehen. Es war nicht das Gewissen, was mich dazu trieb; es war eine Art Feigheit. Ich rechne es mir nicht zur Ehre an, dass ich zu fliehen versuchte.«
»Gewissen und Feigheit sind in Wahrheit ein und dasselbe. Gewissen ist der eingetragene Name der Firma, weiter nichts.«
»Ich glaube das nicht, Harry, und ich glaube, auch du nicht. Indessen, das oder jenes mag mein Motiv gewesen sein – vielleicht war es Stolz, ich bin immer sehr stolz gewesen –, gewiss ist, dass ich die Tür erreichen wollte. Dort natürlich prallte ich mit Lady Brandon zusammen. ›Sie werden doch nicht so früh weglaufen wollen, Herr Hallward?‹ schrie sie. Du kennst ihre seltsam gellende Stimme?«
»O ja, die Dame ist, von der Schönheit abgesehen, ein Pfau«, sagte Lord Henry und zerzupfte mit seinen langen, nervösen Fingern das Gänseblümchen.
»Ich konnte mich nicht von ihr losmachen. Sie produzierte mich königlichen Hoheiten und Leuten mit Sternen und Hosenbandorden und ältlichen Damen mit riesenhaften Diademen und Papageinasen. Sie sprach von mir als von ihrem besten Freund. Wir hatten uns ein einziges Mal vorher gesehen, aber sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, mich als berühmten Mann zu behandeln. Ich glaube, irgendein Bild von mir hatte gerade großen Erfolg gehabt, oder es war wenigstens in den Abendblättern davon geschwatzt worden, und das ist der Unsterblichkeitsmaßstab unsres Jahrhunderts. Plötzlich befand ich mich dem jungen Manne gegenüber, dessen Erscheinung mich so sonderbar erschüttert hatte. Wir waren einander ganz nahe und berührten uns fast. Unsre Augen trafen sich wieder. Es war unbedacht von mir, aber ich bat Lady Brandon, mich ihm vorzustellen. Vielleicht war es, alles erwogen, nicht so unbedacht. Es war einfach unvermeidlich. Wir hätten angefangen, miteinander zu sprechen, auch ohne jede Vorstellung – dessen bin ich sicher. Dorian sagte es mir später. Auch er hatte das Gefühl, dass wir dazu bestimmt waren, einander kennen zu lernen.«
»Und was für eine Beschreibung gab Lady Brandon von diesem wunderbaren Jüngling?« fragte sein Gefährte. »Ich weiß, es ist ihre Art, von allen ihren Gästen einen kurzen Abriss zu geben. Ich erinnere mich, sie stellte mich einmal einem schauderhaften rotbackigen alten Herrn vor, der über und über mit Orden und Bändern bedeckt war, und zischte mir dabei mit einem tragischen Geflüster, das jeder im Zimmer vollkommen deutlich hören musste, die erstaunlichsten Details ins Ohr. Es blieb mir nichts übrig, als wegzulaufen. Ich komme den Menschen gern von mir selbst auf den Grund. Aber Lady Brandon behandelt ihre Gäste genau wie ein Auktionator seine Waren. Sie erklärt sie entweder vollständig fort, oder erzählt einem alles von ihnen, mit Ausnahme dessen, was man wissen möchte.«
»Arme Lady Brandon! Du bist hart gegen sie, Harry«, sagte Hallward in zerstreutem Ton.
»Lieber Junge, sie wollte einen Salon gründen, aber es gelang ihr nur, ein Restaurant zu eröffnen. Wie könnte ich sie bewundern! Aber, sage mir, wie sprach sie über Herrn Dorian Gray?«
»Oh, etwa: ›Ein reizender junger Mensch – die arme Mutter und ich ganz unzertrennlich. Vergaß ganz, was er tut – fürchte, er – tut gar nichts – ach ja, er spielt Klavier – oder war es Geige, Herr Gray?‹ Wir mussten beide lachen, und wir wurden sofort Freunde.«
»Lachen ist für eine Freundschaft noch lange nicht der schlechteste Anfang, und ist weitaus das beste Ende für sie«, sagte der junge Lord und pflückte ein neues Gänseblümchen.
Hallward schüttelte den Kopf. »Du verstehst nicht, was Freundschaft ist, Harry«, murmelte er, »und ebensowenig, was Feindschaft ist. Du magst alle Welt; das heißt, dir sind alle gleichgültig.«
»Wie schrecklich ungerecht von dir!« rief Lord Henry, schob seinen Hut zurück und blickte zu den Wölkchen empor, die wie verwirrte Strähnen glänzender weißer Seide über das Türkisgewölbe des Sommerhimmels dahintrieben.
»Ja, schrecklich ungerecht von dir. Ich unterscheide sehr zwischen den Menschen. Ich wähle meine Freunde nach ihrem guten Aussehen, meine Bekannten nach ihrem guten Charakter und meine Feinde nach ihrem guten Verstand. Man kann nicht vorsichtig genug in der Auswahl seiner Feinde sein. Ich habe keinen einzigen erlangt, der dumm ist. Es sind alles Leute von einer gewissen geistigen Stärke, und daher schätzen sie mich alle. Ist das sehr eitel von mir? Ich glaube, es ist ein bisschen eitel.«
»Ich glaube auch, Harry. Aber nach deiner Einteilung kann ich bloß ein Bekannter von dir sein.«
»Mein lieber alter Basil, du bist viel mehr als ein Bekannter.«
»Und viel weniger als ein Freund. Eine Art Bruder vermutlich?«
»Oh, Bruder! Ich mache mir nichts aus Brüdern. Mein ältester Bruder denkt nicht ans Sterben, und meine jüngeren scheinen nichts anderes zu tun.«
»Harry!« rief Hallward und runzelte die Stirn.
»Lieber Junge, ich rede nicht ganz ernsthaft. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich verabscheue meine Verwandten. Ich vermute, das ist der Tatsache zuzuschreiben, dass kein Mensch andere Menschen ausstehen kann, die dieselben Fehler wie er selbst haben. Ich verstehe den Zorn der englischen Demokratie gegen das, was sie die Laster der oberen Stände nennen, vollkommen. Die Massen fühlen, dass Trunkenheit, Dummheit und Unmoral ihre eigene Domäne sein sollten, und dass jemand von uns, der sich bloßstellt, auf ihren Jagdgründen wildert. Beim Ehescheidungsprozess des armen Southwark war ihre Entrüstung ganz prachtvoll. Und doch möchte ich behaupten, dass nicht zehn Prozent im Proletariat vorschriftsgemäß leben.«
»Ich stimme keinem einzigen Wort zu, das du da gesagt hast, und was mehr ist, Harry, ich bin sicher, du auch nicht.«
Lord Henry strich seinen braunen Spitzbart und klopfte mit seinem zierlichen Ebenholzstock gegen die Spitze seines eleganten Stiefels. »Wie englisch du bist, Basil! Zum zweiten Mal hast du jetzt diese Bemerkung gemacht. Wenn man einem richtigen Engländer eine Idee vorträgt – schon an sich eine Tollkühnheit –, denkt er nie daran, zu erwägen, ob die Idee richtig oder falsch ist. Das einzige, was ihm von Bedeutung scheint, ist, ob man selbst daran glaubt. Aber der Wert einer Idee hat nicht das mindeste mit der Aufrichtigkeit des Menschen zu tun, der sie vorbringt. In Wahrheit ist es wahrscheinlich, dass, je unaufrichtiger der Mensch ist, umso mehr rein geistig die Idee sein wird, da sie in diesem Fall weder von seinen Bedürfnissen und Wünschen noch von seinen Vorurteilen gefärbt sein wird. Indessen habe ich nicht die Absicht, Politik, Soziologie oder Metaphysik mit dir zu treiben. Ich mache mir mehr aus Personen als aus Prinzipien, und nichts liebe ich mehr als Personen ohne Prinzipien. Erzähle mir mehr von Herrn Dorian Gray. Wie oft siehst du ihn?«
»Jeden Tag. Ich wäre unglücklich, wenn ich ihn nicht täglich sähe. Er ist mir ganz und gar ein Bedürfnis.«
»Wie ungewöhnlich! Ich hätte gedacht, du kümmertest dich um nichts als deine Kunst.«
»Er ist mir jetzt meine ganze Kunst«, sagte der Maler ernst.
»Ich denke manchmal, Harry, es gibt in der Weltgeschichte nur zwei Perioden von Bedeutung. Die erste ist das Auftreten eines neuen Kunstmittels, und die zweite ist, ebenfalls für die Kunst, das Auftreten eines neuen Menschentypus. Was die Erfindung der Ölmalerei für die Venezianer war, das ist das Antlitz des Antinous für die spätgriechische Skulptur gewesen, und das wird eines Tages das Antlitz des Dorian Gray für mich sein. Es ist nicht bloß, dass ich nach ihm male, zeichne, skizziere. Natürlich habe ich all das getan. Aber er ist für mich viel mehr als ein Modell oder ein Mensch, der mir sitzt. Ich möchte nicht sagen, dass ich unzufrieden mit dem bin, was ich aus ihm gemacht habe, oder dass seine Schönheit derart ist, dass die Kunst sie nicht ausdrücken kann. Es gibt nichts, was die Kunst nicht ausdrücken kann; und ich weiß: was ich gemacht habe, seit ich Dorian Gray kennen gelernt, ist gute Arbeit, ist die beste Arbeit meines Lebens. Aber auf seltsame Weise – ich glaube kaum, dass du mich verstehst – hat seine Erscheinung in mir eine neue Art meiner Kunst wachgerufen, eine völlig neue Stilform. Ich sehe die Dinge anders, ich denke anders über sie. Ich kann jetzt das Leben in einer Weise gestalten, die mir vorher verborgen war. ›Ein Traum von Form in den Tagen des Denkens‹ – wer hat das gesagt? Ich habe es vergessen; aber das ist Dorian Gray für mich geworden. Das bloße sichtbare Dasein dieses Jünglings, der fast noch ein Knabe ist – so erscheint er, obwohl er in Wirklichkeit über zwanzig ist – sein bloßes sichtbares Dasein – ah! ich glaube nicht, dass du dir vorstellen kannst, was alles darin liegt! Ohne es zu wissen, bildet er für mich das Lineament einer neuen Schule, einer Schule, die bestimmt ist, alle Leidenschaft des romantischen Geistes, alle Vollkommenheit des griechischen in sich zu fassen. Die Harmonie der Seele und des Körpers – wie viel das ist! Wir in unserm Wahnsinn haben die zwei getrennt und haben einen Realismus erfunden, der gemein ist, und einen Idealismus, der leer ist. Harry! wenn du nur wüsstest, was Dorian Gray für mich ist! Erinnerst du dich an die Landschaft, für die Agnew mir einen so ungeheuren Preis bot, von der ich mich aber nicht trennen wollte? Sie ist eins der besten Stücke, die ich je gemacht habe. Und warum? Weil, während ich sie malte, Dorian Gray neben mir saß. Irgendein feiner Einfluss ging von ihm zu mir, und zum ersten Mal in meinem Leben sah ich in der einfachen Waldlandschaft das Wunder, nach dem ich immer ausgeblickt und das ich nie gefunden hatte.«
»Basil, das ist etwas Außerordentliches! Ich muss Dorian Gray sehen.«
Hallward stand auf und ging im Garten hin und her. Nach einer Weile kam er zurück. »Harry«, sagte er, »Dorian Gray ist für mich lediglich ein künstlerisches Motiv. Vielleicht sähst du nichts in ihm. Ich sehe alles in ihm. Er ist in meiner Arbeit nie mehr gegenwärtig, als wenn kein Abbild von ihm darin ist. Er ist, wie ich sagte, eine Anregung zu einer neuen Art in der Kunst. Ich finde ihn in den Schwingungen gewisser Linien, in dem Zauber und der zarten Tönung gewisser Farben. Das ist es, und das ist alles.«
»Warum willst du dann aber sein Porträt nicht ausstellen?« fragte Lord Henry.
»Weil ich, ohne es zu wollen, einen gewissen Ausdruck all dieser absonderlichen künstlerischen Abgötterei hineingelegt habe, von der ich natürlich zu ihm nie sprechen wollte. Er weiß nicht darum. Er soll nie darum wissen. Aber die Welt könnte es erraten; und ich will meine Seele ihren oberflächlichen, spähenden Augen nicht entblößen. Mein Herz soll nie unter ihr Mikroskop kommen. Es ist zu viel von mir in dem Ding, Harry – zu viel von mir!«
»Die Dichter sind nicht so peinlich wie du. Sie wissen, wie nützlich es ist, Leidenschaft zu publizieren. Heutzutage bringt es ein gebrochenes Herz zu vielen Auflagen.«
»Ich hasse sie darum«, rief Hallward. »Ein Künstler sollte schöne Dinge schaffen, sollte aber nichts von seinem eigenen Leben hineintun. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen die Kunst behandeln, als ob sie bestimmt wäre, eine Art Selbstbiografie zu sein. Wir haben den Sinn für absolute Schönheit verloren. Eines Tages werde ich der Welt zeigen, was Schönheit ist, und aus diesem Grunde soll sie nie mein Porträt Dorian Grays sehn.«
»Ich glaube, du hast unrecht, Basil, aber ich will nicht mit dir streiten. Nur die geistig Enterbten finden Gefallen am Streiten. Sag mir, hat Dorian Gray dich sehr lieb?«
Der Maler überlegte ein paar Augenblicke. »Er hat mich gern«, antwortete er nach einer Weile, »ich weiß, dass er mich gern hat. Natürlich schmeichle ich ihm schrecklich. Ich finde ein schreckliches Vergnügen daran, Dinge zu ihm zu sagen, von denen ich weiß, dass sie mir später leid tun werden. In der Regel ist er reizend zu mir, und wir sitzen im Atelier und plaudern von tausenderlei Dingen. Hie und da jedoch ist er schrecklich gedankenlos und scheint eine richtige Freude daran zu finden, mir weh zu tun. Dann fühle ich, Harry, dass ich meine ganze Seele an einen hingegeben habe, der sie behandelt, als ob sie eine Blume fürs Knopfloch wäre, eine kleine Dekoration, seiner Eitelkeit damit zu schmeicheln, ein Schmuck für einen Sommertag.«
»Im Sommer, Basil, ziehen sich die Tage manchmal lange hin«, erwiderte Lord Henry. »Vielleicht wirst du früher müde werden als er. Es ist eine traurige Sache, wenn man es bedenkt, aber es ist kein Zweifel, dass das Genie länger dauert als die Schönheit. Das erklärt die Tatsache, dass wir alle uns so damit quälen, uns mit Bildung vollzustopfen. In dem wilden Kampf ums Dasein wollen wir alle etwas haben, das dauert, und so füllen wir unsern Geist mit Schund und Tatsachen in der törichten Hoffnung, unsern Platz zu behaupten. Der durchaus wohlunterrichtete Mann – das ist das Ideal unserer Zeit. Und um den Geist des durchaus wohlunterrichteten Mannes ist es etwas Schreckliches. Er ist wie ein Antiquitätenladen, in dem es Ausgeburten aller Art und Staub gibt und jedes Ding über seinen wirklichen Wert ausgezeichnet ist. Ich glaube, du wirst trotzdem zuerst müde werden. Eines Tages wirst du deinen jungen Freund ansehn, und er wird dir ein bisschen verzeichnet vorkommen, oder du magst seinen Farbenton nicht oder so was. Du wirst ihm in deinem Herzen bittere Vorwürfe machen und ernsthaft der Meinung sein, er benehme sich sehr schlecht gegen dich. Wenn er dich das nächste Mal besucht, wirst du völlig kalt und gleichgültig sein. Es wird sehr schade sein, denn es wird dich ändern. Was du mir erzählt hast, ist völlig ein Gedicht, ein Gedicht von der Kunst möchte man es nennen, und das Schlimmste daran, ein Gedicht irgendeiner Art erlebt zu haben, ist, dass es einen so unpoetisch zurücklässt.«
»Harry, sprich nicht so. Solange ich lebe, wird die Erscheinung Dorian Grays Herr in mir sein. Du kannst meine Empfindung nicht nachfühlen. Du wandelst dich zu oft.«
»Ah, lieber Basil, genau darum kann ich sie nachfühlen. Menschen, die treu sind, kennen nur die gemeine Seite der Liebe: die Treulosen sind es, die die Tragödien der Liebe erfahren.« Und Lord Henry zündete an einer wertvollen silbernen Büchse ein Streichholz an und begann mit selbstbewusster und zufriedener Miene, als ob er die Welt auf einen Satz gebracht hätte, eine Zigarette zu rauchen. Es war ein Lärmen von zwitschernden Sperlingen in den Blättern des Efeus, die von grünem Lack überzogen glänzten, und die blauen Wolkenschatten jagten wie Schwalben über das Gras. Wie lieblich war es in dem Garten, und wie reizend die Empfindungen anderer Leute! – viel reizender als ihre Ideen, schien es ihm. Des Menschen eigene Seele und die Leidenschaften seiner Freunde, – das waren im Leben die fesselnden Dinge. Er malte sich in stiller Vergnüglichkeit das langweilige Frühstück aus, um das er gekommen war, weil er sich so lange mit Basil Hallward verweilt hatte. Wäre er zu seiner Tante gegangen, so würde er sicher dort Lord Goodbody getroffen haben, und die ganze Unterhaltung hätte sich um die Ernährung der Armen und um die Notwendigkeit gedreht, Musterarbeiterhäuser zu errichten. Menschen von allerlei Art hätten über die Wichtigkeit gerade der Tugenden gepredigt, für die sie in ihrem eigenen Leben keine Verwendung hatten. Der Reiche hätte vom Wert der Sparsamkeit gesprochen, und der Faule wäre über die Würde der Arbeit zum Redner geworden. Es war prächtig, alledem entgangen zu sein. Als er an seine Tante dachte, schien ihm ein Einfall zu kommen. Er wandte sich zu Hallward und sagte: »Mein Lieber, ich erinnere mich jetzt.«
»Woran erinnerst du dich, Harry?«
»Wo ich den Namen Dorian Grays gehört habe.«
»Wo war es?« fragte Hallward mit leichtem Stirnrunzeln.
»Blick nicht so ärgerlich drein, Basil. Es war bei meiner Tante Lady Agatha. Sie erzählte mir, sie habe einen prächtigen jungen Menschen entdeckt, der ihr im East-End helfen wollte, und er heiße Dorian Gray. Ich muss allerdings sagen, dass sie mir nie mitteilte, er sei schön. Frauen haben keinen Sinn für Schönheit, wenigstens gute Frauen nicht. Sie sagte, er sei sehr ernst und habe eine edle Seele. Ich malte mir für mich ein Geschöpf mit einer Brille und herabhängendem Haar aus, dessen Gesicht furchtbar mit Sommersprossen übersät war und der auf riesigen Füßen einhertrat. Ich wollte, ich hätte gewusst, dass er dein Freund ist.«
»Ich bin sehr froh, dass du es nicht wusstest, Harry.«
»Warum?«
»Ich will nicht, dass du ihn kennen lernst.«
»Du willst nicht, dass ich ihn kennen lerne?«
»Nein.«
»Herr Dorian Gray ist im Atelier«, sagte der Diener, der in den Garten heraustrat.
»Jetzt musst du mich vorstellen«, rief Lord Henry lachend.
Der Maler wandte sich zu dem Bedienten, der blinzelnd in der Sonne stand. »Bitten Sie Herrn Gray, er möchte warten, Parker; ich werde in ein paar Augenblicken kommen.« Der Mann verbeugte sich und ging ins Haus.
Dann schaute der Künstler Lord Henry an. »Dorian Gray ist mein liebster Freund«, sagte er. »Er hat eine einfache und edle Seele. Deine Tante hatte mit dem, was sie von ihm sagte, ganz recht. Verdirb ihn nicht! Versuche nicht, Einfluss auf ihn zu üben! Dein Einfluss wäre schlimm. Die Welt ist weit und birgt viele wundervolle Menschen. Entreiß mir nicht den einzigen Menschen, der meiner Kunst allen Zauber gibt, den sie besitzt: mein Leben als Künstler hängt von ihm ab! Denk daran, Harry, ich verlasse mich auf dich.« Er sprach sehr langsam, und die Worte schienen ihm gegen seinen Willen entpresst zu werden.
»Was für einen Unsinn du redest«, sagte Lord Henry lächelnd, nahm ihn unterm Arm und führte ihn ins Haus.
Zweites Kapitel
Sie traten ein und erblickten Dorian Gray. Er saß am Klavier, wendete ihnen den Rücken und blätterte in einem Bande mit Schumanns Waldszenen. »Die musst du mir leihen, Basil«, rief er. »Ich will sie spielen lernen. Sie sind ganz entzückend!«
»Das hängt ganz davon ab, wie du heute sitzt, Dorian.«
»Oh, ich habe das Sitzen satt, ich brauche kein lebensgroßes Bild von mir«, antwortete der junge Mann und drehte sich nach Art eines eigenwilligen, launischen Knaben auf dem Klavierstuhl herum. Als er Lord Henry gewahrte, färbte ein schwaches Rot einen Augenblick seine Wangen, und er sprang auf. »Ich bitte um Entschuldigung, Basil, aber ich wusste nicht, dass jemand bei dir ist.«
»Das ist Lord Henry Wotton, Dorian, ein alter Freund von mir aus Oxford. Ich habe ihm eben erzählt, wie famos du sitzt, und jetzt hast du alles verdorben.«
»Mein Vergnügen, Sie kennen zu lernen, haben Sie nicht verdorben, Herr Gray«, sagte Lord Henry, indem er auf ihn zuging und die Hand ausstreckte. »Meine Tante hat mir oft von Ihnen gesprochen. Sie sind einer ihrer Günstlinge und ich fürchte, auch ihrer Opfer.«
»Ich stehe zurzeit bei Lady Agatha im schwarzen Buch«, antwortete Dorian und machte ein komisch bußfertiges Gesicht. »Ich versprach ihr, letzten Dienstag mit ihr in einen Klub in Whitechapel zu gehen, und ich habe es in der Tat völlig vergessen. Wir hätten zusammen vierhändig spielen sollen – drei Stücke, glaube ich. Ich weiß nicht, was sie zu mir sagen wird. Ich fürchte mich hinzugehn.«
»Oh, ich werde Sie mit meiner Tante versöhnen. Sie ist Ihnen überaus gewogen, und ich glaube nicht, dass es in Wahrheit etwas ausmacht, dass Sie nicht dort waren. Die Zuhörer dachten vermutlich, es sei vierhändig. Wenn Tante Agatha sich ans Klavier setzt, macht sie völlig genug Lärm für zwei Personen.«
»Das ist recht abscheulich gegen sie und nicht sehr hübsch gegen mich«, erwiderte Dorian und lachte.
Lord Henry sah ihn an. Ja, er war sicher wunderbar schön mit seinen fein geschwungenen Purpurlippen, seinen treuherzigen blauen Augen und seinem gewellten Goldhaar. Es lag etwas in seinen Mienen, das sofort Vertrauen hervorrief. Aller Schimmer der Jugend war da, und ebenso all die leidenschaftliche Keuschheit der Jugend. Man fühlte, er hatte sich in seiner Unbeflecktheit vor der Welt bewahrt. Kein Wunder, dass Basil Hallward ihn anbetete.
»Sie sind zu hübsch, um sich mit Wohltätigkeit zu befassen, Herr Gray – viel zu hübsch.« Und Lord Henry warf sich auf den Diwan und nahm eine Zigarette.
Der Maler hatte sich damit beschäftigt, seine Farben zu mischen und seine Pinsel zurechtzumachen. Er sah gequält aus, und als er Lord Henrys letzte Bemerkung hörte, sah er ihn an, zögerte einen Augenblick und sagte dann: »Harry, ich möchte dieses Bild heute fertig bekommen. Fändest du es sehr grob von mir, wenn ich dich bäte fortzugehn?«
Lord Henry lächelte und schaute Dorian Gray an. »Soll ich gehn, Herr Gray?« fragte er.
»Oh, bitte nein, Lord Henry. Ich sehe, Basil ist wieder einmal schlecht aufgelegt, und ich kann ihn gar nicht leiden, wenn er verdrossen ist. Außerdem möchte ich Sie gern fragen, warum ich mich nicht mit Wohltätigkeit befassen soll?«
»Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen soll, Herr Gray. Es ist ein so langweiliges Thema, dass man ernsthaft darüber reden müsste. Aber sicher werde ich nicht fortgehn, nachdem Sie mir erlaubt haben zu bleiben. Du bist doch nicht im Ernst dagegen, Basil, nicht wahr? Du hast mir oft gesagt, es sei dir recht, wenn die, die dir sitzen, einen haben, mit dem sie plaudern können.«
Hallward biss sich auf die Lippen. »Wenn Dorian es wünscht, musst du natürlich bleiben. Dorians Launen sind für jeden Gesetz, außer ihm selbst.«
Lord Henry griff nach Hut und Handschuhen. »Trotz deiner dringlichen Aufforderung, Basil, fürchte ich, ich muss gehn. Ich habe versprochen, jemanden im Orleans zu treffen. Adieu, Herr Gray! Bitte, besuchen Sie mich einmal nachmittags in Eurzon Street. Um fünf Uhr bin ich fast immer zu Hause. Schreiben Sie mir, an welchem Tage Sie kommen. Es täte mir leid, wenn Sie mich verfehlten.«
»Basil«, rief Dorian Gray, »wenn Lord Henry Wotton geht, gehe ich auch. Du machst nie den Mund auf, solange du malst, und es ist schrecklich ermüdend, auf einem Podium zu stehn und sich Mühe zu geben, hübsch auszusehen. Bitte ihn zu bleiben. Ich bestehe darauf!«
»Bleibe, Harry, du machst Dorian ein Vergnügen damit und mir auch«, sagte Hallward, ohne von seinem Bild aufzuschauen. »Es ist völlig wahr, ich rede nie während der Arbeit und höre ebensowenig zu, und das muss für die Unglücklichen, die mir sitzen, schrecklich langweilig sein. Ich bitte dich, bleib!«
»Aber was mache ich mit meinem Mann im Orleans?«
Der Maler lachte. »Ich glaube, das wird keinerlei Schwierigkeiten machen. Setz dich wieder, Harry. Und nun, Dorian, geh auf das Podium und bewege dich nicht zu viel und achte nicht auf das, was Lord Henry sagt. Er hat einen sehr schlechten Einfluss auf alle seine Freunde, mich allein ausgenommen.«
Dorian Gray ging mit der Miene eines jungen griechischen Märtyrers die Stufen zum Podium hinauf und stieß gegen Lord Henry einen leichten, drolligen Seufzer aus. Er gefiel ihm gut. Er war so anders als Basil. Sie bildeten einen reizenden Kontrast. Und er hatte so eine schöne Stimme. Nach ein paar Augenblicken sagte er zu ihm: »Üben Sie wirklich einen sehr schlechten Einfluss aus, Lord Henry? So schlecht, wie Basil sagt?«
»So etwas wie guten Einfluss gibt es nicht, Herr Gray. Jeder Einfluss ist unmoralisch – unmoralisch im wissenschaftlichen Sinne.«
»Warum?«
»Weil, wer einen Menschen beeinflusst, ihm seine eigene Seele gibt. Er denkt nicht seine natürlichen Gedanken und glüht nicht in seinem natürlichen Feuer. Seine Tugenden gehören nicht wirklich ihm. Seine Sünden, wenn es so etwas wie Sünden gibt, sind geborgte. Er wird ein Echo der Musik irgendeines Fremden, Schauspieler einer Rolle, die nicht für ihn geschrieben wurde. Das Ziel des Lebens ist Selbstentfaltung. Seine eigene Natur vollkommen zu verwirklichen – dafür ist jeder von uns da. Die Menschen von heutzutage haben Angst vor sich selbst. Sie haben die höchste aller Pflichten vergessen, die Pflicht, die man sich selbst gegenüber hat. Natürlich sind sie wohltätig. Sie nähren den Hungrigen und kleiden den Bettler. Aber ihre eigenen Seelen sterben Hungers und sind nackt. Der Mut ist unserm Geschlecht verloren gegangen. Vielleicht haben wir ihn nie wirklich besessen. Die Furcht vor der Gesellschaft, die die Grundlage der Moral ist, die Furcht vor Gott, die das Geheimnis der Religion ist – das sind die zwei Dinge, die uns beherrschen. Und doch …«
»Bitte, drehe den Kopf ein wenig mehr nach rechts, Dorian, sei so lieb!« sagte der Maler, der tief in seine Arbeit versenkt war und nur gewahrte, dass ein Zug in das Gesicht des Jünglings gekommen war, den er vorher nie darin gesehen hatte.
»Und doch«, fuhr Lord Henry mit seiner sanften, wohlklingenden Stimme und mit der anmutigen Handbewegung fort, die so bezeichnend an ihm war und die er schon seinerzeit in Eton gehabt hatte, »ich glaube, wenn ein einziger Mensch sein Leben völlig und ganz ausleben wollte, jeder Empfindung Form, jedem Gedanken Ausdruck, jedem Traum Wirklichkeit geben wollte – ich glaube, die Welt erhielte einen solchen Schwung von Freudigkeit, dass wir all das Siechtum aus den Zeiten des Mittelalters vergäßen und zum hellenischen Ideal zurückkehrten – vielleicht zu etwas, das intimer und reicher wäre als das hellenische Ideal. Aber der Tapferste unter uns hat Angst vor sich selber. Die Selbstverstümmelung der Wilden lebt in tragischer Weise in der Selbstverleugnung fort, die unser Leben verstümmelt. Wir werden für unser Verleugnen gestraft. Jeder Trieb, den wir ersticken möchten, wühlt sich im Geiste fort und vergiftet uns. Der Körper sündigt nur einmal und hat die Sünde abgetan, denn das Tun ist eine Art Reinigung. Es bleibt nichts übrig als die Erinnerung an eine Lust oder der köstliche Schmerz, dass sie vorbei ist. Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben. Widerstehe ihr, und deine Seele wird krank vor Sehnsucht nach den Dingen, die sie sich selber verboten hat, vor Verlangen nach dem, was ihre ungeheuerlichen Gesetze zu etwas Ungeheuerlichem und Gesetzwidrigem gemacht haben. Man hat wohl gesagt, die größten Geschehnisse in der Welt ereigneten sich im Hirne. Im Hirne, und einzig und allein im Hirne ereignen sich auch die großen Sünden der Welt. Sie, Herr Gray, Sie selber mit Ihrer rosigen Jugend und Ihrer Knabenunschuld, die wie weiße Rosen ist, Sie haben Leidenschaften gehabt, die Ihnen bange machten, Gedanken, die Sie in Schrecken setzten, Träume bei Tag und Träume im Schlaf, die, wenn Sie nur daran denken, das Blut der Scham in Ihre Wangen jagen …«
»Halten Sie ein!« rief Dorian Gray mit versagender Stimme, »halten Sie ein, mir wird wirr von Ihren Reden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt eine Antwort auf Ihre Worte, aber ich kann sie nicht finden. Sprechen Sie nicht! Lassen Sie mich nachdenken. Oder lieber, lassen Sie mich den Versuch machen, nicht nachzudenken.«
Fast zehn Minuten lang stand er da, ohne sich zu regen, mit geöffneten Lippen und einem seltsamen Glanz in den Augen. Er war sich undeutlich bewusst, dass völlig neue Einflüsse in ihm am Werke seien. Jedoch schienen sie ihm in Wahrheit aus ihm selbst gekommen. Die paar Worte, die Basils Freund zu ihm gesprochen hatte – Worte, die ohne Zweifel von ungefähr und mit absichtlicher Paradoxie gesprochen waren –, hatten eine geheime Saite berührt, die zuvor nie berührt worden war, die er aber jetzt zittern und in seltsamer Wildheit rauschen hörte.
Die Musik hatte ihn so ähnlich erregt. Die Musik hatte ihn oft wirr gemacht. Aber die Musik war unbestimmt. Sie erzeugte in einem nicht eine neue Welt, sondern eher ein neues Chaos. Worte! bloße Worte! Wie furchtbar sie waren! Wie deutlich und lebendig und grausam! Man konnte ihnen nicht entrinnen. Und was war doch in ihnen für eine feine Magie! Sie schienen imstande, gestaltlosen Dingen plastische Gestalt zu geben und eine Musik in sich zu bergen, die so süß war wie die der Bratsche oder der Laute. Bloße Worte! Gab es denn irgendetwas, das so wirklich war wie Worte?
Ja: es hatte in seinem Jünglingsknabentum Dinge gegeben, die er nicht verstanden hatte. Er verstand sie jetzt. Das Leben wurde für ihn plötzlich feuerfarben. Ihm schien, er sei in leibhaftem Feuer gewandelt. Warum hatte er es nicht gemerkt?
Mit seinem feinen Lächeln beobachtete ihn Lord Henry. Er verstand sich auf den feinen psychologischen Moment, wo es galt, nicht zu reden. Er war stark interessiert. Er war über den plötzlichen Eindruck erstaunt, den seine Worte hervorgebracht hatten; er erinnerte sich an ein Buch, das er mit sechzehn Jahren gelesen, ein Buch, das ihm vieles offenbart hatte, was er zuvor nicht gekannt, und so war er neugierig, ob Dorian Gray jetzt ein ähnliches Erlebnis hätte. Er hatte nur einen Pfeil in die Luft geschossen. Hatte er ins Schwarze getroffen? Wie bezaubernd der Junge war!
Hallward malte mit seinem wundervollen kühnen Pinselstrich, der die wahre Feinheit und vollkommene Zartheit an sich hatte, die, in der Kunst jedenfalls, nur aus der Kraft kommt, drauf los. Er merkte nichts von dem Schweigen.
»Basil, ich habe genug gestanden!« rief Dorian Gray plötzlich. »Ich muss hinausgehn und mich in den Garten setzen. Die Luft hier ist zum Ersticken.«
»Mein Lieber, das tut mir sehr leid. Wenn ich beim Malen bin, kann ich an nichts anderes denken. Aber du hast nie besser gesessen. Du warst völlig ruhig. Und ich habe den Effekt erhascht, den ich brauchte, die halb offenen Lippen und den Glanz in den Augen. Ich weiß nicht, was Harry zu dir gesagt hat, aber sicher hat er bewirkt, dass du den wundervollsten Ausdruck hast. Ich vermute, er hat dir Schmeicheleien gesagt. Du musst kein Wort von allem, was er sagt, glauben.«
»Er hat mir gewiss keine Schmeicheleien gesagt. Vielleicht glaube ich darum nichts von allem, was er gesagt hat.«
»Sie wissen, dass Sie es alles glauben«, sagte Lord Henry und sah ihn mit seinen träumerischen, lockenden Augen an. »Ich komme mit Ihnen in den Garten. Es ist furchtbar heiß im Atelier. Basil, verschaffe uns ein Eisgetränk, mit Erdbeeren darin.«
»Gern, Harry. Drücke nur auf die Klingel, und wenn Parker kommt, werde ich ihm sagen, was ihr haben wollt. Ich bin jetzt mit dem Hintergrund hier beschäftigt und werde also später zu euch kommen. Halte Dorian nicht zu lange auf! Ich bin nie besser zum Malen aufgelegt gewesen als heute. Das wird mein Meisterwerk werden! Wie es dasteht, ist es mein Meisterwerk!«
Lord Henry ging in den Garten hinaus und fand Dorian Gray, wie er sein Gesicht in den großen kühlen Fliederblütenbüscheln badete und fiebrig ihren Duft schlürfte, als wäre er Wein. Er trat nahe zu ihm hin und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Sie tun ganz recht daran, es so zu machen«, sprach er leise. »Nichts kann die Seele heilen als die Sinne, gerade wie nichts die Sinne heilen kann als die Seele.«
Der Jüngling fuhr zusammen und trat zurück. Er war barhäuptig, und die Zweige hatten seine widerspenstigen Locken verwirrt und ihre goldenen Strähnen in Unordnung gebracht. Es war ein furchtsamer Ausdruck in seinen Augen, wie ihn Menschen haben, die man plötzlich geweckt hat. Seine fein gebauten Nüstern bebten, und irgendein versteckter Nerv riss leise an seinen Purpurlippen, sodass sie in einem Zittern blieben.
»Ja«, fuhr Lord Henry fort, »das ist eins der großen Geheimnisse des Lebens: die Seele mittelst der Sinne, und die Sinne mittelst der Seele zu heilen. Sie sind ein prächtiges Menschenkind! Sie wissen mehr, als Sie denken, gerade wie Sie weniger wissen, als Ihnen zu wissen nottut.«