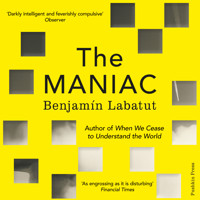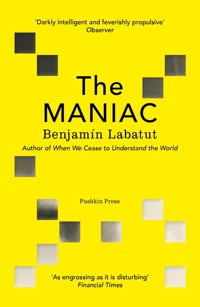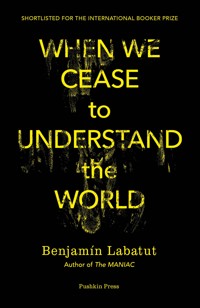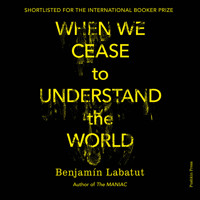11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Benjamín Labatut erzählt vom schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn, von der zwiespältigen Kraft der Wissenschaft und dem verhängnisvollen Moment, an dem wir aufhören, die Welt zu verstehen.
Sie sind Pioniere und Verdammte. Eroberer von Raum und Zeit. Träumer des Absoluten. Sie verändern den Lauf der Geschichte und verzweifeln an sich selbst: Werner Heisenberg, dessen Gleichungen – im Wahn auf der Insel Helgoland entstanden – zum Bau der Atombombe führen. Der Mathematiker Alexander Grothendieck, der es vorzieht, seine Formeln zu verbrennen, um die Menschheit vor ihrem zerstörerischen Potential zu schützen. Oder Fritz Haber, dessen physikalische Verfahren eine Hungerkrise vermeiden und zugleich das diabolischste Werkzeug der Nationalsozialisten hervorbringen werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BENJAMÍN LABATUT
Das blinde Licht
Irrfahrten der Wissenschaft
Aus dem Spanischen von Thomas Brovot
Suhrkamp
»Wir steigen auf, wir fallen. Steigen im Fallen vielleicht auf. Niederlagen prägen uns. Was wir an Weisheit haben, ist tragisch, zu spät erkannt, und nur von den Verlorenen.«
Guy Davenport
Inhalt
Preußischblau
Bei einer Untersuchung Monate
Schwarzschilds Singularität
Am 24. Dezember 1915saß Albert Einstein
Das Herz im Herzen
Am frühen Morgen des 31. August 2012
Wenn wir aufhören, die Welt zu verstehen
Prolog
I Die Nacht auf Helgoland
II Die Wellen des Prinzen
III Perlen in den Ohren
IV Das Reich der Unbestimmtheit
V Gott und die Würfel
Epilog
Danksagung
Preußischblau
Bei einer Untersuchung Monate
Bei einer Untersuchung Monate vor Beginn der Nürnberger Prozesse fiel den Ärzten auf, dass Hermann Görings Finger- und Fußnägel knallrot gefärbt waren. Auf den ersten Blick führten sie dies auf seine Abhängigkeit von Dihydrocodein zurück, einem Schmerzmittel, von dem er täglich mehr als hundert Tabletten zu sich nahm. William Burroughs zufolge ist die Wirkung vergleichbar mit Heroin, doppelt so stark wie Codein, aber mit einer Dröhnung wie Kokain, weshalb die Amerikaner sich gezwungen sahen, Göring von seiner Sucht zu heilen, ehe er vor Gericht erscheinen konnte. Es war nicht einfach. Bei seiner Festnahme durch die Alliierten hatte man in den Koffern, die der NS-Führer mitschleppte, nicht nur den Nagellack gefunden, den er auftrug, wenn er sich als Nero verkleidete, sondern auch mehr als zwanzigtausend Paracodin-Pillen, seine bevorzugte Droge und fast der gesamte Restbestand, der von dem in Deutschland hergestellten Medikament am Ende des Zweiten Weltkriegs geblieben war. Ungewöhnlich war eine solche Abhängigkeit nicht, praktisch alle Truppen der Wehrmacht erhielten Methamphetamin-Tabletten als Teil ihrer Verpflegung. Im Handel bekannt unter dem Namen Pervitin, nahmen die Soldaten sie, um sich aufzuputschen und wochenlang wach zu halten, pendelnd zwischen manischem Furor und albtraumhafter Benommenheit, eine Überbelastung, die bei vielen in Euphorie umschlug: »Es ist beinahe wie Schweigen hier oben. Alles wird unwesentlich und abstrakt. Entrückt, als ob ich selbst über meinem Flugzeug flöge«, schrieb ein Pilot der Luftwaffe Jahre später, als erinnerte er sich an die stille Verzückung seliger Anschauung, nicht an die Niederungen des Alltags im Krieg. Heinrich Böll schickte von der Front mehrmals Feldpost an seine Familie, in der er bat, ihm weiteren Nachschub zu senden: »Der Dienst ist stramm«, schrieb er seinen Eltern am 9. November 1939, »und Ihr müßt verstehen, wenn ich späterhin nur alle 2-4 Tage schreibe. Heute schreibe ich hauptsächlich um Pervitin … Euer Hein.« Am 20. Mai 1940 schrieb er ihnen einen langen, aufgewühlten Brief, der mit der gleichen Bitte endete: »Vielleicht könntet Ihr mir noch etwas Pervitin für meinen Vorrat besorgen?« Zwei Monate später war es nur noch eine hingeworfene Zeile: »Schickt mir nach Möglichkeit bald noch etwas Pervitin.« Methamphetamin war, wie man heute weiß, der Treibstoff für Deutschlands Blitzkrieg mit seinem unaufhaltsamen Vormarsch, und viele Soldaten erlitten psychotische Anfälle, als sie spürten, wie sich die bitteren Pillen in ihrem Mund auflösten. In den oberen Etagen des Deutschen Reichs dagegen schmeckte man etwas ganz anderes, als der russische Winter die Ketten ihrer Panzer erstarren ließ, als unter den Feuerstürmen der alliierten Luftangriffe jede Siegesgewissheit erlosch und Hitler befahl, auch innerhalb des Reichsgebietes alles von Wert zu zerstören, um den heranrückenden Truppen nichts zu lassen als verbrannte Erde. Angesichts der totalen Niederlage, bezwungen von dem Bild des Schreckens, das sie über die Welt gebracht hatten, wählten die Verantwortlichen einen raschen Abgang: Sie bissen auf Zyankalikapseln und erstickten unter dem lieblichen Mandelduft des Gifts.
Eine Suizidwelle schwappte in den letzten Kriegsmonaten durch Deutschland. Allein im April 1945 nahmen sich in Berlin dreitausendachthundert Menschen das Leben. Die Bewohner der Kleinstadt Demmin, etwa drei Stunden nördlich der Hauptstadt, erlagen einer Massenpanik, als die deutschen Truppen auf ihrem Rückzug nach Westen die Brücken hinter sich sprengten und sie auf ihrer Halbinsel in der Falle zurückließen, umgeben von drei Flüssen, hilflos den Grausamkeiten der Roten Armee ausgeliefert. Hunderte Männer, Frauen und Kinder starben in nur drei Tagen von eigener Hand. Ganze Familien gingen ins Wasser der Peene und der Tollense, aneinandergebunden mit Stricken um die Taille wie bei einem grausigen Tauziehen, die kleineren Kinder beschwert mit ihren Schulranzen voller Steine. Der Schrecken nahm solche Ausmaße an, dass die russischen Truppen – die sich darin ergingen, Wohnungen zu plündern, Häuser niederzubrennen und Frauen zu vergewaltigen – Befehl erhielten, der Selbstmordepidemie Einhalt zu gebieten. Dreimal mussten sie eine Frau von der stattlichen Eiche in ihrem Garten herunterholen, an der sie sich zu erhängen versuchte und in deren Schatten sie bereits ihre drei Kinder begraben hatte; sie hatte ihnen – eine letzte Leckerei – Plätzchen gebacken, in die sie Rattengift mischte. Die Frau überlebte, aber die Soldaten konnten nicht verhindern, dass ein Mädchen verblutete, das die Klinge des Rasiermessers, mit dem sie bereits ihren Eltern die Pulsadern aufgeschnitten hatte, ans eigene Handgelenk setzte. Ein ähnlicher Todeswahn ergriff auch die höheren Ränge der Nationalsozialisten: Dreiundfünfzig Generale des Heeres, vierzehn der Luftwaffe und elf Admirale der Marine nahmen sich das Leben, außerdem der Erziehungsminister Bernhard Rust, der Justizminister Otto Thierack, der Feldmarschall Walter Model, der »Wüstenfuchs« Erwin Rommel und natürlich der Führer selbst. Andere, darunter Hermann Göring, waren zögerlicher und ließen sich gefangen nehmen, auch wenn sie damit das Unvermeidliche nur hinausschoben. Als die Ärzte ihn für verhandlungsfähig erklärten, wurde Göring vom Internationalen Militärgerichtshof zum Tod durch den Strang verurteilt. Er stellte den Antrag, erschossen zu werden, er wollte nicht wie ein gewöhnlicher Krimineller sterben. Kaum erfuhr er, dass man ihm seinen letzten Wunsch verwehrte, tötete er sich selbst mit einem Biss auf eine Zyankalikapsel, die er in einem Pomadendöschen versteckt hatte, dazu erklärte er in einem Brief, er habe die Todesart »des großen Hannibal« gewählt. Die Alliierten beschlossen, alle Spuren seiner Existenz auszulöschen. Sie zogen ihm die Glassplitter aus den Lippen und schickten seine Kleidung, seine sonstigen Sachen und seinen nackten Leichnam ins Städtische Krematorium auf dem Münchner Ostfriedhof, wo man einen der Öfen anfachte, um Göring zu verbrennen, auf dass seine Asche eins werde mit dem Staub der Tausenden von politischen Häftlingen und Gegnern des Naziregimes, die in Gefängnissen wie Stadelheim unter dem Fallbeil starben, der Psychiatriepatienten und Kinder mit Behinderungen, die im Rahmen des Euthanasieprogramms Aktion T4 ermordet wurden, all der Opfer in den Konzentrationslagern. Das bisschen, was nach dem Erlöschen des Feuers von ihm blieb, wurde des Nachts in den Wenzbach gestreut, ausgewählt aufs Geratewohl auf einer Landkarte, um zu verhindern, dass sein Grab für künftige Generationen zu einer Pilgerstätte würde. Aber alle Mühe war umsonst: Bis heute tauschen Sammler auf der ganzen Welt Gegenstände aus dem Besitz des Letzten der großen Nazis, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und einst designierter Nachfolger Hitlers. Im Juni 2016 zahlte ein Argentinier mehr als dreitausend Euro für eine Seidenunterhose des Reichsmarschalls. Monate später blätterte derselbe Mann sechsundzwanzigtausend Euro hin für die Messinghülse, in der die Glasampulle steckte, die Göring am 15. Oktober 1946 zwischen seinen Zähnen zerbiss.
Ähnliche Kapseln erhielten die Parteispitzen der NSDAP nach dem Konzert, das die Berliner Philharmoniker noch am 12. April 1945 gaben, kurz vor dem Fall der Stadt. Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition und oberster Architekt des Dritten Reichs, hatte ein Sonderprogramm organisiert mit Beethovens Violinkonzert in D-Dur, gefolgt von Bruckners Vierter Sinfonie – der »Romantischen« – und endend, sehr passend, mit Brünnhildes Arie beim Finale des dritten Aufzugs von Richard Wagners Götterdämmerung, wenn die Walküre sich auf einem Scheiterhaufen opfert, dessen Flammen schließlich nicht nur die Welt der Menschen, sondern auch den Saal Walhalls und mit ihm sämtliche Götter verzehren. Als das Publikum zum Ausgang strebte, Brünnhildes Schmerzensschreie noch in den Ohren, verteilten Mitglieder des Jungvolks der Hitlerjugend – gerade mal zehnjährig, die Älteren starben auf den Barrikaden – aus kleinen Körben Zyankalikapseln, als wären es Opfergaben bei einer Liturgie. Mit einigen dieser Kapseln nahmen sich Göring, Goebbels, Bormann und Himmler das Leben, viele andere Nazigrößen schossen sich, während sie auf die Kapseln bissen, gleichzeitig in den Kopf, da sie Sabotage befürchteten oder ein Versagen des Gifts, was ihnen statt des erwünschten sofortigen und schmerzlosen Todes ebenjenes qualvolle Ende bereitet hätte, das sie verdienten. Hitler war gar so fest von einer Manipulation der Dosierung überzeugt, dass er sich entschloss, die Wirkung erst an Blondi zu erproben, seiner Schäferhündin, die ihn in den Führerbunker begleitet hatte, zu Füßen seines Bettes schlief und alle möglichen Privilegien genoss. Lieber wollte er sie töten, als zuzulassen, dass sein Liebling den russischen Truppen in die Hände fiel, die Berlin bereits umringt hatten und dem unterirdischen Bunker Tag für Tag näher rückten. Nur hatte er nicht den Mut, es selbst zu tun, und so befahl er seinem Leibarzt, eine der Giftampullen im Maul des Tiers zu zerdrücken. Die Hündin – die gerade vier Junge zur Welt gebracht hatte – starb auf der Stelle, als das winzige Cyanidmolekül, bestehend aus einem Atom Stickstoff, einem Atom Kohlenstoff und einem Atom Kalium, in ihre Blutbahn gelangte und ihren Atem lähmte.
Cyanid wirkt so blitzartig, dass es nur ein einziges Zeugnis für seinen Geschmack gibt, hinterlassen zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts von M. P. Prasad, einem zweiunddreißigjährigen indischen Goldschmied, der noch ein paar Zeilen kritzeln konnte, nachdem er es geschluckt hatte. »Ärzte, Zyankali, ich habe es probiert, es brennt auf der Zunge, schmeckt bitter«, stand auf einem Zettel, den man in dem Hotelzimmer, das er sich für seinen Freitod genommen hatte, bei seinem Leichnam fand. Die wasserlösliche Form des Gifts, in Deutschland bekannt als Blausäure, ist äußerst flüchtig; ihr Siedepunkt liegt bei sechsundzwanzig Grad Celsius, und sie hinterlässt in der Luft einen leicht bittermandelartigen Geruch, den nicht alle wahrnehmen, da die Fähigkeit dazu abhängt von einem Gen, über das vierzig Prozent der Menschen nicht verfügen. Aufgrund dieser Laune der Natur ist anzunehmen, dass ein nicht geringer Teil der in Auschwitz, Majdanek und Mauthausen mit Zyklon B Ermordeten den Geruch des in die Gaskammern strömenden Cyanids nicht einmal bemerkte, während andere mit demselben Duft in der Nase starben wie die Organisatoren ihrer Vernichtung beim Zerbeißen der Suizidkapseln.
Jahrzehnte zuvor hatte man einen Vorläufer des von den Nazis in den Vernichtungslagern eingesetzten Gifts – das Zyklon A – in Kalifornien als Pestizid auf die Orangen gesprüht, so wie man damit auch die Züge entlauste, in denen sich Zigtausende mexikanische Einwanderer versteckt hatten, um über die Grenze in die USA zu gelangen. Das Holz der Waggons verfärbte sich daraufhin und zeigte einen wunderschönen bläulichen Ton, es ist derselbe, den man auch heute noch an einigen Ziegelsteinen in Auschwitz sehen kann; beides verweist auf den eigentlichen Ursprung dieses Cyanids, isoliert 1782 aus dem ersten synthetischen Pigment, dem Preußischblau.
Kaum stand der Farbstoff zur Verfügung, trat er seinen Siegeszug in der europäischen Kunst an. Dank geringerer Kosten hatte das Preußischblau innerhalb weniger Jahre fast vollständig die Farbe ersetzt, mit der die Maler seit der Renaissance die Engelsgewänder und den Mantel der Heiligen Jungfrau schmückten: das Ultramarin, das edelste und teuerste aller blauen Pigmente, gewonnen aus dem Lapislazuli, das man in den Höhlen des afghanischen Koktscha-Tals förderte und zermahlte. Dieses Mineral, nun allerfeinstes Pulver, ergab ein so prachtvolles Indigoblau, dass es nichts Vergleichbares gab, erst Anfang des achtzehnten Jahrhunderts konnte es chemisch nachgeschaffen werden, als ein Schweizer Farbenhersteller namens Johann Jacob Diesbach das Preußischblau entdeckte. Es war ein Versehen gewesen, denn eigentlich wollte er das Karminrot erzeugen, das man durch die Verarbeitung von Millionen weiblicher Koschenillen erhält, kleiner Schildläuse, die in Mexiko, Mittel- und Südamerika als Parasiten auf Feigenkakteen leben und so empfindlich sind, dass sie einer noch größeren Pflege bedürfen als die Seidenraupen, zumal Wind, Regen und Frost ihren flaumig weißen Körpern leicht Schaden zufügen, wenn sie nicht gleich aufgefressen werden von Ratten, Vögeln oder anderen Insekten. Ihr scharlachrotes Blut war – neben Silber und Gold – einer der größten Schätze, die die Konquistadoren den amerikanischen Völkern raubten. Die spanische Krone sicherte sich das Monopol auf das Karminrot und diktierte über Jahrhunderte die Preise. Diesbach hätte das Monopol gern gebrochen, doch als er einmal sale tartari (Pottasche) auf ein Destillat von tierischen Resten schüttete, mit denen einer seiner Gehilfen experimentierte, der junge Alchemist Johann Conrad Dippel, ergab das Gemisch nicht das leuchtende Rot des Insekts Dactylopius coccus, sondern ein so strahlendes Blau, dass Diesbach dachte, er hätte das hsbd-iryt gefunden, die ursprüngliche Farbe des Himmels, das legendäre Blau, mit dem die Ägypter die Haut ihrer Götter verzierten. Jahrhundertelang von den ägyptischen Priestern mit Argusaugen bewacht, war das Rezept eines Tages von einem griechischen Dieb gestohlen worden, ging nach dem Untergang des Römischen Reichs aber für immer verloren. Diesbach nannte seine neue Farbe »Preußischblau«, um ein inniges und dauerhaftes Band zu knüpfen zwischen seiner zufälligen Entdeckung und diesem Reich, das die alten Imperien gewiss einmal an Ruhm übertreffen würde. Tatsächlich hätte es sehr viel größerer Fähigkeiten bedurft – der Gabe der Weissagung vielleicht –, um seinen künftigen Niedergang zu erahnen, und Diesbach mangelte es nicht nur an dergleichen höheren Vorstellungskraft, sondern auch am notwendigen Händchen fürs Geschäftliche und an den unentbehrlichen Handelskontakten, um den materiellen Gewinn aus seiner Schöpfung zu ziehen, sodass es seinem Finanzier zufiel, dem Ornithologen, Sprachforscher und Entomologen Johann Leonhard Frisch, sein Blau in Gold zu verwandeln.
Frisch häufte ein Vermögen an mit dem Vertrieb von Preußischblau, er belieferte Geschäfte in Paris, London und Sankt Petersburg. Mit den Erträgen kaufte er einige hundert Hektar Land in der Nähe von Spandau, wo er mit der ersten Seidenraupenzucht Preußens begann. Der leidenschaftliche Naturforscher schrieb einen langen Brief an König Friedrich Wilhelm I., in dem er die einzigartigen Eigenschaften der kleinen Seidenraupe rühmte, auch legte er darin ein ambitioniertes Projekt des landwirtschaftlichen Umbaus dar, eine Vision, die ihm im Traum gekommen war: Er hatte Maulbeerbäume in allen Kirchhöfen Preußens gesehen und wie sich die kleinen Raupen des Bombyx mori von den sattgrünen Blättern ernähren. Der Plan, vom König eher zaghaft umgesetzt, wurde schließlich im Dritten Reich, fast zwei Jahrhunderte später, umso schwungvoller aufgegriffen. Millionen solcher Bäume pflanzten die Nationalsozialisten auf Brachflächen und in Wohnsiedlungen, an Schulen und auf Friedhöfen, in den Parkanlagen von Krankenhäusern und Heilanstalten und beiderseits der Autobahnen, die das neue Deutschland durchzogen. Man verteilte Anleitungen und Handreichungen an die Amateurlandwirte, in denen die staatlich verordneten Techniken für die Ernte und die Weiterverarbeitung der Seidenraupen beschrieben standen; so waren die Puppen nach dem Einsammeln mindestens drei Stunden über einen Topf mit siedendem Wasser zu hängen, damit der Dampf sie langsam tötete, ohne dass das kostbare Material der Kokons, in die sie sich eingesponnen hatten, Schaden litt. Dieselbe Methode hatte Frisch bereits in einem der Anhänge seines Opus magnum beschrieben, ein dreizehnbändiges Werk, dem er die letzten zwanzig Jahre seines Lebens widmete und worin er mit einer Akribie, die schon an Wahnsinn grenzte, dreihundert in Deutschland heimische Insektenarten erfasste. Der letzte Band enthält den vollständigen Lebenszyklus der Feldgrille, vom Nymphenstadium bis hin zum Lockgesang der geschlechtsreifen Männchen, ein lautes, durchdringendes Zirpen wie der Klang einer mit dem Rauholz gestrichenen Geigensaite. Frisch beschrieb es ebenso wie das Paarungsverhalten und die Eiablage der Weibchen, deren Gelege eine erstaunlich ähnliche Farbe hat wie das Pigment, das ihn zu einem vermögenden Mann machte und mit dem Künstler in ganz Europa arbeiteten, kaum dass es im Handel erhältlich war.
Das erste große Werk, bei dem es zum Einsatz kam, war Die Grablegung Christi, gemalt 1709 von dem Niederländer Pieter van der Werff. Am Himmel ziehen Wolken und verdecken den Horizont, während der blaue, das Gesicht der Jungfrau verdunkelnde Schleier leuchtet und die Trauer der beim nackten Leichnam des Messias versammelten Jünger spiegelt; seine Haut ist so blass, dass sie das Gesicht der Frau illuminiert, die vor ihm kniet und seinen Handrücken küsst, als wollte sie mit ihren Lippen die von den eisernen Nägeln geschlagenen Wunden schließen.
Eisen, Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei, Phosphor, Arsen – zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts kannte der Mensch nur eine Handvoll reiner Elemente. Die Chemie hatte sich von der Alchemie noch nicht emanzipiert, und die Verbindungen, die man unter einer Vielfalt arkaner Bezeichnungen wie Wismut, Vitriol, Zinnober und Amalgam kannte, waren ein Nährboden für alle möglichen unerwarteten und glücklichen Zufälle. Das Preußischblau zum Beispiel hätte es nicht gegeben ohne den jungen Alchemisten, der in Diesbachs Werkstatt arbeitete. Johann Conrad Dippel präsentierte sich selbst als pietistischen Theologen, Philosophen, Künstler und Arzt; seine Verleumder dagegen sahen in ihm bloß einen Quacksalber. Er wurde auf der Burg Frankenstein im Odenwald geboren, und von klein auf besaß er ein außergewöhnliches Charisma, dem sich niemand, der sich länger in seiner Gegenwart aufhielt, entziehen konnte. Für eine Weile schlug er gar einen der bedeutendsten Wissenschaftler der damaligen Zeit in seinen Bann, den schwedischen Mystiker Emanuel Swedenborg, der erst einer seiner begeistertsten Jünger war, schließlich aber sein größter Widersacher. Swedenborg zufolge hatte Dippel ein Talent dafür, die Leute vom Glauben abzubringen, um sie sodann aller Erkenntnisse des Wahren und Guten zu berauben und »in einer Art Delirium zurückzulassen«. In einer seiner glühendsten Schmähschriften vergleicht Swedenborg ihn mit keinem Geringeren als mit Satan: »Er ist der schändlichste Teufel, keinem Prinzip unterworfen, vielmehr allen feind.« Seine Kritik berührte Dippel nicht, er war längst immun gegen die Empörung, nachdem er wegen seiner häretischen Ideen und Praktiken sieben Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Als die Strafe verbüßt war, ließ er jeden Anspruch auf Menschlichkeit fahren und führte zahllose Experimente mit lebenden und toten Tieren durch, die er mit rastlosem Eifer sezierte. Sein Ziel war es, in die Geschichte einzugehen als der erste Mensch, der eine Seele von einem Körper in einen anderen verpflanzte. Was ihn am Ende aber zur Legende machte, war die Grausamkeit und perverse Lust, mit der er die Überreste seiner Opfer handhabte. In seinem Buch Vitae animalis morbus et medicina, veröffentlicht in Leiden unter dem Pseudonym Christianus Democritus, behauptete er, er habe das Lebenselixier entdeckt – das flüssige Pendant zum Stein der Weisen –, das es vermöchte, jede Krankheit zu heilen und dem, der es tränke, die Unsterblichkeit zu verleihen. Vergeblich versuchte er sein Rezept gegen das Eigentumsrecht an der Burg Frankenstein einzutauschen, und die einzige Verwendung, die man für sein Gebräu fand – eine Mischung aus verwesendem Blut, Knochen, Geweih, Horn und Huf –, war als Insektizid, so unvergleichlich stank es. Aufgrund dieser Beschaffenheit diente die teerig klebrige Flüssigkeit Jahrhunderte später den deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg als nichttödliches (und demnach vom Genfer Protokoll ausgenommenes) chemisches Mittel; man schüttete es in die nordafrikanischen Brunnen, um das Vorrücken der Truppen des Generals Patton zu erschweren, dessen Panzer sie durch den Wüstensand verfolgten. Schließlich sollte das Blau, das sich einer der Ingredienzien von Dippels Elixier verdankte, nicht nur auf dem Wasser von Hokusais Die Große Welle vor Kanagawa und am Himmel von van Goghs Sternennacht erstrahlen, sondern auch auf den Uniformen der preußischen Infanterie, so als wäre da etwas in der chemischen Struktur der Farbe, was nach Gewalt riefe: ein Schatten, ein grundlegender Makel, Erbe der Experimente dieses Alchemisten, der Tiere bei lebendigem Leib zerstückelte, ihre Überreste zu schrecklichen Chimären zusammenfügte und mit Elektrizität zum Leben zu erwecken versuchte; Monster, wie sie Mary Shelley zu ihrem meisterlichen Roman Frankenstein oder Der moderne Prometheus inspirierten, einer Warnung vor dem blinden Fortschritt in der Wissenschaft, der gefährlichsten aller menschlichen Künste.
Schon der Chemiker, der das Cyanid entdeckte, bekam diese Gefahr am eigenen Leib zu spüren: 1782 benutzte Carl Wilhelm Scheele zum Umrühren eines Topfes Preußischblau einen Löffel, an dem noch Reste von Schwefelsäure hingen, und so schuf er das mächtigste Gift der modernen Zeit. Er nannte seine neue Verbindung »Berlinerblausäure« und erkannte sofort das ungeheure Potenzial, das ihm seine besondere Reaktivität verlieh. Nur hätte er sich nicht vorstellen können, dass es keine zweihundert Jahre nach seinem Tod, mitten im zwanzigsten Jahrhundert, eine solch umfassende industrielle Verwendung in der Medizin und in der Chemie finden sollte, dass man Monat für Monat eine Menge produzierte, die ausreichte, um alle Menschen auf dem Planeten zu vergiften. Scheele, dieses zu Unrecht vergessene Genie, wurde sein Leben lang vom Pech verfolgt. Zwar war er der Chemiker, der mehr natürliche Elemente als irgendein anderer entdeckte (neun, einschließlich des Sauerstoffs, den er »Feuerluft« nannte), dennoch musste er die Anerkennung einer jeden seiner Entdeckungen mit Kollegen von geringerem Talent teilen, da sie ihre Ergebnisse vor ihm bekanntmachten. Scheeles Verleger brauchte mehr als fünf Jahre für die Herausgabe des Buchs, an dem der Schwede mit so viel Herzblut und Selbstdisziplin gearbeitet hatte, was so weit ging, dass er an den neuen Substanzen, die er in seinem Labor hervorzauberte, oftmals roch und sie sogar probierte. Zum Glück tat er es nicht mit seiner Blausäure, es hätte ihn binnen Sekunden umgebracht. Trotzdem kostete ihn diese Angewohnheit mit dreiundvierzig Jahren das Leben; er starb mit zerstörter Leber, von Kopf bis Fuß bedeckt von eiternden Blasen und gelähmt von der angesammelten Flüssigkeit in seinen Gelenken. Es waren dieselben Symptome wie bei Tausenden von europäischen Kindern, deren Spielzeuge angemalt waren mit einer von Scheele hergestellten, arsenhaltigen Farbe, ohne dass ihm bewusst gewesen wäre, wie toxisch sie war – ein so leuchtendes und verführerisches Smaragdgrün, dass Napoleon sie zu seiner Lieblingsfarbe erkor.
Scheeles Grün zog sich über die Tapeten der Zimmer und Bäder des Longwood House, des feuchten und dunklen, von Spinnen und Ratten befallenen Wohnsitzes des Kaisers während seiner sechs Jahre dauernden britischen Gefangenschaft auf der Insel St. Helena. Die Farbe, die seine Gemächer schmückte, erklärt womöglich den hohen Arsengehalt, den man in Haarproben fand, analysiert zwei Jahrhunderte nach seinem Tod, so wie die Toxine auch den Krebs verursacht haben könnten, der ihm ein Loch von der Größe eines Tennisballs in den Magen fraß. In den letzten Lebenswochen des Kaisers zerstörte die Krankheit seinen Körper mit derselben Rasanz, mit der seine Soldaten durch Europa gefegt waren: Seine Haut nahm einen grauen, leichenfahlen Ton an, seine Augen verloren allen Glanz und versanken in den Höhlen, in seinem spärlichen Bart klebten Reste von Erbrochenem; die Armmuskulatur schwand, und seine Beine überzogen sich mit kleinen Wunden, als erinnerten sie sich plötzlich all der kleinen Schnitte oder Kratzer, die sie im Laufe des Lebens erhalten hatten. Aber Napoleon war nicht der Einzige, der unter dem Exil auf der Insel zu leiden hatte. Seine Bediensteten, eine ganze Schar von Mitgefangenen in der Verbannung in Longwood, hinterließen zahlreiche Zeugnisse, die ihre ständigen Durchfälle und Magenschmerzen belegen, das schreckliche Anschwellen ihrer Gliedmaßen und einen Durst, den keine Flüssigkeit zu stillen vermochte. Mehrere von ihnen starben mit ähnlichen Symptomen wie der Mann, dem sie gedient hatten, was die Ärzte, Gärtner und sonstigen Mitglieder des Hauspersonals nicht daran hinderte, sich förmlich um die Bettlaken des toten Kaisers zu reißen, obwohl sie voller Blut waren, befleckt von Kot und Urin und sicherlich auch kontaminiert mit der Substanz, die ihn schleichend vergiftet hatte.
Arsen ist ein geduldiger Mörder, es versteckt sich tief im Körpergewebe und sammelt sich dort über Jahre an. Cyanid dagegen nimmt einem buchstäblich den Atem. Eine ausreichend hohe Konzentration stimuliert mit einem Schlag die Chemorezeptoren des Glomus caroticum und löst einen die Atmung blockierenden Reflex aus, in der englischen medizinischen Literatur beschrieben als audible gasp, der dem Herzrasen vorangeht, dem Atemstillstand, den Zuckungen und dem Herz-Kreislauf-Kollaps. Die Geschwindigkeit, mit der es wirkt, machte es zum bevorzugten Gift nicht weniger Mörder. So glaubten etwa die Feinde Grigori Rasputins, sie könnten Alexandra Fjodorowna Romanowa, die letzte Zarin des russischen Kaiserreichs, aus seinem Bann befreien, indem sie ihn mit petits fours vergifteten, versetzt mit Cyanid. Doch aus einem bisher unbekannten Grund war Rasputin dagegen immun, und um ihn zu töten, musste ihm erst dreimal in die Brust und einmal in den Kopf geschossen werden, ehe man seinen Leichnam in eiserne Ketten schlug und in die zugefrorenen Wasser der Newa warf. Der gescheiterte Giftanschlag aber mehrte nur noch den Ruhm des verrückten Mönchs, ebenso die Verehrung, die die Kaiserin und ihre vier Töchter seinem Leichnam entgegenbrachten, und so schickten sie ihre treuesten Bediensteten aus, ihn aus dem Eis zu bergen, und legten ihn auf einen Altar im Wald, wo die Kälte seinem Leib ein perfekter Schutz war, bis die Behörden beschlossen, ihn einzuäschern, es war die einzige Möglichkeit, ihn ganz und gar verschwinden zu lassen.
Cyanid lockte aber nicht nur Mordgesellen aller Art. Nachdem ein britisches Gericht ihn wegen seiner Homosexualität zu einer chemischen Kastration verurteilt hatte und ihm Brüste gewachsen waren, nahm sich Alan Turing, Mathematikgenie und Vater der Informatik, mit einem Biss in einen vergifteten Apfel das Leben. Der Legende nach wollte er auf diese Weise einer Szene aus Schneewittchen nacheifern, seinem Lieblingsfilm, wo es heißt: »Dip the apple in the brew / Let the Sleeping Death seep through«, Verse, die er bei der Arbeit manchmal vor sich hin sang. Doch der Apfel wurde nie untersucht, sodass die Suizidhypothese nicht bewiesen werden konnte (die Kerne enthalten zwar einen natürlichen Stoff, der im Körper Blausäure freisetzt, allerdings brauchte es, um einen Menschen zu töten, mindestens eine halbe Tasse voll), und manche glauben, Turing sei vom britischen Geheimdienst ermordet worden, obwohl gerade er mit seinem Team den Code geknackt hatte, mit dem die Deutschen im Zweiten Weltkrieg ihre Funksprüche verschlüsselten, ein entscheidender Faktor beim Sieg der Alliierten. Einer seiner Biografen deutet an, die zweifelhaften Umstände seines Todes (die Tatsache etwa, dass in seinem Hauslabor ein Fläschchen mit Zyankali stand, oder der handschriftliche Zettel auf seinem Nachttisch, auf dem nur die am nächsten Tag zu tätigenden Einkäufe aufgelistet waren) könnten von Turing selbst arrangiert worden sein, damit seine Mutter an einen Unfall glauben konnte und nicht die Bürde eines Suizids tragen musste. Es wäre dies das exzentrische Adieu eines Mannes gewesen, der sich den Unbilden des Lebens auf eine sehr eigene, sehr persönliche Weise stellte. Da er es nicht mochte, dass seine Bürokollegen seinen Lieblingsbecher benutzten, kettete er ihn, gesichert mit einem Vorhängeschloss, an einen Heizkörper, wo er heute noch hängt. 1940, als England sich auf eine deutsche Invasion vorbereitete, erwarb Turing von seinen Ersparnissen zwei Silberbarren und vergrub sie in der Nähe seiner Arbeitsstätte im Wald. Er fertigte eine raffiniert codierte Lageskizze an, versteckte die Barren aber so gut, dass es ihm nach Kriegsende auch mit einem Metalldetektor nicht gelang, sie wiederzufinden. In seiner Freizeit spielte er gern »einsame Insel«, ein Spiel, das darin bestand, aus Substanzen, die er zur Hand hatte, die unterschiedlichsten Haushaltsprodukte herzustellen; so schuf er sich sein eigenes Reinigungsmittel, Seife und ein derart potentes Insektizid, dass es die Gärten seiner Nachbarn verwüstete. Während des Krieges benutzte er, um zu seinem Büro im Abhörzentrum Bletchley Park zu kommen, ein Fahrrad mit einer defekten Kette, die zu reparieren er sich weigerte. Statt es in die Werkstatt zu bringen, kalkulierte er lieber die Anzahl der Umdrehungen, die die Kette jeweils noch durchhielt, und sprang, Sekunden bevor sie abfiel, vom Rad. Wurde im Frühling seine Pollenallergie unerträglich, zog er sich eine Gasmaske übers Gesicht (zu Kriegsbeginn hatte die britische Regierung solche Masken an die Bevölkerung ausgeteilt), womit er unter den Passanten Panik säte, da sie dachten, ein Angriff stehe unmittelbar bevor.
Dass Deutschland die Insel mit Giftgas bombardieren würde, schien eine unabwendbare Tatsache zu sein. Einem Berater der britischen Regierung zufolge würde es bei einem Angriff allein in der ersten Woche mehr als zweihundertfünfzigtausend Opfer unter der Zivilbevölkerung geben, weshalb selbst die Neugeborenen speziell für sie entworfene Schutzmasken erhielten. Kinder im Schulalter griffen zum Modell Mickey Mouse