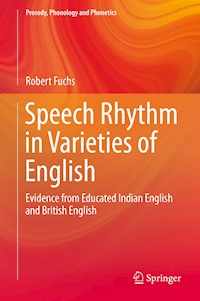Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das wächserne Antlitz drückte furchtbaren Todesschmerz aus, grauenvolles Entsetzen. Der breitgezerrte Mund stand halb offen, als wäre soeben erst ein qualvoller Schrei der Sterbensangst über die Lippen gedrungen. Beide Hände waren in dem Brustteil der Flanelljacke verkrampft. Um die linke Faust hatte sich in dem weißen Stoff ein großer Blutfleck verbreitet, und die Finger dieser Faust waren mit Blut besudelt. Das machte den Eindruck, als wäre der verströmende Lebenssaft hier aus einer Wunde aufgesprudelt und als hätte der Sterbende diesen Quell mit der Faust zu schließen versucht. In diesem Augenblick entdeckte Schulze einen Gegenstand unter der Kniekehle des rechten Beines. »Soll ich das hervorziehen?« fragte er. »Nur zu!« forderte der Kommissar auf und bückte sich neugierig, beide Hände auf die Knie gestemmt. Der Gegenstand war eine zierliche Puderquaste, an deren Zotteln Reste eines gelblichen Puders, vermischt mit etwas künstlichem Wangenrot, zu erkennen waren. Die Quaste duftete nach einem herb riechenden Parfüm. »Aha – und hier liegt eine Haarspange«, sagte der Kommissar plötzlich wie erfreut. Aufmerksam betrachteten die beiden Beamten die unscheinbaren Dinge ... unwichtige Gegenstände ... und doch war durch sie auf die erste Spur zur Aufhellung eines Verbrechens hingewiesen. »Hier – hier, Herr Kommissar!« rief Schulze. Er deutete auf die rechte Faust des Toten. Der Kommissar kniete eilig nieder und starrte auf den von Schulze gewiesenen Fleck. Dann erhoben sich beide Männer. Der Kommissar stellte in hämischem Tone fest: »Ausgerissene Frauenhaare – wahrscheinlich im Kampf ausgerissen – ein Weib also. Ich denke, das alles genügt vorläufig ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Fuchs
Das blonde Frauenhaar
idb
ISBN 9783962243159
1.
Dumpf tappend klangen Schritte im nachtdunkeln Treppenhaus. Einmal glitt ein Fuß aus auf der Kante einer Stufe. Ein Poltern drang durch den finsteren Schacht des Stiegenraumes.
Der herabschleichende Mensch hielt den Atem an und krampfte die rechte Hand fester um das Geländer. Dann stahl er sich mit vorsichtigem Tasten der Sohlen weiter, bis er vor dem verschlossenen Haustor stand.
Die Helle der Straßenbeleuchtung drang hier zwischen vergitterten Scheiben herein. Der zage Schimmer überfloß ein verzerrtes Menschenantlitz, dessen spähende Augen ein paar Sekunden lang einen jenseits der Straße schreitenden Fußgänger verfolgten. Dieser Mann hatte den Mantelkragen hochgeschlagen, das Kinn in die schützende Hülle vergraben, und ohne auf die Einsamkeit des Weges zu achten, strebte er irgendeinem Ziele zu. Ein Auto ratterte vorüber.
Als die Schritte des Mannes verhallten, der tosende Motor des Kraftwagens nicht mehr zu hören war, schob der Mensch im Hausflur geräuschlos den Schlüssel in das Schloß. Die sich nach innen öffnende Tür ließ sich ohne Mühe zurückziehen. Ein hastiger Blick straßauf und straßab. Da weit und breit keine Menschenseele und kein Fahrzeug zu gewahren war, verließ der Flüchtende das Haus. Mit dem leis zischenden Saugen des selbsttätigen Türschließers ging langsam die Pforte zu.
Ohne Hast, ohne unüberlegtes sinnloses Gebaren, wenn auch am ganzen Körper zitternd, glitt eine scheue Gestalt an den Häusern entlang. Sie verschwand um die nahe Straßenecke und im Finstern einer schmalen Seitengasse.
Dort blieb der Flüchtende unter einem Erdgeschoßfenster stehen. Blutroter Lichtschein, erzeugt durch von innen erhellte purpurfarbene Vorhänge, übergoß den verharrenden Menschen. Drinnen dröhnte eine Männerstimme unnatürlich und gequollen, weil sie aus dem Lautsprecher eines Radioempfängers scholl. Der Ansager verkündete eine neue Nummer der Abendveranstaltung. Plötzlich flutete plärrende Musik einen bekannten Gassenhauer hin über die Zuhörer drinnen. Schrille Frauenstimmen sangen mit: »Valencia ... derallala ... derallala ... derallalaaaa ...«
Der Mensch vor dem Fenster musterte in dem roten Lichte die Vorderseite seines Ueberrockes. Der hellfarbige Mantelstoff zeigte nahe dem unteren Saume zwei tiefdunkle Flecke. Schrecken überfiel den Mann. Langsam bog er sich weiter vornüber und betrachtete ratlos die schwarz erscheinenden Spuren der Besudelung.
»Valencia ... derallala ... derallala ...!« sangen hinter den Purpurvorhängen aufs neue Frauenstimmen, vereint mit einem gröhlenden Baß.
Der Mensch richtete sich schwerfällig auf, als wäre nach und nach eine ungeheure Last auf seinen Rücken niedergesunken. Sein Blick fing sich jetzt an einem Firmenschild über dem Eingang. Die Buchstaben verkündeten eine Kneipe »Zum gesottenen Hummer«, und sie verhießen Getränke aller Art, die von freundlicher Damenbedienung aufgetragen würden. Die immer wieder den Kehrreim des Gassenhauers schrill mitsingenden Frauenstimmen bekräftigen diese Ankündigung.
Nach einer Minute sorgsamen Nachdenkens zog der Mann ein Taschentuch hervor und arbeitete damit an seiner Nase herum. Mehrmals betrachtete er vergeblich das weiße Linnen. Endlich zeigte es Blutspuren. Und nun, das Taschentuch ans Gesicht pressend, schritt er entschlossen die drei Treppenstufen des Einganges hinauf und betrat die Kneipe.
Der Gassenhauer war eben zu Ende. »Wir bringen jetzt den Twostep »›Mumblin Mose‹ von Thurban!« hörte man aus dem Lautsprecher. Sogleich hob ein Saxophon ein melancholisches Genäsel an.
Ein schlankes Mädchen löste sich von einer kreuzvergnügten Gruppe, die zechend an einem Tisch in der Ecke schwatzte und lachte. Das Mädchen hatte ein hübsches, zartes Gesicht mit großen Blauaugen. Doch dies Antlitz wirkte wie eine absichtlich gewählte Maske in seinem unnatürlichen Verschminktsein und mit der übermäßigen Rötung des bemalten Mundes. Die Kellnerin fuhr glättend über ihr kurzverschnittenes, blond gebeiztes Haar und näherte sich mit einem Lächeln der Verlegenheit dem neuen Gast. Offenbar mangelte ihr die nötige Dreistigkeit für ihren Beruf.
»Guten Abend«, grüßte sie zaghaft, fast schämig, und wies den Besucher nach einem abseits stehenden kleinen Tische hin.
Der junge Mann entschuldigte sich: »Seien Sie nicht bös, Fräulein, denn ich will mich nur ein paar Minuten hier erholen. Ich bin von einem scheußlichen Nasenbluten befallen. Mir ist ganz übel.«
Dabei zeigte er sein mit nur leichten hellroten Flecken betupftes Taschentuch.
»Ich werde Ihnen ein kaltes Schlüsselbund ins Genick legen«, versprach das Mädchen.
Der Mann erwiderte: »Sehr liebenswürdig. Man sagt, das hülfe. Gern hätte ich Sie um ein wenig Essig gebeten zum Riechen. Das soll auch helfen. Ich möchte mein Taschentuch damit anfeuchten.«
Eine dicke Weibsperson hinter dem Schanktisch rief herüber: »Hier, Sylvia, nehmen Sie lieber ein Stückchen Eis, in ein Tuch gewickelt.«
Das Mädchen befolgte den Rat. Sie tat das Eis in ihr Batisttüchelchen und zwängte den naßkalten Gegenstand hinter den Kragen des Mannes.
Der Fremde saß still da, ein wenig ratlos und mit unzufriedener Miene, als sei ihm eine Absicht mißglückt. Zu der wieder singenden Gruppe am entfernten Tisch lugend, hielt er sein Taschentuch vors Gesicht.
»Wie scheußlich das aussieht!« sagte plötzlich Sylvia schaudernd, als sie zufällig über die Schulter des Gastes vorn hinabblickte.
»Scheußlich? – Was – wieso?«
»Das Blut aus der Nase ist auf Ihren Mantel getropft. Sehen Sie nur: zwei ganz nasse große Flecke.«
»Das machen Sie mal gleich weg, mein Herr«, riet die Weibsperson vom Schanktische aus. »Wenn Blut eintrocknet in solch hellem Stoff, hilft keine Reinigung mehr. Es wäre schade um den schönen Ulster. Gerade vorn ganz verdorben.«
Sylvia holte eine Wasserschüssel und einen Lappen herbei und machte sich bereitwillig an die Arbeit.
Der Mann sah dem zu seinen Füßen kauernden Mädchen aufmerksam zu. Er schien nun zufrieden zu sein. Mit einem Ausdruck schuldbewußter Dankbarkeit in den ernsten Augen verfolgte er Sylvias Tun. Die Blutspuren verschwanden vollkommen von dem filzhaarigen Mantelstoff, dessen Rauheit der roten Flüssigkeit das Eindringen verwehrt hatte.
Die Person hinter dem Schanktisch sagte plötzlich schrill: »Sind Sie ungeschickt, Sylvia! Was knien Sie sich die Seidenstrümpfe schmutzig! Der Herr kann doch seinen Mantel ausziehen.«
»Das ist auch wahr«, bestätigte das Mädchen und lächelte zu dem Gast hinauf.
Doch als sie sich erhob, ihm beim Ablegen behilflich zu sein, wehrte er ihr.
»Danke vielmals, Kleine, aber ich habe wirklich nicht Zeit, mich aufzuhalten. Ich fühle mich auch wieder ganz munter. Ich habe öfter solche Anfälle, verbunden mit Nasenbluten.«
Sylvia sah enttäuscht drein.
Die dicke Schankdame meinte schroff: »Na, Sie sind gut! Als vornehmer Herr werden Sie zum Dank doch wenigstens eine Flasche Wein mit dem Mädel trinken. Sie kriegt das Pfropfengeld. Los, Sylvia, servieren Sie!«
Das Mädchen gehorchte. Während die Gebieterin sachkundig eine Rotweinflasche entkorkte, die Gläser auf ein Tablett stellte und alles der Kellnerin übergab, plärrte der Lautsprecher einen alten Operettenschlager.
An dem Tisch in der Ecke sang man vergnügt mit: »Das ist die Liebe – die dumme Liebe – ...«
Zwei Paare an dem mit Flaschen dicht bestellten Tische küßten einander. Von den Vorgängen mit dem neuen Gast hatten sie keinerlei Notiz genommen.
Sylvia schenkte ein. Der rote Wein gluckerte in die Gläser. Der Fremde sah starr auf den rinnenden Trank. Dann verfärbte sich sein Gesicht zu leichenhafter Blässe.
»Ihr Wohlsein!« flüsterte in diesem Augenblick das junge Ding und ließ ihr Glas an das andere klingen.
Der Mann machte eine verneinende Geste, als ekle er sich vor dem blutigroten Getränk.
Dann sagte er: »Trinken Sie nur, Kleine, ich mag nichts.«
Sylvia nahm ihr Glas von den Lippen und lächelte voll Mitleid.
»Es ist auch wahrscheinlich bester so«, bestätigte sie. »Der Wein treibt Ihnen vielleicht noch mehr das Blut in den Kopf.«
Sie trank einen bescheidenen Schluck und legte schüchtern-liebkosend ihre Hand über die aus der Tischplatte ruhende Rechte des Gastes. Es kam über sie wie ein seltsames Mitleiden, wie der jäh in ihr wach werdende Wunsch, dem jungen Menschen Trost zu spenden. Ihre Hand zitterte. Doch sie fühlte auch das heftige Zittern dieser Manneshand unter ihren weichen Fingern.
Freundlich riet das Mädchen dem späten Besucher: »Es wäre wohl richtiger, Sie gingen nach Hause.«
Mit einem müden Seufzen, körperliche und seelische Schwäche verratend, legte der Fremde einen Geldschein auf den Tisch, Bezahlung und reiches Trinkgeld zugleich. Sein Geldtäschchen war dick gefüllt mit Banknoten. Dann erhob er sich zum Abschied.
Gerade dröhnte der Lautsprecher: »Wir machen jetzt in der Abendmusik eine Pause und bringen die neuesten Tagesnachrichten.« Dann hörte man deutlich, wie der Ansager mit Papierblättern raschelte.
Hierauf scholl die entstellte Stimme eindringlich: »Gerüchte über einen heute abend verübten Mord verbreiten sich mit so unheimlicher Schnelligkeit, daß wir uns veranlaßt sehen, sie weiterzugeben.«
Da sah Sylvia, wie ihr Gast wortlos und grußlos aus dem rauchdurchnebelten Kneipraum eilte.
*
Frau Schlomke stand mit vor Entsetzen geweiteten Augen in dem Winkel zwischen Kleiderschrank und Tür. Die furchtbare Erschütterung hatte sie förmlich erstarren lassen. Es war dem armen Geschöpf in diesem Zustand unmöglich, Tränen zu vergießen.
Der Beamte wandte ihr sein ruhiges, beinahe gleichgültiges Gesicht zu. Er betrachtete eingehend die hübsch und stattlich aussehende, etwa in den Dreißiger Jahren stehende Frau.
Sie war unauffällig gekleidet, aber ihre Gewandung war doch von modischem Schnitt und nicht einfach genug für eine in dienender Nebenstellung als Aufwärterin tätige Person. Offenbar hielt Frau Schlomke sehr auf ihr Aeußeres. Sie war es, die nach der Entdeckung des Verbrechens die Behörde verständigt und herbeigerufen hatte durch ein Ferngespräch aus der Wohnung des Toten.
Endlich fragte der Kommissar: »Sie fanden also die Flurtür unverschlossen – und das fiel Ihnen sofort auf?«
Eintönig gab Frau Schlomke Auskunft: »Herr Beverstorff hatte mir von Beginn meines Morgendienstes an die Schlüssel übergeben. Der eine ist der Drücker, mit dem sich die Haustür, aber auch die Flurtür öffnen läßt. Um die Flurtür aufzusperren, muß man den anderen Schlüssel aber erst zweimal im oberen Schloß herumdrehen.«
Der Beamte stellte fest: »Herr Beverstorff schloß sich also gewohnheitsmäßig des Abends ein – etwa vor dem Schlafengehen.«
»Ja«, bestätigte Frau Schlomke. »Das bin ich seit fünf Jahren so gewöhnt. Fünf Jahre schon bin ich bei dem armen Herrn für Morgendienst angestellt gewesen.«
»Nur für Morgendienst?«
»Jawohl, nur morgens komme ich in die Wohnung.«
»Und zum ersten Male in den fünf Jahren fanden Sie die Flurtür unverschlossen?«
»Zum erstenmal«, versicherte die Frau. Und wie um die Wichtigkeit dieses Befundes besonders hervorzuheben, wiederholte sie nachdrücklich: »Zum allerersten Male!«
»Daher fiel Ihnen der unverschlossene Zustand der Tür sofort auf?«
»Sofort, Herr Kommissar. Ich war an das Aufschließen so sehr gewöhnt, daß ich ein paarmal immer wieder den oberen Schlüssel herumzudrehen versuchte. Ich dachte, das Schloß müsse sich verklemmt haben. Dann erst kam mir der Gedanke, den Drücker einzuschieben, und da ging dann auch sofort die Flurtür auf.«
»Das hat Sie sehr überrascht?«
»Sehr. Ich dachte: Nanu, das Zuschließen hat er doch noch niemals vergessen.«
Der Beamte unterbrach: »Dadurch schöpften Sie sogleich irgendwelchen Verdacht?«
»Nein, das nicht«, entgegnete Frau Schlomke, und sie machte abwehrend eine müde Handbewegung. »Es kam mir nur sonderbar vor. Doch ich ging dann ohne böse Gedanken an meine Arbeit, wie immer.«
»Worin bestand diese Arbeit?« wollte der Beamte hören.
»Ich kochte auf Gas in der Küche den Kaffee, richtete auf dem Servierbrett das Frühstück her, und das mußte ich dem Herrn Beverstorff ans Bett bringen.«
»Hatten Sie denn ohne weiteres Zutritt zum Schlafzimmer?« forschte der Beamte. »Ich meine: die Schlafzimmertür schloß Ihr Herr niemals zu?«
»Niemals. Ich war angewiesen, ohne vorheriges Anklopfen hineinzugehen. Auf dem Tisch da setzte ich das Servierbrett ab. Dann mußte ich die Vorhänge aufziehen. Darüber wurde Herr Beverstorff gewöhnlich wach. Danach rückte ich den stummen Diener neben das Bett und brachte das Frühstück hin. Es kam auch hier und da mal vor, daß der Herr das alles gar nicht hörte. Für diesen Fall hatte ich den strengen Auftrag, ihn wachzurütteln.«
»Sie genossen demnach viel Vertrauen bei Ihrem Herrn, der offenbar einen festen Schlaf hatte.«
»Ja, manchmal schlief er ganz tief. Wahrscheinlich, wenn er nachts mit Weibern gebummelt hatte.«
Im stillen merkte sich der Kommissar, mit welcher Gehässigkeit die Frau das vorbrachte.
Er fragte weiter: »Na, und wie war das nun heute?«
»Bis auf die unverschlossene Flurtür war alles wie sonst. Als ich aber zu den Fenstervorhängen hinüber wollte, wäre ich beinah' über etwas gefallen.«
»Demnach hätten Sie zunächst nichts gesehen. Schließen denn die Vorhänge so dicht, daß es finster ist im Schlafzimmer?«
»Es sind mit dünnem Filzstoff abgefütterte Samtgardinen, weil draußen keine Fensterladen zum Vorlegen sind.«
»Und warum knipsten Sie nicht Licht an?«
»Das war mir verboten«, sagte Frau Schlomke, und ihre Stimme klang auf einmal wie belegt. »Herr Beverstorff wollte – er meinte immer – er – er – wollte nicht so geweckt sein.«
Der Beamte sagte nichts. Er ging um den mit einer Decke verhüllten Toten herum und zog die Fenstervorhänge zu. Es war nun kaum ein Schimmer von Helle in dem Gemach. Um so krasser wirkte die Lichtflut, als er die Vorhänge wieder zurückgleiten ließ.
Nun deutete er auf die zugedeckte Leiche. »Das da war's also, worüber Sie beinahe gefallen wären, Frau Schlomke?«
Die Aufwärterin drückte beide Fäuste vor die Augen und quälte ein »Ja« hervor.
Mit erhobener Stimme und als hege er ein Mißtrauen gegen die Wahrhaftigkeit der Aussagen, fragte der Kommissar scharf: »Errieten Sie denn sogleich, was unter der Decke lag?«
»Erraten?« staunte Frau Schlomke. »Die Decke habe doch ich ihm übergelegt. Es sah so furchtbar aus, wie er in seinem Blute da in dem grellen Tageslicht lag. Er war immer gut zu mir gewesen, hatte nur freundliche Worte gehabt. Und nun lag er tot vor mir, und ich sah ihm an, daß er in seiner letzten Stunde furchtbare Schmerzen ausgestanden hatte –«
Plötzlich war es, als zerbreche die Stimme der erschütterten Frau. Endlich konnte die Schlomke weinen. Sie sank in den Knien zusammen, kauerte geduckt in dem Winkel zwischen Schrank und Tür und gab Laute von sich wie ein gepeinigtes Tier.
»Wegnehmen, Schulze!« gebot der Kommissar halblaut seinem Gefährten.
Bis dahin, schweigend am Fußende des Bettes lehnend, hatte Schulze dem Gespräch zugehört, indem er ab und zu etwas in sein Notizbuch kritzelte. Er steckte das Merkbuch ein und nickte mit starrer Miene. Der körperlich behäbige Mann schritt ein wenig schwerfällig zu dem Toten hin.
Der Kommissar stellte sich derweil' so auf, daß er sofort einen guten Ueberblick über die Lage des Leichnams erlangen konnte. Schulze zog vorsichtig die Decke fort, zögernd fast, als scheue er den zu erwartenden Anblick.
Der Ermordete lag lang hingestreckt auf dem Rücken, bekleidet mit einem weiß-flanellenen Schlafanzug. Er war ein Mann, der die Fünfziger Jahre weit überschritten haben mußte und zu seinen Lebzeiten gewiß ein stattlicher Mensch gewesen war. Nur die stark angegrauten Haare deuteten auf sein Alter.
Das wächserne Antlitz drückte furchtbaren Todesschmerz aus, grauenvolles Entsetzen. Der breitgezerrte Mund stand halb offen, als wäre soeben erst ein qualvoller Schrei der Sterbensangst über die Lippen gedrungen. Beide Hände waren in dem Brustteil der Flanelljacke verkrampft. Um die linke Faust hatte sich in dem weißen Stoff ein großer Blutfleck verbreitet, und die Finger dieser Faust waren mit Blut besudelt. Das machte den Eindruck, als wäre der verströmende Lebenssaft hier aus einer Wunde aufgesprudelt und als hätte der Sterbende diesen Quell mit der Faust zu schließen versucht.
»Erstochen!« sagte Schulze, der trotz Diensterfahrung und trotz des Gewöhntseins an derartige Bilder kaum weniger fahl aussah als das Totenantlitz vor ihm.
»Und die Waffe?« warf der Kommissar kalt hin.
Beide Männer suchten mit flüchtigen Blicken vergeblich im Schlafzimmer herum.
Schulze meinte: »Sie liegt vielleicht unter dem Toten – falls der Täter sie nicht mitgenommen hat.«
»Dann müssen wir warten«, stellte der Kommissar fest. »Bevor nicht der Arzt und der Fotograf hier waren, dürfen wir nicht das Geringste verändern an der Lage des Körpers.«
In diesem Augenblick entdeckte Schulze einen Gegenstand unter der Kniekehle des rechten Beines.
»Soll ich das hervorziehen?« fragte er.
»Nur zu!« forderte der Kommissar auf und bückte sich neugierig, beide Hände auf die Knie gestemmt.
Der Gegenstand war eine zierliche Puderquaste, an deren Zotteln Reste eines gelblichen Puders, vermischt mit etwas künstlichem Wangenrot, zu erkennen waren. Die Quaste duftete nach einem herb riechenden Parfüm.
»Aha – und hier liegt eine Haarspange«, sagte der Kommissar plötzlich wie erfreut.
Aufmerksam betrachteten die beiden Beamten die unscheinbaren Dinge ... unwichtige Gegenstände ... und doch war durch sie auf die erste Spur zur Aufhellung eines Verbrechens hingewiesen.
»Hier – hier, Herr Kommissar!« rief Schulze.
Er deutete auf die rechte Faust des Toten. Der Kommissar kniete eilig nieder und starrte auf den von Schulze gewiesenen Fleck. Dann erhoben sich beide Männer.
Der Kommissar stellte in hämischem Tone fest: »Ausgerissene Frauenhaare – wahrscheinlich im Kampf ausgerissen – ein Weib also. Ich denke, das alles genügt vorläufig. Wir werden leichte Mühe haben.«
Schulze nickte ernst vor sich hin.
Der Kommissar wandte sich jetzt an Frau Schlomke: »Sagen Sie mal, hatte der Herr die Gewohnheit, Nachtbesuche in die Wohnung, genauer gesagt, ins Schlafzimmer mitzunehmen?«
Die Frau erhob sich aus ihrer kauernden Stellung, nach deutlich merkbarem Zögern murmelnd: »Ich weiß von Herrn Beverstorffs Frauengeschichten nichts.«
In unerbittlicher Schärfe kam die Frage: »Und Sie selbst – betraten Sie nie zur Abendzeit die Wohnung?«
Frau Schlomke brauchte lange, bevor sie zugab: »Es ist manchmal vorgekommen – nein, nur einmal.«
»Vorhin sagten Sie aber anders aus«, nagelte der Kommissar sie fest. »Sie sprachen da sehr bestimmt lediglich von Morgenarbeit, Morgendienst. Oder ... wie?«
»Ich bin etwas verwirrt durch all das«, entschuldigte sich die Frau.
»Wissen Sie, daß Ihr Eifer, die Polizei zu verständigen, mir verdächtig vorkommt?« grollte der Mann. Dann trat er dicht zu der Erstarrten hin und schrie sie an: »Sie pudern sich ja!«
»Nein – nein«, stieß Frau Schlomke hervor.
»Na, lassen wir das einstweilen!« sagte der Kommissar nach einem kurzen Auflachen. »Also Sie betreten nur ausnahmsweise des Abends die Wohnung. Nun – und gestern abend?«
»Ge – gestern abend – da – ich ...«, stammelte Frau Schlomke mit wirrem Gesichtsausdruck, unruhig und ausweichend hin und her zuckenden Augen. Plötzlich warf sie die Arme hoch und heulte auf: »Ich bitte Sie – ich – ich bitte – Sie ...«
Dann brach sie wimmernd zusammen.
*
Der Kriminalbeamte Schulze saß am Fenster der Wohnstube und sah geistesabwesend dem Treiben drunten auf der Straße zu. Manchmal trommelte er mit nervösen Fingern leise auf der Fensterbank. Er sah fahl und angegriffen aus, wie überanstrengt von dem schweren Dienst dieses Vormittags.
Seine Frau betrat das Zimmer und richtete den Mittagstisch her. Eine noch sehr junge und schöne Blondine, die einen sehr gepflegten Eindruck machte.
Mit zierlichen Bewegungen rückte sie die Teller zurecht und ordnete die Messer, Gabeln und Löffel. Dann holte sie von der Kredenz eine kleine Vase herbei. Die ersten Frühlingsblumen, Schneeglöckchen und ein paar blasse Primeln, leuchteten über dem Rande des glitzernden Gefäßes. Als der bescheidene Blumenstrauß die Mitte des Tisches schmückte, musterte die junge Frau zufrieden ihr Werk.
»So, Friedrich«, sagte sie. »Nur noch fünf Minuten, und wir können essen.«
»Es drängt nicht«, gab Schulze zurück.
Er hatte mit ablehnenden Blicken das Tun seiner Frau verfolgt. So, als wäre ihm ihr hausfrauliches Gehaben nicht recht, weil sie es mit einem Hang zum Luxus verband.
Das Tischgeschirr war denn auch just nicht bürgerlich einfach, mit den vergoldeten Rändern fast zu prunkhaft für den Haushalt eines bescheidenen Beamten. Die Bestecke blinkten silbern. Und zu jedem Mittag schmückte die Vase mit einem immer anderen Blumeninhalt die Tischmitte. Das alles schuf gewiß den Eindruck der Behaglichkeit. Aber es verstieß gegen die bisherigen einfachen Gewohnheiten des vor wenigen Monaten noch Junggeselle gewesenen, schon ältlichen Mannes.
Frau Schulze ging trällernd in dem Zimmer umher, mit kleinen Schritten, sich in den Hüften wiegend, eine niedliche, aber vollschlanke Gestalt. Das wirkte immer, als sei sie sich ihres prächtigen Wuchses sehr genau bewußt und als kokettiere sie auch vor sich selbst mit ihrer liebreizenden Erscheinung.
»Daß du doch stets etwas zu zupfen hast an Deckchen, Spitzen und solchem Plunder auf den Möbeln!« knurrte Schulze plötzlich.
Die Frau blieb stehen. Ihr schönes Gesicht nahm den Ausdruck kindlichen Staunens an. Der sehr kleine Mund verzog sich zu einem Schippchen, ganz wie bei einem gekränkten Backfisch.
Nach einem tiefen Atemzug versetzte sie: »Ja, lieber Friedrich, daß ich bestrebt bin, unsere Wohnung vornehmer als eine Kasernenstube oder gemütlicher als eine öde möblierte Junggesellenbude zu gestalten, das kannst du mir doch nicht verübeln wollen.«
»Tue ich auch gar nicht«, gab er mürrisch zurück. »Nur den Kinkerlitzchenkram mag ich nun mal nicht leiden, Alma.«
Sie zuckte die Schultern und entgegnete: »Wenn du keinen Wert legst auf eine behagliche Häuslichkeit, dann hättest du bester nicht geheiratet. Wenigstens hättest du nicht mich heiraten sollen. Ich habe gern Sauberkeit und etwas Freundliches um mich.«
»Gewiß«, meinte er, »ich bin auch für Ordnung.«
Frau Alma unterbrach sofort: »Räume, in denen ich infolge deines Dienstes oft tagelang, ja, nächtelang allein sein muß! Und dann, Friedrich, – kannst du dich über unnütze Geldausgaben beklagen? Schaffe ich nicht alles an von dem Monatsgeld, das du mir gibst? Kannst du mir Schulden vorwerfen oder nachweisen? Habe ich je auch nur einen Pfennig mehr verlangt für all dies Hübsche?«
Sie machte mit ausgebreiteten Armen eine Gebärde, als wolle sie den mürrischen Mann hinweisen auf das blitzsaubere Aussehen des Wohnraumes. An ihren schlanken Händen blitzten die rosig polierten Fingernägel, als Frau Alma nun nervös an der Vorstecknadel nestelte, die den Ausschnitt ihrer seidenen Bluse schmückte.
Schulze deutete stracks auf das Zierstück hin und grollte: »Das da ist doch auch wieder ein neuer Krimskrams. Ich mag das nicht leiden. Komm mal her, Alma!«
Während sie sich ihm gehorsam näherte, seufzte sie: »Gott, wie eigentümlich du nur heute wieder bist, Friede! Eine unechte Nadel – billig – aber sie sieht doch niedlich aus. Ja, sogar wie echt.«
»Wie echt«, murmelte er ihr nach. Dann riß er unvermittelt die Frau an sich: »Sag' mir's, Alma – du hast nur mich lieb – denkst an keinen anderen – bist mir treu – läßt dir nichts schenken?«
Sie löste sich aus der schroffen Umarmung. In jähem Verblüfftsein wich sie zwei Schritte zurück und brach in ein silbern und mädchenhaft klingendes Gelächter aus.
»Na, Friede, weißt du!« zankte sie. »Du beleidigst mich ja geradezu mit solchen Fragen.«
»Ach, ich bin heute so nervös«, brachte er zu seiner Entschuldigung vor.
»Ich bin dir nicht bös, Friede«, tröstete sie und kam wieder näher, um ihm über den Kopf zu streicheln. »Hattest gewiß schweren Dienst, nicht wahr?«
Er ließ den Kopf sinken, bis das Kinn die Brust berührte. So saß er, schwer atmend, da und hielt die Augen geschlossen. Seine geballten Hände ruhten mit eingekrampften Daumen auf seinen Knien.
In dieser Haltung erzählte er in abgehackten Sätzen: »Ein Mord – der Arzt gibt mir recht: erstochen – ein mit aller Kraft geführter zielsicherer Stoß. Die Aufwärterin – eine hübsche Person – entdeckte die Tat, kommt dem Kommissar Weinreich aber verdächtig vor. Wir fanden ein paar Gegenstände – eine Puderquaste, eine Haarspange – ja, und in der Faust des Toten einige Haare – Frauenhaare. Eine Frau muß es getan haben – vielleicht Eifersucht – der Mann war leichtlebig, ein Frauenjäger, geschieden – aber wir wissen noch nicht alles – ein reicher Kerl.«
»Ihr meint, eine Frau habe es getan?« sagte Alma, als der Gatte schwieg. »Du weißt, ich beschäftigte mich gern mit euren Untersuchungen und Schlußfolgerungen. Als Frau würde ich bezweifeln, daß es ein weibliches Wesen getan hat.«
Er staunte sie an. »Wieso, Alma?«
Sie gab die kluge Antwort: »Eine Frau ersticht nicht. Die knallt höchstens nieder, oder sie greift zum Gift, aber ganz gewiß nicht zum Messer oder zum Dolch oder zu sonst einer Stichwaffe.«
Friedrich Schulze hob langsam den Kopf. Er starrte auf seine Frau, als sei sie ein Wunder, als werde sie ihm unheimlich oder als erschrecke er, daß sie sich ihm, ja, sogar dem Kommissar Weinreich überlegen zeigte.
»Eine Frau ersticht nicht«, wiederholte er ihre Worte so schwerfällig, als behindere ein Gegenstand im Munde ihn am deutlichen Sprechen.
»Auf gar keinen Fall!« trumpfte Frau Alma auf.
»Das – das hat niemand bedacht«, murmelte er.
»Du warst gewiß mit Weinreich am Tatort«, erriet die junge Frau.
»Wir wurden kurz nach acht Uhr hingerufen – durch die Aufwärterin.«
Frau Alma betrachtete das fahl und verfallen aussehende Gesicht des Mannes und entschied: »Du scheinst für diesen Dienst wenig geeignet, Friede. Wenn dich so etwas dermaßen mitnimmt, dann melde dich doch für ein anderes Beamtenfach!«
»Ach, überhaupt fortkönnen!« seufzte er sehnsüchtig.
Sie lachte ihn aus: »Nachdem wir die schöne, mollige Wohnung haben, Friede? Du bist ja verrückt. Ich habe sie mit soviel Liebe und Sorgfalt eingerichtet, mit soviel Freude auf die ruhige Ehe mit dir.«
»Ich meine ja auch nur so«, verteidigte er sich. »Der schwere, oft so schauerliche Dienst!«
»Na, aber – Friedrich!« tadelte sie seine Schwäche. »Du bist doch nun schon fünf Jahre dabei. Man sollte meinen, du müßtest dich eingewöhnt haben. Du hast auch bis heute nie geklagt. Wie gesagt – wenn dir's über den Kopf wächst oder auf die Nerven geht, dann stell dich um auf ein friedliches Beamtenfach!«
»Ich hatte immer so viel Interesse für diesen Dienst«, murmelte er wie beschämt.
»Auch ich habe viel Teilnahme für deinen Beruf«, versicherte sie. »Kann ich dir vielleicht helfen? Was würde ich darum geben, wäre ich Detektivin!«
»Du – mir helfen?« entgegnete er aufgeregt. »Deshalb schmökerst du in Kriminalromanen herum und läufst in die Gerichtsverhandlungen? Sieh dir meinen Beruf mal aus nächster Nähe an! Es gibt da furchtbare Dinge zu sehen – wie heute den Ermordeten. Und das glaubst du ertragen zu können? Mir schlug das Herz wie ein Hammer.«
Frau Alma hob die runden Schultern und wandte sich ab. Der Mann tat ihr leid, und doch haßte sie im gleichen Augenblick sein Schwachsein. Sie ging an den Tisch und ordnete noch eine Kleinigkeit.
»Na, nun komm zum Essen!« forderte sie den Gatten kurz angebunden auf.
Er erhob sich folgsam und nahm am Tische Platz.
»So, so – eine Frau ersticht nicht«, wiederholte er abermals Frau Almas Behauptung, als beschäftigte ihn dies weiblich kluge Urteil über alle Maßen.
Bevor sie, um aus der Küche die Suppe zu holen, das Zimmer verließ, erkundigte sich die junge Frau noch: »Wer ist denn der Ermordete?«
»Ein Geschäftsmann«, gab Schulze Auskunft. »Ein schwerreicher Kerl – Arthur Beverstorff heißt er.«
Es war wie ein Seufzen der jungen Frau ... dann schloß sich die Tür hinter ihr.
Friedrich Schulze saß lange Zeit einsam vor dem Tisch. In Gedanken versunken spielte er mit dem Löffel. Er wog ihn in der Hand, der schwer war wie echtes Silber. Er fuhr mit dem Finger prüfend über den Goldrand des Tellers, schob das Geschirrstück zurück und zog es wieder herbei, faltete die noch neu glänzende Serviette auseinander und legte sie geistesabwesend wieder zusammen. Dann neigte er den Kopf und saß wie eingeschlummert still da. Endlich verkündete die Standuhr mit lange nachschwirrendem Gongschlag die Zeit.
Schulze heftete den Blick auf das vornehme Möbelstück. Wie Alma nur derartige Anschaffungen möglich machte? Ja, daß sie – daß sie ... ach, was hatte er doch jetzt denken wollen – er war so zerstreut – es fiel ihm nicht wieder ein. Doch richtig: wo blieb sie mit der Suppe? Er mußte bald wieder in den Dienst. Diese Mordsache Beverstorff ...!
Schulze rief ein paarmal den Namen seiner Frau. Endlich erhob er sich schwerfällig und trottete mit seinem behäbigen Körper hinaus. Er ging in die Küche, um Frau Alma zur Eile zu mahnen.
Er fand die junge Frau dort: sie saß auf dem Küchenstuhl, hatte verweinte Augen und ein tränenfeuchtes Gesicht und ließ tatenlos die Hände im Schoße ruhen. Aus einem Topf sprudelte Essen über. Es roch nach Angebranntem in dem so säuberlich und zierlich eingerichteten Raum.
»Na, was ist los mit dir?« rief Schulze mit grober Stimme die junge Frau an, und seine vorquellenden Augen starrten auf sie nieder.
Sie erhob den leeren Blick und stieß aufschluchzend hervor: »Du tust mir so bitter leid, Friede!«
2.
In der Weinkneipe »Zum gesottenen Hummer« schufteten die drei Kellnerinnen, um die noch kalte Gaststube für den Abend vorzubereiten. Die Mädchen sahen übernächtig und müde aus. Die Zecherei mit den beiden trinkfrohen alten Herren hatte sich bis fast zum Tagesgrauen hingezogen.
Sylvia war erschöpft, obwohl sie nur wenig hatte trinken müssen, da nach dem eiligen Abschied des seltsamen Gastes kein anderer Besucher mehr sich in das Lokal verirrte. Manchmal hielt sie mit einem verlorenen Lächeln in ihrer Arbeit inne. Dann war vor ihrer Seele das Bild jenes Fremden emporgetaucht – und sie entsann sich des Blickes seiner sonderbaren, ernsten Augen. Augen, in denen ein Leid oder ein Schmerz – – –
Die fette Stimme der Gebieterin unterbrach Sylvias Nachdenken: »Na, Mädel, gaffen Sie nicht schläfrig vor sich hin! Dalli, dalli! Sie sehen ja, die anderen arbeiten auch.«
»Gewiß, Frau Schurich«, beeilte sich Sylvia zu sagen; sie wußte, wie unangenehm die Kneipwirtin wurde, wenn man ihr auf eine Anrede nicht irgendeine Antwort gab.
Frau Schurich war in einen kostbaren Nerzmantel gehüllt. Trotz ihrer dicken Waden trug sie ihn modisch kurz. Ein hochroter Filzhut, der zu der am Mantelkragen befestigten künstlichen Blume paßte, mit seiner schmalen Krempe bis tief auf die Augenbrauen herabgezogen, rahmte ihr gewöhnliches Gesicht ein.
»Sie weigern sich also, mit zu Kriminalkommissar Weinreich zu kommen, Sylvia?« fragte die Wirtin, während sie ein Paar zarter weißer Wildleder-Handschuhe über die kurzen Finger streifte.
»Es ist kein Weigern, Frau Schurich«, verteidigte sich Sylvia sanften Tones. »Ich meine nur: daß der Herr Blutflecke auf dem Mantel hatte und daß er so eilig davonlief, als das Radio die Nachricht von dem Mord bekanntgab – – –«
Da das Mädchen verstummte, zeterte die Schurich giftig: »Na, was meinen Sie?«
»Verzeihen Sie«, fuhr Sylvia fort, »ich finde nicht, man müsse auf einen Zusammenhang zwischen dem Mord und dem Herrn schließen, nur weil – – –«
»Eine dumme Gans sind Sie!« schalt die Wirtin los. »Sie haben sich wohl vergafft in den Kerl? Es könnte aber doch sein, daß ein Zusammenhang bestünde. Und wenn nun der Mörder unter solch auffälligen Umständen hier im Lokal war und das kommt dann heraus und wir haben der Polizei nicht sofort Mitteilung gemacht, so gibt's Unannehmlichkeiten über Unannehmlichkeiten.«
»Finde ich auch, gnädige Frau«, nahm eines der anderen Mädchen das Wort. »Noch dazu, da gleich hier um die Ecke 'rum heute nacht noch ein zweiter Mord passiert ist.«
»Um Gottes willen – was?« schrillte die dicke Wirtin entsetzt. »Noch ein Mord – heute nacht? Woher wissen Sie denn das?«
Das Mädchen erzählte: »Als ich zum Reinemachen herkam, standen die Leute in Scharen vor dem Haus.«
Die Schurich stöhnte: »Dann war der Kerl mit den Blutflecken der andere Mörder. Na, ich gehe zu Weinreich. Das ist meine Pflicht. Man kann ja in die tollsten Sachen kommen, wenn man schweigt.«
Sie lief aufgeregt in der Kneipstube herum und wies den Mädchen noch allerlei Arbeit zu. Dann stürzte sie mit puterrotem Kopf von dannen.
»Eilig hat's die Alte«, spottete das dritte Mädchen, eine frech aussehende Person. »Ja, vor den Polypen hat das Weib eine Heidenangst. Sie ist nicht gut angeschrieben bei den Grünen. Darum rennt sie nun hin und macht sich lieb Kind.«
»Man kriegt ja auch eine Belohnung, wenn man der Polizei hilft«, behauptete die ältere der Kellnerinnen.
Sylvia verrichtete nachdenklich ihr Tagewerk. Still und in sich gekehrt kam sie ihrer Pflicht nach. Am Gespräch der Kameradinnen beteiligte sie sich nicht, hörte kaum einmal hin. Die erzählten einander nur von Schlechtigkeiten.
Die Uhr über dem Schanktisch zeigte fünf, als das Instandsetzen der Gaststube beendet war. Sylvia richtete noch an dieser und jener Kleinigkeit. Die beiden anderen Mädchen verschnauften, während sie einen Spaziergang durch die Stadt verabredeten. Sie wollten die Abwesenheit der ewig antreibenden Schurich gründlich ausnutzen.
»Und wenn die Alte zehnmal schimpft!« erklärte die Freche. »Man will doch auch mal in die Schaufenster gucken und Luft schnappen, bevor man die halbe Nacht hier hockt und säuft und qualmt. Sagen Sie der Schurich einfach, wir seien zum Ondulieren gegangen, Sylvia!«
Das Mädchen blieb allein. Sie trug sich einen Stuhl an den allmählich warm werdenden Kachelofen. Hier saß sie und beschäftigte sich mit einer leichten Handarbeit. Die Stille in dem niedrigen Raum tat ihr wohl. Abends immer die zudringlichen Männer – das fade Gewäsch der Kellnerinnen – der fortwährend dudelnde Lautsprecher oder das Grammophon, wenn der Rundfunk eine zu ernste Abendvorstellung bot.
Einen Augenblick dachte Sylvia daran, sich in der Handhabung des sonst nur von Frau Schurich bedienten Radioapparates zu versuchen. Doch sie fürchtete, etwas an dem Gerät zu verderben, und ließ den Gedanken wieder fallen.
Plötzlich hörte sie, wie jemand die Stufen vor dem Eingang betrat. Ein Gast konnte es nicht sein. Die Besucher kamen nicht so frühzeitig am Nachmittag schon. Sie glaubte zunächst, die Wirtin kehre zurück. Deshalb erhob sie sich. Die herrische Frau sah es nicht gern, wenn eines der Mädchen saß, außer bei Herren.
Aber der Jemand draußen blieb auf der kleinen Sandsteintreppe stehen. In Sylvias Seele stieg ein eigenartiges, halb banges, halb frohes Gefühl auf, als stünde vor der Tür ein Mensch, auf den sie wartete.
Wieder kam ihr der Fremde von gestern nacht in den Sinn.
Und als endlich die Tür geöffnet wurde, trat wirklich dieser Mann ein.
Sylvia konnte einen halblauten Ausruf der Freude nicht unterdrücken. Mit einem freundlichen Lächeln schritt sie dem Gast entgegen.
»Ich habe Ihr Kommen geahnt«, flüsterte sie mit gesenkten Lidern, noch bevor er einen Gruß sagen konnte.
»Begreiflich, Kleine«, stimmte er bei; doch wie fluchtbereit blieb er an der Tür stehen. Dann stieß er hastig hervor: »Als ich gestern abend den Wein bezahlte, ließ ich meine Geldtasche liegen, nicht wahr?«
Nun erhob Sylvia den Blick. Ja, das war das jugendliche Männergesicht, das sie wie durch einen unerklärlichen inneren Zwang sich fort und fort vergegenwärtigen mußte seit der verflossenen Nacht. Sie vertiefte sich in diese hübschen, gleichmäßigen, doch eigenartigen Züge.
Ein Antlitz von bräunlicher Färbung, zu der zwar die tiefschwarzen Brauen, doch nicht die so absonderlich hellgrauen großen Augen paßten. Diese Augen fielen ihr jetzt auf. Bis zur Sekunde war sie des Glaubens gewesen, der Mann habe schwermütig dunkle Augen. Und nun dieser starre, grelle, glitzernde Blick, der sich in sie hineinbohrte voll Mißtrauen, voll Besorgnis, wie um einen Bann auszuüben.
»Rasch – reden Sie doch!« verlangte der Mann gebieterisch.
»Eine Geldtasche?« begann Sylvia zaghaft, erschreckt durch den schroffen, messerscharfen Ton.
»Hellbraun gekörntes Leder – mit silbereingefaßter Verschlußlasche – etwas über zweitausend Mark Inhalt in Hundertmarkbanknoten und anderen kleinen Geldscheinen.«
»Bestimmt nicht«, versicherte das Mädchen. »Hier haben Sie kein Geld verloren.«
»Nicht verloren«, verbesserte er. »Ich ließ das Täschchen liegen, als ich den Wein bezahlte, weil der Lautsprecher –«
Er sprach nicht weiter, wie um nicht daran zu erinnern, daß der den Mord verkündende Radioapparat ihn zur Flucht getrieben hatte.
»Ich bin ehrlich«, sagte Sylvia herb. »Sie haben Ihr Geld nicht hier vergessen.«
»Ich muß es hier vergessen haben«, blieb der Mann bei seiner Behauptung. »Anders ist es gar nicht möglich.«
»Sie beleidigen mich«, entgegnete Sylvia schneidend.