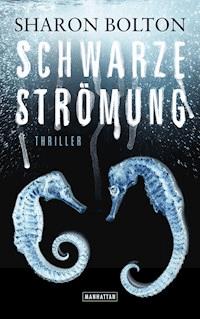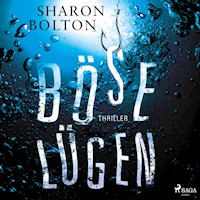11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Nachbarn sehen alles. Doch niemand bricht das Schweigen ...
Ein neuer Anfang. Das ist es, was Anna Brown sich wünscht, als sie in die idyllische englische Kleinstadt St. Abel’s Chapel zieht. Doch der Schein trügt. Anna fühlt sich von Anfang an beobachtet und erfährt schon bald, dass in den letzten Jahren drei 16-jährige Mädchen spurlos verschwunden sind. Alle scheinen davon zu wissen, aber niemand spricht darüber. Als ein viertes Mädchen Anna verzweifelt um Hilfe bittet, beginnt sie, Fragen zu stellen. Sie ahnt nicht, dass das Böse in St. Abel’s Chapel nur einen Schritt entfernt lauert …
»Es ist ein Vergnügen, so gekonnt auf die falsche Fährte geführt zu werden.« The Times
»Ein Pageturner mit mörderischem Twist, der schockiert und überrascht.« The Bookseller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Auf den ersten Blick ist St. Abel’s Chapel eine verschlafene Kleinstadt in Cumbria. Der perfekte Ort für einen Neuanfang, findet die Bäckerin Anna Brown, die ihre Vergangenheit ein für alle Mal hinter sich lassen will. Doch schon bald erfährt sie, dass in den letzten Jahren mehrere 16-jährige Mädchen spurlos verschwunden sind. Alle scheinen davon zu wissen, doch man spricht nur hinter vorgehaltener Hand darüber.
Als die 16-jährige Constance in Annas Bäckerei auftaucht und sie um Hilfe bittet, beginnt diese, Nachforschungen anzustellen. Unterstützt von ihrem Nachbarn, will sie das Geheimnis von St. Abel’s Chapel lüften. Doch offenbar hat in dieser Kleinstadt jeder etwas zu verbergen, und Anna fühlt sich auf Schritt und Tritt beobachtet …
Weitere Informationen zu Sharon Bolton
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Sharon Bolton
Das Böse nebenan
Thriller
Aus dem Englischenvon Marie-Luise Bezzenberger
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Neighbour’s Secret« bei Orion Fiction, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2025
Copyright © 2024 by Sharon Bolton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotive: © Miguel Sobreira/ Trevillion Images Ltd.
Redaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze
LS · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-33453-6V001
www.goldmann-verlag.de
Für Lupe, den besten Hund der Welt
1
Wäre Anna Brown eine überzeugendere Lügnerin gewesen, so hätte ich vielleicht sofort das Interesse an ihr verloren. Aber Lügen sind ja so faszinierend, nicht wahr? Warum die Menschen lügen, wie wenig sie die Konsequenzen bedenken, wie verzweifelt sie sind, wenn sie Gefahr laufen, entlarvt zu werden. Für mich kommen Lügen gleich nach Geheimnissen, und Geheimnisse finde ich ungeheuer aufregend. Kurz nachdem ich herausfand, dass Anna Brown eine Lügnerin war, entdeckte ich, dass sie ein Geheimnis verbarg. Danach war es ausgeschlossen, dass ich sie in Ruhe lassen würde.
Man könnte sagen, Geheimnisse sind mein Ding.
Das erste Mal begegnete ich ihr Mitte Oktober, an einem Tag, der frisch und strahlend hell war. Eine weiche Nebeldecke lag über dem größten Teil des Erdbodens, als die Sonne aufging. Die Bäume standen noch im vollen Laub, und nicht alle Blätter hatten sich verfärbt. Doch sie waren spröde geworden, und wenn der Wind wehte, machten sie dieses Geräusch, das mich immer an das Knistern eines Feuers aus feuchtem Holz erinnert.
Ich war am Vorabend im Dunkeln nach Hause gekommen und wollte unbedingt sehen, wie der Garten meine zehntägige Abwesenheit verkraftet hatte. Was eigentlich ein kleiner chirurgischer Eingriff hätte sein sollen, war dank einer postoperativen Infektion kompliziert geworden, und ich war schwächer aus dem Krankenhaus gekommen, als ich hineingegangen war. Trotzdem war ich früh aufgewacht – ich betrachte mich gern als die erste Person im Dorf, die morgens auf den Beinen ist. Das fühlt sich ein bisschen so an, als schlüge man dem Feind ein Schnippchen.
Die meisten späten Rosen waren verblüht. Ich schnitt alle Blütenköpfe weg, die ich erreichen konnte, und befestigte eine lose Geißblattranke. Gerade war ich dabei, hier und da sprießendes Unkraut zu jäten, und trat auf eine Schnecke, als ich draußen auf der Straße Stimmen hörte.
»Ich hab wohl den Regen verpasst.«
Das war Gardner, mein Nachbar von nebenan. Ein großer, lauter Mann Anfang vierzig mit einer Frau, die ihn verlassen hat, und ein paar schlecht erzogenen Söhnen, die zu seinem Glück nicht bei ihm wohnen. Manchmal kommen sie zu Besuch – die Kinder, nicht die Frau –, und der Krach wird unerträglich. Ich habe sieben konfiszierte Fußbälle, die auf meiner Seite des Zauns gelandet sind. Natürlich bestreite ich jegliche Kenntnis davon. Gardner würde darauf bestehen, sie zurückzubekommen, trotz des Schadens, den sie an meinen Pflanzen angerichtet haben.
Er ist der Typ Mann, der nicht ein einziges Buch im Jahr liest, aber zu allem eine Meinung hat. Noch nie habe ich ihn spazieren gehen sehen, aber morgens steht er meistens früh auf, um ins Fitnessstudio zu gehen. Er bekommt auch regelmäßig Proteinpulver geliefert, etwas, das ich eher mit kränkelnden Kindern und alten Leuten assoziiere als mit einem Mann in der Blüte seiner Jahre. Das weiß ich, weil ich oft seine Pakete annehme, wenn er bei der Arbeit ist.
Es war also definitiv Gardner da draußen auf der Straße. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wovon er redete, es hatte seit Tagen nicht mehr geregnet. Ein rascher Blick auf den Erdboden hätte ihm das sagen können.
»Bitte?« Die Frau, die antwortete, war ebenso verblüfft wie ich, wenngleich höflicher, als ich es vielleicht gewesen wäre.
»Ihr Haar ist nass. Hat’s geregnet?«
»Ich war schwimmen.«
Ich habe Gardners Umgang mit Frauen sehr oft miterlebt, und anscheinend wird er nicht besser. Gerade wollte ich wieder hineingehen, als die Frau noch etwas sagte.
»Im See. Die Straße rauf und durch den Wald.«
Gardner hatte sie offenbar gefragt, wo sie schwamm; ein klügerer Mann wäre selbst darauf gekommen. Hinter unserer kleinen Häuserreihe verläuft eine Straße, die nach einem guten halben Kilometer an einem Zauntritt endet. Von dort kommt man auf einem öffentlichen Fußweg in einer Viertelstunde zum See. Ich sage See, aber verglichen mit der Pracht von Bassenwaithe, Derwent Water und Thirlmere, unseren nächsten größeren Gewässern, ist er nicht viel mehr als ein großer Teich. Ich hatte noch nie gehört, dass jemand darin schwamm, aber jedem das seine.
»Ist das nicht gefährlich?«, wollte Gardner wissen.
»Wieso gefährlich?«
Allmählich erwärmte ich mich für die Frau. Sie schäkerte nicht, wie es so viele Frauen taten, wenn sie mit Gardner redeten. Ihre Stimme klang sachlich und herausfordernd.
»Na ja, Sie wissen schon. Ist ganz schön tief.«
»Man kann in fünfzig Zentimeter tiefem Wasser ertrinken. Tiefe ist irrelevant.«
»Und sauber ist er auch nicht gerade.«
»Es ist ein See. Da ist kein Chlorwasser drin.«
Ich merkte, dass ich lächelte.
»Ist bestimmt kalt.«
»Na ja, da kann ich nicht widersprechen. Entschuldigen Sie mich, ich muss …«
»Ich bin Hugh. Hugh Gardner.«
Eine kurze Pause. »Anna Brown«, sagte sie, und da überlegte ich es mir anders und ging schnurstracks zum hinteren Gartentor. Vor einiger Zeit hatte ich den Kies auf dem Weg durch Steinplatten ersetzt und machte deshalb kein Geräusch, als ich mich den beiden bis auf einen guten Meter näherte. Im Holz des Tors ist ein Spalt, und durch den konnte ich Gardner von hinten sehen. Er trug Jeans und ein dunkles Jackett, die Sachen, die er immer anhat, wenn er zur Arbeit fährt. Seine Uniform zieht er erst dort an.
Die Frau konnte ich nicht sehen, doch irgendetwas daran, wie sie ihren Namen genannt hatte, hatte mich neugierig gemacht. Wie eine Bekanntmachung, eine Herausforderung. Fast so, als rechne sie nicht damit, dass man ihr glaubte.
Ihr Akzent war eine Überraschung, obwohl er mir natürlich gleich aufgefallen war. Sie stammte aus dem Süden, aus einer der Grafschaften, die an London grenzten, hätte ich getippt.
»Die neue Bäckerin?« Gardner ist nicht der Mann für dezente Hinweise. »Ich wollte ja schon vorbeikommen, aber ich hatte Nachtdienst. Schon eingelebt? Wir sind übrigens Nachbarn, ich wohne im übernächsten Haus. Auf der anderen Seite von …«
»Freut mich, Mr Gardner. Einen schönen Tag noch.«
Ich erhaschte einen kurzen Blick auf eine zierliche Gestalt mit feuchtem dunklem Haar, die rasch aus meinem Gesichtsfeld verschwand. Gardner sah ihr nach und stieg erst in seinen Wagen, einen lachhaft übermotorisierten pseudo-amerikanischen Truck, als sie um die Ecke gebogen war. Er fuhr davon, und ich ging wieder ins Haus.
Ich hatte keine Ahnung, wie mir all die Zeichen hatten entgehen können, dass in dem Haus links von mir jemand wohnte. Es war spät gewesen, als ich nach Hause gekommen war, und ich war müde gewesen, nachdem ich stundenlang darauf gewartet hatte, dass Rezepte ausgestellt wurden und Ärzte die Entlassungspapiere unterschrieben. Unsere kleine Drei-Häuser-Zeile war früher ein einziges viel größeres Gebäude gewesen, und die Trennwände sind aus Rigips. Gardner könnte sie mit einem Schlag seiner Feuerwehraxt zertrümmern, wenn ihm der Sinn danach stünde. Das Resultat ist, dass ich so gut wie alles hören kann, was in beiden Häusern vorgeht. Ich weiß, was Gardner sich im Fernsehen ansieht, was für Videospiele er spielt und was für Musik er hört. Ich weiß, dass er mehrmals einen fahren lässt, bevor er morgens aufsteht, und dass er unter der Dusche singt, aber nur dort. Beim Geschlechtsverkehr kann er die Erektion zwischen fünfzehn und siebenundzwanzig Minuten lang halten, und obgleich er seinen Kumpels gegenüber behauptet, er wähle die Labour Party, stimmt das nicht.
Das Haus auf der anderen Seite von mir jedoch, die Bäckerei, hatte ein Jahr lang leer gestanden. Ich hatte mich an die Stille gewöhnt, und mir war gestern Abend nichts Ungewöhnliches aufgefallen, jetzt jedoch, da ich wusste, dass das Haus bewohnt war, schien es vor Lärm aus allen Nähten zu platzen. Ich hörte Klappern in der Küche, und wie ein Ofen eingeschaltet wurde. Ein Wasserhahn wurde aufgedreht. Sie ließ etwas fallen und knurrte halblaut: »Verdammt!« Sie arbeitete und hatte es eilig. Dann ging sie mit schnellen, leichten Schritten nach oben, und die Dusche war zu hören. Da ich wusste, dass sie anderweitig beschäftigt war, trat ich aus der Haustür und betrachtete im frühen Morgenlicht die Verwandlungen nebenan.
Die stumpfbraune Täfelung, die unechten Koppelfenster, die verstaubten Brotlaibe und Kuchen aus Plastik und die rot gewürfelten Tücher waren verschwunden, und an ihrer Stelle war ein riesiges, aber schlichtes taubengraues Schild mit der Aufschrift The Bread Basket angebracht worden. Das neu verglaste Schaufenster war mit weißen Wimpeln geschmückt, und ein fast unsichtbares Regalsystem aus Kunststoff stand für die heutige Ware bereit.
Ich quetschte mich an einem gusseisernen Tisch mit dazugehörigen Stühlen vorbei, sah durchs Schaufenster Regale aus Eichenholz, die bis zur Decke reichten. Vitrinen aus Plexiglas, noch mehr Tische und Stühle, Kommoden, Steinplatten auf dem Boden. Eine Kaffeemaschine, aufgestapeltes flaschengrün glasiertes Geschirr und schimmerndes Besteck.
Was ich sehen konnte, war jedoch nichts im Vergleich dazu, was ich riechen konnte. Eine absolute Sinfonie aus Gerüchen. Die zugrunde liegenden Töne war die Hefe von den Brotlaiben, die noch dabei waren, aufzugehen, doch darüber, wie das An- und Abschwellen von Instrumenten, wenn die Musik sich entfaltet, schwebte die gehaltvolle Schwere von warmem Rosinenbrot, ein bittersüßer Hauch von schmelzender Schokolade und der Kümmelduft von Roggenbrot. Auch Zucker lag in der Luft, so fein wie Babypuder, wie der Hauch eines Schneesturms, und juckte mir in den Nasenlöchern.
So viele verschiedene Gerüche, bei denen mir warm und behaglich zumute wurde, als sei ich wieder ein Kind und lebte in der Welt von Enid Blyton, nicht in der Realität. Gleichzeitig überkam mich eine unerklärliche Traurigkeit, als wäre der Duft der Bäckerei dazu da, mich zu quälen, Genüsse anzudeuten, die mir nie zuteilwerden konnten.
»Guten Morgen.«
Ich fuhr zusammen. Sie hatte mich überrascht. Ich, stolz darauf, zu wissen, wann meine Nachbarn nachts auf die Toilette gehen, hatte ganz einfach nicht gehört, wie Anna Brown die Vordertür der Bäckerei geöffnet und zu mir herausgetreten war. Ich merkte, dass ich die Augen geschlossen hatte.
»Tut mir leid, wir haben noch nicht geöffnet«, fuhr sie fort. »Erst um halb acht.«
»Macht nichts.« Ich konnte ihr nicht in die Augen sehen. Mir war, als hätte sie mich dabei erwischt, wie ich die Croissants stibitzte, die sie ins Fenster gestellt hatte. Sie hatte sie auf einem rechteckigen Teller perfekt ausgerichtet, und sie lagen mit militärischer Präzision da, so golden wie Sonnenlicht und gekrümmt wie geschälte Krabben.
»Ich bin Anna«, sagte sie. »Sie wohnen wohl nebenan?«
Ich riss meinen Blick von den Croissants los und musterte sie eingehend. Ihre Hände waren voller Mehl, daher gab sie mir nicht die Hand, und ich tat das natürlich auch nicht. Ich fasse nicht gern die Hände anderer Leute an, nicht einmal, wenn sie anscheinend sauber sind. Auch ihre Schürze war schmutzig, mit Mehl und Fett und etwas beschmiert, das nach Aprikosenmarmelade aussah. Ihre Augen waren ein ganz klein wenig blutunterlaufen, und ich überlegte, ob das vom Seewasser kam.
Diesmal, das gebe ich zu, hätte ich die Lüge nicht bemerkt. Diesmal war sie vorbereitet. Ihre Stimme war leise und ruhig, und sie hatte kein Problem damit, Blickkontakt aufzunehmen. Ich hätte ihr Alter auf Ende dreißig geschätzt. Ihr schulterlanges Haar war von allerdunkelstem Braun, das nur möglich ist, bevor es zu Schwarz wird. Ihre Haut war rein, doch um die Augen und auf der Stirn zeigten sich erste Falten. Sie war weniger attraktiv, als ich nach Gardners albernem Gehabe erwartet hatte. Tatsächlich fand ich sie ziemlich reizlos, die Augen ein wenig zu klein und zu dunkel, das Gesicht ziemlich lang. Doch dann dachte ich an den Strom der Besucherinnen, den ich im Laufe der Jahre hatte ertragen müssen, und mir fiel wieder ein, dass Gardner leicht zufriedenzustellen ist.
Ich stellte mich vor und machte ein paar Bemerkungen über die Veränderungen, die sie an der Bäckerei vorgenommen hatte. Es war ganz höflich gemeint, doch sie wirkte ein bisschen pikiert.
»Die Leute finden die Tische draußen anscheinend gut«, sagte sie.
»Warten wir’s ab, wie beliebt die nächsten Monat noch sind«, erwiderte ich. »Wenn der Wind kommt.«
Ich versuchte, hilfsbereit zu sein. Da sie aus dem Süden stammte, wusste sie bestimmt nicht, wie schlimm die Winter hier in Cumbria sein können. Im Januar gibt es Tage, an denen der Schneefall wie eine Lawine vom nahe gelegenen Tamland Fell herabzuströmen scheint, das Dorf stundenlang einhüllt und alle außer die Allerhärtesten ins Haus verbannt. Die Novemberstürme können Schwache und Gebrechliche glatt umpusten. Der Gedanke, hier ein Kaffeekränzchen abzuhalten, war fast schon komisch.
»Drinnen sind auch Tische«, sagte sie. »Und hinten im Innenhof. Da ist es geschützter.«
Innenhof? Ich wollte ja wirklich nicht spotten, aber war das ihr Ernst? Sie hatte einen Hinterhof, wir hatten alle drei einen. Ich hatte meinen durch harte Arbeit und nicht unerhebliche Investitionen in einen bescheidenen, aber gut gedeihenden Garten verwandelt. Als ich das letzte Mal in den Hinterhof der Bäckerei geschaut hatte, hatte dort ein Durcheinander aus Mülltonnen und Gerümpel geherrscht, das die letzte Bewohnerin zurückgelassen hatte. Mit fiel ein, dass ich heute Morgen gar nicht aus dem hinteren Fenster gesehen hatte. Der Krankenhausaufenthalt hatte mich mehr mitgenommen, als mir klar gewesen war.
»Um halb acht mache ich auf«, sagte sie, obwohl sie mir das bereits mitgeteilt hatte. »Kommen Sie zum Frühstück. Geht aufs Haus.«
»Ich habe Diabetes«, ließ ich sie wissen, und nachdem ich ihr einen guten Morgen gewünscht hatte – ich bin nie unhöflich –, ging ich hinein.
Doch ich kam nicht zur Ruhe. Die Milch, die ich gestern Abend auf dem Nachhauseweg gekauft hatte, schien mir an der Zunge zu kleben, und das Weetabix lag mir so schwer im Magen, als hätte ich es trocken hinuntergewürgt. Vielleicht bildete ich es mir ja bloß ein – ich hatte sämtliche Fenster geschlossen –, doch die Backdüfte stahlen sich allmählich in mein Haus. Die Sendung Today auf BBC 4 – ich höre immer mit Kopfhörern Radio, aus Rücksicht auf meine Nachbarn – war langweilig und uninteressant. Mir ist es ziemlich egal, ob die Polizisten in den Innenstädten mit Tasern ausgerüstet sind, und der Aufstieg und Fall des britischen Pfundes betrifft mich nicht.
Ich war mir sicher, dass Anna Brown irgendetwas verbarg. Als sie mit mir geredet hatte, hatte sie sich schon wieder gefasst, doch Gardner hatte sie kalt erwischt. Ich wollte dasselbe tun. Also machte ich das Radio aus, als die Nachrichten um halb acht angekündigt wurden, und griff nach meiner Jacke. Selbstverständlich schloss ich meine Haustür ab. Es wird jede Menge Unsinn erzählt, dass man auf dem Land sicher ist. Doch auch wenn es schwerfällt, sich eine noch ländlichere Gegend vorzustellen, ich hatte an den Menschen, unter denen ich lebte, nichts übermäßig Vertrauenswürdiges gefunden.
Fremde und Besucher sehen die hübschen Häuser, die Erhabenheit der umliegenden Hügel, und glauben, sie seien in eine Art bukolisches Idyll hineingeraten, ein Idyll mit starkem Gemeinschaftssinn, in dem alle aufeinander aufpassen. Sie könnten nicht falscher liegen.
Manchmal habe ich mich gefragt, ob es die Kombination aus Isolation, schlechtem Wetter und relativer Armut ist, die in der hiesigen Bevölkerung einen Hang zur Gemeinheit erzeugt. Kleinkriminalität und hohe Arbeitslosigkeit gehen anscheinend Hand in Hand, und wenn der Alltag nur mit Mühe zu stemmen ist, ist es schwer, viel Interesse für das Wohlergehen der Nachbarn aufzubringen.
Oder vielleicht mögen sie mich auch einfach nicht.
An der Tür der Bäckerei hing noch immer das Geschlossen-Schild. Doch Ms Brown musste mich durch die Glasscheibe in der Tür gesehen haben, denn sie öffnete schon nach ein paar Sekunden. Sie hatte die Schürze gewechselt und sich die Hände gewaschen.
»Hallo noch mal«, sagte sie. »Willkommen. Kommen Sie rein.«
Ich folgte ihr, wappnete mich innerlich gegen den Geruch und sagte mir, dass es doch bloß Chemie sei. Ein zweites Mal würde ich mich nicht so leicht verführen lassen.
»Ich habe Ihren Namen vergessen«, sagte ich. Natürlich wusste ich noch genau, wie sie hieß, aber ich wollte sie ihn noch einmal sagen hören.
»Anna Brown«, antwortete sie halblaut, und ich empfand ein warmes Gefühl des Triumphs. Sie hatte die Augen niedergeschlagen, und ihre Wangen liefen rot an. Es behagte ihr nicht, ihre Lüge zu wiederholen, aber es war eine Lüge. Sie hieß nicht Anna Brown.
»Wo sind Sie her, Anna?« Ich benutzte absichtlich ihren Vornamen, um unseren unterschiedlichen sozialen Status klarzustellen. Vorhin hatte ich ihr nur meinen Nachnamen genannt und damit angedeutet, dass sie mich förmlich anzusprechen hätte.
»Aus dem Süden.« Sie zog sich hinter den Tresen zurück, wo, wie ich sah, Brotlaibe bereits säuberlich aufgereiht waren. Jeder war mit einer kleinen schwarzen Karte mit goldener Schrift versehen: Sauerteigbrot, Schrotbrot, Bauernbrot, Ciabatta mit Spinat & Käse, Focaccia mit Süßkartoffel & rote Bete. Von den meisten Brotsorten, die ich vor mir sah, hatte ich noch nie gehört.
»Setzen Sie sich doch«, forderte sie mich auf. »Im Innenhof ist es noch ein bisschen frisch, da kommt die Sonne erst am Vormittag hin.«
In einer Ecke der Bäckerei standen zwei Tische. Das musste ich ihr lassen – sie hatte sich den Platz sehr gut eingeteilt.
»Von wo denn im Süden?« Ich zog einen Stuhl hervor – aus Holz, türkisblau gestrichen und mit einem Kissen auf der Sitzfläche – und nahm Platz.
Ihr Kopf zuckte nach rechts. »Entschuldigen Sie mich«, sagte sie. »Das ist der Ofen-Timer. Bin gleich wieder da.«
Ich hatte keinen Timer gehört, und ich habe Ohren wie eine Fledermaus. Im Stillen nahm ich mir vor, einen Blick auf ihre linke Hand zu werfen, wenn sie zurückkam. Die Delle eines vor Kurzem abgelegten Eherings könnte darauf hindeuten, dass sie auf der Flucht aus einer gescheiterten Beziehung war.
Ein paar Sekunden später kam sie mit leeren Händen zurück.
»Haben Sie dort ein ähnliches Geschäft geführt?« Ich machte eine kurze Pause, um den Effekt zu verstärken. »Im Süden?«
»Nein.« Sie täuschte Geschäftigkeit vor, indem sie eine Reihe bereits perfekt aufgestapelter Brotlaibe neu anordnete. »Das hier ist etwas ganz Neues.«
»Und was bringt Sie nach St. Abel’s Chapel?«
Sie blickte auf, ein ganz klein wenig zu schnell. »Ein leer stehendes Geschäft. Also, was kann ich Ihnen bringen? Tee, Kaffee, heiße Schokolade? Vielleicht keine Schokolade, wenn Sie Diabetes haben. Wie wär’s mit Kaffee und einem Teekuchen mit Butter? Da ist nur ein bisschen Zucker obendrauf, und ein Teelöffel Rosinen ist auch drin. Das sollte doch okay sein, oder?«
»Ich habe schon gefrühstückt. Nur Tee, bitte. Indischen. Lose. Und die Milch würde ich gern selbst dazutun.«
Den Bruchteil einer Sekunde lang gefror ihr Lächeln. »Kommt sofort.«
Beim Arbeiten kehrte sie mir den Rücken zu, wodurch ich Zeit hatte, die Anrichte mit den Reihen selbst gemachter Marmeladen, Chutneys und eingelegtem Gemüse und die beiden Riesenteller Scones zu betrachten, die dort standen: einer mit süßen, einer mit herzhaften. In einem Kühlschrank wurden Räucherlachs, roher Schinken und Streichrahm angeboten. Direkt vor mir auf dem Tresen stand fast wie eine Herausforderung ein Teller mit Schweinepasteten. Ihre gewellten Ränder glänzten vor Fett.
Allmählich fühlte ich mich wieder unbehaglich. Irgendetwas an dem schieren Überfluss im Laden schien mich kleiner zu machen. Es war, als hätten sich die Sauerteigbrotlaibe, die Croissants, die Schweinepasteten und die Teekuchen mit der Bäckerin gegen mich verbündet. Alles an der Bäckerei kündete lauthals von Professionalität, und doch war hier ein Makel. Eine Illusion. Nicht alles war, wie es schien.
»Sie müssen bestimmt viel von alldem hier kaufen«, meinte ich. »Das können Sie doch nicht alles selber herstellen.« Beinahe hätte ich hinzugefügt: »Schon gar nicht, wenn Sie schwimmen waren«, doch das verkniff ich mir. Gardner hatte mich mehr als einmal beschuldigt, ihn zu bespitzeln. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er mich bei unserer neuen Nachbarin schlechtmachte, und es wäre ja idiotisch von mir, ihm noch in die Hände zu spielen.
»Ich stehe um vier auf«, erwiderte sie, ohne sich umzudrehen. »Und am Abend bereite ich alles vor, sodass es gleich aufgehen oder backen kann. Und manche Sachen, die Pasteten und die größeren Torten, halten auch ein paar Tage.«
Ich hatte bereits eine große verzierte Torte auf dem Tresen stehen sehen, geschützt von einer großen Plexiglaskuppel. Sie war knallbunt, mit schwarzem Zuckerguss und mit orangefarbenen Kürbissen und Cartoon-Gespenstern obendrauf. Happy Halloween stand unten rund um den Tortenboden, und eine kleine handschriftliche Karte ließ die Kunden wissen, dass Bestellungen für Halloween entgegengenommen wurden.
»Liegt das jetzt an mir, oder scheint heute im Dorf eine Menge los zu sein?«, fragte sie, während sie den Tee mit kochendem Wasser aufgoss. »Ich habe bestimmt schon an die zwanzig Wagen hier durchfahren sehen.«
Ich sah auf das Datum an meiner Armbanduhr. »Kommt ungefähr hin«, antwortete ich. »Spätestens heute Mittag kommt man kaum noch über die Hauptstraße.«
Da drehte sie sich um. Ihre dunklen Brauen berührten sich fast. »Wo wollen die alle denn hin? Da oben ist doch nichts. Also, nicht dass ich wüsste.«
»Aber Sie wohnen ja auch noch nicht lange hier.«
Sie sagte nichts mehr, doch ihr Mund hatte sich verhärtet, als sie wieder an den Tisch kam. Diesmal mit einem Tablett, das in Anbetracht der Tatsache, dass ich nur Tee erwartete, geradezu lachhaft überladen aussah. Sie stellte es ein bisschen heftiger ab als nötig, doch dann gewann ihre Neugier die Oberhand.
»Gibt es da oben ein Hotel? Ein Konferenzzentrum? Viele von den Autos sind anscheinend Lieferwagen.«
Sie nahm Teekanne, Teetasse mit Untertasse, Löffel, Milchkännchen Zuckerschale und einen kleinen Teller vom Tablett. Ich blickte rasch auf und sah die Herausforderung in ihren Augen.
»Das ist ein Wurstbrötchen.« Sie schenkte mir ein verkniffenes Lächeln. »Mein eigenes Rezept. Nur zum Probieren.«
Das Gebäckstück war klein und vollendet geformt, golden wie eine Honigwabe. Teigblättchen schienen jeden Augenblick davonfliegen zu wollen wie Distelflaum. Die glänzende Wurst ragte an beiden Enden daraus hervor, rosa und ein wenig obszön. Ich spürte, wie sich mir der Magen umdrehte.
»Stören Sie sich nicht an meiner Neugier«, sagte sie. »Ich bin Geschäftsfrau. Wenn es da oben ein großes Hotel gibt, könnte das sehr gut für mich sein.«
»Da ist eine Kirche«, entgegnete ich. »Vielleicht brauchen die ja Brot für die Kommunion.«
Ich machte nur Spaß. Mir war klar, dass sie mit Kirchenbestellungen überhäuft werden würde, noch ehe der Tag zu Ende war. Die Leute, die im Laufe der nächsten paar Wochen im Dorf eintreffen würden, waren nicht dafür bekannt, sich zu kasteien. Praktisch wie aufs Stichwort ertönte die Glocke an der Tür, und Anna schaffte es nicht, ihre Erleichterung zu verbergen. Ich nutzte die Gelegenheit, als sie mir den Rücken zuwandte, um in das Wurstbrötchen zu beißen. Mit einem Bissen hatte ich ungefähr die Hälfte davon im Mund. Der Teig zerbarst auf meiner Zunge. Die Wurst war warm und pfeffrig, mit einem Hauch von etwas, dass ich nicht recht einordnen konnte. Pflanzlich, aber mit Hitze drin. Der Geschmack war verflogen, ehe ich es mich versah, und ich merkte, dass ich zitterte. Das glitschige, salzige Wurstfett überzog noch immer das Innere meines Mundes, und ich trank hastig kochend heißen Tee, um es loszuwerden.
Die Neuankömmlinge waren Kirchenanhänger. Die kann man leicht von den gelegentlichen Touristen unterscheiden, die von Zeit zu Zeit durchs Dorf wandern. Die Touristen tragen für gewöhnlich Wander- oder Fahrradmontur. Den Kirchenleuten ist ihre alljährliche Versammlung sehr wichtig, und sie sind gekleidet wie für eine Landpartie.
Diese drei, alles Frauen, waren keine Ausnahme. Zwei waren für diese frühe Tageszeit sehr schick angezogen. Hochhackige Schuhe, durchsichtige Strumpfhosen, taillierte Jacken und dezentes Make-up. Perfekte Frisuren. Die Sorte Frau, die sich an Coco Chanels Modetrick halten, ihren Schmuck anzulegen und dann ein Schmuckstück wieder abzunehmen. Die Jüngste der drei trug weite Jeans und ein College-Sweatshirt. Sie hatte die Hände tief in die Hosentaschen geschoben.
»Du meine Güte«, sagte die Älteste. »Ist das nicht himmlisch?«
»Sehr hübsch«, pflichtete die vom Alter her Nächste ihr bei. Die Jüngste, sah ich, war fast noch ein Kind. »Viel, viel schöner als früher. Oh, schau mal, Mum, glutenfrei. Großartig. Guten Morgen, Sie sind bestimmt Anna.«
»Oh, riecht das gut«, meinte die Älteste, bevor Anna etwas sagen konnte.
»Das haben Sie ja alles ganz wunderbar zurechtgemacht«, verkündete die Jüngere, obgleich sie dasselbe eben schon gesagt hatte.
So machten sie eine Weile weiter und beachteten mich nicht, also stand ich auf und stellte den Teller mit dem halb verzehrten Wurstbrötchen auf den Tresen. Ich war mir nicht sicher, dass ich es nicht aufessen würde, wenn es auf dem Tisch blieb. Momentan von dem Trio abgelenkt, das ihre Inneneinrichtung bewunderte, zog Anna die Brauen hoch.
»Zu fett«, sagte ich.
Ihr Gesicht zuckte, dann wandte sie mir den Rücken zu.
»Wir haben gehört, Sie sind genau die Richtige für uns«, sagte die Jüngere. »Wir brauchen eine Torte.«
»Da bin ich die Richtige für Sie.« Anna nickte, und in einem Spiegel an der Wand gegenüber vom Tresen konnte ich sehen, dass sie lächelte, ein sehr viel breiteres, strahlenderes Lächeln, als alles, womit sie mich bisher bedacht hatte. Es veränderte ihr Gesicht vollkommen. »Was denn für eine Torte?«
»Eine Torte und noch so dies und das«, fiel ihr die Ältere ins Wort. »Aber mit der Torte fangen wir an. Es muss aber eine richtig schöne Torte sein.«
Das hier wurde allmählich langweilig. Ich war zuerst hier gewesen und wohnte auch noch direkt neben Anna, und doch beachtete sie mich praktisch gar nicht. Die Neuankömmlinge hatten meine Existenz nicht einmal zur Kenntnis genommen, ich hätte genauso gut gar nicht im Laden sein können.
»Hochzeit? Taufe?«, wollte Anna wissen.
Das Kind wurde nach vorn geschoben. Anscheinend war das Mädchen nicht imstande, irgendetwas anderes anzuschauen als den Boden, und ich hatte ihr Gesicht noch gar nicht richtig gesehen. Außerdem schien sie zu zittern, als hielte sie irgendwelche starken Gefühle zurück.
»Eine Geburtstagstorte für unsere süße Constance. Meine Güte, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist.«
Ich war zu dem Schluss gekommen, dass dies drei Generationen derselben Familie waren. Tochter, Mutter und Großmutter. Jetzt konnte ich auch die Familienähnlichkeit erkennen. Alle waren mehr oder weniger gleich groß und von gleicher Statur, allerdings schien das Mädchen ein bisschen größer und ein bisschen dünner zu sein. Alle hatten helles Haar und helle Haut. Die beiden Älteren hatten ganz leichte Hakennasen und jede Menge sehr weiße Zähne.
Noch ehe sie den Mund aufgemacht hatte, wusste ich, dass das junge Mädchen eine Spange trug. Das hier war die Sorte Familie, die viel Wert auf perfekte Zähne legte.
»Zum sechzehnten Geburtstag«, ergänzte die Mutter. »Wir brauchen sie in neun Tagen. Lässt Ihnen das genug Zeit?«
»Natürlich«, versicherte Anna. »Schauen wir uns doch mal ein paar Muster an, ja? Constance, richtig? Freut mich sehr, dich kennenzulernen.«
Eigentlich hatte ich eine Bemerkung darüber machen wollen, dass der Tee kalt sei, obwohl das gar nicht stimmte. Es war sogar sehr guter Tee. Und dann ließ mich irgendetwas jäh innehalten. Das Mädchen Constance, das demnächst sechzehn werden würde, hatte endlich doch aufgeblickt.
Sie war im wahrsten Sinne versteinert, stand wie angewurzelt da. Ihre Augen waren starr, und sie blinzelte nicht. Und zu beiden Seiten ihrer Füße tropfte Blut auf den Boden.
Die Ärmelmanschetten ihres Sweatshirts waren nass – es war dunkelbraun, fast schwarz, sonst wäre mir das schon früher aufgefallen –, und ihre Jeans hatte auf beiden Seiten in Hüfthöhe nasse Flecken.
Dieses junge Mädchen hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten und war möglicherweise im Begriff, in der neuen Bäckerei zu verbluten.
Ich setzte mich wieder hin und schenkte mir noch eine Tasse Tee ein.
2
April, ein Jahr zuvor
Also, war er verrückt? Oder böse?
Möglicherweise die Frage, die Psychiatern und Psychologen am häufigsten gestellt wird. Gleichzeitig war es unmöglich, sie auch nur halbwegs integer zu beantworten. Die Gründe für mentale Störungen waren ebenso vielfältig und verschieden wie deren Krankheitsbilder. Traurigerweise hatte das Strafrecht mit Nuancen nicht viel am Hut.
»Wir haben acht Termine«, erklärte sie dem Jungen, nachdem sie sich vorgestellt hatte. »Zweimal die Woche, den ganzen nächsten Monat.«
»Ich verstehe.« Sein Lächeln wurde noch ein wenig breiter. »Es tut mir leid, dass ich so viel Mühe mache.«
Jago Moore, siebzehn Jahre alt, weiß und hochintelligent, war vor sechs Tagen in der Cafeteria seiner teuren Privatschule durchgedreht (so hatte der Direktor es ausgedrückt). Er hatte Geschirr zerbrochen und Stühle gegen die Fenster geschleudert, dann war er über die langen Esstische gerannt und hatte seinen verblüfften (und, seien wir ehrlich, wahrscheinlich ein bisschen schadenfrohen) Mitschülern Teller, Essen und Besteck auf den Schoß gekickt. Als großes Finale hatte er einer Physiklehrerin ein Tafelmesser in den Bauch gerammt, und da hatte sich jegliche Schadenfreude seitens der Jungen in nacktes Entsetzen verwandelt. Wie eine Gnuherde beim Anblick eines Löwen waren sie aus dem Speisesaal gestürmt.
Wäre das Messer ein wenig länger gewesen, ein wenig schärfer, hätte die junge Lehrerin das Klingeln zum Ende der Mittagspause vielleicht nicht mehr erlebt. So hatte sie schwere Blutergüsse und leichte innere Blutungen davongetragen. Man erwartete sie in absehbarer Zeit wieder in der Schule. Ob das auch für den Angreifer galt, blieb abzuwarten.
»Meinen Sie, wir könnten die Rollos hochziehen?«, fragte er. Seine Augen wurden schmal, als er zu den verhängten Fenstern hinüberschaute. An seinem Lächeln jedoch änderte sich nichts.
Sie saßen an einem Ende eines langen, schmalen Raumes, wo sie ein Sofa für ihre Patienten und einen Sessel für sich selbst hingestellt hatte. Auf einem niedrigen Couchtisch langen nicht bedrohliche Zeitschriften. Auf die Bezeichnung nicht bedrohliche Zeitschriften war sie in einem Praxis-Handbuch gestoßen, und sie zerbrach sich noch immer den Kopf, was eine bedrohliche Zeitschrift sein könnte. Das Waffenjournal Guns and Ammo vielleicht?
»Ich kriege Klaustrophobie, wenn die zu sind.« Noch immer dieses unerschütterliche Lächeln.
»Die Rollos schützen deine Privatsphäre«, erklärte sie ihm. »Da draußen sind eine Straße und eine Bushaltestelle. Die Leute, die da vorbeikommen, könnten hier reinschauen.«
»Das stört mich nicht. Mir wär’s lieber, wenn sie offen sind.« Er sah aus, als wäre er drauf und dran aufzustehen. »Ich zieh sie jetzt hoch.«
»Ich mach das schon.« Sie hob die Hand, um ihn zurückzuhalten, und ihr war bewusst, dass er hier bereits die Bedingungen festlegte und dass sie es zuließ. »Aber wenn es zu hell wird, müssen wir uns das vielleicht noch mal überlegen.«
»Wird es nicht. Das Fenster geht nach Westen. Da scheint die Sonne den ganzen Nachmittag nicht rein.«
Sie zog die Rollos hoch. Was die Himmelsrichtung anging, hatte er recht gehabt, allerdings hatte sie bisher noch nie darüber nachgedacht. Und mit der Bushaltestelle hatte sie recht gehabt. Drei Personen standen keine fünf Meter entfernt, und da im Zimmer Licht brannte, würden sie hereinschauen können.
Als sie sich wieder umdrehte, sah sie ein Leuchten der Befriedigung in den Augen des Jungen.
»Es tut mir leid, dass ich so viel Mühe mache«, wiederholte er. »Ich weiß, Sie haben bestimmt viel zu tun. Und die Polizei auch. Das hätte ich gern im Protokoll stehen, bitte. Dass ich mich entschuldigt habe.«
Noch immer lächelte er, obwohl ihm inzwischen die Kiefermuskeln wehtun mussten. Ihr wurde klar, wie sehr er sich anstrengte, normal zu wirken.
Jago Moore war eigentlich ein gut aussehender Junge: groß und schlank, mit dem allmählichen Muskelaufbau in Schultern und Oberschenkeln, der sich bei Jungen zum Ende der Adoleszenz einstellt. Sein Haar war dunkelbraun und ziemlich lang. Es fiel ihm in die Stirn und verbarg halb seine Augen, die von einem verblüffend hellen Blau waren. Sein Gesicht war lang und schmal, sein Mund breit und die Zähne darin das Resultat von hervorragenden Genen oder Tausenden von Pfund für den Kieferorthopäden. Die Sorte Junge, von der hormongebeutelte halbwüchsige Mädchen träumten.
Sie hatte keine Ahnung, warum sich ihr Magen verkrampfte, wenn sie ihm so nahe war. Das konnte nur an dem großen Unterschied liegen, an der Disparität zwischen der bemerkenswerten Selbstbeherrschung, die sie jetzt vor sich sah, und dem, was sie erwartet hatte, nachdem sie über den Vorfall in der Cafeteria gelesen hatte.
Zeugen, darunter auch die Polizisten, die als Erste am Tatort gewesen waren, hatten berichtet, dass Jago nach seiner Attacke in einen fast katatonischen Zustand verfallen war. Er hatte sich zuckend in Embryonalstellung auf dem Boden zusammengekrümmt und auf keine Fragen geantwortet, hatte jedoch auf eine Art und Weise, die als »voll gruselig« beschrieben worden war, das meiste wiederholt, was zu ihm gesagt worden war. So war er während der folgenden vier Stunden geblieben.
Am nächsten Tag war er vom Schulbesuch ausgeschlossen worden, bis ein psychiatrisches Gutachten vorlag. Auch die Polizei wartete darauf, von ihr zu hören, bevor man entschied, ob Anklage erhoben werden sollte oder nicht. Nur drei Monate vor dem Abitur war das kein guter Zeitpunkt für einen hochintelligenten Jungen, von der Schule verwiesen zu werden.
»Ich werde dir viele Fragen stellen, Jago«, sagte sie, »über dein Leben als solches, nicht nur über den Vorfall letzte Woche. Und ich werde auch mit deinen Angehörigen reden. Ich möchte dich gut kennenlernen. Ich werde mir Notizen machen, und der Bericht, den ich schreibe, wird es der Polizei und deiner Schule ermöglichen, zu entscheiden, wie es weitergehen soll.«
Abgesehen von dem einen Versuch, aufzustehen und die Rollos hochzuziehen, hatte Jago sehr still dagesessen. Er zappelte nicht herum oder ließ den Blick schweifen, wie es die meisten ihrer jungen Patienten taten, er pulte nicht an seinen Nägeln herum oder baumelte mit den Beinen. Er wirkte völlig entspannt, und er hatte sich die Zeit genommen, sich ordentlich anzuziehen – dunkelblaue Chinos und ein cremefarbenes Hemd. Seine Halbschuhe waren teuer und blank geputzt, und sein Haar war heute Morgen gewaschen worden. Er roch sauber. Von Kopf bis Fuß ein mustergültiger Siebzehnjähriger, bis auf diese unnatürliche Reglosigkeit.
»Bekomme ich den Bericht zu sehen?«, wollte er wissen.
Jagos Eltern waren wohlhabend und sehr darauf aus, ihren Sohn zu schützen. Vor allem sein Vater hatte kein Geheimnis daraus gemacht, dass er großen Wert auf eine psychiatrische Diagnose und eine medikamentöse Behandlung legte, mit der Jago seine Abiturvorbereitung schnell aufnehmen und sein Leben wieder auf die Reihe bekommen konnte. Der für den Fall zuständige Ermittlungsleiter jedoch, ein Sergeant ein Jahr vor der Pensionierung, hatte das anders gesehen. »Der läuft nicht rund«, hatte er zu ihr gesagt. »Den würde ich nicht in der Nähe meiner Kinder haben wollen.«
»Ich fürchte, nein«, antwortete sie Jago. »Der Bericht ist von der Polizei und vom Sozialdienst in Auftrag gegeben worden, und er ist vertraulich. Vielleicht beschließen sie, ihn dir irgendwann zu zeigen, aber das ist ihre Entscheidung. Um ehrlich zu sein, ich würde nicht damit rechnen.«
Am besten setzte man gleich zu Beginn klare Parameter. Doch sie registrierte das winzige Gefühl der Befriedigung, dass sie dabei hatte, Nein zu ihm zu sagen, und ärgerte sich darüber.
Seine Brauen zogen sich jäh zusammen. »Aber das ist doch mein Bericht. Da geht’s doch um mich.«
»Fangen wir an.« Sie schlug ihren Notizblock auf. »Erzähl mir vom Dienstagmorgen letzte Woche. Von Anfang an. Als du aufgewacht bist.«
Als Antwort bog und streckte er die Finger beider Hände, ein bisschen wie ein Pianist, der sich anschickt, etwas Gewichtiges, Schwieriges zu spielen, und begann dann, seine Fingergelenke knacken zu lassen, eins nach dem anderen. Die ganze Zeit über hielt er Blickkontakt, ohne zu blinzeln. Sie gab sich alle Mühe, nicht zusammenzuzucken, obwohl sie sowohl das Geräusch als auch die Vorstellung von knackenden Gelenken nicht ausstehen konnte.
Ihrer Erfahrung nach war die Polizei oft sehr schnell mit einem Urteil bei der Hand, doch ausnahmsweise war sie ganz einer Meinung mit dem Detective Sergeant. Ihr graute vor Jago Moore.
3
Angst ist unverwechselbar, nicht wahr? Constance blickte auf. Ich sah, wie sich ihre Lippen öffneten, als sie sich anschickte, etwas zu sagen – mit der Spange hatte ich recht gehabt –, und dann gefroren ihre Züge. Ihr Mund war in einer verzerrten Grimasse erstarrt, und an ihren Schläfen traten die Adern hervor. Ich wappnete mich für einen Schrei, doch sie beherrschte sich. Gerade eben noch.
Faszinierend.
Ich wartete darauf, dass jemand von den anderen reagierte, und merkte dann, dass nur ich den stummen Gefühlsausbruch des Mädchens mitbekommen hatte. Anna hatte sich zur Anrichte umgedreht und griff nach einer weißen Plastikmappe, und die beiden älteren Frauen konzentrierten sich auf sie. Niemand sah Constance an, und ich glaube, mich hatte sie noch gar nicht richtig bemerkt. Sie dachte, sie wäre unbeobachtet, und hatte zugelassen, dass ihre Maske verrutschte.
War ihr bewusst, dass sie den Boden der Bäckerei voll blutete? Auf den Fliesen neben ihrem rechten Fuß zählte ich vier Blutspritzer, auf der linken Seite ein paar mehr. Ich konnte mich wirklich nicht entscheiden, worauf ich meine Aufmerksamkeit richten sollte: auf das Gesicht des Mädchens oder auf die wachsende Menge roter Tropfen zu ihren Füßen. Als sie mit den Schultern zuckte, sah ich ganz kurz einen blutbefleckten Verband, der nachlässig um ihr rechtes Handgelenk gewickelt war.
»Die erste Entscheidung ist, Obstkuchen oder Biskuit-Teig«, erklärte Anna, während sie die Mappe aufschlug und die beiden anderen Frauen näher traten. »Obst ist teurer, aber die Torte hält über die Geburtstagswoche hinaus.«
»Biskuit«, sagte die Mutter. »Sie braucht nicht lange zu halten.«
Ein erschrockenes Keuchen entfloh Constances Mund, und sie stürzte zur Tür. Sie riss sie auf, wobei sie einen Blutstreifen hinterließ, und rannte die Straße hinunter davon.
Eine und dann noch eine Sekunde lang sagte niemand im Laden etwas. Als die Mutter einen Schritt auf die Tür zu machte, schoss die Hand der Großmutter vor wie die Zunge eines Chamäleons.
»Ich gehe.« Ihre Fingerknöchel auf der Schulter ihrer Tochter waren weiß, und ihre Stimme war leise und warnend. »Du regelst das mit der Torte.«
Na, viel Glück. Eine Oma in hochhackigen Schuhen versuchte, eine Sechzehnjährige einzuholen, die Turnschuhe anhatte.
»Ist sie verletzt?« Endlich hatte jemand – Anna – das Blut auf der Türklinke bemerkt.
Die beiden Frauen wechselten einen Blick. »Vielleicht sollte ich …«, setzte die Mutter an.
»Unsinn«, wehrte die Großmutter ab und griff nach der Tür, wobei sie es sorgfältig vermied, in das Blut zu fassen. »Sie wird sich beim Frühstückmachen in den Finger geschnitten haben – ich habe dir doch gesagt, das Brotmesser ist zu scharf – und hat sich nicht die Mühe gemacht, ein Pflaster draufzukleben. Du weißt doch, wie sie ist.«
Wieder ertönte die Türglocke, und mir wurde klar, dass ich sie den ganzen Tag zu hören bekommen würde. Als wolle sie noch darauf herumreiten, blieb die Großmutter auf der Türschwelle stehen und ließ die Glocke weiterläuten. Sie sah erst mich und dann Anna an und zuckte ganz leicht die knochigen Schultern.
»Teenager«, sagte sie.
Die Tür fiel zu, die Glocke verstummte, und ich sah zu, wie die alte Frau die Straße hinunterstöckelte.
»Möchten Sie vielleicht später wiederkommen?«, fragte Anna die Mutter. »Ich habe bis vier geöffnet.«
»Nein.« Die Mutter stieß einen tiefen, schweren Seufzer aus. »Bringen wir’s hinter uns. Wenn sie keine Lust hat, sich damit zu befassen, muss sie halt mit dem zufrieden sein, was ich aussuche.«
Anna blickte kurz zu mir herüber, fast als wäre ich jemand, dem sie Mitgefühl entlocken könnte. Ich starrte zurück, und sie schaute weg.
Während der nächsten paar Minuten wurde das Gespräch zu langweilig, um es sich zu merken, und ich hörte nicht mehr richtig zu. Ich beobachtete die Straße, wartete darauf, dass Constance oder ihre Großmutter wieder auftauchte, und lauschte dem Gerede von Schokolade-, Vanille- oder Holundergeschmack, von traditioneller Zuckerblumenverzierung oder vielleicht etwas, das eher auf Constance selbst zugeschnitten war, nur halb. Sie kamen zu einem Entschluss – die Details interessierten mich nicht –, und Geld wechselte den Besitzer.
Die ganze Zeit über schien es Anna nicht zu behagen, ohne Constance endgültige Entscheidungen zu treffen. Mehr als einmal wiederholte sie ihr Angebot, das alles später zu besprechen, doch als die beiden fertig waren, füllte sich der Laden allmählich, und sie wollte sich den anderen Kunden widmen. Ganz zu schweigen davon, das Blut wegzuputzen. Blutspritzer sind ja wohl kaum das, was man in einem Café sehen möchte.
Ich stand auf und ging. Dabei bot ich nicht an, zu bezahlen. Anna, oder wie auch immer sie hieß, hatte mir ein Frühstück aufs Haus angeboten, und ich hatte nicht um das Wurstbrötchen gebeten. Rasch holte ich mein Taschentuch hervor, um mich vor einem möglichen Kontakt mit Constances Blut zu schützen. Ich würde es sofort wegwerfen müssen, aber die Alternative – mit den Körperflüssigkeiten eines anderen Menschen besudelt zu werden – war undenkbar.
Auf der Schwelle drehte ich mich um, um mich von Anna zu verabschieden, doch sie kehrte mir den Rücken zu und schaute nicht zu mir herüber. Unhöflich, fand ich.
Von dem flüchtigen jungen Mädchen oder von der Oma im Verfolgungsmodus war auf der Straße nichts zu sehen, doch als ich meine Haustür aufschloss, dachte ich, dass der Morgen bereits sehr viel interessanter gewesen war, als ich es hätte erwarten können.
Immer mehr Fahrzeuge trafen ein, als ich kurz darauf zum Postamt ging. Die Lieferwagen von heute früh waren von Wohnmobilen und Autos mit Wohnanhängern verdrängt worden, und es herrschte reges Treiben, weil die Besucher sich mit Lebensmitteln eindeckten. Sicher wäre es einfacher für sie gewesen, unterwegs bei einem der Riesensupermärkte haltzumachen, doch sie werden alle aufgefordert, im Dorf einzukaufen. Das ist einer der Gründe dafür, dass die alljährliche Veranstaltung toleriert wird. Natürlich gibt es noch andere.
St. Abel’s Chapel, das Dorf, das ich in den letzten Jahren zu meinem Zuhause erkoren habe, besteht aus nicht viel mehr als aus einer langen, ziemlich tristen Hauptstraße mit Häusern aus Schiefer und Granit. Die Bauvorschriften des Lake District verlangen bei sämtlichen Gebäuden eine traditionelle und ziemliche öde Einförmigkeit. Häuser und Geschäfte sind hoch und schmal und die Fenster eher dafür gedacht, die Kälte draußen zu halten, als Licht hereinzulassen. Vorgärten gibt es nicht, aber hartnäckiger Efeu und wilder Wein wachsen üppig. Wenn die Sonne nicht scheint – was im Nordwesten meistens der Fall ist –, wird das Dorf zu einem Ort voller Schatten und verwinkelter Ecken.
Über der Hauptstraße, ein bisschen wie eine böse Macht, die über ihr Reich wacht, ragt der Tamland Fell auf, einer der höheren Berge in diesem Teil des Nationalparks. Er liegt genau westlich vom Dorf und stiehlt ihm jeden Abend das Licht, außer an den ganz langen Tagen im Mittsommer.
Ich musste im Postamt anstehen, und als ich meine Päckchen schließlich gewogen, frankiert und draußen in den Briefkasten geworfen hatte (ich gebe sie nie am Tresen ab), waren alle Ausgaben des Telegraph verkauft. Egal. The Times tat es fast ebenso gut. Ich bezahlte sie und meinen üblichen Daily Mirror, holte die Päckchen ab, die für mich eingetroffen waren (drei Stück) und verließ das Postamt, wobei ich auf dem Gehsteig beinahe mit Anna Brown zusammenstieß. Sie entschuldigte sich.
Ich nicht, ich hatte nichts falsch gemacht. Sie auch nicht, um fair zu sein, wir waren nur beide zur selben Zeit am selben Ort gewesen. Entschuldigungen bedeuten mehr, finde ich, wenn man nicht mit ihnen um sich wirft wie mit Konfetti.
Wir machten uns auf den Rückweg, und uns blieb nicht viel anderes übrig, als zusammen zu gehen. Normalerweise finde ich das lästig, doch die sogenannte Anna Brown faszinierte mich noch immer.
»Ich war beim Metzger«, berichtete sie, obgleich ich nicht gefragt hatte. »Mittags biete ich Sandwiches an. Bloß Käse, Schinken und Gürkchen, aber die gehen gut. Ich habe überlegt, ob ich es nächste Woche mal mit Suppe probieren soll. Was meinen Sie?«
Ich tat so, als würde ich kurz darüber nachdenken.
»Eine Dose Tomatensuppe bekommen die meisten Leute schon auf«, antwortete ich. »Ich würde Ihre Zeit nicht mit so was verschwenden.«
Sie schniefte und verstummte. Wir blieben stehen, um die Straße zu überqueren, und mussten etliche Sekunden lang warten.
»Ist das hier eine Art Oktoberfest?«, erkundigte sie sich, als ein großer grüner Van mit der Aufschrift Pandora Productions vorüberrollte. »Viele von den Wagen, die ich heute früh gesehen habe, scheinen etwas mit dem Showbusiness zu tun zu haben. Und im Ort sind Leute unterwegs, die aussehen wie Rockmusiker.«
»Ich denke, Sie werden feststellen, dass das Oktoberfest in München stattfindet«, entgegnete ich. »Und dass es am ersten Sonntag im Oktober vorbei ist.«
»Überall auf der Welt gibt es jetzt ähnliche Veranstaltungen«, erwiderte sie schroff. »Ich dachte, das hier wäre auch eine.«
»Ist es aber nicht.«
»Beim Metzger hat gerade jemand von ›der Einsammlung‹ gesprochen. Es heißt also Einsammlung?«
»Ja«, sagte ich.
»Klingt das für Sie nicht ein bisschen gruselig?«
»So habe ich nie darüber gedacht.«
»Und was ist das nun?« Wir hatten die andere Straßenseite erreicht, und sie hatte tatsächlich angehalten und verstellte mir den Weg. »Sie sind die fünfte Person, die ich heute Vormittag gefragt habe, und keiner hat mir eine klare Antwort gegeben.«
»Die Leute von hier sagen Ihnen, dass sie nur sehr wenig darüber wissen, dass es eine Privatveranstaltung ist, an der niemand teilnimmt, der hier wohnt. Dass sie keinen Schaden anrichtet und jedes Jahr eine Menge Einnahmen bringt«, erwiderte ich. »Wenn Sie weiterfragen, wird man Ihnen sagen, dass Sie in den nächsten paar Wochen mehr Umsatz machen werden als im ganzen restlichen Jahr, und dass Sie gut beraten sind, das auszunutzen und sich nicht zu viele Gedanken darüber zu machen, was da passiert oder nicht passiert.«
Sie antwortete nicht, starrte mich aber weiter an.
»Die Besucher wiederum zucken mit den Schultern und sagen: Ach, das machen wir jedes Jahr. Einfach nur ein Treffen von ein paar Freunden.« Sie senkte den Blick.
»Habe ich recht?«, hakte ich nach.
»Ja«, antwortete sie. »Also, was passiert denn nun da?«
Ich lächelte. »Ich war noch nie dort. Ich weiß nichts darüber, nur dass die Leute so gegen Mitte Oktober hier aufkreuzen und dass dann im Dorf eine Menge los ist, aber am ersten Wochenende im November sind sie alle wieder weg.«
»Mir ist noch etwas anderes aufgefallen«, meinte sie. »Viele verlassen das Dorf. Von denen, die hier wohnen, meine ich. Ich habe allein heute Morgen bestimmt ein halbes Dutzend Leute ihre Autos vollpacken sehen.«
»Ich denke, Sie werden feststellen, dass nächste Woche Herbstferien sind. Dann sind viele Familien weg. Die meisten fahren am Freitagabend los.«
Sie nickte. »Daran habe ich nicht gedacht. Kommt mir aber komisch vor. Neue Leute strömen hier rein, und die, die hier wohnen, fliehen vor den Horden.«
»So, wie Sie das sagen, hört es sich an wie eine Invasion«, bemerkte ich.
Das sollte ein Witz sein, doch Anna lächelte nicht einmal, als ich zu ihr hinüberschaute.
»Was halten Sie von dieser Familie heute Morgen?«, wechselte sie das Thema. »Um ehrlich zu sein, ich hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen, denen so viel Geld abzunehmen. So große Torten sind nicht billig, und sie haben auch noch jede Menge anderes Party-Essen bestellt.«
»Ihr neues Unternehmen wird vielleicht nicht sehr erfolgreich, wenn Sie sich beim Verkaufen unwohl fühlen.«
Das hatte nicht witzig sein sollen, aber sie lachte. Allmählich revidierte ich meine Ansicht, dass sie reizlos war.
»Stimmt auch wieder. Aber ich habe mir Sorgen um Constance gemacht. Sie schien sich nicht gerade auf ihre Party zu freuen, nicht wahr? Sie und die Großmutter sind nicht zurückgekommen. Und für einen Schnitt mit einem Brotmesser hat sie ganz schön heftig geblutet.«
Ich erwog, ihr zu sagen, was ich gesehen hatte, doch alte Gewohnheit hielt mich davon ab. Wissen ist etwas, was man schätzen und bewahren sollte, denke ich immer.
»Ich hoffe, sie ist okay«, beendete Anna ihren Gedankengang.
»Können Sie irgendetwas unternehmen, wenn sie nicht okay ist?«
Sie antwortete nicht, aber ich merkte, wie sie sich neben mir im Gehen versteifte. Ungewöhnlich emphatisch, dachte ich bei mir, und nervös, das merkt man an ihrer plappernden Art zu reden. Fühlt sich mit ihrem neuen Namen nicht wohl und weicht Fragen nach ihrer Vergangenheit aus. Ich hatte bereits nach Spuren eines Eherings an ihrer linken Hand gesucht. Nichts Eindeutiges, hatte ich entschieden.
In diesem Moment hielt ein Lastwagen mitten auf der Straße.
»Entschuldigung«, rief die Fahrerin, eine Frau in den Fünfzigern mit starkem ausländischem Akzent. »Können Sie mir bitte sagen, wie ich nach Gathering Hall komme?«
»Geradeaus die Straße rauf«, erklärte ich ihr. »Nach dem Dorf die Erste rechts und weiter bis zum Ende. Etwas über drei Kilometer. Die machen die Tore auf, wenn Sie kommen.«
Die Frau nickte zum Dank und fuhr weiter.
»Theaterkostümverleih?«, bemerkte Anna. »Und der Wagen hat ein holländisches Kennzeichen. Was läuft da oben?«
»Sind Sie ein neugieriger Mensch, Anna?«, erkundigte ich mich, als wir die Vordertür der Bäckerei erreichten.
»Ist nicht jeder neugierig?«, fragte sie ein wenig abwehrend zurück.
Das war eine durchaus vertretbare Herausforderung. Ich bin selber neugierig, und Anna Brown machte mich allmählich sehr neugierig. Der Unterschied zwischen uns war, dass ich inzwischen sehr geübt darin war, meine Neugier zu verbergen.
Aber ich wohnte ja auch schon länger hier.
4
April, ein Jahr zuvor
»Ich werde verrückt, stimmt’s?«, fragte Jago.
Die Psychiaterin zwang sich zu lächeln. »Diese Worte habe ich noch nie in einem Bericht verwendet, und ich habe nicht vor, bei deinem damit anzufangen.«
Drei Tage nach ihrer ersten Begegnung war Jago ähnlich sauber und gut gekleidet. Das seltsame, starre Grinsen hatte er abgelegt, wofür sie dankbar war, doch beim Hinsetzen hatte er seinen Nacken knacken lassen, erst in die eine und dann in die andere Richtung, und sie dabei genau beobachtet. Als wüsste er, dass sie das nicht ausstehen konnte.
Sie hatte die Rollos hochgezogen, bevor er gekommen war, und war sich des gedämpften Verkehrslärms und des Stimmengewirrs an der Bushaltestelle sehr bewusst.
»Kannst du dich jetzt an mehr von dem Vorfall in der Cafeteria erinnern?«
Bei ihrem ersten Gespräch hatte Jago behauptet, keinerlei Erinnerung an seinen Anfall zu haben, abgesehen von einem merkwürdigen, traumartigen Szenario aus Lärm, Chaos und einer enormen, verinnerlichten Wut. Es war, als würde ich innerlich verbrennen, hatte er gesagt. Und dann ist alles dunkel geworden.
Er schüttelte den Kopf. »Es verschwindet immer mehr. So wie Träume. Beim Aufwachen hat man sie noch vor Augen, aber sie verschwinden.«
»Als die Polizei das erste Mal mit dir gesprochen hat, hast du gesagt, du hättest Stimmen gehört.«
Er machte ein verblüfftes Gesicht. »Echt? Ganz ehrlich, das ist alles total verschwommen.«
»Stimmen in deinem Kopf, um genau zu sein, die dich angetrieben hätten. Erinnerst du dich daran?«
Seine Lippen zuckten, als sei er gelinde erheitert. »Daran, die Stimmen zu hören, oder daran, dass ich’s der Polizei erzählt habe?«
Niemand, der so tief im Dreck saß wie dieser Junge, konnte es sich leisten, Sprüche zu klopfen. »Fangen wir mit den Stimmen an. Was haben sie zu dir gesagt?«
Langsam und bedächtig schüttelte er den Kopf. »Da war unheimlich viel Krach im Saal. Die Jungs haben mich angefeuert. Zumindest am Anfang. Vielleicht habe ich ja das gemeint.«
Er stellte die Idee in den Raum wie eine Herausforderung, als wolle er sagen: Beweisen Sie mir, dass es nicht so war.
»Und du sagst, so was ist dir noch nie passiert? Hast du jemals etwas Ähnliches erlebt? Jemals gesehen, wie jemand in deinem Beisein die Beherrschung verloren hat? Vielleicht als Kind?«
Eine ihrer Aufgaben bestand darin, während der Sitzungen mit Jago das Risiko und die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, dass er wieder gewalttätig werden würde. Zu dem Verfahren, das sie angewendet hatte, gehörte eine Liste von zwanzig Faktoren, darunter die Berücksichtigung relevanter Ereignisse in der Vergangenheit. Einfach gesagt, bei einem Patienten mit einer Gewaltanamnese, selbst wenn er nur selbst Gewalt erfahren hatte, war es wahrscheinlicher, dass er solches Verhalten wiederholte. Erste Anfragen in seiner Schule und bei seinen Eltern hatten nichts erbracht.
Bis auf die Aussage seiner Klassenlehrerin, einer dunkelhaarigen jungen Frau, die gesagt hatte, Jago würde sie »verunsichern«. Auch wenn der Junge nie etwas getan hatte, das eine förmliche Beschwerde ausgelöst hätte, war sie nie gern allein mit ihm im Klassenraum gewesen.
Während Jago auf ihre Fragen antwortete und erklärte, dass seine Eltern ihn nie geschlagen hätten und dass es ihm gelungen sei, den meisten Spielplatzraufereien aus dem Weg zu gehen, machte sich die Psychiaterin Notizen. Eine jähe Bewegung ließ sie aufblicken. Jago hatte abrupt den Kopf gesenkt, sodass seine Schläfen auf seinen Fingerspitzen ruhten. Seine Augen waren fest zugekniffen.
»Jago, ist alles in Ordnung?«
Er blickte auf. »Das Licht stört mich. Ich kriege Kopfschmerzen davon. Können Sie bitte das Rollo runterlassen?«
»Am Montag wolltest du, dass es oben ist. Du hast gesagt, du bekommst sonst Klaustrophobie.«
»Heute muss es zu sein. Und kann ich ein bisschen Wasser haben?«
Sie legte ihre Notizen weg, stand auf, zog das Rollo herunter und goss ihm Wasser aus der Kanne auf dem Beistelltisch ein.
»Sie sind ein Engel«, sagte er, als sie es ihm reichte. Sein Gesicht war wieder glatt, und er lächelte. Er sah nicht aus, als hätte er Kopfschmerzen. »Wo waren wir?«
Verdammt, dieser Bengel ließ sie hier nach seiner Pfeife tanzen.
5
Ich wartete, bis es im Laden ruhig geworden war, bevor ich wieder hinüberging. Es war fast vier, und drüben hatte ein steter Besucherstrom geherrscht. Anna hatte recht gehabt, als sie gesagt hatte, die Stühle draußen wären beliebt. Sie waren den Großteil des Tages besetzt gewesen, genau wie die hinten im Hof.
Fairerweise muss gesagt werden, dass der hintere Teil ihres Grundstücks sehr viel besser aussah als vorher – ich hatte vom Fenster meines Arbeitszimmers einen recht guten Blick darauf –, doch fürs Erste würde ich das nicht als Innenhof bezeichnen.
Schließlich hörte ich, wie sie um vier die Riegel an der Vordertür vorschob. Ich klopfte, während sie noch im Laden war. Sie runzelte die Stirn, kam jedoch zur Tür und lächelte mich müde an.
»Ich habe geschlossen«, sagte sie, als wäre das Schild an der Tür nicht deutlich zu sehen.
»Ich bin nicht wegen Backwaren hier«, erklärte ich. »Ich wollte wissen, ob Sie heute irgendwelche Probleme mit Ihrem Telefon hatten.«
Sie furchte die Stirn. »Nein …« Dann hielt sie inne. »Na ja, nicht direkt Probleme, aber …«
»Das Telefon klingelt, aber dann wird aufgelegt, sobald Sie rangehen?«
Mit nachdenklichem Gesicht ging Anna zurück hinter den Tresen, wo sie gerade unverkaufte Ware von den Tellern auf ein größeres Tablett geschoben hatte. »Woher wissen Sie … Ist Ihnen das auch passiert?«
»Dreimal.« Ich folgte ihr in den Laden. »Unterdrückte Rufnummer, also konnte ich nicht zurückrufen.«
Einen Teller mit Scones auf halber Höhe in der Hand, hielt sie jäh inne. »Ich frage mich, ob das Constance war«, sagte sie, fast als spräche sie mit sich selbst.
»Wer?«, fragte ich, obwohl ich sehr gut wusste, wen sie meinte.
»Das Mädchen von heute Morgen. Die, die demnächst sechzehn wird.« Anna sah mich an. »Aber woher sollte die Ihre Nummer haben? Meine Telefonnummern stehen beide auf der Karte, die ich ihrer Mutter gegeben habe, aber Ihre würde sie doch nicht kennen.«
Nun, das ließ sich leicht erklären. »Meine Festnetznummer ist fast identisch mit Ihrer«, erwiderte ich. »Nur mit einer Zwei am Schluss statt mit einer Eins. Die von Hugh Gardner ist dieselbe, sie endet nur mit einer Drei. Alle drei Anschlüsse sind gleichzeitig gelegt worden, mit fortlaufenden Nummern. Constance könnte sich verwählt haben.«
Anna nickte.
»Das erklärt aber trotzdem nicht, warum Sie denken, dass sie das war«, bohrte ich nach.
»Ich hatte eine Nachricht auf meinem Handy.« Sie griff in ihre Schürzentasche und holte ein Mobiltelefon hervor. Dann drückte sie auf ein paar Knöpfe und hielt es mir hin, sodass ich die SMS lesen konnte:
Tut mir leid wegen heute Morgen. Sie scheinen echt nett zu sein. Ich wünschte, ich hätte jemanden wie Sie zum Reden.
»Und Sie glauben, die ist von Constance?«, fragte ich.
»Von wem denn sonst? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Antworte ich darauf oder nicht?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich würde mich da nicht einmischen. Aber gut zu wissen, dass nichts mit meiner Telefonleitung ist. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.«
Auf dem Weg hinaus drehte ich mich nicht um, doch in der Spiegelung der Glasscheibe konnte ich sehen, dass Anna mir nachblickte. Ein beklommener Ausdruck lag auf ihrem Gesicht.
Mitte Oktober ist mir die liebste Jahreszeit, vor allem wegen der Art, wie die Nacht alle überrascht. Am späten Nachmittag zieht sich Finsternis um uns zusammen wie ein Hinterhalt, stürzt sich auf das, was vom Tag übrig ist, und verschlingt das Licht. Bis November haben wir uns daran gewöhnt, aber im Oktober verdrängen wir es noch. Wir machen Licht an – wir müssen, sonst könnten wir uns nicht gefahrfrei fortbewegen –, doch an unsere Rollos und Vorhänge denken wir nicht. Töricht klammern wir uns an die Erinnerung an lange Sommerabende und denken überhaupt nicht daran, wie wir uns eine Stunde oder länger am Ende des Tages selbst zur Schau stellen. Ich sage »wir«, schließe mich dabei jedoch natürlich nicht selbst mit ein. Meine Vorhänge sind vor fünf Uhr zu, meine Türen sind abgeschlossen, und ich bin draußen, warm angezogen wegen der Kälte, und wandere durch die immer dunkler werdenden Straßen. Und erfahre mehr über meine Nachbarn, als ich es in einem ganzen Jahr des Beobachtens bei Tageslicht täte.
Und so sehe ich, wie Sie, Marinekommandant im Ruhestand, hinter den Seiten der Financial Times in der Nase bohren. Ich sehe Sie, alte Dame, täglich die Rahmen Ihrer Familienfotos polieren und dafür sorgen, dass man sie von der Straße aus sehen kann. Wie sie der Welt vorgaukeln, dass Ihr Mann Sie nicht wegen einer Jüngeren verlassen hat und dass Ihre Kinder nicht schon vor Jahren aufgehört haben, anzurufen oder zu Besuch zu kommen. Ich sehe Sie, die Frau, die mit so viel Energie und solcher Effizienz den Lehrer-Eltern-Ausschuss der Schule leitet; ich sehe, wie Sie Ihrem Kleinkind einen heftigen Klaps auf sein pummeliges Beinchen geben, als es seinen vollen Löffel auf den Boden schmeißt. Ich sehe den erschrockenen Schmerz des Kleinen und das Leuchten der Macht in Ihren Augen.
Und ich sehe dich, junges Mädchen, wie du Essen aus dem Kühlschrank klaust, wenn deine Mutter nicht in der Küche ist, und ich sehe, wie dein Vater dich anschaut, wenn er glaubt, dass es niemand mitbekommt. Ich bezweifele, dass er seine Fantasie ausleben wird. Er ist ein Mann, den ich stets für feige gehalten habe, aber er hat diese Gedanken trotzdem, und sie halten ihn nachts wach.
An diesem Abend sollte ich enttäuscht werden. Noch immer trafen die Besucher ein, ein gleichmäßiger Strom aus Autos und Wohnmobilen auf der Hauptstraße. Aber weniger als sonst, dachte ich. Das chinesische Restaurant in der Hauptstraße war nicht nur voll, sondern machte auch regen Umsatz mit Essen zum Mitnehmen. Der Pub The Gray Mare war eine pulsierende Lärm- und Lichtblase, fast schien er vor Parfüm-, Hopfen- und Schweißgeruch zu bersten. Mehrere Gäste, die alle rauchten, standen draußen auf dem Gehsteig.
Der Zustrom hatte die Dorfbewohner wie immer nervös gemacht. Vorhänge waren früh zugezogen worden, und ich vermisste die Lichtrechtecke, die auf die Gehsteige fielen. Eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, doch ich lag zehn Tage hinter meinem üblichen Zeitplan zurück. Das Leben hatte sich weitergedreht, während ich im Krankenhaus gewesen war.
Unser Dorf hat nur wenige Straßenlaternen, und normalerweise sind etwa die Hälfte davon wegen Vandalismus oder Nachlässigkeit außer Betrieb. Dieser Abend jedoch war wolkenlos, auch wenn der Mond gerade abnahm. Ich rechnete rasch im Kopf, und mir wurde klar, dass es in neun Tagen nachts in der Tat sehr finster sein würde, wenn der Mond sich nicht am Himmel zeigte. Der Höhepunkt der Einsammlung würde in dieser dunkelsten aller Nächte stattfinden.
Um den Pub machte ich einen großen Bogen. Ich war noch nie da drin gewesen, doch selbst, wenn ich daran vorbeiging, fühlte ich mich unwohl. Irgendwie war ich aufgewühlt und gereizt. Meine Abendspaziergänge sollen mich eigentlich beruhigen, und dieser tat nichts dergleichen. Gewiss, der Tag war interessanter gewesen, als ich erwartet hatte – die rätselhafte Angst und die mysteriösen Blutungen der kleine Constance, ganz zu schweigen von Anna Browns wundervollem Potenzial –, doch wenn überhaupt,