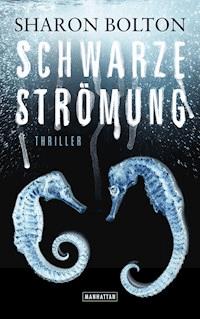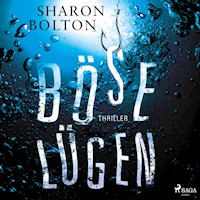7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lacey Flint
- Sprache: Deutsch
Du kannst ihn nicht sehen. Du kannst ihn nicht hören. Aber er beobachtet dich – und er kennt deine schlimmsten Ängste …
Zwanzig Selbstmorde in fünf Jahren. Meist sind es junge Frauen, die sich auf höchst ungewöhnliche Art das Leben nehmen. Zuletzt versuchte die 19-jährige Bryony Carter sich zu verbrennen. Nicht nur die Polizei vermutet, dass irgendetwas an der ehrwürdigen Universität Cambridge nicht mit rechten Dingen zugeht. Auch die Psychiaterin Evi Oliver ist besorgt. Nun soll sich DC Lacey Flint im Auftrag von DI Mark Joesbury als verletzlich-depressive Studentin ausgeben und den Lockvogel spielen. Doch je tiefer sie mit Evi Olivers Unterstützung in die Selbstmordserie eintaucht, desto bedrohlicher wird die Situation für beide Frauen. Als Lacey schließlich unter denselben Albträumen leidet, von denen die jungen Frauen in den Tod getrieben wurden, weiß sie: Sie ist die Nächste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Eine Serie von Selbstmorden unter Studentinnen sorgt an der Cambridge University für Unruhe. DI Mark Joesbury beauftragt seine Kollegin DC Lacey Flint, sich an der Uni einzuschreiben und verdeckt zu ermitteln. Obwohl die Todesfälle keinen Zweifel zulassen, dass die jungen Frauen sich selbst das Leben nahmen, gibt es doch auffällige Parallelen, die die Polizei stutzig machen: Alle waren psychisch labil, auf ähnliche Weise sozial vernetzt und besuchten dieselben Internetseiten. Joesbury vermutet daher, dass irgendeine treibende Kraft hinter den Taten steckt, dass sich jemand gezielt Opfer aussucht und auf perfide Weise in den Tod treibt. Lacey Flint soll nun in die Rolle der verletzlichen Studentin schlüpfen und den perfekten Lockvogel abgeben. Aber ist es wirklich nur eine Rolle? Lacey muss eine schwierige Vergangenheit verarbeiten und wird noch immer von inneren Dämonen gequält. Und tatsächlich werden die Killer bald auf sie aufmerksam. Aber hält Lacey die Fäden überhaupt noch in der Hand, oder ist sie bereits in ein tödliches Spiel verstrickt, in dem sie das nächste Opfer sein wird?
Autorin
Sharon Bolton wurde im englischen Lancashire geboren, hat eine Schauspielausbildung absolviert und Theaterwissenschaft studiert. »Todesopfer«, ihr erster Roman, wurde von Lesern und Presse begeistert gefeiert und machte die Autorin über Nacht zum neuen Star unter den britischen Spannungsautorinnen. Ihrem ersten Triumph folgten mittlerweile vier weitere Thriller, mit denen Sharon Bolton ihr brillantes Können immer wieder unter Beweis stellte. So wurde beispielsweise »Schlangenhaus« als bester Thriller des Jahres mit dem Mary Higgins Clark Award ausgezeichnet. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Oxford.
Mehr zur Autorin und ihren Büchern finden Sie unter www.sjbolton.com
SHARON BOLTON
Dead End
Thriller
Aus dem Englischenvon Marie-Luise Bezzenberger
MANHATTAN
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel»Dead Scared«bei Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, London
Manhattan Bücher erscheinen imWilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
1. AuflageDeutsche Erstveröffentlichung Mai 2013Copyright © der Originalausgabe2012 by S. J. BoltonCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHDie Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigungdes Hans-im-Glück-Verlags, MünchenUmschlaggestaltung und Konzeption: FinePic®, München; Mark Fearon/Arcangel ImagesRedaktion: Martina KlüverSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-09231-3www.manhattan-verlag.de
Peter Inglis Smith im Gedenken:netter Nachbar, toller Schreiber, guter Freund.
What are fears but voices airy?Whispering harm where harm is not,And deluding the unwaryTill the fatal bolt is shot!
William Wordsworth
Prolog
Dienstag, 22. Januar (ein paar Minuten vor Mitternacht)
Wenn ein schwerer Gegenstand aus großer Höhe herabstürzt, beschleunigt sich seine Fallgeschwindigkeit, bis der aufwärts wirkende Luftwiderstand gleich der abwärts wirkenden Schwerkraft ist. An diesem Punkt erreicht er dann das, was gemeinhin als Endgeschwindigkeit bezeichnet wird. Diese bleibt so lange unverändert, bis das sich im freien Fall befindliche Objekt auf eine stärkere Gegenkraft, im Allgemeinen den Erdboden, trifft.
Die Endgeschwindigkeit eines durchschnittlichen menschlichen Körpers wird auf etwas über 190 Stundenkilometer geschätzt. Normalerweise wird diese Geschwindigkeit nach fünfzehn oder sechzehn Sekunden erreicht, bei einer Falldistanz von fünf- bis sechshundert Metern.
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Menschen, die aus beträchtlicher Höhe abstürzen, bereits vor dem Aufschlag sterben. Das ist nur selten der Fall. Obgleich stressbedingt ein tödlicher Herzinfarkt eintreten könnte, dauern die meisten Stürze dafür einfach nicht lange genug an. Theoretisch ist es auch möglich, dass man bei Lufttemperaturen unterhalb des Gefrierpunktes erfriert oder durch Sauerstoffmangel das Bewusstsein verliert, aber für diese Szenarien müsste man in großer Höhe aus einem Flugzeug springen, und abgesehen von sehr furchtlosen Fallschirmspringern tun die Leute dergleichen nur selten.
Die meisten Menschen, die aus großer Höhe fallen oder aus freien Stücken in den Tod springen, sterben beim Aufschlag, wenn ihre Knochen brechen und das umliegende Gewebe zerrissen wird. Der Tod tritt augenblicklich ein. Normalerweise.
Die Frau an der Dachkante eines der höchsten Türme von Cambridge braucht sich wahrscheinlich nicht allzu viele Gedanken darum zu machen, wann sie ihre Endgeschwindigkeit erreichen wird. Der Turm ist knapp über sechzig Meter hoch, und ihr Körper wird immer weiter beschleunigen, wenn sie die volle Höhe herabstürzt. Andererseits sollte sie sehr eingehend über das Aufschlagen nachdenken. Denn wenn das geschieht, wird das Kopfsteinpflaster am Fuß des Turmes ihre jungen Knochen zerschmettern wie feines Kristall. Im Augenblick jedoch scheint sie nichts zu kümmern. Sie steht da wie eine Touristin beim Sightseeing und betrachtet die Aussicht.
Kurz vor Mitternacht ist Cambridge eine Stadt der schwarzen Schatten und der goldenen Lichter. Der beinahe volle Mond scheint wie ein Suchscheinwerfer auf die prachtvollen umliegenden Gebäude herab, auf die Säulen, die wie steinerne Finger in den wolkenlosen Himmel hinaufdeuten, und auf die wenigen Menschen, die noch unterwegs sind und wie Gespenster in Lichtpfuhle hinein- und wieder hinausgleiten.
Sie schwankt ein wenig, und dann, als hätte sie irgendetwas bemerkt, neigt sie den Kopf.
Am Fuß des Turms ist die Luft still. Eine zerrissene Seite der Daily Mail vongestern liegt regungslos auf dem Pflaster. Oben auf dem Turm weht der Wind, stark genug, um das Haar der Frau wie eine Flagge um ihren Kopf flattern zu lassen. Die Frau ist jung, um die dreißig, und sie wäre schön, wäre ihr Gesicht nicht vollkommen leer und ausdruckslos. Wäre da ein Lebensfunke in ihren Augen. Dies ist das Gesicht eines Menschen, der glaubt, er sei bereits tot.
Der Mann, der über den First Court des St. John’s College hetzt, ist dagegen ungemein lebendig, denn nichts weckt den natürlichen Lebenswillen des Menschen so sehr wie nackte Furcht. Mark Joesbury, Angehöriger jener Abteilung der Londoner Polizei, die ihre Beamten zu den gefährlichsten Einsätzen abkommandiert, hat in seinem ganzen Leben noch nie solche Angst gehabt.
Oben auf dem Turm ist es kalt. Die Januarkälte treibt über das Marschland herein und legt sich um die Stadt wie die Hand eines Pädophilen um die eines kleinen, gefügigen Kindes. Die Frau ist nicht für Wintertemperaturen angezogen, doch sie scheint die Kälte nicht zu bemerken. Sie blinzelt, und plötzlich stehen Tränen in diesen toten Augen.
DI Joesbury hat die Tür des Kirchturms erreicht und findet sie unverschlossen vor. Sie kracht gegen die Steinmauer, und seine linke Schulter, die immer die schwächere sein wird, registriert kurz den Schmerz. An der ersten Treppenkehre sieht Joesbury einen Schuh liegen, einen schmalen, flachen, spitzen Schuh aus blauem Leder, spiegelblank poliert. Fast bleibt er stehen, um ihn aufzuheben, doch dann wird ihm klar, dass er das nicht über sich bringt. Schon einmal hat er den Schuh einer Frau in der Hand gehalten und gedacht, er hätte sie verloren. Er hastet weiter die Stufen hinauf und zählt sie beim Laufen. Nicht weil er auch nur die blasseste Ahnung hat, wie viele es sind, sondern weil er im Kopf festhalten muss, dass er vorankommt. Als er den zweiten Treppenlauf erreicht, hört er Schritte hinter sich. Jemand folgt ihm nach oben.
Er spürt die kalte Luft im selben Moment, als er die Tür oben an der Treppe sieht. Dann ist er draußen auf dem Dach, noch ehe er irgendeine Vorstellung davon hat, was er tun soll, wenn es zu spät ist und sie bereits gesprungen ist. Oder was zum Teufel er tun soll, wenn sie es nicht getan hat.
»Lacey!«, brüllt er. »Nein!«
1
Freitag, 11. Januar (vor elf Tagen)
Die Bar in der Nähe der Waterloo Station war gut besucht. Fast hundert Leute brüllten aus vollem Hals, um sich über die Musik hinweg verständlich zu machen. Rauchen ist in Großbritannien in öffentlichen Gebäuden schon seit Jahren verboten, doch irgendetwas schien über diesen Menschen in der Luft zu hängen, schien die Luft zu verdichten und die Szene um mich herum zu einem unscharfen Foto zu machen, aufgenommen mit einer Billigkamera.
Instinktiv wusste ich, dass er nicht da war.
Ich brauchte nicht auf die Uhr zu schauen, um zu wissen, dass ich sechzehn Minuten zu spät kam. Ich hatte es auf die Sekunde genau so geplant. Nochspäter würde unhöflich wirken oder als wollte ich irgendetwas beweisen; zu pünktlich würde beflissen erscheinen. Gelassen und professionell, genau das würde ich sein. Ein bisschen distanziert. Ein bisschen zu spät kommen gehörte dazu. Nur war er jetzt derjenige, der sich verspätete.
An der Bar bestellte ich meinen üblichen Drink für schwierige Situationen und hievte mich auf einen leeren Barhocker. Während ich an der farblosen Flüssigkeit nippte, konnte ich mich im Spiegel hinter der Bar sehen. Ich war direkt von der Arbeit gekommen. Irgendwie hatte ich der Versuchung widerstanden, früher zu gehen und zwei Stunden mit Duschen, Haareföhnen, Schminken und Klamottenaussuchen zu verbringen. Ich war fest entschlossen, mich für Mark Joesbury nicht hübsch zu machen.
Jetzt holte ich meinen Laptop aus meiner Tasche und stellte ihn auf die Bar – nicht weil ich vorhatte, tatsächlich zu arbeiten, nur damit es so aussah. Ich öffnete eine PowerPoint-Präsentation über die Pornografie-Gesetze Großbritanniens, die ich nächste Woche vor einer Gruppe Berufsanfänger in Hendon halten sollte. Aufs Geratewohl klickte ich eine Folie an – den Criminal Justice and Immigration Act. Die jungen Kollegen würden überrascht sein, dass der Besitz von Pornografie ohne Beteiligung von Kindern lange Zeit vollkommen legal gewesen war. Erst 2008 wurden extreme pornografische Darstellungen gesetzlich verboten. Das überraschte jeden. Natürlich würden sie wissen wollen, was als extrem galt. Das stand wiederum auf der Folie, die ich gerade betrachtete.
Eine extreme pornografische Darstellung zeigt eine sexuelle Handlung, die:
das Leben eines Menschen bedroht oder zu bedrohen scheint,zu schweren Verletzungen der Geschlechtsorgane führt,an einem menschlichen Leichnam vollzogen wirdan einem Tier vollzogen wird.Ich korrigierte einen Rechtschreibfehler und fügte einen Punkt ein.
Joesbury war immer noch nicht aufgetaucht. Nicht dass ich mich umgesehen hätte. Ich würde es wissen, sobald er durch die Tür kam.
Vierundzwanzig Stunden zuvor hatte ich auf der Polizeiwache von Southwark eine Fünf-Minuten-Besprechung mit meinem Vorgesetzten gehabt. Das SCD10 – kurz für Special Crimes Directorate der Polizei von London, das für verdeckte Ermittlungen zuständig ist, im Polizeijargon aber immer noch SO10 heißt – hatte meine Hilfe bei einem Fall angefordert. Nicht einfach nur irgendeine junge Zivilbeamtin, sondern spezifisch mich, und der leitende Ermittlungsbeamte bei diesem Fall, DI Mark Joesbury, wollte sich am folgenden Abend mit mir treffen. »Was denn für ein Fall?«, hatte ich gefragt. DI Joesbury würde mir alles erklären, sagte man mir. Mein Boss war schmallippig und mürrisch gewesen, wahrscheinlich weil man ihm seine Mitarbeiter abzog, ohne ihm zu sagen, warum.
Wieder schaute ich auf die Uhr. Er war mittlerweile dreiundzwanzig Minuten zu spät dran, mein Drink ging zu schnell zur Neige, und bei dreißig würde ich nach Hause gehen.
Ich wusste nicht einmal mehr, wie er aussah, ging mir plötzlich auf. Oh, ich hatte eine vage Vorstellung von Größe, Körperbau, Haar- und Augenfarbe, und ich erinnerte mich an diese türkisblauen Augen, doch ich konnte kein Bild von seinem Gesicht heraufbeschwören. Was wirklich seltsam war, wenn man bedachte, dass ich ihn ständig im Kopf hatte, jede Sekunde.
»Lacey Flint, so wahr ich hier stehe«, sagte eine Stimme direkt hinter mir.
Ich atmete tief durch, drehte mich langsam um und erblickte Mark Joesbury, gut eins achtzig groß, kräftig gebaut, sogar im Januar sonnengebräunt, leuchtend türkisblaue Augen. Mit einer wuscheligen rotblonden Perücke.
»Ich ermittle verdeckt«, verkündete er. Und dann zwinkerte er mir zu.
2
Der Behindertenparkplatz vor Dr. Evi Olivers Haus war zur Abwechslung frei. Trotz des gut sichtbaren »Privatparkplatz«-Schildes an der alten Ziegelmauer war es vor allem an Wochenenden nichts Ungewöhnliches für Evi, nach Hause zu kommen und festzustellen, dass ein Tourist mit kaputtem Bein ihn in Beschlag genommen hatte. Heute Abend hatte sie Glück.
Sie wappnete sich gegen den unvermeidlichen Schmerz und stieg aus dem Wagen. Ihre Medikamente waren eine halbe Stunde überfällig, und sie wirkten einfach nicht mehr so gegen die Schmerzen wie früher. Sie klappte ihren Gehstock auseinander, klemmte ihn unter den linken Arm und holte, nunmehr etwas standfester, ihre Aktentasche aus dem Auto. Wie üblich war sie danach ein wenig außer Atem. Wie üblich half es nicht, dass sie ganz allein im Dunkeln stand.
Obwohl sie so schnell wie möglich hineinwollte, zwang Evi sich dazu, einen Moment stehen zu bleiben, um sich umzuschauen und zu lauschen. Das Haus, in dem sie seit fünfeinhalb Monaten wohnte, stand am Ende einer Sackgasse, war von ummauerten Collegegärten umgeben und lag am Ufer des Flusses Cam. Dies war wahrscheinlich eine der ruhigsten Straßen von Cambridge.
Es war niemand zu sehen, und nichts war zu hören außer den Autos auf der nächsten Straße und dem Wind in den nahen Bäumen.
Es war spät. Neun Uhr abends an einem Freitag, und es war einfach nicht möglich gewesen, noch länger zu arbeiten. Ihre neuen Kollegen hatten sie bereits als trübsinnige, halb verkrüppelte und vor der Zeit gealterte Jungfer abgeschrieben, die kein Privatleben hatte. Damit hatten sie nicht ganz unrecht. Doch was Evi wirklich an ihrem Schreibtisch hielt, bis der Sicherheitsdienst das Gebäude abschloss, war nicht die Leere im Rest ihres Lebens. Es war Angst.
3
Ich war mir des einen oder anderen Gekichers bewusst, auch etlicher neugieriger Blicke. Entfernt hörte ich, wie Joesbury dem Typ hinter der Bar sagte, er hätte gern ein Bier und die Lady hätte gern noch mal dasselbe. Als ich endlich wieder zu Atem gekommen war und mir die Augen gewischt hatte, sah Joesbury mich ziemlich verdattert an.
»Ich glaube, ich habe Sie noch nie lachen sehen«, bemerkte er. Mit leisem Kopfschütteln, als wäre ich hier die Verrückte, sah er zu, wie der Barkeeper meinen Drink einschenkte. Bombay Sapphire auf viel Eis in einem hohen Glas. Er schob ihn mir hin, die Augenbrauen hochgezogen.
»Sie trinken Gin pur?«, fragte er.
»Nein, ich trinke ihn mit Eis und Zitrone«, gab ich zurück, während mir klar wurde, dass der Mann hinter der Bar und einige andere in der Nähe uns beobachteten.
»Was zum Teufel ziehen Sie hier eigentlich ab?«, fragte ich ihn. »Haben Sie vor, das Ding da den ganzen Abend aufzubehalten?«
»Nö, da juckt der Kopf so drunter.« Er nahm die Perücke ab, ließ sie auf die Bar fallen und griff nach seinem Glas. Das entsorgte Haarteil lag vor ihm wie ein totgefahrenes Tier, während er sich hinterm linken Ohr kratzte. »Ich kann’s ja später wieder aufsetzen«, fügte er hinzu. »Wenn Sie wollen.«
Sein Haar war länger geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, es reichte hinten gerade eben bis zum Kragen. Es war von einem dunkleren Braun, als ich es in Erinnerung hatte, mit einer ganz leichten Welle darin. Die längeren Haare standen ihm gut, ließen die Umrisse seines Schädels weicher und seine Wangenknochen markanter erscheinen; er sah unendlich viel attraktiver aus. In dem gedämpften Licht der Bar war die Narbe um sein rechtes Auge kaum zu sehen. Meine Kiefermuskeln schmerzten. Ich hatte ihn die ganze Zeit angelächelt.
»Und ich frage noch mal, was ziehen Sie hier ab?« Wenn ich mich unwirsch anhörte, würde er vielleicht nicht merken, wie wahnsinnig ich mich freute, ihn zu sehen. »Sollten Sie nicht eigentlich Mr. Unauffällig sein?«
»Ich dachte, damit breche ich vielleicht das Eis«, erwiderte er und wischte sich Bierschaum von der Oberlippe. »Als ich Sie das letzte Mal gesehen habe, war die Situation etwas angespannt.«
Damals war er drauf und dran gewesen zu verbluten. Ich übrigens auch. »Etwas angespannt« beschrieb es wohl ganz gut.
»Wie geht es Ihnen?«, erkundigte ich mich, obwohl ich das eigentlich recht gut wusste. Die letzten paar Monate hatte ich gemeinsame Bekannte schamlos um Neuigkeiten angebaggert. Ich wusste, dass der Schuss, den er in jener Nacht abbekommen hatte, einen ordentlichen Batzen Lungengewebe zerfetzt hatte, den die Chirurgen und der Lauf der Zeit hatten reparieren können. Ich wusste, dass er vier Wochen im Krankenhaus gelegen hatte und noch die nächsten drei Monate als eingeschränkt diensttauglich galt.
»Den London Marathon lasse ich dieses Jahr vielleicht aus«, sagte er, streckte eine Hand aus und griff nach meiner. Prompt begannen in meinem Bauch straff gespannte Gitarrensaiten zu klingen. »Sonst ist alles bestens.« Er drehte mein Handgelenk herum, um die Unterseite zu betrachten, und schaute einen Moment auf das dicke Pflaster, das ich immer noch trug, mehr weil ich die Narbe darunter nicht ansehen mochte, als weil sie abgedeckt werden musste. Nach drei Monaten war sie so gut verheilt, wie es nur ging. Und das würde niemals genug sein.
»Ich dachte ja, Sie kommen mal vorbei und besuchen mich«, fuhr er fort. »Diese Krankenhausnachthemden sind echt sexy.«
»Ich hab einen Teddy geschickt«, erwiderte ich. »Ist wohl in der Post verloren gegangen.«
Wir wussten beide, dass ich log. Was ich ihm nie erzählen würde, war, dass ich fast eine Stunde damit verbracht hatte, mir auf der Website von Steiff genau den Teddy auszusuchen, den ich geschickt hätte, wenn so etwas möglich gewesen wäre. Der, für den ich mich schließlich entschied, war dem, den er mir einmal geschenkt hatte, ganz ähnlich, nur größer und frecher. Als ich das letzte Mal nachgeschaut hatte, war er als nicht lieferbar gekennzeichnet gewesen. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Jetzt betrachtete er mein Gesicht, genauer gesagt meine neu modellierte Nase. Vor einem Monat war sie nach einem Bruch neu gerichtet worden, und die postoperativen Blutergüsse waren gerade erst verblasst.
»Nicht schlecht«, bemerkte er. »Kleines bisschen länger als vorher?«
»Ich dachte, so sehe ich intellektuell aus.«
Er hielt noch immer mein Handgelenk, und ich machte keine Anstalten, es wegzuziehen. »Ich habe gehört, man hat Sie auf Pornografie angesetzt«, meinte er. »Macht’s Spaß?«
»Die lassen mich recherchieren und Präsentationen abliefern«, schnappte ich, denn ich mag es nicht, wenn Männer sich auch nur ansatzweise scherzhaft über Pornografie auslassen. »Anscheinend glauben sie, ich bin gut, wenn’s um Details geht.«
Joesbury ließ mich los, und ich konnte sehen, wie seine Stimmung umschlug. Er wandte sich ab, und sein Blick fiel auf einen Tisch am Fenster.
»Also, jetzt wo die Nettigkeiten ausgetauscht wären, sollten wir uns hinsetzen.« Ohne meine Zustimmung abzuwarten, klemmte er sich die Perücke unter den Arm, nahm beide Drinks und bahnte sich einen Weg durch die Bar. Ich folgte ihm und redete mir ein, dass ich kein Recht hatte, enttäuscht zu sein. Das hier war kein Date.
Joesbury hatte einen Rucksack dabei. Er zog eine dünne braune Akte daraus hervor und legte sie ungeöffnet zwischen uns auf den Tisch.
»Ich habe die Genehmigung Ihrer Vorgesetzten in Southwark, Ihre Mithilfe für einen Fall anzufordern«, sagte er und hätte jeder x-beliebige ranghöhere Beamte sein können, der irgendeinen x-beliebigen Untergebenen einweist. »Wir brauchen eine Frau. Jemand, der als höchstens Anfang zwanzig durchgehen kann. In der Abteilung ist niemand verfügbar. Da hab ich an Sie gedacht.«
»Ich bin tief gerührt«, spielte ich auf Zeit. Bei Fällen, die ans SO10 verwiesen wurden, gehörte es dazu, dass Polizeibeamte undercover in schwierige und gefährliche Situationen eingeschleust wurden. Ich war mir nicht sicher, ob ich schon wieder für so etwas bereit war.
»Machen Sie Ihre Sache gut, und es wird in Ihrer Akte prima aussehen.«
»Umgekehrt natürlich auch.«
Joesbury lächelte. »Ich habe Befehl, Ihnen zu sagen, dass es ganz allein Ihre Entscheidung ist«, sagte er. »Des Weiteren bin ich von Dana angewiesen worden, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass ich ein verantwortungsloser Idiot bin, dass es nach dieser Ripper-Geschichte noch viel zu früh ist, auch nur daran zu denken, Sie auf so einen Fall anzusetzen, und dass Sie mir sagen sollen, ich soll mich zum Teufel scheren.«
»Grüßen Sie sie von mir«, erwiderte ich. Dana war DI Dana Tulloch, die das Ermittlungsteam geleitet hatte, das ich letzten Herbst unterstützt hatte. Außerdem war sie Joesburys beste Freundin. Ich mochte Dana, doch ich konnte nicht anders, ich nahm ihr ihre Nähe zu Joesbury übel.
»Andererseits«, sagte er gerade, »sind wir eigentlich weitestgehend durch Dana auf den Fall aufmerksam geworden. Sie ist auf inoffizieller Ebene von einer alten Studienfreundin kontaktiert worden, die jetzt Leiterin der Studentenberatung an der Cambridge University ist.«
»Was ist das für ein Fall?«, wollte ich wissen.
Joesbury öffnete die Akte. »Sie haben doch einen guten Magen?« Ich nickte, obwohl mein Magen in letzter Zeit nicht gerade auf die Probe gestellt worden war. Er zog einen kleinen Stapel Fotos aus der Akte und schob sie hin. Ich warf einen kurzen Blick auf das oberste und musste einen Moment lang die Augen schließen. Manche Dinge sollte man wirklich lieber niemals zu Gesicht bekommen.
4
Evi ließ den Blick an der Ziegelmauer entlangwandern, die ihren Garten umgab, über die Gebäude in der Nähe, in dunkle Bereiche unter Bäumen, und fragte sich, ob die Angst wohl den Rest ihres Lebens überschatten würde.
Angst vor dem Alleinsein. Angst vor Schatten, die sich zu fester Substanz verdichteten. Vor geflüsterten Worten, die aus der Dunkelheit gehuscht kamen. Vor einem schönen Gesicht, das nicht mehr war als eine Maske. Angst vor den wenigen kurzen Schritten zwischen der sicheren Zuflucht ihres Autos und ihrem Haus.
Irgendwann musste es ja doch sein. Sie schloss den Wagen ab und machte sich auf den Weg zu ihrem Gartentor. Das schmiedeeiserne Gittertor war alt, aber es war neu eingehängt worden, so dass es auf eine leichte Berührung hin aufschwingen würde.
Der Ostwind von den Marschen blies an diesen Abend kräftig, und die Blätter der beiden Lorbeerbäume raschelten gegeneinander wie altes Papier. Sogar die winzigen Blätter der Buchsbaumhecke führten kleine Tänze auf. Lavendelbüsche säumten den Weg auf beiden Seiten. Im Juni würde der Duft sie zu Hause willkommen heißen wie ein Lächeln auf dem Gesicht eines geliebten Menschen. Jetzt waren die ungekürzten Stängel kahl.
Das Queen-Anne-Haus, vor fast dreihundert Jahren für den Schulmeister eines der älteren Colleges von Cambridge erbaut, war das Letzte gewesen, was Evi als Domizil erwartet hätte, als sie ihre neue Stelle angenommen hatte. Es war ein großes Haus aus warmen, sanft roten Backsteinen mit Verzierungen aus hellem Sandstein, eines der prestigeträchtigsten in der Schenkung der Universität. Sein vorheriger Bewohner, ein international renommierter Physikprofessor, der zweimal nur knapp an einem Nobelpreis vorbeigeschrammt war, hatte fast dreißig Jahre darin gewohnt. Nachdem Meningitis seine unteren Extremitäten gelähmt hatte, hatte die Universität das Haus behindertengerecht umgebaut.
Der Professor war vor neun Monaten gestorben, und als man Evi die Stelle als Leiterin des psychologischen Studentenbetreuungsdienstes angeboten hatte, hatte die Universität eine Chance gesehen, einen Teil ihrer Investition wieder hereinzuholen.
Der Gartenweg aus Steinplatten war kurz. Nur fünf Meter mitten durch den Vorgarten, und sie hätte die kunstvoll verzierte vordere Veranda erreicht. Laternen zu beiden Seiten der Haustür beleuchteten den Weg in seiner ganzen Länge. Normalerweise war sie froh darüber. Heute war sie sich da nicht so sicher.
Denn ohne die Lampen hätte sie wahrscheinlich die Spur aus Tannenzapfen nicht gesehen, die vom Gartentor zur Haustür führte.
5
»Was Sie hier sehen, ist Bryony Carter«, erklärte Joesbury mir. »Neunzehn Jahre alt. Medizinstudentin im zweiten Semester.«
»Was ist passiert?«
»Sie hat sich angezündet«, antwortete er. »An dem Abend, an dem in ihrem College der Weihnachtsball stattgefunden hat, vor ein paar Wochen. Vielleicht war sie sauer, weil sie nicht eingeladen war, aber das Dinner war schon fast zu Ende, als sie reingetaumelt kam wie eine menschliche Fackel.«
Ich riskierte einen schnellen Blick auf die in Flammen gehüllte Gestalt. »Schlimm«, meinte ich. Das schien nicht auszureichen. Von eigener Hand zu sterben war eine Sache, dafür den Feuertod zu wählen, etwas ganz anderes. »Und die Leute haben gesehen, wie das passiert ist?«
Joesbury nickte einmal knapp. »Nicht nur das, ein paar haben mit ihren iPhones Fotos gemacht. Kids, total daneben!«
Ich begann, den Rest der Fotos durchzusehen. Das brennende Mädchen hatte den Kopf zurückgeworfen, und es war nicht möglich, sein Gesicht zu sehen. Das war etwas, wofür man dankbar sein konnte. Schlimmer waren die undeutlichen Umrisse, die durch die Flammen hindurch sichtbar waren und aussahen wie Fleischklumpen, die von ihrem Körper abschmolzen. Ihre linke Hand, der Kamera entgegengestreckt, war schwarz verkohlt. Sie sah mehr aus wie eine Hühnerklaue als etwas, das man an einem menschlichen Körper vorfinden könnte.
Auf dem fünften Foto in dem Stapel lag das Mädchen am Boden. Ein langhaariger Mann in einem Dinnerjackett stand mit schockiertem Gesichtsausdruck dicht neben ihm, einen Feuerlöscher in den Armen. Daneben war ein umgekippter Eiskübel. Eine junge Frau in einem blauen Kleid hielt einen Wasserkrug in der einen Hand.
»Sie war zu dem Zeitpunkt ziemlich high. Irgend so eine neumodische halluzinogene Droge«, berichtete Joesbury. »Man kann nur hoffen, dass sie nicht viel von dem mitgekriegt hat, was passiert ist.«
»Und was hat das mit dem SO10 zu tun?«, fragte ich.
»Das war meine erste Frage«, erwiderte er. »Die Kollegen von der zuständigen Kriminalpolizei machen sich keine übermäßigen Gedanken deswegen. Die haben den klassischen Drei-Punkte-Check gemacht, um einen Selbstmord festzustellen, und nichts gefunden, was auf irgendetwas Schlimmes hinweist.«
Ich gestattete mir einen Moment für die stumme Frage, was wohl schlimmer sein sollte, als sich selbst in Brand zu stecken. »Damit kenne ich mich nicht aus«, sagte ich. »Was Sie da gerade über diese drei Punkte gesagt haben.«
»Mittel, Motiv, Absicht«, antwortete Joesbury. »Zuerst überprüft man bei einem möglichen Suizid, ob das, was den Tod herbeigeführt hat, zur Hand war. Eine Pistole gleich neben der Schusshand, eine Schlinge um den Hals und irgendwas zum Draufsteigen, so was in der Art. In Bryonys Fall wurde der Benzinkanister draußen vor dem Saal gefunden. Und der Ermittlungsbeamte hat eine Quittung dafür in ihrem Zimmer gefunden. Außerdem hat er Spuren der Droge gefunden, mit der sie sich Mut angekifft hat.«
Irgendjemand beugte sich herüber, um ein leeres Glas auf dem Tisch abzustellen, und erblickte die Fotos. Ohne aufzuschauen schob ich die Bilder unter die Akte.
»Der nächste Punkt ist das Motiv«, dozierte Joesbury weiter. »Bryony war schon seit einiger Zeit depressiv. Sie war ein kluges Mädchen, aber sie hatte Mühe, ihr Studium zu bewältigen. Hat geklagt, dass sie nie schlafen könnte.«
»Und was ist mit Absicht?«
Joesbury nickte. »Sie hat eine Nachricht an ihre Mutter hinterlassen. Kurz und sehr traurig, hab ich gehört. Der Bericht des Kollegen, der als Erster am Ort des Geschehens war, ist in der Akte. Auch der der Spurensicherung, die das Zimmer des Mädchens unter die Lupe genommen hat«, fuhr er fort. »Keinerlei Anhaltspunkte für eine Inszenierung.«
Inszenierung bezieht sich auf Tricks, die Mörder manchmal anwenden, um ihre Tat wie Selbstmord aussehen zu lassen. Eine Pistole neben die Hand eines Opfers zu legen wäre ein klassisches Beispiel. Das Fehlen der Fingerabdrücke des Opfers auf der Waffe würde auf eine Inszenierung hindeuten.
»Und ein paar hundert Leute haben gesehen, wie sie es getan hat«, setzte ich hinzu.
»Auf jeden Fall haben sie sie in Flammen stehen sehen«, meinte Joesbury. »Und das ist der dritte Suizid an der Uni in diesem Studienjahr. Sagt Ihnen der Name Jackie King etwas?«
Ich dachte kurz nach und schüttelte den Kopf.
»Hat sich im November das Leben genommen. Wurde in ein paar überregionalen Zeitungen erwähnt.«
»Das muss ich übersehen haben.« Seit dem Fall, den wir beide bearbeitet hatten, hatte ich Zeitungen und die Nachrichten mit voller Absicht gemieden. Ich würde mich nie wohl dabei fühlen, meinen eigenen Namen im Rampenlicht zu sehen. Und immer wieder daran erinnert werden, was das Team alles durchgemacht hatte, war, wie Therapeuten sagen würden, dem Heilungsprozess nicht gerade förderlich.
»Ich kapier’s immer noch nicht«, sagte ich. »Wieso interessiert sich das SO10 für einen College-Selbstmord?«
Joesbury zog eine zweite Akte aus seinem Rucksack. Ihn zu bitten, sie nicht aufzuschlagen, schien keine Option zu sein, also saß ich da und wartete ab, während er einen weiteren Stapel Fotos daraus hervorzog. Nicht dass mehr als eins wirklich notwendig gewesen wären; ich erkannte schon auf dem obersten eindeutig, worum es ging. Eine junge Frau, offenkundig tot, mit nassem Haar und nassen Kleidern. Und einem fest um beide Fußknöchel geschnürten Strick.
»Das war ein Selbstmord?«
»Anscheinend schon«, erwiderte Joesbury. »Auf jeden Fall gibt es keine erkennbaren Beweise für etwas anderes. Das hier war Jackie zu besseren Zeiten.«
Joesbury hatte das letzte Foto aus dem Stapel nach ganz oben gelegt. Jackie King sah aus wie jemand, der gern an der frischen Luft ist. Sie trug ein Segler-Sweatshirt und hatte langes helles Haar, glatt und glänzend. Jung, gesund, klug und attraktiv, bestimmt hatte sie doch jede Menge gehabt, wofür es sich zu leben lohnte.
»Das arme Mädchen«, sagte ich und wartete darauf, dass er weitersprach.
»Drei Suizide in diesem Jahr, drei im letzten, vier in dem davor«, zählte er auf. »Cambridge entwickelt langsam eine echt ungesunde Bilanz in Sachen junge Leute, die sich das Leben nehmen.«
6
Evi blieb stehen und versuchte, den Wind mit reiner Willenskraft dazu zu zwingen nachzulassen, damit sie das hämische Kichern hören konnte, das Füßescharren, das ihr verraten würde, dass jemand sie beobachtete. Denn es musste sie ja jemand beobachten. Diese Tannenzapfen konnten unmöglich vom Wind auf den Weg geweht worden sein. Es waren insgesamt zwölf Stück, jeder genau in der Mitte einer Steinplatte; sie bildeten eine schnurgerade Linie bis zur Haustür.
Das war jetzt drei Abende hintereinander passiert. Gestern und vorgestern Abend hätte man es noch wegerklären können. Die Zapfen waren verstreut gewesen, als sie sie das erste Mal gesehen hatte, wie von einer Bö dorthin geweht. Gestern Abend hatten welche gleich hinter dem Gartentor auf einem Haufen gelegen. Das hier war viel zu geplant.
Wer konnte wissen, wie sehr sie Tannenzapfen verabscheute?
Sie drehte sich im Kreis, hielt mit dem Stock das Gleichgewicht. Der Wind war zu laut, um irgendetwas zu hören. Die Schatten waren zu zahlreich, um sicher zu sein, dass sie allein war. Sie sollte hineingehen. So schnell sie konnte, hastete sie den Weg hinauf zur Tür und trat ins Haus.
Ein weiterer Tannenzapfen, größer als die anderen, lag auf der Fußmatte.
Evi stellte ihren Rollstuhl für drinnen immer gleich neben der Tür ab. Ohne den Blick von dem Zapfen abzuwenden, drückte sie die Tür zu und setzte sich in den Stuhl. Eine alte, irrationale Furcht hatte sie gepackt, eine Furcht, die sie zur Kenntnis nahm, gegen die sie jedoch nichts unternehmen konnte. Sie stammte aus einer Zeit, als sie als pummelige Vierjährige einmal unter einem Baum einen großen Tannenzapfen aufgehoben hatte.
Sie war mit ihren Eltern im Urlaub in Norditalien gewesen. Die Tannen in dem Wald waren riesig gewesen, hatten bis zum Himmel gereicht, jedenfalls war es dem kleinen Mädchen so vorgekommen. Auch der Tannenzapfen war riesengroß, viel größer als ihre kleinen Hände. Sie hatte ihn aufgehoben, sich begeistert zu ihrer Mutter umgedreht und ein Kitzeln am linken Handgelenk gespürt.
Als sie nach unten geschaut hatte, waren ihre Hände und Unterarme von krabbelnden Insekten bedeckt gewesen. Sie wusste noch, dass sie aus vollem Hals gebrüllt hatte, und ihre Mutter oder ihr Vater hatten die Insekten weggewischt. Doch ein paar waren unter ihre Kleider geraten, und sie hatte sie ausziehen müssen, mitten im Wald. Jahre später hatte die Erinnerung an Entzücken, das sich in Abscheu verwandelte, immer noch die Macht, sie durcheinanderzubringen.
Niemand konnte das wissen. Selbst ihre Eltern hatten den Vorfall seit Jahrzehnten nicht mehr erwähnt.
Das hier war ein seltsamer Scherz, mehr nicht; wahrscheinlich hatte es gar nichts mit ihr zu tun. Vielleicht hatte ein Kind heute irgendwann hier gespielt, hatte die Zapfenspur gelegt und einen durch den Briefschlitz gesteckt. Evi rollte auf die Küche zu. Sie kam nur bis zur Tür.
Auf dem Küchentisch, den sie vor etlichen Stunden völlig leer zurückgelassen hatte, waren große Tannenzapfen zu einem Haufen aufgestapelt.
7
»Dass junge Menschen Selbstmord begehen, ist aber doch nichts wirklich Ungewöhnliches«, wandte ich ein und überlegte. »Die Selbstmordrate ist doch unter Studenten höher als beim Rest der Bevölkerung, oder? Gab’s da nicht mal einen Fall in Wales vor ein paar Jahren?«
»Sie denken an Bridgend«, sagte Joesbury. »Obwohl das rein technisch gesehen nichts mit Studenten zu tun hatte. Dass Suizide gehäuft auftreten, kommt vor. Aber es ist selten. Und Danas Freundin ist nicht die Einzige, die sich Gedanken macht. Die Universitätsleitung ist auch schon ganz nervös wegen dem Medieninteresse. Abgefahrene Selbstmorde in aller Öffentlichkeit, das sieht bei einer der besten Unis weltweit gar nicht gut aus.«
»Aber es gibt keine Anhaltspunkte für irgendwelche finsteren Machenschaften?«, erkundigte ich mich.
»Im Gegenteil. Sowohl Bryony als auch Jackie waren in psychiatrischer Behandlung«, erwiderte Joesbury. »Jackie früher mal, Bryony vor Kurzem.«
»Bryony war in Therapie?«
»Jawohl«, bestätigte Joesbury. »Nicht bei Danas Freundin, wie heißt sie doch gleich wieder …« Er zog einen Papierstapel aus der Akte und blätterte ihn durch. »Oliver«, verkündete er gleich darauf. »Dr. Evi Oliver … nicht bei ihr, sondern bei einem von ihren Kollegen. Da gibt es ein Therapeutenteam, das für die Uni zuständig ist, und Dr. Oliver leitet es.«
»Was ist mit dem anderen Mädchen?«, wollte ich wissen.
Joesbury nickte. »Jackie hatte laut ihren Freundinnen auch so ihre Probleme«, meinte er. »Genau wie der junge Mann, der sich in seiner dritten Woche im College erhängt hat.« Joesbury schielte rasch auf seine Unterlagen hinunter. »Jake Hammond«, sagte er. »Neunzehn Jahre, hat Englisch studiert.«
»Über wie viele Fälle reden wir hier eigentlich?«
»Neunzehn in fünf Jahren, Bryony Carter eingeschlossen«, antwortete Joesbury.
»Na ja, ich kann verstehen, warum die Behörden sich Sorgen machen«, bemerkte ich. »Aber mir ist nicht klar, wieso das SO10 eingeschaltet wird.«
Joesbury lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er sah dünner aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. An Brust und Schultern hatte er Muskeln eingebüßt. »Ein Netzwerk aus alten Freundinnen«, meinte er. »Dr. Oliver meldete sich bei ihrer alten Kommilitonin Dana, die sich wiederum mit ihrer früheren Ausbilderin bei der Polizei in Verbindung setzte, ebenfalls eine ehemalige Cambridge-Studentin.«
»Die da wäre?«
»Sonia Hammond.«
Joesbury wartete darauf, dass der Name mir etwas sagte. Tat er nicht.
»Commander Sonia Hammond«, half er nach. »Gegenwärtig Leiterin der Abteilung für verdeckte Ermittlungen bei Scotland Yard.«
Ich begriff. »Ihr Boss«, stellte ich fest. »Ich wusste gar nicht, dass Sie einer Frau unterstehen.«
Joesbury zog eine Augenbraue empor. Ich hatte ganz vergessen, dass er das konnte. »Mein Lebensschicksal«, sagte er. »Commander Hammond hat eine Tochter, die in Cambridge studiert, sie hat also besonderes Interesse an diesem Fall.«
»Trotzdem«, wandte ich ein. »Was in aller Welt glauben die denn, was eine Undercover-Operation in der City of Dreaming Spires bringen soll?«
»Ich glaube, das mit den träumenden Kirchtürmen ist Oxford«, erwiderte Joesbury. »Dr. Oliver hat da so eine Theorie, dass diese Selbstmorde nicht zufällig passieren. Sie glaubt, dass hier irgendwelche ausgesprochen finsteren Machenschaften im Gange sind.«
8
Nachdem Evi sich bei der jungen Polizistin bedankt hatte, schloss sie die Haustür ab und verriegelte sie. Sie war noch immer verstörter, als sie zugeben wollte. Die Polizistin war höflich gewesen, hatte das Haus gründlich durchsucht und betont, dass Evi sofort anrufen solle, wenn noch irgendetwas passierte. Abgesehen davon jedoch hatte sie nicht vor, mehr zu unternehmen, als einen Bericht zu schreiben. Es lägen keinerlei Hinweise auf einen Einbruch vor, hatte sie erklärt, und Tannenzapfen waren wohl kaum etwas Bedrohliches.
Die Frau hatte natürlich nicht unrecht. Evi war nicht die Einzige, die Schlüssel zu dem Haus besaß. Die Reinigungsfirma kam jeden Dienstag. Das Gebäude gehörte der Universität, und es war durchaus möglich, dass die Verwaltung kurzfristig etwas hatte reparieren lassen. Wieso von einem Wartungsteam Tannenzapfen ins Haus eingeschleppt worden sein sollten, war eine andere Frage, doch das war nichts, worüber eine junge Beamtin sich lange den Kopf zerbrechen würde.
Evi ging durch die Küche und füllte den Wasserkessel. Sie hatte ihn gerade eingeschaltet, als etwas am Küchenfenster kratzte. Sie fuhr so heftig auf, dass sie beinahe hinfiel.
»Nur der Baum«, sagte sie sich, während ihr klar wurde, dass sie ihre Schmerzmittel immer noch nicht genommen hatte. »Nur wieder dieser verflixte Baum.«
Evis Küche ging auf den ummauerten Garten hinter dem Haus hinaus, der bis zum Flussufer hinunterreichte. Eine gewaltige Zeder wuchs gleich hinter dem Haus, und die unteren Äste hatten die Angewohnheit, bei starkem Wind an den Fenstern im Erdgeschoss zu kratzen.
Evi nahm ihre Schmerztabletten, wartete ein paar Minuten darauf, dass sie zu wirken begannen, und aß dann so viel, wie sie schaffte. Sie räumte das Geschirr weg, rollte ins Schlafzimmer und hielt nur kurz inne, um den Tannenzapfen von der Fußmatte aufzuheben. Ohne auch nur zu schaudern, schob sie ihn wieder durch den Briefschlitz. Die aus der Küche lagen draußen in der Mülltonne.
Sie drehte die Wasserhähne im Bad auf und fing an, sich auszuziehen. Auf ihrem Nachttisch lag ein geöffneter Brief. Er war vor ein paar Tagen gekommen, in einem dicken gepolsterten Umschlag. Sie hatte den Umschlag über dem Bett ausgeschüttelt und zugesehen, wie Muscheln, Kieselsteine, getrockneter Seetang und schließlich ein Schnappschuss von einer Familie herausgefallen waren. Das Foto lag mit der Bildseite nach oben auf dem Tisch. Mum, Dad, kleine Kinder. Letztes Jahr waren sie Patienten von ihr gewesen und dann zu Freunden geworden. Gerade hatten sie einen halb verfallenen Bungalow an der Küstenstraße von Lytham St. Annes in Lancashire gekauft, und im Frühjahr, hatte die Mutter geschrieben, hatten sie vor, ihn abzureißen und sich ihr neues Traumhaus zu bauen. Es würde ihr zweiter Versuch sein; der erste hatte nicht besonders gut geklappt. Evi könne sie gern jederzeit besuchen, beteuerte der Brief. Harry war nicht erwähnt worden.
Obwohl sie genau wusste, dass sie das nicht tun sollte, zog Evi die Nachttischschublade auf und zog einen Zeitungsartikel hervor, den sie in einem Internetarchiv gefunden hatte. Sie machte sich nicht die Mühe, den Text zu lesen, den kannte sie auswendig. Sie musste bloß sein Gesicht sehen.
Bestimmt lief die Wanne allmählich voll. Nur noch eine Sekunde das Haar betrachten, dessen Farbe irgendwo zwischen Rötlichblond und Honigbraun lag, die hellbraunen Augen, den kantigen Unterkiefer und die Lippen, die sich anscheinend immer zu einem Lächeln verzogen, selbst wenn er versuchte, ernst auszusehen, wie auf dem Bild. Nur noch eine Sekunde, um sich zu fragen, wann die guten Tage – die, an denen sie ihn wie alte Erinnerungen in ihren Gedanken ganz nach hinten drängen konnte – zahlreicher sein würden als die schlechten. An denen war er so präsent, dass sie fast den Zitronen- und Ingwergeruch seiner Haut riechen konnte. Nur noch eine Sekunde, um sich zu fragen, wann der Schmerz wohl vergehen würde.
Als das Wasser allmählich kalt wurde, war Evi fast eingeschlafen. Sie drückte auf den Knopf des Wannenlifts, der sie aus dem Bad heben würde. Es gelang ihr, lange genug ohne Hilfe zu stehen, um sich abzutrocknen und einzucremen. Du hast so weiche Haut, hatte er ihr einmal zugeflüstert. Als sie das Badezimmer verließ, hatte sie Tränen in den Augen und versuchte gar nicht erst, sich einzureden, es seien nur die Schmerzen, die in letzter Zeit abends so viel schlimmer waren, die sie zum Weinen brachten.
Sie hatte die Botschaft auf dem Badezimmerspiegel nicht gesehen, die erst durch den Dampf des heißen Badewassers sichtbar geworden war.
Ich kann dich sehen, stand da.
9
»Inwiefern finster?«, fragte ich.
»Dr. Oliver glaubt, dass es da – und ich lese das jetzt wörtlich ab – eine subversive, den Suizid verherrlichende Subkultur gibt«, antwortete Joesbury. »Sie glaubt, diese jungen Leute stacheln sich gegenseitig auf, unterstützt von einem Online-Netzwerk.«
»Das haben die Leute über Bridgend auch gesagt«, gab ich zu bedenken.
»Ist immer sehr schwer nachzuweisen«, erwiderte Joesbury. »Aber es gibt dokumentierte Fälle von Suizidpakten, wo Menschen sich begegnen, normalerweise online, und beschließen, gemeinsam Schluss zu machen. Sie geben sich gegenseitig den Mut, das durchzuziehen.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!