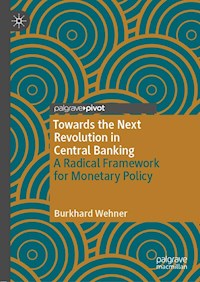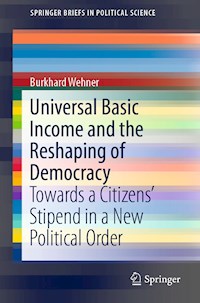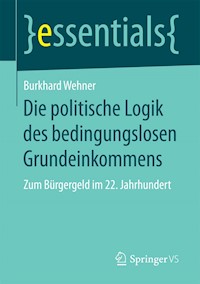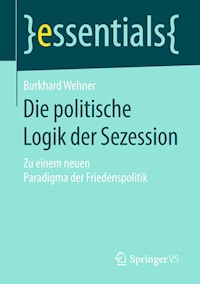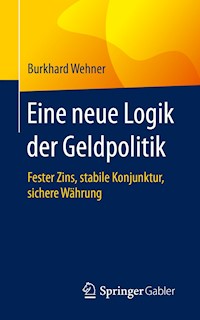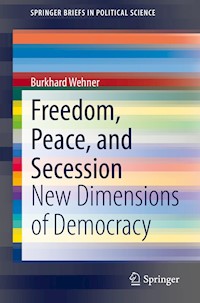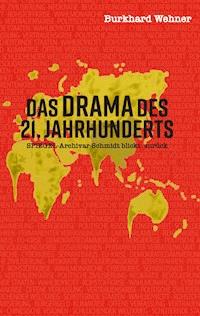
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
2077. Matthias Schmidt, früherer Archivleiter des SPIEGEL-Verlags, geboren kurz vor der Jahrtausendwende, erzählt die Geschichte seines Jahrhunderts. Schmidt zeichnet das Bild einer zutiefst verstörenden Epoche nach. Er schildert den dramatischen Wandel der politischen Problemstellungen in seiner Lebenszeit, und er fragt sich, ob das politische Bewusstsein mit dieser Entwicklung Schritt gehalten hat. Sein bitteres Fazit: Zumindest im so genannten Westen kann davon keine Rede sein. Die westliche Demokratie zeigt sich mit den Problemen des 21. Jahrhunderts systematisch überfordert. Die politischen Überzeugungen, die im frühen Jahrhundert noch scheinbar Orientierung gaben, sind weggebrochen, und die längst überfällige Öffnung für das neue politische Denken ist ausgeblieben. Allein in China flackerte Hoffnung auf grundlegende Erneuerung auf. In Schmidts Erzählung werden ein knappes Jahrhundert Weltgeschichte, Schmidts eigene Lebensgeschichte und die Geschichte des SPIEGEL miteinander verflochten. Schmidt skizziert zugleich ein Porträt seiner Generation, die auch für die nachfolgenden keinen Willen zur Erneuerung stiftete. Er weiß: Sein Jahrhundertporträt wird für die Lebenden eine Zumutung sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Vorgeschichten
Staatstheater
Generation Sichtflug
Das 20. Jahrhundert
2000 – 2024
Ein schleichender Weltkrieg und andere Krisen
Jahrhundertauftakt
Bewusstseinsstörung
Exkurs Wirtschaft
Russland und die Ukraine
Afrika
Die arabische Welt
Amerika
Israel und das historische Unrecht
China und Indien
Und Europa?
Noch einmal Wirtschaft
Zwischenstand
2025 – 2049
Hilflose Demokratie, Neues Denken
Parteienzuwachs
Was geht wie lange gut?
Dauerkonflikt um Staatsgrenzen
Flüchtlingsströme und territoriale Integrität
Kurze Begegnung
Scheidungsrecht für Staaten
Neues Denken in China
Partei wider Willen
Das digitale Hiroshima
Flächengewinne der Demokratie
Verblichenes Vorbild Europa
Das Elend des Parteienstaats
Hundertjahrfeiern
Sinnstiftungsversuche
Kleine Staatsreparaturen
2050 – 2074
Globale Erschöpfung
Mächtige Senioren
Neue Hoffnungsträger
Rentnerrevolution?
Das Yang-Konzept
Noch mehr Ideologiefreiheit
Die Krise der Archive
Abschied von Hauser
Ringen um Rohstoffe
Ölkartell: Die Bösen tun Gutes
Jahrhundertereignis Klimawandel
Kalter und heißer Cyberkrieg
Mit Milliardären aus der Systemkrise?
Chinesische Visionen
Noch einmal Euphorie
Yang, China und die Neokraten
Wie Constanze es sah
2075 – …
Ist das Jahrhundert noch zu retten?
Europas letzter Versuch
Altfall Griechenland
Deutsche Zustände
Denkwürdige Zusammenkunft
Kleine Neuerungen
Stillstände
Demokratiedämmerung
Epilog
Vorwort
Ein Buch über dieses Jahrhundert zu schreiben wäre mir allein nie in den Sinn gekommen. Ein Protokoll zu dem halben Jahrhundert zwischen 2025 und 2075, eine Zusammenstellung von Aufzeichnungen und Gedanken zu dieser kurzen Epoche, das immerhin hatte ich mir nach langem Zögern zugetraut, und daran hatte ich schließlich zu schreiben begonnen. Ich wollte es so beginnen lassen, wie es hier im Abschnitt über das zweite Jahrhundertquartal zu lesen ist:
Der Paukenschlag zum Auftakt des ersten Jahrhundertquartals war der Anschlag auf das World Trade Center gewesen, der Auslöser des Weltkriegs gegen den Terror, der ein Teil des schleichenden Dritten Weltkriegs war. Das zweite Jahrhundertquartal begann weniger aufsehenerregend. Nach der Jahrtausendwende war die Welt aus dem schönen Traum gerissen worden, mit der Vorherrschaft von Demokratie und Marktwirtschaft sei die Zeit ewigen Friedens und Wohlstands angebrochen. Dieser Traum war ausgeträumt, und die Erwartungen waren gedrückt.
Statt mit einem Paukenschlag begann das zweite Jahrhundertquartal mit einem lang anhaltenden Trommelwirbel, der die Krisen der Zeit wie in einem großen politischen Welttheater aneinanderreihte. Aber man täte diesem zweiten Jahrhundertquartal Unrecht, wenn man nicht auch anerkennte, dass die Demokratie in dieser Zeit ihre beste Phase erlebte. Es gab Ausnahmen, es gab China, es gab noch Nordkorea, es gab muslimische Gottesstaaten und Emirate, es gab gescheiterte Staaten ohne etablierte Staatsordnung, es gab noch einige wenige bekennende Autokratien, und fast überall steckte die politische Auseinandersetzung tief im populistischen Sumpf, aber immer weniger Staaten bekannten sich noch offen dazu, keine Demokratie im üblichen Sinne zu sein. Zumindest dem Schein nach orientierten sich mehr Staaten denn je am Beispiel westlicher Demokratien. Spätere Historiker dürften den Zenit der modernen Demokratie auf das frühe zweite Quartal des 21. Jahrhunderts datieren.
Keine der Krisen, die das erste Jahrhundertquartal geprägt hatten, war zu Beginn des zweiten Quartals wirklich gelöst, einige Konflikte waren mit militärischen und diplomatischen Mitteln vorerst eingefroren worden, aber fast alle schrieben sich in den Anfängen des zweiten Quartals neu in die Weltgeschichte ein.
Es waren dann andere – von denen hier noch die Rede sein wird –, die mich drängten, mich hier doch auch auf die davorliegenden Jahrzehnte einzulassen. Ich dürfe nicht so mit der Tür ins Haus fallen, war der Einwand, nicht mit Andeutungen und Gedanken, die für mich im Lauf der Zeit selbstverständlich geworden seien, für viele andere aber noch immer nicht. Ich solle mir also die Mühe machen, zumindest noch ein paar Seiten über das erste Jahrhundertviertel voranzustellen. Diesem Drängen gab ich am Ende nach.
Eine Geschichte des Jahrhunderts soll dies natürlich trotzdem nicht werden, nicht einmal in Ansätzen. Ich bin kein Historiker. Ich will weniger über die Ereignisse dieses Jahrhunderts schreiben als darüber, wie Menschen, wie Bürger und politische Akteure in diesem Jahrhundert gedacht haben. Ich weiß, auch das ist beinahe vermessen, wenigstens dann, wenn man dabei aus eigener Erinnerung schöpfen will. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis, und ich habe sogar ein eigenes kleines Archiv. Keines, wie ich es in meinem Berufsleben verwaltet habe, als Archivleiter des SPIEGEL, nur eines mit privaten Aufzeichnungen, die ich, Archivarseele, die ich nun einmal bin, akribisch verwahre. Wann ich wie und was als politischer Mensch gedacht habe, das finde ich wohlsortiert auch in meinen Dateien und Zettelkästen.
Schrankfüllend ist es nicht. Im Beruf musste ich detailbesessen sein, aber damit war meine Neigung zum Detail für dieses Leben beinahe erschöpft. Im sonstigen Leben wollte ich die Welt eher aus der Vogelperspektive betrachten, aber immer auch geerdet durch archivarisches Faktenwissen.
Menschen werden noch immer nicht alt genug, um ein Jahrhundert aus eigenem Erleben beschreiben zu können, aber ich bin immerhin in diesem Jahrhundert aufgewachsen und mit ihm ziemlich alt geworden. Ich könnte mit diesem Jahrhundertporträt noch warten, bis das Jahrhundertende näherkommt, aber zwei Gründe sprechen dagegen. Erstens weiß ich nicht, wie lange ich als mittlerweile Achtzigjähriger zu einer solchen Arbeit noch fähig wäre. Zweitens könnte dieses Jahrhundert tatsächlich schon reif für eine abschließende Betrachtung sein. Würde nämlich der Rest des Jahrhunderts die überfällige Zeitenwende bringen, würde dies den Rahmen dieses Textes ohnehin sprengen. Dann hätte der Rest seinen Platz – als dessen Vorspiel gewissermaßen – eher in einem Porträt des 22. Jahrhunderts. Oder aber das letzte Jahrhundertviertel wird – ich fürchte, so wird es kommen – für dieses Jahrhundertporträt wenig Neues bringen.
Dieses Jahrhundert hat natürlich auch mein eigenes politisches Bewusstsein geprägt, also bin ich Teil dessen, was ich hier beschreibe. Also muss ich mir auch darüber im Klaren sein, wie mein eigenes Denken sich in den Etappen dieses Jahrhunderts verändert hat. Das im Nachhinein zu verfolgen war fast ein Glückserlebnis. Ich weiß jetzt, dass ich nicht noch einmal so denken darf, wie ich in früheren Jahrhundertabschnitten gedacht habe, aber ich weiß natürlich auch, dass viel zu viele es immer noch tun.
Als früherer Archivar falle ich aus der Rolle, wenn ich so etwas schreibe. Von einem Archivar erwartet man Fakten, keine Meinung, kein Urteil, und diese Erwartung habe ich in meinem Arbeitsleben lange erfüllen wollen. Aber gerade weil man von mir keine Meinung erwartete, genoss ich die denkbar größte innere Meinungsfreiheit. Ich nehme das als ein Privileg.
Die schreibenden Kollegen haben dieses Privileg nicht. Nur wer meinungsstark schreibt, schreibt interessant, und interessant wirkt nur, was den Resonanzboden bestehender Vorurteile zum Schwingen bringt. Das bringt die schreibenden Kollegen immer wieder in Versuchung, sich Vorurteile zu eigen zu machen. Solcher Versuchung war ich nie ausgesetzt. Von einem Archivar erwartet niemand, dass er Vorurteile bedient. Das verleiht innere Freiheit, es hat allerdings auch seinen Preis: Wer keine Vorurteile hat, der findet selten Gleichgesinnte.
Aber das war bei mir natürlich nicht von Anfang an so, ich wurde schließlich nicht als Archivar geboren. Ich war achtundzwanzig, als ich in der Dokumentationsabteilung des SPIEGEL – ich nenne sie hier einfach SPIEGEL-Archiv – meine erste Stellung antrat, und natürlich hatte ich damals schon politische Meinungen und Urteile, und natürlich waren das großenteils Vorurteile. Ich könnte daher über die Zeit davor, über das 20. und das frühe 21. Jahrhundert, nicht so vorurteilsfrei schreiben, wie ich es möchte, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, im Archiv auf Hauser zu treffen, meinen Mentor, den großen Entzauberer von Vorurteilen. Aber darüber später.
Kollase, den 25.04.2077
PS: Dieser Text wird wohl überwiegend Leser finden, die nach der Jahrhundertmitte geboren sind. Trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass auch einige Ältere, vielleicht auch einige aus meiner Generation der um die Jahrtausendwende Geborenen, sich die Mühe des Lesens machen werden, auch wenn sie darin nur wenige eigene Meinungen bestätigt finden.
Wem täte es nicht gut, sich im hohen Alter doch noch einen Reim auf dieses ungereimte Jahrhundert zu machen?
Vorgeschichten
Staatstheater
Irgendwo las ich, dass man sich jung fühlen muss, um für junge Leute zu schreiben, und sich alt fühlen muss, um für Alte zu schreiben. Das gilt auch für das Schreiben einer Geschichte des 21. Jahrhunderts. Ich kann nicht so tun, als wäre ich noch jung, aber vielleicht hilft es, hier mit meiner Zeit als junger Mensch zu beginnen, auch wenn ich damals manchmal meinte, nicht ganz in meine Zeit zu passen.
Meine Erinnerung setzt mit der Nacht der Jahrtausendwende ein. Ich musste für ein Foto posieren: Mein Kindsgesicht todmüde vor einem vom Feuerwerk taghell erleuchteten Berliner Nachthimmel. Zum Glück war unten auf dem Foto das Brüstungsrohr unserer Dachterrasse zu sehen, sonst wären es wirklich nur der beleuchtete Himmel und ich gewesen. Unter dem Foto in der Handschrift meiner Mutter: Matthias und das neue Jahrtausend feiern Geburtstag. Ich, Matthias Schmidt, bin am 1. Januar 1996 geboren.
Es gibt andere peinliche Jugendfotos von mir, aber dieses war für mich eines der peinlichsten. Neujahrsgeborene gehen ohnehin mit einer Last ins Leben, nun war meiner Kindheitserinnerung noch dieses Jahrtausendwendespektakel aufgebürdet. Ich hätte das Foto später vernichten mögen, aber das habe ich – irgendwie bin ich eben doch ein Zauderer – immer wieder aufgeschoben, bis heute. Das Foto wird diese Welt wohl nach mir verlassen.
Vielleicht war es auch wegen dieses Fotos, dass ich mich später bei Feiern oft fragte, ob denn der Anlass der richtige sei. Man soll sich nicht zu früh freuen, das hatte ich mit der Zeit gelernt, aber dann gilt doch auch: Man soll nicht zu früh feiern. Wie kann man guten Gewissens eine Jahrtausendwende feiern, wenn man für das neue Jahrtausend neues Unheil fürchten muss? Ich weiß, dass die wenigsten Jungen sich mit solchen Gedanken befassen, aber die meisten Alten tun es leider auch nicht.
Später habe ich das Feiern dann etwas besser verstehen gelernt. Bei jungen Menschen feiert man in die Zukunft hinein: In einem Jahr bist du schon sooooo groß. Bei deinem nächsten Geburtstag bist du schon ein Schulkind. Nächstes Mal darfst du schon wählen. Nächstes Jahr hast du schon deinen Führerschein. Nächstes Jahr hast du schon dein Abitur. Nächstes Jahr studierst du schon.
Ganz anders bei alten Menschen. Sie feiern in die Vergangenheit hinein. Die späten runden Geburts- und Hochzeitstage und Jubiläen – keine Rede mehr von Herausforderungen, von Zielen und Plänen, von Zukunft überhaupt, höchstens noch ein trotziges: Auf weitere soundso viele Jahre. Ansonsten Erinnerungen, alte Geschichten, Erlebtes, Miterlebtes, Überstandenes, Geleistetes, einzelne Glücksmomente. Erlittenes? Schwamm drüber.
Ich weiß, von privatem Feiern soll hier am allerwenigsten die Rede sein, aber politische Feiern, Staatsfeiertage, haben damit Gemeinsamkeiten. All die Feiern von politischen Jahrestagen sind Feiern in die Vergangenheit hinein. Mein Vater war noch bei Feiern zu Jahrestagen der Oktoberrevolution dabei gewesen. Großes Staatstheater mit Blick in die Vergangenheit, so sagte es einmal mein Großvater. Natürlich wurde dabei auch kurz über Zukunft geredet, aber dafür versetzte man sich erst einmal weit in die Vergangenheit. So fühlte sich die Gegenwart wie eine strahlende Zukunft an, und die wirkliche Zukunft kam nur als Floskel vor.
Die Oktoberrevolution feiert niemand mehr, aber ist es mit dem Staatstheater unserer Zeit, unseres Jahrhunderts nicht ähnlich? All die Jahrestage von lange zurückliegenden Ereignissen, bei denen man sich in eine graue Vorzeit versetzt, um sich umso emphatischer zur Gegenwart zu gratulieren. Fühlen die meisten politischen Jahrestage, die wir heute feiern, sich nicht an wie diamantene Hochzeiten? Aber was gibt es in der Politik noch oder was könnte es geben, das man wie Kindergeburtstage, wie Geburtstage der Jugend feiern kann? Hat die Demokratie uns nicht alle, Alte wie Junge, schon politisch vergreisen lassen? In diesem Jahrhundert standen uns Hundertjahrfeiern – hundert Jahre deutsches Grundgesetz und anderes – bevor, die genau diesen Gedanken aufdrängten.
Generation Sichtflug
Politische Vergreisung – das sind fast schon wieder Gedanken eines alten Mannes. Wie war es, als ich achtzehn war? Ich versuche, an diese Zeit zu denken. Der Blick ging damals in die Zukunft, die naheliegende eigene vor allem. Was wollte ich werden? Was würde ich studieren? Ich ging die Sache damals ziemlich systematisch an und stellte mir all die gängigen Fragen. Welcher Beruf gäbe deinem Leben Sinn? An welchem hättest du Spaß? Wofür hättest du Talent? Was würde für Spannung sorgen? Was gäbe dir Sicherheit? Womit ließe sich gutes Geld verdienen? Und welches Studienfach wäre zu all dem der Schlüssel?
Vieles konnte ich vornherein ausschließen. Ich schaute in den Spiegel und wusste: Andere sehen besser aus, du gehörst nicht ins Rampenlicht. Ich hörte mir zu und wusste: Andere reden besser, flüssiger, überzeugender, also wirst du – Streitigkeiten anderer langweilen dich sowieso – kein Anwalt, auch kein Politiker. Und ich horchte in mich hinein und wusste: Andere sind durchsetzungsstärker, also wirst du kein Manager, kein Unternehmer. Technik interessiert dich nur mäßig, also wirst du kein Ingenieur. Naturwissenschaften hast du in der Schule gemieden, also wirst du kein Chemiker, kein Biologe, kein Physiker. Zeichnen können andere viel besser, also wirst du kein Künstler, kein Gestalter, kein Architekt. Du kannst kein Blut sehen, also wirst du kein Arzt. Du bist ungeduldig, also wirst du kein Lehrer.
Schließlich ging ich zur Berufsberatung. Der Rat war: Sie sind noch nicht reif, sich zu entscheiden, Sie brauchen eine Orientierungsphase, studieren sie erst mal was Allgemeinbildendes.
Was das denn sein könnte, fragte ich.
Schauen Sie sich mal bei den Geistes- und Sozialwissenschaften um, war die Antwort.
Ich durchforstete die Websites der Universitäten. Von den mehr als 200 Studiengängen – tausende spezialisierte Unterstudiengänge nicht mitgezählt – schloss ich zwei Drittel sofort aus, mehr als 60 allgemeinbildende blieben übrig. Viele mit klingenden Namen, sehr viele, von denen ich nie gehört hatte, viele, unter denen ich mir nichts vorstellen konnte. Studiengangerfinder, dachte ich, das wäre mein Beruf. Ich war in einem schwierigen Alter.
Ich schob die Entscheidung vor mir her. Ein guter Freund wollte Medizin in Halle studieren, also entschied auch ich mich erst einmal für Halle. Welche anderen Gründe sprachen dafür? Ich erinnere mich an keine, an Gründe, die dagegen sprachen, schon eher. Mein Freund entschied sich dann doch für München. Für mich zu spät, ich blieb bei Halle.
Die Entscheidung für Politik – genauer gesagt, die so genannte Wissenschaft davon – hatte ich buchstäblich in letzter Minute getroffen. Jemand hatte mir von Graf erzählt, der in Halle Politikwissenschaft lehrte. Graf sei anders als die meisten, ein hoch interessanter Mann, für angehende Politologen Grund genug, nach Halle zu gehen. Warum also nicht Politikwissenschaft in Halle?
Im Nebenfach habe ich dann – allgemeinbildend – Geschichte, Soziologie und Philosophie studiert. Mit Halle hatte ich dann nach zwei Jahren meinen Frieden gemacht. Natürlich war Halle mir zu klein und zu provinziell und die Stimmung zu depressiv, und die Wochenenden waren zu lang, um dort bleiben, und fast immer zu kurz, um zu Freunden nach München, Heidelberg oder Hamburg fahren zu wollen. Aber irgendwann wurde Halle mir dann doch vertraut genug. Ähnlich mochte es lange vorher Graf gegangen sein. Er lehrte seit über zwanzig Jahren in Halle, schien aber mit seinen Gedanken dort nie ganz angekommen zu sein. Von vielen Studenten wurde er „Der Fremde“ genannt. Aber Halle brauchte so einen. Er war das Glanzlicht im Hallenser akademischen Alltag.
Nach sieben Jahren Halle war ich dann so weit, dass ich wusste, was ich hätte werden wollen: Stadtplaner. Zu spät. Nun musste ich als studierter Politologe ins Berufsleben eintreten. Aber was ließ sich daraus machen? Ich wusste es nicht, und die meisten Kommilitonen auch nicht. Wir alle wussten nur, dass wir viel zu viele waren für die Jobs, in denen wir unser Studienwissen anwenden konnten. Wenn wir uns den akademischen Stil schnell genug abgewöhnten, hatte ein Dozent einmal gesagt, könnten wir z.B. Journalisten werden oder Redenschreiber für Manager. Es war spannend, und noch fühlte es sich gut an. Noch hatte ich nichts zu verlieren.
Als Student hatte ich oft darüber gelesen, welche Gedanken Ältere sich über unsere Studentengeneration machte. Damals wurde in fast jeder Dekade eine neue Generation ausgerufen, und unsere nannte man seltsamerweise Generation Z. Der Tonfall, in dem man über uns schrieb, war ärgerlich, aber vieles Geschriebene war richtig. Wir waren viel mit uns selbst beschäftigt. Die Wenigsten waren politisch ernsthaft interessiert, auch unter den Politikstudenten, und wenn, dann ohne jegliche Leidenschaft. Zeit für politisches Engagement hatten wir nicht oder nahmen wir uns nicht. Die Bereitschaft, Lebenszeit für politische Ziele zu opfern, wächst eben – so hat Graf es einmal gesagt – am ehesten aus Empörung, und empört waren wir nicht. Empörung und Zorn herrschten anderswo.
„Euer Wohlstand frisst eure Zeit.“ So sagte Graf es in einer Vorlesung kurz vor seiner Emeritierung, einer denkwürdigen Vorlesung, in der er aussprach, was keiner seiner Kollegen je gewagt hätte. Er begann im üblichen akademischen Tonfall. Dann, ganz spontan, ganz offensichtlich ungeplant, vielleicht sogar ungewollt, zuerst im Tonfall einer beiläufigen Anmerkung, dann immer erregter, für Augenblicke wie in unterdrücktem Zorn, rechnete er mit uns ab, mit seinen Studenten, nein mit einer ganzen Studentengeneration. Und dann, fast am Schluss: Ihr seid die Generation Sichtflug.
Generation Sichtflug. Das wurde bei uns ein geflügeltes Wort. „Na, du Sichtflieger“, so pflaumten wir einander amüsiert an. Ich nahm es nicht so locker. Hatte Graf nicht irgendwie Recht? Ja, irgendwie waren wir eine Generation Sichtflug. Aber hatte er uns denn Besseres gelehrt? Den politischen Instrumentenflug? Nein, das hatte auch er nicht. Sein kaum verhohlener Zorn traf, ohne dass er es merkte, auch ihn selbst.
Aber Graf legte kurz darauf noch einmal nach. Alle wussten, dass es sein allerletzter Auftritt in Halle sein würde, der Hörsaal quoll über bis weit in die Flure hinein. Er fing wieder streng akademisch an mit Anmerkungen zur politischen Theorie der Gegenwart. Dann brach er unvermittelt ab, ließ seinen Blick in die Weite des Hörsaals schweifen, dann sagte er:
Aber das ist für euch natürlich alles graue Theorie.
Für euch, sagte er. Er hatte, solange ich ihn kannte, nie einen Studenten geduzt, nun dieses „für euch“.
Ihr wisst ja, fuhr er dann fort, dass ihr die Generation Sichtflug seid.
Dann wurde sein Tonfall schärfer, fast schneidend.
Aber ihr macht nicht einfach nur Sichtflug, ihr macht Sichtflug im Nebel. Ohne Kompass, ohne Orientierung. Und trotzdem gut gelaunt.
Dann der Zwischenruf eines Studenten: Woher kommt denn der Nebel?
Großes Gelächter im Hörsaal. Darauf Graf – jetzt siezte er uns wieder:
Es ist der Nebel der Begriffe. Von überall her. Von den Medien, von Parteien, von Regierungen, in Wahlkämpfen.
Dann, nach einer kurzen, kunstvollen Pause:
Aber auch von den nebulösen akademischen Begriffen.
Wieder ein langer, weiter Rundblick in den Hörsaal.
Den einen Rat gebe Ihnen noch mit: Behalten Sie die wenigen Prozente des Lehrstoffs, die wichtig sein könnten, die Sie vielleicht zu etwas besseren Staatsbürgern machen. Und vergessen Sie möglichst schnell den ganzen Rest. Machen Sie den Kopf frei für Neues, das im wirklichen Leben hilft.
Im Saal eine fast unheimliche Stille. Dann ein anschwellendes Klopfen auf die Tische.
Dann wieder Graf:
Ich wünsche Ihnen viel Weitsicht auf Ihrem weiteren Lebensweg. Alles Gute.
Er schob die vor ihm liegenden Papiere zusammen und steckte seine Brille ein. Alle im Hörsaal blieben sitzen. Dann fingen einige an zu klatschen, einige riefen „bravo“, einige standen auf, dann immer mehr, nach einigem Zögern auch ich. Ich sah mich nach allen Seiten um. Nein, es war nicht die Mehrheit, die hier stehend applaudierte, aber es war eine bewegende Kulisse.
Graf blieb stehen, kämpfte sichtlich mit den Tränen, dann machte er eine beschwichtigende Handbewegung. Das Klatschen ebbte ab. Dann sein allerletzter Satz:
Ich sage das noch einmal: Vergessen sie möglichst schnell möglichst viel von dem, was Sie hier gelernt haben.
Dann ging er, die Standing Ovations sichtlich genießend, mit einem verschmitzten Lächeln. Es war der bewegendste Moment meiner Zeit in Halle. Vielleicht der einzige wirklich bewegende.
Aber zu was hatten wir Graf eigentlich so heftig applaudiert? Zu seiner unverhofften Wahrhaftigkeit? Dazu, dass unser Studium größtenteils Zeitverschwendung war, all die schönen Demokratie- und sonstigen Theorien eingeschlossen? Wir wussten es nicht. So begeistert wir von Grafs Auftritt gewesen waren, so schnell war er vergessen. Am nächsten Tag tauchten die Gedanken wieder in den Alltag ein, die nächste Seminararbeit, die nächste Klausur, das anstehende Praktikum, die Fertigstellung der Bewerbungsmappe und so weiter, und schon waren die Standing Ovations für Graf nur noch ein aus dem Zusammenhang gerissener Erinnerungsfetzen. Eine Zehnsekundenaufnahme davon auf YouTube war nach ein paar Tagen gelöscht. Drei Tage nach seiner Abschiedsvorlesung hatte Graf Halle für immer verlassen.
Wenn ich mich richtig erinnere, sah ich Constanze – die Cramer, wie viele sie nannten – zum ersten Mal in einer von Grafs Vorlesungen. Constanze Cramer. Politik und Informatik im Nebenfach, Hauptfach Ökonomie. Ich war im dritten von vierzehn Semestern, sie in ihrem vorletzten, dem siebten. Ein älterer Kommilitone neben mir machte eine Kopfbewegung zu ihr hin. „Schau mal!“ Man kannte sie. Eine Erscheinung. Auffallend schön, auffallend athletisch, auffallend weiblich, auffallend schwarzes langes Haar, einschüchternd groß, manchmal auf hohen Absätzen, auffallend gepflegt, auffallend gut gekleidet, auffallend geschminkt. Auf den ersten Blick eine Allerweltseleganz wie aus Modejournalen, ein Karrieretyp. Eine von jenen, die einmal von Weitem gesehen zu haben mir eigentlich vollauf genügt hätte.
Im ersten Moment konnte man sie auch für einen akademischen Jungstar halten, eine angehende Professorin. Alles an ihr, ihre Körperhaltung, ihre Mimik, ihre Gestik, ihre Blicke, sagte: Kommt mir nicht zu nahe; ich weiß, ihr würdet gern, aber tut es nicht. Dazu passte ihr immer in voller Länge, nie in Kurz- oder Koseform ausgesprochener Vorname. Immer Constanze, niemals Connie oder sonstwas. Bei uns Politologen gab es keine Frauen und auch keine Männer, die es mit einer wie ihr hätten aufnehmen mögen. „Bei solcher Frau bist du als Mann doch immer nur der Kofferträger.“ Nur einmal – ich saß ihr in Grafs Seminar näher als sonst – erahnte ich in ihrer Miene für einen kurzen Moment Tiefgründigeres.
Auch in Grafs Seminar war sie immer wortgewandt und schlagfertig, sie argumentierte glänzend, aber wenn sie sprach, dann in angestrengtem, fast schrillem Tonfall. Einer Erscheinung wie ihr hätte man eine wohlklingendere Stimme gewünscht. Aber dann hätte man vielleicht auch sie spontan zur Generation Sichtflug gezählt. Das wäre, wie ich später herausfand, ein großer Fehler gewesen. Ich habe ihr viel zu verdanken, auch für dieses Buch.
Das 20. Jahrhundert
Die Geschichte orientiert sich nicht am Kalender. Ein kalendarisches Jahrhundert, auch das einundzwanzigste, als zusammenhängende Epoche zu behandeln ist im Grunde, ich weiß es, schlicht Unsinn. Wenn man unser Jahrhundert als historische Epoche betrachten will, dann hat diese eher mit dem letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts begonnen, mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staatenwelt.
Ich fange daher mit einer Anmerkung zum 20. Jahrhundert an. Wie haben Menschen im vorigen Jahrhundert politisch gedacht? Was haben sie mit ihrem Denken angerichtet, und was haben sie damit – im Guten wie im Schlechten – verhindert? Welche Fortschritte gab es im politischen Bewusstsein? In Geschichtsbüchern wird man vieles anders lesen, aber gerade deswegen will ich hier aufschreiben, wie Hauser es mir schon vor 50 Jahren zu sehen geholfen hat.
Das 20. Jahrhundert – nicht das kalendarische – hatte einigermaßen klare Konturen. Die Zeit bis zur Jahrhundertmitte war das wohl dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte, die Zeit der Weltkriege, die Zeit massenmörderischer Despotien und die Zeit menschenverachtender Ideologien. Es war die Zeit von kolonialistischer Ausbeutung und Rassismus, wozu, um nur ein Beispiel zu nennen, das lange geleugnete und fast vergessene Terrorregime in Belgisch Kongo mit seinen ca. 10 Millionen Opfern gehörte. Und es war auch – und das wird hier eine herausragende Rolle spielen – das Jahrhundert in politischem Leichtsinn, politischer Ignoranz, in Siegerwillkür und kolonialistischer Überheblichkeit gezogener Staatsgrenzen. Daneben war es aber auch die Zeit, in der eine vergleichsweise zivilisierte politische Ideologie, die Ideologie der Demokratie, sich global durchzusetzen begann.
Das Ende des Zweiten Weltkriegs war natürlich eine historische Zäsur. Im nachfolgenden Ost-West-Konflikt steigerten sich die militärischen Bedrohungsszenarien zu atomaren Weltuntergangsszenarien. Auch dem militärisch Stärkeren drohte nun schlimmstenfalls die vollständige Vernichtung, und militärische Überlegenheit bewahrte nicht mehr vor Vernichtungsangst. Vor allem in der westlichen Welt war das Weltkriegsende daher auch eine Bewusstseinswende. Das politische Bewusstsein wurde zuallererst zu einem Welt- und Atomkriegsverhinderungsbewusstsein. Das war das Verbindende dieser Ära.
Auf diesem Entwicklungsstand war die westliche Welt mit sich zufrieden. Gegenüber dem Rest der Welt konnte sie immerhin einen politischen Zivilisierungsvorsprung für sich reklamieren, der nach Jahrzehnten und teilweise nach Generationen und Jahrhunderten zu bemessen war. Auch der sozialistischen Staatenwelt sah man sich natürlich moralisch weit überlegen. Und da diese erst mit jahrzehntelanger Verzögerung kollabierte, wurde auch die Selbstzufriedenheit der westlichen Welt weit über ihre Zeit hinaus konserviert. Sonst wäre es spätestens in den siebziger Jahren Zeit für die Einsicht gewesen, dass dem Zivilisierungsschub der Nachkriegszeit ein neuer folgen muss.
Mit dem politischen Bewusstsein ging es in der späteren Nachkriegszeit kaum noch voran. Den Schreckensregimen der ersten Jahrhunderthälfte folgten Diktatoren wie Franco und Salazar, terroristische Militärjuntas wie in Argentinien, kommunistische Schreckensherrscher wie Mao Zedong, Pol Pot und Ceausescu, archaische Despoten wie Idi Amin und Saddam Hussein und Völkermorde wie in Ruanda. Es wurden – auch von demokratischen Weltkriegssiegermächten – weiter konventionelle Kriege geführt, u.a. in Korea, Vietnam und Afghanistan, allein in diesen Ländern mit mehr als acht Millionen Todesopfern. Dies wurde im Westen nicht etwa als zivilisatorische Entgleisung gesehen, sondern eher als natürliche Fortsetzung der Geschichte. Die Beschränkung der Atommächte auf konventionelle Kriegsführung galt in dieser Zeit schon als Ausweis zeitgemäßer zivilisatorischer Reife.
Solche Beispiele zeichnen ein düsteres Bild dieser Epoche, aber in der westlichen Welt wurde die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts dennoch nicht als düstere Zeit erlebt. Man lebte weiter im Bewusstsein, dass zumindest in der eigenen Welt das Schlimmste verhindert und das Mögliche im Großen und Ganzen erreicht wurde. Die westlichen Staaten führten gegeneinander keine Kriege, die noch verbliebenen Despoten der westlichen Welt wurden schließlich gestürzt, und es gab vor allem keinen Atomkrieg. Die konventionellen Kriege fanden woanders statt, wenn auch immer wieder mit militärischer, finanzieller und geheimdienstlicher Beteiligung etablierter Demokratien. Ansonsten blieben die westlichen Staaten ganz darauf konzentriert, in der eigenen Welt den erreichten Status zu bewahren.
Nichts anderem diente auch die europäische Integration. Dass der Weg zur politischen Einigung Europas aber nicht nur Konflikten vorbeugen, sondern sich später selbst als konfliktträchtig erweisen würde, ahnte damals niemand. So wurde in der westlichen Welt eine zwischenstaatliche Nachkriegsordnung festgezurrt, die den durch die Weltkriege geschaffenen Status bewahrte. Als dann zehn Jahre vor der Jahrtausendwende endlich die sozialistischen Regime des Ostens kollabierten, war man in der westlichen Welt sicherer denn je, die denkbar höchste Stufe politischer Zivilisierung erreicht zu haben. Nach zwei Weltkriegen und jahrzehntelangem kaltem Krieg schien die Zeit der großen weltgeschichtlichen Dramen vorbei und die Zeit reif für ein entspanntes neues Jahrhundert. Europa würde auf absehbare Zeit friedlich und demokratisch vereint sein, und der Rest der Welt würde zur politischen Zivilisierung des Westens aufschließen. Wir haben unsere großen politischen und wirtschaftlichen Probleme gelöst, glaubte man, zumindest die grundsätzlichen, wir haben die sozialen Konflikte hinreichend entschärft, und nach unserem Vorbild wird nach und nach auch die restliche Welt es schaffen.
Auch die zwischenstaatliche Friedensordnung schien zumindest dem Prinzip nach fest gefügt zu sein, nicht nur für Europa und den Westen. Die Staatengemeinschaft hatte sich auf die Unverletzlichkeit bestehender Staatsgrenzen als vermeintlich friedenswahrendes Prinzip geeinigt, auf das so genannte Prinzip der territorialen Integrität. Damit hatten bestehende Staaten einen Anspruch auf Unveränderlichkeit ihrer Staatsgrenzen. Da die meisten Kriege bis dahin mit Übergriffen auf Staatsgrenzen begonnen hatten, versprach man sich von der Durchsetzung dieses Prinzips eine vollends nichtkriegerische Zukunft.
Fast über die gesamte zweite Jahrhunderthälfte hinweg gab es aber militante Konflikte, die nicht in dieses Bild passten. Es gab innerstaatliche Konflikte wie in Nordirland, im Baskenland, in Kaschmir und vielen anderen Krisenregionen, die im Kern Konflikte um Staatsgrenzen waren und damit auch Konflikte um das Prinzip der territorialen Integrität. Ähnliche Konflikte gab es fast permanent in Afrika, wo sie allein in den neunziger Jahren Millionen Todesopfer forderten. Und Europa, das das kriegerische Zeitalter zumindest für sich selbst überwunden glaubte, erlebte schon bald nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Jugoslawien-Kriege und andere ähnliche Gewaltkonflikte. Dies zeigte, wie brüchig die politische Zivilisierung auch in Europa noch immer war. Diese Kriege waren nicht, wie viele damals glaubten, die letzten Nachwehen eines kriegerischen zwanzigsten, sie waren vielmehr der unheilvolle Auftakt zu einem unfriedlichen 21. Jahrhundert.
Aber die westliche Welt ließ sich von ihrer Selbstzufriedenheit zum Jahrtausendausklang nicht ablenken. Die Sektkorken sollten knallen. So feierte man ziemlich unbesorgt in ein verstörendes neues Jahrhundert hinein.
2000 – 2024Ein schleichender Weltkrieg und andere Krisen
Jahrhundertauftakt
Meine Großeltern würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüssten, wie ihr Jahrhundert hier auf ein paar Seiten abgefertigt wird. Auch meine Eltern haben die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als große Selbstverständlichkeit erlebt wie fast alle damals. Sie waren stolz darauf, was in ihrer Zeit überwunden, erkämpft und verteidigt worden war, und sie wollten sich diese Zeit nicht kleinreden lassen. Mir fällt der distanzierte Blick natürlich leichter. Für mich ist auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Zeit, in der Menschen – auch die im so genannten Westen – sich von Überzeugungen haben tragen lassen, die sich heute mit Vernunft nicht mehr erklären lassen.
Aber nun endlich zu unserem, dem 21. Jahrhundert, in dem ich mein Berufsleben als Archivar verbracht habe. Dass ich Archivar geworden bin, ist eigentlich ein Zufall. Eigentlich hatte ich doch eher Redakteur werden wollen. Bis irgendwann ein älterer Freund mir sagte, auch etwas wie Archivarbeit sollte man als Redakteur einmal gemacht haben.
Das Wort Archivarbeit hatte bei mir keinen guten Klang. Archive sind eben keine Orte, in die es viele lebenshungrige Mitt- oder Endzwanziger zöge. Aber dann war da diese von Hauser verfasste verführerische Stellenanzeige des SPIEGEL.
Dann das Bewerbungsgespräch. Ich ging auf das einschüchternde Verlagsgebäude in der Hamburger Hafen City zu und dachte: Hier wärest du ein winziges Rädchen einer großen Maschinerie, das kannst du nicht wollen. Dann stand ich vor Hausers fast bescheidenem Büro, die Tür stand offen, hinter einem großen, hellen Schreibtisch ein schlanker Mann mit etwas gedrungener Figur, schmalem Gesicht, fast filigraner Hornbrille und dichtem, leicht gewelltem, dunklem Haar. Mit einer Geste bat er mich herein, lenkte mich auf den spartanischen Stuhl vor seinem Schreibtisch. Ein eher stiller Typ, dachte ich, kein autoritärer Chef, nicht unsympathisch. Dann sah er mich einen kurzen Moment lang mit einem eindringlichen, bis ins Innerste ausforschenden Blick an, dann hörte ich seine helle, freundliche Stimme sagen:
Ich bin Jan Hauser.
Als wäre damit alles gesagt.
Aber ein paar Sätze später waren wir schon in einem intensiven Gespräch, und nach wenigen weiteren Sätzen wussten wir beide: Wir vertrauten einander. Und dann seine Begeisterung für die Archivarbeit. Nirgendwo sind Sie so unabhängig wie hier, erklärte er mir, nirgendwo erfährt man Überraschenderes, nirgendwo kann man klarer denken. Ganz verstand ich es damals noch nicht, aber es machte mir Mut weiterzufragen, so naiv und so direkt, wie es nur ein Anfänger tun kann.
Aber was bewirkt man als Archivar? Welchen Einfluss hat man?
Mehr, als Sie vermuten, sagte er. Vielleicht mehr als die meisten Redakteure.
Ich sah ihn erstaunt an, und genau das hatte er offenbar erwartet.
Manche, die sich hier bewerben, wollten eigentlich Redakteur werden. Sie auch?
Ich tat, als müsse ich überlegen.
Ich selbst wollte es nie, sagte er. Hier arbeitet man viel freier. Als Redakteur ist man immer auch gefangen.
Worin?
Im Zeitgeist? In der Aktualität? In Vorgaben des Verlags?
Er sah mich auffordernd an, als warte er auf meine Bestätigung. Dann sagte er:
Außerdem hat man hier im Archiv den Blick ins Weite.
Weit in die Vergangenheit, meinen Sie?
Das hängt ganz von Ihnen ab, sagte er.
Dabei sah er mich wieder mit seinem eindringlichen Hauser-Blick an, einem Seelenfängerblick, verführerisch und auftrumpfend zugleich, der Menschen für Augenblicke sprachlos machen kann. Ich will dich, sagte mir der Blick in diesem Moment, ich will dich für unser Archiv, ich will dich als Kollegen.
Ich senkte den Blick und horchte in mich hinein. Dann spürte ich, wie meine Miene sich ganz ohne mein Zutun zu einem stummen, widerstandslosen „Du kriegst mich“ formte.
Hauser lehnte sich mit entspanntem Stöhnen zurück.
Ich glaube, Sie passen zu uns.
Kurzes Schweigen.
Vor allem wegen Ihrer breiten Allgemeinbildung.
Er beugte sich wieder vor.
Allerdings …
über meinen Kopf hinwegsehend
… ein bisschen mehr Wirtschaftswissen hätte nicht geschadet.
Dann:
Aber egal, dafür haben wir jemand anderes.
Dann gab er sich einen Ruck, richtete sich auf, sah mich mit befreitem Lächeln an.
Also? Sind wir uns einig?
So fing alles an. So kam ich zum SPIEGEL-Archiv, so kam ich mit Jan Hauser zusammen, ohne den ich kein Archivar geworden wäre oder doch einer, wie die meisten Menschen sich Archivare vorstellen, ohne den mein politisches Bewusstsein noch heute ein ganz anderes wäre, als es geworden ist, und ohne den ich nicht einmal auf den Gedanken hätte kommen können, dieses Buch zu schreiben.
Die meisten Menschen machen sich von einem Archiv wie unserem falsche Vorstellungen. Sie meinen, wir archivierten nur Informationen, die unseren Redakteuren beim Schreiben nützlich sind. Hauser hat mir erklärt, dass das bei uns von Anfang an anders war: Wir archivierten nicht nach dem Kriterium Nützlichkeit, darüber dürften wir uns kein Urteil anmaßen. Es gebe immer wieder unscheinbare Informationen, die erst nach Jahrzehnten in ihrer Bedeutung erkannt würden, und manche davon würden nirgendwo anders als in Archiven wie unserem zu finden sein. Auch darin liege der Sinn unserer Arbeit.
Natürlich ist man als Archivar zuerst einmal Quellensammler, eine Art Buchhalter des Zeitgeschehens. Im Umgang mit Informationen war ich immer auch passionierter Systematiker. Mein Gedächtnis ist ein systematisches Privatarchiv, manche meinten damals sogar, es sei ein Autistengedächtnis. Aber ich hatte nicht nur ein Bild davon, was in diesem Jahrhundert politisch getan und gedacht wurde, mein Gedächtnis versuchte auch zu speichern, was zu tun, zu denken oder zu dokumentieren möglicherweise versäumt wurde.
Insofern sah ich als Archivar vieles anders, als andere es taten. Zum Aktuellen musste ich professionelle Distanz halten, daran gewöhnte ich mich. Beruflich lebte ich insofern in der Vergangenheit. Aber manches Mal bin ich aus dieser Rolle gefallen. Manchmal habe ich der Redaktion Archiveinträge aufgedrängt, die mir für mögliche spätere Artikel wichtig erschienen, auch sehr viel spätere. „Wozu denn das?“, war dann oft die erstaunte Antwort, und darauf hätte ich antworten mögen: „Das werdet ihr noch sehen.“ Habe ich natürlich nicht.
Seit ich im Archiv arbeitete, vom Beginn des zweiten Jahrhundertquartals an, hinterließen politische Ereignisse bei mir viel tiefere Spuren als vorher. Ich versuchte nun auch, mir ein möglichst klares Bild vom Denken und vom Handeln von Politikern meiner bisherigen Lebenszeit zu machen. Dabei zehrte ich natürlich auch von Erinnerungen aus zweiter Hand, aber es ist genug Zeit vergangen, um daraus allzu Einseitiges herauszufiltern.
Deutschland war zur Jahrtausendwende noch immer in der Rolle des schuldbeladenen Weltkriegsverlierers. Nicht noch einmal auffallen in der Weltgeschichte, das war noch immer eine Maxime deutscher Politik. Nicht negativ auffallen, aber auch nicht mit dem Anspruch, besser zu sein als traditionsreichere Demokratien. So waren die anderen mit Deutschland einigermaßen zufrieden und erst recht Deutschland mit sich selbst. Anders ging es den Weltkriegssiegerdemokratien. Sie taten sich, auch wenn sie es sich selbst noch kaum eingestanden, schwer mit ihrem schleichenden Bedeutungsverlust. Keine guten Voraussetzungen für eine vernunftgesteuerte Weltpolitik.
So war man zur Jahrtausendwende im so genannten Westen vor allem mit sich selbst beschäftigt. „Es geht uns besser denn je“, dachte man, oder „Es könnte uns viel schlechter gehen.“ Großen Veränderungswillen gab es nicht. Gedanken wie „Könnte es uns und anderen nicht noch besser gehen?“ oder „Wie lange wird es uns noch so gut gehen?“ waren Gedanken von Spielverderbern. Man wollte nicht in längeren Zeiträumen denken als gewohnt. Meine Generation, die Generation Sichtflug nicht, aber auch nicht die Generationen der Älteren.
Vielleicht war ich bis weit in die erste Jahrhunderthälfte hinein einfach noch zu jung, um besondere Erwartungen an unser Jahrhundert zu haben. Erst Jahre nach meinem Eintritt ins Archiv begann ich, Vergleiche zwischen unserem und dem 20. Jahrhundert anzustellen. Wie weit sind Menschen, Staaten und die Staatenwelt im letzten Jahrhundert vorangekommen, fragte ich mich nun, und um wie viel weiter könnten sie in diesem Jahrhundert vorankommen? Fragen, mit denen ich mich ziemlich allein fühlte. Bis ich darüber mit Hauser sprach.
Anfang unseres Jahrhunderts war bei Älteren die größte Sorge noch immer: Nicht noch eine Jahrhunderthälfte wie die vorletzte, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich selbst hatte diese Sorge nie. Der Anspruch hätte doch sein müssen: nicht noch eine Jahrhunderthälfte wie die jüngste, die fünf Nachkriegsjahrzehnte. Also habe ich später die erste Hälfte unseres Jahrhunderts immer wieder an der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemessen. Je länger ich dies tat, desto besorgter wurde ich. Das habe ich aber, so gut ich konnte, für mich behalten.
Wem hätte ich es auch anvertrauen sollen? Kein Redakteur hätte darüber schreiben wollen. Ein einziges Mal habe ich mich damit vorgewagt, und die Antwort war: „Dafür finden wir keine Leser.“ Der Kollege hatte natürlich Recht. Dass die Geschichte der politischen Zivilisierung mit der Ausbreitung der Demokratie abgeschlossen sei, glaubte inzwischen niemand mehr, aber man sah sich dem Ziel doch immer noch nah. „Was erwartest du eigentlich?“, sagte der Kollege noch, „so viel Fortschritt in so kurzer Zeit gab es noch nie.“ Auch das mochte richtig sein, aber die Antwort darauf wäre gewesen: „Es gab in so kurzer Zeit auch noch nie so viele neue Probleme.“ In dieser Zeit war der Niedergang des demokratischen Parteiensystems längst unübersehbar, aber selbst das änderte nichts an der herrschenden Selbstzufriedenheit.
Das gehört aber schon nicht mehr hierher, es gehört in die Geschichte späterer Jahrhundertabschnitte.
Bewusstseinsstörung
Dieses kleine Jahrhundertporträt soll vor allem eine Bewusstseinsgeschichte sein. Auch deswegen kann man dabei nicht über den barbarischen Jahrhundertauftakt hinweggehen, den islamistischen Anschlag auf das New Yorker World Trade Center im September 2001. Was haben die Täter dabei gedacht, was ihre Inspiratoren, was ihre Sympathisanten? Was haben diejenigen gedacht, die auf diesen Anschlag politisch reagierten, die dabei im Namen der Opfer zu handeln meinten und selbst zu Tätern wurden? Wer hat bei all dem wie weit über die Folgen seines Handelns nachgedacht, wer wie weit über die Folgen des Handelns der Anderen? Ein Problemknäuel, das die Welt zu überfordern schien.
Erst einmal aber zu einer anderen fast unentwirrbaren Geschichte, über die ich im Archiv lange recherchiert habe, zu den Jugoslawien-Kriegen der frühen neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Heute wissen wir, dass dies exemplarische Kriege zur Lösung einer Jahrhundertaufgabe waren: der Entflechtung falsch zusammengesetzter Staaten.
Dass Jugoslawien nach dem Zusammenbruch des Sozialismus nicht als zusammenhängender Staat zu halten sein würde, war den Beteiligten offenbar rasch klar. Niemand schien aber zu wissen, wie man einen solchen Staat friedlich auflöst. Also gab es über die neunziger Jahre hinweg Krieg, genauer gesagt mehrere Kriege, in die auch NATO-Staaten verwickelt waren.
Das Ergebnis, der Zerfall Jugoslawiens in Serbien, Kroatien und fünf weitere eigenständige Nachfolgestaaten, war eigentlich für alle vorhersehbar. Warum brauchte es dafür dann aber diese Kriege, eine Intervention der NATO und ein anschließendes endlos langes Besatzungsregime im Kosovo und in Bosnien? Und was, wenn überhaupt etwas, hat man daraus gelernt? Und wenn man nichts oder zu wenig gelernt hat: Konnte das der Auftakt einer Abfolge ähnlicher Kriege sein, womöglich einer langen Ära von Kriegen zur Auflösung von Staaten? Und konnte es wirklich sein, dass niemand, weder Politiker noch Bürger noch Experten, sich ernsthaft diese Frage stellte? War die Welt womöglich in der Hand politischer Schlafwandler, ähnlich wie sie es vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs gewesen war? Genau diesen Anschein hatte es. Unser Jahrhundert begann ähnlich unheilträchtig wie das vorherige.
Ein schlichter Rückfall in ein Denken wie hundert Jahre zuvor war dies aber nicht, davon hat mich auch die Archivarbeit überzeugt. Wer sich mit den Jugoslawien-Kriegen näher befasste, dem musste klar sein: Die Kriege des 21. Jahrhunderts würden ganz andere sein als die großen Kriege der Vergangenheit. Die meisten großen Kriege waren Ausbrüche überschießenden Machtgefühls gewesen. Wenn man andere Staaten besiegen und damit Macht und Einfluss über fremde Staatsgebiete ausweiten konnte, warum dann nicht? Gelohnt haben sich die großen Kriege dieser Art aber auf sehr lange Sicht fast nie, und in der Welt des 21. Jahrhunderts war dies weniger denn je zu erwarten. Dass auch unser Jahrhundert eine Ära von Eroberungskriegen sein würde, war kein plausibles Szenario.
Nun aber Kriege wie die um Jugoslawien. Viele hieran Beteiligte waren natürlich noch ganz in altem Denken befangen, hatten also Eroberung und Unterdrückung als Kriegsziele im Sinn. Im Kern ging es bei diesen Kriegen aber um etwas ganz anderes. Hier wollte kein Despot oder Monarch oder ideologisch verblendetes Regime seinen Herrschaftsbereich ausweiten. Hier wollten werdende Demokratien sich Staatsgrenzen schaffen, in denen es unter ihren Bürgern genügend spontanen Zusammenhalt geben würde und damit die Voraussetzungen für innerstaatlichen Frieden. Das waren verständliche, vernünftige und alles andere als unmoralische Anliegen. Trotzdem war die Staatenwelt hierauf völlig unvorbereitet. Konzepte für eine friedliche Erfüllung dieser Anliegen hatte die Weltpolitik nicht. Die aus der Geschichte gezogenen Lehren reichten hierfür offensichtlich nicht aus.
Heute wissen wir, dass die Staatenwelt auch aus den Jugoslawienkriegen keine Lehren gezogen hat, nicht einmal diese, die sich unmittelbar aufdrängte: Wo Autokraten stürzen, die ihr Staatsvolk nur mit eiserner Faust hatten zusammenhalten können, leben bei den Bürgern generationenalte Zusammengehörigkeitsbedürfnisse und Fremdheitsgefühle neu auf. Wenn diese Bedürfnisse missachtet werden, kommt es zu schweren innerstaatlichen Konflikten. Nur eine herausragende politische Zivilisierung kann dann noch verhindern, dass die Zusammensetzung von Staatsvölkern mit Gewalt, Terror, Bürgerkrieg oder Krieg neu ausgekämpft wird. Für diese einfache Wahrheit war die Zeit noch nicht reif.
Man muss wohl froh sein, wenn in einem Jahrhundert wenigstens einige wenige politische Ideologien und Dogmen überwunden werden. Das vorige Jahrhundert war damit beschäftigt, Ideologien wie Kolonialismus, Imperialismus, Kommunismus, Rassismus und Geschlechterdiskriminierung zu überwinden oder zumindest abzumildern. Würde im 21. Jahrhundert wenigstens der alte ideologische Umgang mit Staatsgrenzen überwunden werden? Diese Frage hatte mich in meiner Zeit im Archiv immer wieder beschäftigt, und sie begleitet mich bis heute.
Zum politischen Bewusstsein nach der Jahrtausendwende an dieser Stelle nur noch dies: In dieser Zeit war viel von Globalisierung die Rede, also auch davon, dass fast überall auf der Welt ähnliche Informationen und gleiches Wissen verfügbar würden. Dies, so glaubte man, würde zu einer globalen Angleichung der politischen Zivilisierung führen. Diese Auffassung war zum Ende des 20. Jahrhunderts geradezu zum Dogma geworden. Aber eine Ideologie sah man hierin natürlich nicht, allenfalls eine Ideologie zur Überwindung von Ideologien, also eine denkbar harmlose.
Aber es war eben doch eine Ideologie, und diese hatte, wie sich zeigen sollte, ähnlich fatale Auswirkungen wie die Ideologien des 20. Jahrhunderts. Sie war Wegbereiterin für die größte politische Katastrophe des ersten Jahrhundertviertels, den Krieg der USA und Großbritanniens gegen den Irak und den mörderischen Flächenbrand, der ihm im Nahen Osten folgte. Möglich wurde dieser Krieg nur, weil Figuren wie George W. Bush und Tony Blair ernsthaft glaubten, ein besiegter und vom Diktator Saddam befreiter Irak würde sich ähnlich rasch modernisieren, sich also ähnlich rasch zu einer stabilen modernen Demokratie entwickeln können, wie die Nachkriegs-Bundesrepublik es getan hatte. Bush, Blair und ihre zahllosen Gesinnungsgenossen und Sympathisanten hatten aber, wie die Nachkriegsgeschichte des Irak dann zeigte, vom Modernisierungspotential des Irak und vergleichbarer Länder nicht die geringste Ahnung. Nach dem Sturz Saddam Husseins offenbarte sich im Irak ein politischer Bewusstseinsstand, der eher Parallelen zum Dreißigjährigen Krieg nahelegte als zur Situation Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Der vermeintliche Befreiungskrieg wurde damit zum exemplarischen Fall eines gescheiterten Modernisierungskrieges. Der Nachkriegs-Irak wurde formal demokratisiert, aber als Demokratie war er von Anfang an nicht lebensfähig. Er zerfiel in Bürgerkriegen, die noch archaischer geführt wurden als im zerfallenden Jugoslawien. Die westlichen Modernisierer, die Krieg für eine höhere Stufe politischer Zivilisierung zu führen vorgaben, standen damit in der Wirkung ihres Tuns moralisch auf dem Niveau ihrer Kriegsgegner. Nach dem Zerfall des Irak gab es keine politische und militärische Weltmacht mit glaubhafter moralischer Autorität mehr. Die Welt war in der politischen Zivilisierung zurückgefallen.
Exkurs Wirtschaft
An meinem zweiten Arbeitstag im Archiv stellte Hauser mich den Kollegen vor. Alle freundlich, einige beinahe herzlich. Die meisten schienen hoch konzentriert, manche introvertiert, manche etwas verschroben, wie die meisten Menschen sich Archivare wohl vorstellen. Vielleicht ist wirklich etwas Wahres daran, dass typische Archivare leicht autistische Züge haben. Aber wenn Hauser auf sie zuging, hellte sich bei fast allen die Miene auf.
Am Ende unseres Rundgangs standen wir, Hauser und ich, vor einer geschlossenen Tür am Ende eines langen Flurs. „Hier sind wir in der Abteilung Wirtschaftsordnung“, sagte Hauser. Er ging hinein, ich einen Schritt hinter ihm. Im Raum nur ein Schreibtisch, dahinter eine junge Frau mit auffallend kurzem schwarzem Haar, markanter Brille. Sie sah kurz auf, schaute Hauser aus dem Augenwinkel an, sagte ein kurzes „hallo?“.
Ihr neuer Kollege.
Ach so, sagte sie. Dann, mit einem freundlichen Lächeln, noch einmal: Hallo!
Ich sagte nichts, sah sie eine Weile unschlüssig an. Ein bekanntes Gesicht?
Sie erwiderte meinen Blick, zögerte, zog die Augenbrauen hoch, dann, mit geweitetem Blick, ein Anflug von Lächeln.
Haben wir uns schon mal gesehen?
Diese Stimme! Die angestrengte, etwas schrille und kratzige Stimme von Constanze Cramer.
Ich rührte mich nicht. Dann stand sie auf, kam auf mich zu, streckte die Hand aus. Was tun? Mich in Luft auflösen? Ihre Hand griff schon nach meiner, da stand sie vor mir mit ihrem jetzt kurz geschnittenen Haar und ihrer markanten Brille, so selbstbewusst wie früher, so imposant wie früher und ebenso elegant wie früher. Aber unnahbar? Nein. Nicht unnahbar, nicht einschüchternd, nicht abweisend. Hatten wir uns alle in ihr getäuscht?
Vielleicht im Seminar?, fragte ich mit viel zu leiser Stimme. In Grafs Seminar?
Ja, genau.
Constanze Cramer? Frau Cramer?
Constanze.
Matthias. Matthias Schmidt.
Ja, jetzt erinnere ich mich.
Ach, ihr kennt euch?, fragte Hauser. Dabei sah er uns abwechselnd mit dem gütigen Blick eines Vaters an, der zusieht, wie sein Kind einen Freund von früher trifft.
Ihr werdet öfter miteinander zu tun haben.
Würde mich freuen, sagte Constanze. Dann setzte sie sich wieder an den Schreibtisch.
Als wir gegangen waren, sagte Hauser: Sehr selbstbewusste Frau. Ja, genau, hätte ich sagen mögen, aber ich traute mich nicht. Tagelang ging mir diese Bemerkung Hausers durch den Kopf. Würde er das später einmal auch über mich sagen: Sehr selbstbewusster Mann, dieser Schmidt? Würde ich das wollen? War ich von Constanze, der sehr selbstbewussten, der Cramer, schon wieder eingeschüchtert wie damals als junger Student? Von der Constanze, die Informatik und Ökonomie studierte, Fächer, die ich mir nicht zugetraut hätte? Die fast doppelt so schnell studiert hatte wie ich? Die, wie sie bald erzählen würde, vier Jahre bei einer Unternehmensberatung gearbeitet hatte, zu einem Gehalt, das ich vielleicht nie im Leben erreichen würde, vier Jahre ein Leben aus dem Koffer, 13-Stunden-Tage, 60-Stunden-Wochen, die vielen Reisezeiten nicht mitgerechnet, und die dabei gelernt hatte, sich ganz ungeniert unbeliebt zu machen? Die also nicht nur eine Erscheinung war, sondern auch ein Arbeitstier, konsequent und durchsetzungsstark? Die gerade einmal drei Jahre älter war als ich, mir aber mindestens sechs Jahre Berufs- und vielleicht auch Lebenserfahrung voraushatte?
Aber warum saß sie nun hier im Archiv? Warum machte sie nicht Karriere im Management? Warum nicht, wie es damals viele erwartet hatten, eine Hochschulkarriere? Viele Jahre später hat sie mir auch das freimütig erklärt: Starke Erscheinung mit schwacher Stimme, so habe man an der Hochschule über sie geredet. Man habe sie sehen und man habe Texte von ihr lesen wollen, aber ihr zuhören wollen habe man nicht. Das habe sie gerade noch früh genug gemerkt.
Und?, fragte ich. Hast du es bedauert?
Nein, sagte sie. Die Erinnerung an Grafs Abschiedsvorstellung hat es mir leichtgemacht.
Spezialistin für Wirtschaftsordnung im SPIEGEL-Archiv zu sein ist ein ziemlich einsamer Job. Die Archivarbeit allein brachte uns selten zusammen, aber wir schafften uns unsere Gelegenheiten. Wenn wir uns trafen, dann bestimmte natürlich meistens Constanze die Themen, und natürlich ging es dabei oft um Wirtschaft. Ich versuchte dann, wenigstens höfliches Interesse zu zeigen, und sie dankte es mir mit immer mehr Geduld. Sie konnte einem Laien wie mir Wirtschaftsthemen so leichthändig, so gut gelaunt und mit so wenigen Worten verständlich machen wie niemand sonst. Hätte sie mir diesen Nachhilfeunterricht nicht gegeben, würde ich mich heute nicht trauen, hier kurz etwas Eigenes zur Wirtschaftsentwicklung in unserem Jahrhundert anzumerken.
Aber sind Wirtschaftsfragen für die Bewusstseinsgeschichte unseres Jahrhunderts überhaupt wichtig? Oder sind sie zumindest dann eher unwichtig, wenn eine Epoche vom Scheitern großer historischer Projekte wie Friedenswahrung oder globaler Modernisierung geprägt ist? So würde ich vielleicht noch heute denken, wenn die Gespräche mit Constanze nicht gewesen wären.
In meinen ganz jungen Jahren glaubte ich, politische Stimmungen seien von nichts so abhängig wie von der Wirtschaftslage. Constanze erklärte mir, dass das einmal so gewesen sein mag, aber nicht mehr so ist. Die meisten Bürger sind zufrieden, solange es für sie wirtschaftlich nicht bergab geht. Solange es nur überschaubaren Minderheiten wirtschaftlich schlecht geht, will die demokratische Mehrheit keine großen politischen Veränderungen. Wer will es ihr verübeln? Dass eine ganz andere Politik mehr Wohlstand für alle bringen könnte, lässt sich schwer beweisen.
Im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts begann eine schwere Finanzmarkt- und Bankenkrise, und in Teilen Europas folgte ihr eine lange Staatsverschuldungs- und Wirtschaftskrise. In manchen Medien war die Rede davon, dass in dieser Krise Marktwirtschaft und Kapitalismus versagt hätten, aber wirklich ernst nahmen das nur wenige. Die große Mehrheit der Bürger war gelassener. In Deutschland sowieso, aber selbst in den Staaten, die die Krise viel stärker zu spüren bekamen, blieben große politische Veränderungen aus. Was hätte sich, von einer etwas strengeren Kontrolle der Banken abgesehen, politisch auch ändern sollen, um Krisen solcher Art zu verhindern? Auch Constanze hatte darauf noch keine Antwort.
Eine Zeitlang glaubte ich, in Kreisen der Wissenschaft wisse man dies genauer, aber dann hat Constanze es mir so erklärt: Es gebe zwei verschiedene Arten von Wirtschaftswissenschaften, und beide führten in dieser Frage nicht weiter. Die eine, im Elfenbeinturm der Theorie, beschäftige sich vor allem mit sich selbst, die andere mische sich in die Politik ein. Die eine, die theoretische, sei intellektuell auf höchstem Niveau, die andere sei auf dem Niveau der Politik, der sie sich andiene. Die eine sei für politische Fragen unbrauchbar, die andere gebe politischen Rat, wie ihre Geld- und Auftraggeber ihn suchten. So sei es schon immer gewesen, sagte sie, und so werde es sicher auch bleiben. Ich habe sie dann gefragt, ob die Wissenschaft nicht doch dazulerne und in Zukunft besser vor Wirtschaftskrisen werde bewahren helfen. Sie wisse von Krisen, erklärte sie, die durch Wirtschaftstheorien verursacht wurden, aber von keiner, die durch Wirtschaftstheorie verhindert wurde. Sie glaube auch nicht, dass sich daran viel ändern werde. Ob es wirklich alles so einfach sei, fragte ich sie noch, und ihre schnippische Antwort war: Nein, aber für einen Laien wie dich ist es das Wesentliche.
Aber genug davon, mehr als ein kleiner Exkurs in Wirtschaftsfragen soll hier nicht sein. Womit ich nicht sagen will, dass Wirtschaft für das politische Bewusstsein in diesem Jahrhundert doch eher nebensächlich sei. Natürlich erleichtert Wohlstandswachstum auch Fortschritte in der politischen Zivilisierung. Aber wirtschaftlicher Fortschritt wird, wie mir Constanze einmal erklärte, nicht von der Politik und nicht von Politikern gemacht. Politiker behaupteten oft das Gegenteil, die meisten glaubten es sogar, aber es sei nicht so. Politik könne wirtschaftlichen Fortschritt behindern oder zulassen, aber machen könne sie ihn nicht.
Noch nicht?, fragte ich.
Schon das Zulassen des Fortschritts ist eine hohe Kunst.
So redete sie. Kurze, knappe Erläuterungen, gekrönt von einem Satz wie ein Schlusswort, der mich erst einmal sprachlos machte, der mir dann aber immer plausibler erschien. Das war ihr großes Talent. Ob sie einige ihrer Talente als Archivarin nicht doch vergeude, fragte ich sie einmal, und auch darauf gab sie eine Antwort, die mir allmählich immer plausibler wurde.
Ja, sagte sie, das habe sie sich natürlich auch gefragt. In der Unternehmensberatung habe sie gelernt, Dinge genau auf den Punkt zu bringen. Da müsse man zeigen, dass man manches auch ganz anders sehen kann, als die Mandanten es schon viel zu lange gesehen hätten, und dabei gehe es weniger um die richtige Lösung als um die Möglichkeit einer Lösung, und da dies, was die Kunden nicht gleich merken dürften, oft eher diffuse Botschaften seien, fast wie in der Politik, sei es umso wichtiger, sie knackig zu präsentieren. „Es muss sitzen. Es muss ein kleiner Schock sein.“ Das, meinte sie, sei ihr meistens gelungen. Es klang so engagiert, als würde sie nichts lieber tun wollen als genau solche Arbeit, und doch so distanziert, als erzählte sie von einem früheren Leben.
Wieso sie dann nicht dabei geblieben sei, fragte ich.
Auch solches Leben wollte ich einmal gelebt haben. Aber man zahlt einen Preis.
Welchen?
Ich bin hier in der Reha. Das Archiv ist meine Reha.
Viel klüger fühlte ich mich danach nicht, aber ich fühlte, dass, was die Wirtschaft angeht, viele doch viel weniger klug waren, als sie glaubten. Ein gutes Gefühl. Die Wirtschaftsentwicklung unseres Jahrhunderts hat ihm Recht gegeben.
Russland und die Ukraine
Mit der Arbeit im Archiv hatte ich mich bald angefreundet. Begeisterung war es nicht, aber wann immer ich über Alternativen nachdachte, fühlte ich mich dort bestens aufgehoben. Was kein Wunder war, wenn man einen Hauser als Chef hatte.
Zwischen Hauser und mir wuchs eine Vertrautheit, die unseren großen Altersunterschied manchmal fast vergessen ließ. Aber Hauser überraschte auch immer wieder mit irritierenden Bemerkungen. Einmal sagte er beiläufig, er kenne das Archiv fast auswendig. Ich sah ihn ungläubig an. Nein, sagte er, natürlich nicht buchstäblich das ganze Archiv, aber das, worauf es ankomme. Die Schätze des Archivs sozusagen. Die Augenöffner. Von einer Million Archivinformationen seien das höchstens ein paar Dutzend. Über die Jahrzehnte habe er ein Gespür dafür entwickelt, welche das sein könnten. Lernen könne man das nicht, sagte er, lehren könne man es auch nicht, man könne eben nur ein Gespür dafür entwickeln
Nur ein paar Dutzend von einer Million Archivinformationen seien Augenöffner? Pflegten wir also doch einen Riesenberg von Karteileichen, in dem es nur sporadisch Spuren von Bedeutsamkeit gab? Ich fragte Constanze, ob sie es nach ihren zweieinhalb Jahren Archiverfahrung auch so sehe.
Ja, sagte sie, im Archiv einen wirklichen Schatz zu finden, das sei fast wie ein Lottogewinn. Archivarbeit erfordere nun einmal Geduld.
Aber wenn es wirklich so ist, fragte ich, machen wir dann nicht etwas grundsätzlich falsch?
Vielleicht, sagte sie. Einen Unternehmensberater sollte man vielleicht nicht darauf ansetzen.
Was der denn sagen würde, wollte ich fragen, aber dann wusste ich schon selbst die Antwort. Er würde eine große Reorganisation vorschlagen. Constanze hatte mir ja geschildert, wie es geht. Ein langer diffuser Bericht, am Ende eine knackige Botschaft: Das Archiv muss schrumpfen, das Archiv muss sich ganz und gar in Frage stellen.
Weiter wollte ich es mir damals noch nicht ausmalen, auch wegen Hauser nicht. Das Archiv in Frage zu stellen hieße, Hauser in Frage zu stellen, und nichts lag mir ferner.
Hauser war nicht nur ein kollegialer Chef für uns alle, auch im Umgang mit Redakteuren, meinte ich, zeige er sicheres Gespür. Trotzdem war sein Verhältnis zur Redaktion nicht ohne Spannungen. Jahre später, lange nachdem ich sein Nachfolger geworden war, hörte ich im Vorbeigehen einen unserer Chefredakteure sagen: „Einen zweiten Hauser hatten wir uns eigentlich nicht gewünscht, oder?“ Nach Hochachtung für einen früheren Kollegen klang das nicht.
Hatte es also eine Seite Hausers gegeben, von der ich nichts ahnte? Hatten sich Redakteure irgendwann von Hauser falsch informiert gefühlt oder sogar manipuliert? Hatte er Archivinformationen für sich behalten? Hatte er Informationen weitergegeben, von denen er wusste, dass sie falsch waren? War er so bei der Chefredaktion in Misskredit geraten? Nichts davon wollte ich glauben.
Dann erinnerte ich mich, wie Hauser einmal Archive mit Geheimdiensten verglichen hatte. Geheimdienstler, hatte er gesagt, arbeiteten diskret und unauffällig, deswegen werde ihre Macht weit unterschätzt, und ähnlich sei es bei Archivaren. Ein Geheimdienstchef könne Regierungschefs und Minister ins offene Messer laufen lassen, er könne ihnen Macht über andere geben, er könne, das wisse ich doch, sogar Kriegsbereitschaft wecken und Kriegsausbrüche verhindern helfen, und daran habe sich nichts geändert. Ein Archivleiter sei ein Geheimdienstchef im Kleinen. Auch er könne Menschen, vor allem natürlich Redakteure, ins offene Messer laufen lassen und Menschen Macht über andere geben. Ganz unauffällig. Ich fragte ihn, ob er es schon einmal getan habe, und er antwortete, das glaube er nicht.
Archivare, fuhr er dann fort, könnten herausfinden, wer welche Archivinformationen genutzt, also auch, wer welche Informationen Kollegen und Lesern vorenthalten hat. Deswegen seien viele Redakteure vor Archivaren auf der Hut, auch ich würde das noch erleben.
Sprach er aus Erfahrung? War er womöglich ein kleiner Intrigant? Hatte er sogar mitgemischt, als einige Jahre vorher zwei Chefredakteure entlassen wurden? Und hatte ein Gespräch, das wir über Information und Desinformation im Krieg geführt hatten, nicht auch damit zu tun? Redaktionen gehe es im Krieg nicht viel anders als Regierungen, hatte er gesagt. Man erwarte von ihnen, dass sie wissen und schreiben, wer im Krieg die Guten und wer die Bösen seien. Auch wenn sie es nicht wüssten, werde der Druck irgendwann zu groß, dann lege die Redaktion sich fest, auch wenn ein fundiertes moralisches Urteil noch unmöglich sei. Und wie diese Festlegung dann ausfalle, das hänge auch von Informationen aus dem Archiv ab.
Ich fragte nach einem Beispiel, und darauf gab er eine lange Antwort über den Anschluss der Krim an Russland und den Bürgerkrieg in der Ostukraine.
Alle Regierungen, alle Geheimdienste, alle politischen Parteien und alle Medien hätten in dieser Sache ebenso viel desinformiert wie informiert. Moskau habe es getan, Kiew ebenso und die Staaten des Westens kaum weniger. Wir vom Archiv, sagte er, gaben uns damals alle Mühe, Information von Desinformation unterscheiden zu helfen, aber genützt hat es wenig. Die Redaktion habe sich Beweise dafür gewünscht, dass Putin böswilliger Friedensstörer und Kriegstreiber war, die Regierungen des Westens und der Ukraine dagegen dem Frieden dienten. Nur zwei Redaktionskollegen – es tue ihm immer noch leid um sie – hätten sich daran nicht gehalten.
An dieser Stelle kann ich nicht anders, als einen ersten Ausschnitt aus Hausers Aufzeichnungen einzuflechten, auf die ich zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Archiv gestoßen bin. Ich hätte mir gewünscht, Hauser hätte mir diese Aufzeichnungen selbst anvertraut, aber ich fand sie rein zufällig bei einer Recherche im Archiv. Sie waren noch vollkommen unberührt, augenscheinlich noch von niemandem gelesen oder auch nur durchgeblättert oder angeschaut. Hauser hatte am Tag seiner Verabschiedung ein einziges Exemplar dieser Aufzeichnungen ins Archiv gestellt, als unauffällige Hinterlassenschaft, als wollte er es dem Zufall überlassen, ob sie je von jemandem gelesen würden. Ich hatte das Glück, ihr Finder und erster Leser zu sein. Auch mit diesen Aufzeichnungen ist Hauser für mich dann zu einem Zeitzeugen des ersten Vierteljahrhunderts geworden.
Natürlich hat Hauser darin auch einiges über Russland und Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt geschrieben, und natürlich hatte er dazu eine Meinung, die damals alles andere als die gängige war.
Als Archivar hätte ich mir manchmal doch gewünscht, Überflüssiges und Nebensächliches aus dem Archiv herauszuhalten und dem, was ich für das Besondere hielt, einen bevorzugten Platz zu geben. Aber ich habe es nicht getan. Auch zum Ukraine-Konflikt mussten wir natürlich wahllos das viele Redundante archivieren, das westliche Politiker, Organisationen, Ämter und Medien hierzu absonderten und das die Rollen von Gut und Böse fast immer auf die gleiche Art verteilte. Eine Zeitlang waren „Russlandversteher“ und „Putinversteher“ unter Journalisten Schimpfworte. Die anderen, die Nichtversteher also, waren die selbstsichere Mehrheit, auch bei uns.
Russland als Restgebilde der Sowjetunion, das den Verlust der Großmachtrolle nicht verkraftet und sich Teile der Ukraine einverleiben will, um sich dabei doch noch einmal als Großmacht zu inszenieren – das war im Westen die gassenläufige Deutung. Aber was war daran stimmig? Richtig war das innere Bild von Russland als verstörter Ex-Großmacht. Geschwächte nationale Identität, bedrohtes politisches Selbstbewusstsein und ein Verlangen nach Ersatzbefriedigungen, dazu ein Präsident Putin, der für eben diese Gefühle ein sicheres Gespür hatte. Populistische Rhetorik und Symbolik, autokratischer Führungsstil, neuer Nationalismus, neue Feindseligkeit gegenüber Minderheiten jeglicher Art, Durchsetzungskraft vor Rechtsstaatlichkeit, neue Religiosität, das waren – nach einer kurzen Phase versuchter Verwestlichung – die Quellen des politischen Empfindens im postsowjetischen Russland. Putins Nachfolger werden dieser Linie auf absehbare Zeit folgen. Amerika verkraftet den Entzug der Weltmachtrolle etwas besser, schon wegen seiner viel längeren demokratischen Geschichte, aber Ähnlichkeiten werden bleiben.