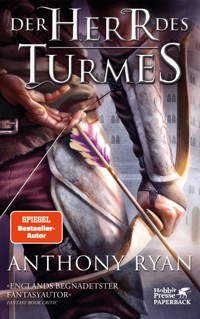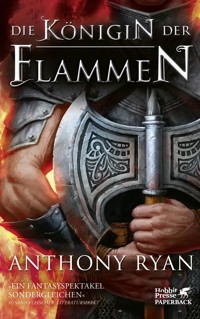10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Von vielen Geheimnissen und Widersprüchen ist der Untergang der Stadt Kethia umrankt. Der legendäre Krieger und König Tavurek führte sie einst in den Krieg gegen das volarianische Reich. Ein Bericht von Lord Vernier, dem Chronisten der Rabenschatten-Reihe. König Tavurek, der in seiner Jugend das Töten in den Kämpfen gegen die Piraten lernte, ist mit vielen Gaben gesegnet. Die hervorstechendste ist sein Hass auf die Volarianer und die Kompromisslosigkeit, mit der er ihn auslebt: »Der Speerfisch verhandelt nicht mit der Ziege.« Vom Volk und den Söldnern wird er so sehr verehrt, dass sie bereit sind, sogar ohne Sold zu kämpfen und zu sterben. Da prophezeit einer der Priester Kethias: Die Stadt wird den Flammen erliegen und Volar wird aus ihrer Asche hervorgehen. Der vom Wahn besessene Tavurek meint aber die Stimme der Götter zu hören, die ihm sagt, dass er ihr Werkzeug sei. Dieser Band enthält des Weiteren die Erzählungen »Der Lord Collector« und »Die Herrin der Krähen«, in welcher der Leser dem Straßenjungen Frentis aus »Das Lied des Blutes« wieder begegnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anthony Ryan
Das Duell der Bösen
Rabenschatten-Geschichten
Aus dem Englischen übersetzt von Sara Riffel
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Englische Originaltitel der drei Novellen: »A Duel of Evils or The Fall of Kethia«; »The Lady of Crows«; »The Lord Collector«
© Anthony Ryan
Für die deutsche Ausgabe
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg; Illustration: Federico Musetti
Datenkonvertierung: Fotosatz Amann, Memmingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98117-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10874-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Das Duell der Bösen oder Der Niedergang Kethias
Die Herrin der Krähen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Der Lord Collector
Das Duell der Bösen oder Der Niedergang Kethias
Eine wahrheitsgetreue und unverfälschte Schilderung der Zerstörung jener Stadt, verfasst auf Geheiß Seiner Majestät des Kaisers Aluran Maxtur Selsus (gesegnet von den Göttern immerdar) durch Lord Verniers Alishe Someren, kaiserlicher Geschichtsschreiber und Erster der Gelehrten.
Den klugen Weisungen Euer Majestät folgend mied ich bei der Vorbereitung dieses Abrisses die Untiefen von Mythen und Legenden – jenes verfluchte Doppelgespann, das sich dem vernünftigen Gelehrten bei seiner Suche nach Wahrhaftigkeit auf ewig in den Weg stellt. Wie Euer Hoheit feststellen werden, sind die überlieferten Quellen jedoch sämtlich durchzogen, man könnte auch sagen: verdorben, von Beschreibungen bizarrer und schlichtweg unmöglicher Vorkommnisse. Warum ein Ereignis von solch außerordentlicher Bedeutung für das volarianische Reich – eine Kultur, die gemeinhin für ihr Streben nach Vernunft bekannt ist und darin gelegentlich sogar das gebotene Maß überschreitet – auf derart unzuverlässige Weise überliefert wird, bleibt mir ein Rätsel. Womöglich litten die Zeugen unter geistiger Verwirrung – die Unbill des Krieges kann selbst den beständigsten Geist seiner Vernunft berauben. Indes habe ich beschlossen, auch die abwegigeren Schilderungen in diesen Bericht mit aufzunehmen, da meiner Auffassung nach die Wahrnehmung eines Ereignisses mindestens ebenso bedeutsam ist wie das Geschehen selbst.
Um zu begreifen, wie der einst mächtige Stadtstaat Kethia ein solch greuliches Ende finden konnte, müssen wir zunächst seine Ursprünge verstehen. Was wir über die frühe volarianische Geschichte wissen, speist sich im Wesentlichen aus Legenden und Erzählungen, die sich um die Taten verschiedener unglaublich mächtiger Helden und deren zahllose Schlachten und Intrigen im Dienste des heute bedeutungslos gewordenen volarianischen Pantheons drehen. An objektiven Quellen sind aus jener Epoche lediglich einige unentzifferbare Schrifttafeln und geschmacklose Malereien auf Fundstücken – vor allem Keramikscherben und Reste von Mosaiken – erhalten geblieben. All diesen Darstellungen gemeinsam ist das Thema der Zerstörung – brennende Städte, Menschenhorden, die von Armeen grausiger Gestalten in blutroten Rüstungen mit dem Schwert niedergemacht werden, bizarre Tiere, die aus den Eingeweiden der Erde hervorbrechen und überall Verwüstung anrichten. Diese Bilder sind gewiss übertrieben oder entstammen gänzlich der Fantasie; als Ganzes betrachtet deuten sie jedoch darauf hin, dass auf der Landmasse, die heute das volarianische Reich beherbergt, einst ein Kampf von einer Größenordnung stattgefunden haben muss, die geeignet wäre, ein ganzes Volk auszulöschen; ein Kampf, dessen Ende erst durch eine Phase der Neugründung von Siedlungen angezeigt wird, zwischen denen Handel und Schriftverkehr wieder auflebten.
Der Name Kethia findet seine früheste Erwähnung vor eintausendsechshundert Jahren, ein ganzes Jahrhundert vor der Geburt unseres eigenen (glorreichen und zweifellos ewigen) Reiches. Bei meiner Suche in den kaiserlichen Archiven bin ich auf einige alte Frachtlisten gestoßen, in denen der Austausch von Waren mit einer Siedlung an der Westküste der heutigen volarianischen Provinz Eskethia verzeichnet war. Der Handel mit dieser Siedlung nahm im Laufe der Jahrhunderte immer mehr zu, bis sie zu genügend Reichtum und Ansehen gelangt war, um mit Kaiser Rahlun, dem zehnten Auserwählten auf dem alpiranischen Thron, ein offizielles Abkommen zu schließen. Die Einzelheiten jenes Abkommens sind nicht weiter erwähnenswert; Ziel waren das Festschreiben bestehender Zölle und der gegenseitige Schutz vor Freibeutern. Aus der Einleitung jedoch geht hervor, dass sich Kethia bereits damals in erbitterter Konkurrenz zum Hafen von Volar befand, der etwa dreihundert Meilen weiter nordöstlich liegt.
Ein kurzer Blick auf eine Karte der Nordküste Volarias erklärt, warum es zwischen diesen beiden Städten zum Konflikt kam. Volar befindet sich am Ende eines langen, schmalen Einschnitts, der den Namen »Arm von Lokar« trägt. Ein leicht zu befahrendes Gewässer, wie mir mehrere Seeleute versicherten, das jedoch den Zugang zu den boraelischen Handelsrouten erschwerte und Kethia damit zum Vorteil gereichte. Zudem profitierte die Stadt vom reichen Ackerland in ihrem Umkreis, das Wein und Baumwolle im Überfluss hervorbrachte. In den Jahrzehnten vor dem kethischen Abkommen mit Alpira war es zu zahllosen Grenzkonflikten und mindestens einem größeren Kampf zwischen den beiden rivalisierenden Hafenstädten gekommen. Die Lage verschärfte sich mit der Ausbreitung der volarianischen Hegemonie auf dem Kontinent, eine Phase, die als Zeitalter der Reichsgründung bezeichnet wird. Das volarianische Reich mit seiner fortschrittlichen Militärdoktrin und seiner gnadenlos praktischen Herangehensweise an Diplomatie und Kriegsführung trat vor achthundert Jahren zum ersten Mal in Erscheinung – und dies markiert auch den Anfangspunkt der Geschichte, die hier erzählt werden soll.
Um den weiteren Fortlauf der Ereignisse nachvollziehen zu können, ist es zunächst wichtig, sich die Unterschiede wie die Gemeinsamkeiten der kethischen und der volarianischen Kultur vor Augen zu halten. Fern läge es mir, die eine über die andere stellen zu wollen, denn wie Eure erlauchte Majestät feststellen werden, erscheinen beide Völker im Vergleich zur unübertroffenen Größe der alpiranischen Gesellschaft als gleichermaßen bestialisch. So herrschte beispielsweise in beiden Kulturen ein Rechtssystem, das nur als barbarisch bezeichnet werden kann; jedwedes Verbrechen, ganz gleich wie geringfügig, wurde mit Hinrichtung bestraft (was sich in Volaria bis heute nicht geändert hat), für schwerere Vergehen erwarteten den Schuldigen eine Reihe festgelegter Torturen, die schließlich im, zweifellos befreienden, Tod endeten. So ähnlich sich beide Kontrahenten hinsichtlich ihrer Brutalität waren, so sehr unterschieden sie sich in der Regierungsform. Eine Schilderung der langen und hässlichen Geschichte der eigentümlichen volarianischen Institution der Sklaverei möchte ich Euch, Majestät, ersparen. Es soll der Hinweis genügen, dass zur Zeit des Aufstiegs des volarianischen Reiches die Sklaverei bereits in allen Bereichen der Gesellschaft fest verankert war.
Wie Euer Majestät wissen, wird Volaria von einem Rat regiert, dem die wohlhabendsten Bürger des Reiches angehören. Auf welche Weise jemand in den Rat gelangt, ist heute nicht leicht zu durchschauen – vieles ist von Intrigen und einem komplexen System der Patronage abhängig. Außenseitern wird häufig nicht einmal ersichtlich, wer überhaupt zum Rat gehört. Einige Familien halten ihren Sitz seit Generationen, ohne sich die Mühe zu machen, den Namen des jeweiligen Amtsinhabers zu ändern. In früheren Zeiten genügte es jedoch, Reichtum im Wert von einhunderttausend Sklaven anzuhäufen. Die Anzahl der Ratssitze im Laufe der Zeitalter liefert deshalb nützliche Hinweise auf die Größe des Reiches oder zumindest die der Sklavenpopulation. Zu Beginn des offenen Krieges gegen Kethia bestand der Rat aus zehn Mitgliedern, deren Macht über das wachsende volarianische Herrschaftsgebiet nahezu uneingeschränkt war.
Kethia hingegen brauchte keine Räte, denn wie die wilden Bewohner des feuchten Nordlandes besaß Kethia einen König. Im Gegensatz zu diesen gelangte bei den Kethern der König aber nicht aufgrund seiner Herkunft auf den Thron, sondern wurde nach Belieben vom Volk gewählt. Alle vier Jahre versammelten sich sämtliche Männer über dreißig, die ein Haus oder Vieh besaßen, in einem eindrucksvollen Gebäude im Stadtzentrum. Der Name des Gebäudes ist nicht überliefert, glaubt man jedoch den Wandmalereien in den Ruinen Kethias, so muss es sich um einen bemerkenswerten Bau gehandelt haben. Er war beinahe dreißig Fuß hoch, und sein Dach wurde von fünf Fuß breiten Marmorsäulen getragen.
Die Wahl lief folgendermaßen ab: Vor jeden der Kandidaten, die sich um das Amt des Königs bewarben, wurde eine Vase gestellt. Dann erhielten alle Anwesenden einen schwarzen Stein. Einzeln traten sie vor und tauchten ihre zur Faust geschlossene Hand mit dem Stein nacheinander in jede der Vasen, sodass niemand sehen konnte, in welche sie ihn legten. Waren alle Steine abgelegt, wurden die Vasen geleert und vor den Augen der Versammlung die Steine gezählt. Der Kandidat, dessen Vase die meisten Steine enthielt, gelangte auf den Thron.
Jeder Mann passenden Alters, der über die notwendigen Voraussetzungen verfügte, konnte sich um den Königsthron bewerben, wenngleich der kethische Gelehrte und Diplomat Karvalev uns Hinweise darauf liefert, welcher Personenkreis die besten Aussichten auf Erfolg hatte:
Kein Bauer ist je auf den Thron gelangt. Und auch kein Viehtreiber, Schmied oder Radmacher. Zum König ernannt werden stets nur Kaufleute oder die Söhne von Kaufleuten. Oder berühmte Krieger oder die Söhne berühmter Krieger. Keiner von ihnen hat je in Armut gelebt. Kethische Mütter ermahnen einen faulen Sohn mit dem Sprichwort: »Wenn du so weitermachst, wird nie ein Stein in deiner Vase landen.«
Karvalev sollte dazu bestimmt – oder verflucht – sein, einen Großteil der folgenden Ereignisse mitzuerleben, weshalb seine Schilderungen eine wichtige Quelle dieses Abrisses darstellen. Viele seiner Werke sind über die Jahrhunderte verlorengegangen; zu Lebzeiten wurde er aber wohl viel gelesen, sodass seine Schriften häufig kopiert und weit verbreitet wurden, was ihm nicht wenig Verdruss bereitete: »Die ganze Welt zieht Nutzen aus der Kunst dieses armen Gelehrten, der um Tinte feilschen muss.«
Volarianische Quellen aus dieser Zeit sind rar und häufig so vorurteilsbeladen, dass sie für uns nutzlos sind, es sei denn, um den abgrundtiefen Hass zu veranschaulichen, den die Volarianer Kethia entgegenbrachten. »Das sind Diebe«, schrieb ein volarianischer Kaufmann einem Handelspartner im fernen Verehl. »Mit List und Bestechung nehmen sie uns jede Möglichkeit, Gewinn zu machen. Ein Kether verkauft notfalls mit Verlust, wenn er damit einem Volarianer schaden kann.«
Es ist jedoch Karvalev, der das deutlichste Bild der volarianischen Abneigung gegenüber ihren wohlhabenden Nachbarn zeichnet. Nachdem er mehrere fruchtlose Reisen nach Volar unternommen hatte, um dort ein Friedensabkommen auszuhandeln, führte sein letzter Versuch diesbezüglich zu folgender aufschlussreicher Schilderung eines Treffens mit einem ungenannten Ratsherrn:
Mit eisigem Blick und versteinerter Miene stand er da, gekleidet in einen roten Seidenumhang und flankiert von Wachen mit gezogenen Schwertern. Seine ganze Haltung war die eines Mannes, dem die schlimmste Beleidigung widerfuhr. Entschlossen, mein Vorhaben dennoch in die Tat umzusetzen, übermittelte ich ihm meine Botschaft, worauf er sprach: »Der Dolchzahn verhandelt nicht mit der Ziege.«
Karvalev beschreibt, wie ihn die Wachen des Ratsherrn festnahmen und zu seinem Schiff zurückbrachten, auf Schritt und Tritt von einer geifernden Menge beschimpft, die »sich in den Straßen drängte, um Gift und Galle gegen das verhasste Kethia zu spucken«. Ein Krieg mit Volar wurde immer unausweichlicher.
Allerdings sollte man nicht annehmen, dass der Handel der einzige Grund für die Feindschaft der beiden Rivalen war. Zwar sprachen sie größtenteils dieselbe Sprache und besaßen dasselbe Götter-Pantheon, doch unterschieden sie sich stark in der Form der Anbetung. Erlauchte Majestät werden sich gewiss an die Darstellung meines Traktats Land der Alpträume – ein Porträt des Volarias der Vorkaiserzeit erinnern, wonach das heute verschwundene volarianische Pantheon eines der schwierigsten Forschungsgebiete des modernen Gelehrten bleibt, da nur die Priester die Namen der Götter kennen durften. Der gemeine Gläubige wandte sich an die Helden der Legende, die selbst gottgleich waren, und bat sie um Rat. Gesuche um göttlichen Beistand konnten nur über die Priesterschaft erfolgen und verlangten nach einer angemessenen Opfergabe. Kethia hingegen, das das Pantheon mit den Volarianern teilte, hatte sich bereits ein Jahrhundert vor seiner Vernichtung dieser Priesterschaft entledigt. Es heißt, die Kether hätten die schlimmste Blasphemie begangen, indem sie den Göttern Namen gaben und ihren Bürgern, sogar den Frauen, gestatteten, sie anzubeten. Wenig überraschend war es in Volaria daher die Priesterschaft, die am lautesten nach einem Krieg gegen Kethia rief.
Eine der wenigen volarianischen Quellen, die eine weitgehend unvoreingenommene Schilderung des Krieges liefern, ist ein gewisser Sevarik Entril, der zu Beginn des Krieges Jungoffizier war und später zu einem Bataillonskommandanten aufstieg. Während des Konfliktes schrieb Entril eine Reihe von Briefen an seine Frau und schuf damit einen wertvollen Bericht über den Hergang des Geschehens. Er vertraute diese Schreiben einem neutralen Schiffskapitän an, der in Wahrheit ein Spion in Diensten des alpiranischen Reiches war, weshalb sich in den Kaiserlichen Archiven Abschriften dieser Briefe befinden. Entril beschreibt, wie seine Division vor einem der hohen Türme aufmarschierte, die für die heute zerstörten volarianischen Tempelanlagen typisch waren:
Auf der Spitze des Turms stand ein Priester und rief etwas in der Sprache der Götter. Seine Worte wurden uns von einem seiner Brüder übersetzt. Er sagte, sein Bruder sei mit einer Vision gesegnet worden, die nicht nur von einem, sondern von sämtlichen Göttern des Himmels stammte: »Kethia wird in Flammen aufgehen und Volar aus seiner Asche auferstehen!« Wie es der Sitte entsprach, stürzte der Priester sich daraufhin vom Turm. Sein Lebenswerk war beendet, und die Götter würden im Fallen seine Seele auffangen. Wir hoben die Schwerter und brüllten uns heiser, derweil die leere Hülle des Priesters als Blutopfer auf dem Boden zerschellte.
Ein weiterer Grund für die Abneigung der Volarianer gegenüber den Kethern war die bei Letzteren übliche Kindsopferung. Wie bereits festgestellt, herrschte in beiden Kulturen ein gleiches Maß an Barbarei; diese Facette der kethischen Gesellschaft macht es indes schwer, ihr tragisches Schicksal zu bedauern. Dass eine solche Praxis tatsächlich verbreitet war und nicht nur dem volarianischen Vorurteil entsprang, wird von Karvalev und mehreren anderen zeitgenössischen Quellen bestätigt. Anscheinend wurden diese Opfer nur bei einer neuen Thronbesteigung gebracht; Karvalevs Beschreibung einer solchen Zeremonie vermittelt allerdings den schaurigen Eindruck des Alltäglichen:
Bei seiner Thronbesteigung griff der König in eine große Glasschüssel voller Holzpflöcke, welche die Namen aller Kinder Kethias trugen. Kein Kind, ganz gleich welchen Standes, wurde ausgelassen. Welche Familie wollte schon auf eine solche Ehre verzichten? Nachdem der König einen Holzpflock ausgewählt hatte, erhob er sich und nannte den Namen des glücklichen Kindes. Diesmal war es ein Junge von etwa acht Jahren, der Sohn eines Schiffbauers, der von diesem stolz nach vorn getragen wurde. Fröhlich lachend saß der Junge auf den Schultern seines Vaters. Der König begrüßte das Kind mit einem Kuss auf die Stirn und führte es alsdann mit dem Messer in der Hand zu dem Brunnen, aus dem die Götter bei Mondaufgang trinken. Die Götter segnen uns auf ewig, doch sie sind auch ewig hungrig.
Die Thronbesteigung ebenjenes Königs war es, die den Krieg endgültig ausbrechen ließ. Es handelte sich um einen Krieger, der unter dem Namen Tavurek in die Geschichte einging. Karvalev beschreibt ihn als »Kethias ganzen Stolz. Seine Statur und Kampfkraft ergänzten sich mit einem Verstand, schärfer als jede Schwertklinge. Es schien, als hätten die Götter unsere Not erkannt und Tavurek aus einem früheren Zeitalter zu uns gesandt, denn er war nicht wie andere Männer.« Die Volarianer gingen bei der Zerstörung aller Bildnisse und Statuen Tavureks mit großer Gründlichkeit vor, sodass die Genauigkeit von Karvalevs Beschreibung heute nicht mehr beurteilt werden kann. Entrils Porträt des todgeweihten Kriegerkönigs stimmt jedoch mit den meisten volarianischen Quellen überein:
Er überragte seine Männer, als sie gegen uns vorrückten. Unbehelmt und mit bloßen Armen schwang er eine Doppelaxt, als wöge sie kaum mehr als ein Zweig. Ein wütender Koloss aus Muskeln und Stahl, dessen Anhänger sich ohne Zögern für ihn opferten.
Über Tavureks früheres Leben ist nur wenig bekannt, wenngleich Karvalev andeutet, dass er der Sohn einer reichen Handelsfamilie war und seine Kindheit am Meer verbrachte. Tavureks Zeit auf See ist von zahlreichen farbenfrohen und absurden Legenden umrankt. Er soll von den Königinnen exotischer Inseln entführt und verführt worden sein und wilde Schlachten gegen Piraten gekämpft haben, in denen er sich seine tödlichen Fähigkeiten aneignete. Die haarsträubendste Geschichte ist dabei zweifellos der heldenhafte Kampf des zukünftigen Königs gegen ein riesiges Meeresungeheuer mit vielen Tentakeln. Natürlich ging er als Sieger daraus hervor, erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er mehrere Tage lang dem Tode nahe war. Wie groß der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten auch sein mag, als Tavurek an die Macht gelangte, war er jedenfalls weit gereist und von beeindruckender körperlicher Statur. Für die Kether war seine bedeutsamste Tugend jedoch nicht seine Kampfkraft, sondern sein leidenschaftlicher Hass auf die Volarianer.
Karvalev zeichnete Tavureks erste Ansprache an das kethische Volk auf. Von einigen poetischen Ausschmückungen abgesehen, die mit großer Sicherheit dem Gelehrten zuzuschreiben sind, liefert diese Rede einen unzweideutigen Einblick in Tavureks zutiefst anti-volarianische Haltung:
Kann man sie überhaupt Menschen nennen? Diese Bestien, diese Hundesöhne, diese Halunken? Wo ist ihre Ehre, frage ich euch? Wo ist ihr Mut? Wo ihre Religion? Sie bezeichnen uns als Gotteslästerer. Sie behaupten, wir würden die Götter entehren, während sie auf Schritt und Tritt Greueltaten begehen. Mein Hund ist gläubiger als sie!
Die Götter finden in Tavureks Reden häufig Erwähnung. Ein kethischer Botschafter in Alpira nannte ihn den frommsten Mann, der je auf dem Thron saß, und wir können mit einiger Gewissheit sagen, dass der neue König seine Mission für eine göttliche hielt. »Sie haben zu mir gesprochen, mein Freund«, soll er einmal zu Karvalev gesagt haben, während sie sich eine karge Mahlzeit aus Beeren und Wasser teilten (es war unter den Königen Kethias üblich, bescheiden zu leben). »Die Götter … ich habe ihre Stimme gehört. Und sie haben mich zu ihrem Werkzeug auf Erden bestimmt. Der volarianische Schmutz muss weggeputzt werden.«
Dies legt die Vermutung nahe, dass Tavurek geisteskrank war oder zumindest zeitweilig unter Wahnvorstellungen litt. Doch wenn dem so war, muss es sich um den Wahn eines ganzen Volkes gehandelt haben, denn seine Leute hielten bis zu seinem Tode zu ihm.
Zu einem ersten ernsten Zusammenstoß kam es kaum zwei Monate nach Tavureks Thronbesteigung, als er eine Flotte Kriegsschiffe direkt in den Arm von Lokar lenkte. Es war seine ausdrückliche Absicht, Volar von den Handelsrouten abzuschneiden und die Stadt dadurch im Hinblick auf eine Invasion zu schwächen. Allerdings erwies sich dies als zu ehrgeiziges Ziel. Die Volarianer waren offenbar gewarnt worden, und so wurde seine Flotte alsbald von vorn und von hinten angegriffen. Ein Verehler Seemann, der Zeuge des Debakels wurde, berichtete einige Monate später einem alpiranischen Handelspartner:
Es geschah bei Nacht, und anfangs glaubte ich, die Götter hätten Himmel und Meer in Brand gesteckt. Ich sah Männer schreiend aus lodernden Schiffen fallen, während die volarianischen Mangonelen ihr Werk verrichteten. Feuerkugeln prasselten wie brennender Regen vom Himmel. Im Arm wimmelt es nur so vor Weißnasenhaien, kleinen, bösartigen Bestien, die gern in Schwärmen angreifen. In jener Nacht gab es für sie so viel zu fressen, dass das Meer förmlich zu brodeln schien. Am Morgen war die Küste voller Schiffswracks, einige volarianisch, die meisten aber kethischen Ursprungs, und die Haie fraßen immer noch.
Irgendwie gelang es Tavurek, die Katastrophe zu überstehen und mit den Resten seiner Flotte nach Kethia zurückzukehren. Seltsamerweise wurde er trotz des Fehlschlags mit einmütiger Freude begrüßt, und es finden sich keine Hinweise darauf, dass es unter den Kethern kritische Stimmen gegeben hätte. »Er hat so eine Art«, schreibt Karvalev nach dem Fiasko über Tavurek. »Er nimmt die Seelen der Menschen ein. Ich kann es mir nicht recht erklären, aber selbst in meinem Herzen ist kein Platz für Zweifel. Nie bin ich mir einer Sache sicherer gewesen: Dieser Mann ist dazu bestimmt, uns anzuführen.«
Nach einer solch offenen Aggression war klar, dass Volaria schnell reagieren würde. Kethia wurde mit einer Blockade belegt; die volarianische Flotte zwang sämtliche Schiffe, unabhängig von ihrer Herkunft, anderswo anzulegen, und versenkte sogar ein Dutzend neutraler Gefährte, deren Kapitäne sich nicht einschüchtern lassen wollten. Der Hauptangriff sollte jedoch an Land erfolgen. Über die Größe des volarianischen Heeres, das kaum drei Monate später in kethisches Gebiet einmarschierte, gibt es unterschiedliche Schätzungen. Karvalevs Behauptung, es habe sich um eine halbe Million Soldaten gehandelt, ist mit Sicherheit übertrieben, aber selbst der etwas gemäßigtere Entril spricht von zweihunderttausend, was immer noch schwer zu glauben ist. Wie dem auch sei, es war gewiss ein beeindruckendes Heer – vielleicht das größte, das während des Zeitalters der Reichsgründung ausgehoben wurde, und auf jeden Fall das erfahrenste.
Die üble Gepflogenheit, in den volarianischen Heeren Sklaven einzusetzen, sollte sich erst vierhundert Jahre später durchsetzen. Damals waren die Soldaten noch allesamt freie Männer. Eine Militäreinheit der Volarianer bestand aus einem Infanteriebataillon, das offiziell eintausend Mann umfasste, tatsächlich aber aufgrund von Kampfverletzungen und Krankheiten der Soldaten häufig unterbesetzt war. Die meisten Soldaten waren Wehrpflichtige zwischen sechzehn und fünfundzwanzig. Für den Feldzug gegen Kethia wurde ihre Zahl auf Erlass des Rates hin durch das Zusammenziehen von Reservisten aufgestockt. In den meisten Bataillonen mischten sich junge Einberufene mit Veteranen, die eine Armeelaufbahn den oft düsteren Unwägbarkeiten des zivilen Lebens in Volaria vorzogen. Die Praxis, zahlungsunfähige Schuldner zu Sklaven zu machen, war auch damals schon im Gesetz verankert, und für diejenigen, die keiner reichen Familie angehörten, konnte das Leben recht beschwerlich sein. Die Armee bot zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit. »Drei Mahlzeiten am Tag, zweimal in der Woche eine Hure und hin und wieder eine Schlacht, um den Appetit zu stillen und sich die Taschen mit Beutegut zu füllen«, gibt Entril die Worte seines Obersten Offiziers wieder. »Das Rezept für einen glücklichen Soldaten.«
Zwar mochte das Dasein als Soldat besser sein als ein Leben in Armut, doch war die Disziplin im Heer so streng, dass es fast schon an Sadismus grenzte. Das volarianische Militärstrafgesetz sieht als mildeste Strafe zehn Schläge mit einer stachelbewehrten Peitsche vor, womit solche Vergehen wie ein schmutziger Harnisch oder eine unpolierte Gürtelschnalle geahndet wurden. Für unerlaubte Trunkenheit setzte es fünfzehn und für die Nichtachtung eines Vorgesetzten zwanzig Schläge, was für die meisten Männer vermutlich bereits tödlich war. Die schlimmste Strafe erwartete Deserteure, denen Hände und Füße abgeschnitten und die Stümpfe mit Pech bestrichen wurden, worauf ein Rudel Sklavenhunde auf sie gehetzt wurde. Eine besonders grausame, aber zweifellos effektive Disziplinarmaßnahme war die kollektive Bestrafung von Bataillonen, die sich in den Augen der Heeresführung feige verhalten hatten. Per Los wurden einhundert Männer bestimmt, die beim nächsten Angriff in der ersten Reihe laufen mussten – komplett nackt und nur mit einem Schwert bewaffnet. Es überrascht daher nicht, dass viele, die einmal gegen die Volarianer kämpften, von deren beispiellosem Mut berichteten.
Zusätzlich zu den regulären Bataillonen unterhielten die Volarianer auch eine Reihe von Elite-Formationen, die nur aus Veteranen bestanden. Diese hatten sich bereits in zahlreichen Schlachten ausgezeichnet und trugen statt der schnöden Nummern Namen. Häufig gingen die Namen auf legendäre Helden zurück – »Livellas Klingen« und »Die Söhne Korsevs« waren die berühmtesten unter ihnen. Sie hatten an sämtlichen großen Schlachten im Zeitalter der Reichsgründung teilgenommen, ohne jemals eine Niederlage hinnehmen zu müssen. In der folgenden Schlacht mussten jedoch selbst solch gestandene Soldaten erfahren, dass im Krieg niemand unbesiegbar ist.
Wenn die volarianische Armee auch größtenteils aus Infanterie bestand, so besaß sie doch auch einige starke Kavalleriekontingente, die vor allem von den Söhnen reicher Kaufleute gebildet wurden, und darüber hinaus ein Korps hochgradig effizient arbeitender Baumeister, deren Einsatz möglicherweise sogar kriegsentscheidend war. Durch den erstaunlich schnellen Bau mehrerer Brücken gelang es den Volarianern bereits in den ersten fünf Tagen ihres Feldzuges, mehr als einhundert Meilen auf kethischem Gebiet zurückzulegen, ohne dass Tavurek, der in Kethia seine Wunden leckte, überhaupt von ihrem Vorstoß erfuhr. Als die Kunde schließlich bei ihm eintraf, reagierte der König jedoch recht zügig.
Kethia besaß ein kleines stehendes Heer von vielleicht zwanzigtausend Mann, dessen Stärke durch die Schlacht im Arm ziemlich gelitten hatte. Um diese magere Streitmacht zu vergrößern, war es in Kethia lange schon üblich gewesen, Söldner aus dem Ausland anzuheuern, was im Vorfeld des Krieges bereits in verstärktem Maße geschehen war. Es überrascht daher nicht, dass Karvalev das Heer, das den Volarianern entgegenmarschierte, als buntgemischt beschreibt. Zugleich wirft seine Schilderung ein Licht auf Tavureks unheimliche Fähigkeit, selbst die Abgebrühtesten zu seinen Anhängern zu machen:
Bogenschützen von den Küsten des Jarvenischen Meeres standen neben dunkelhäutigen Schleuderern aus Verehl. Lanzenreiter aus Atethia nannten wilde hellhäutige Axtkämpfer aus den Nordbergen ihre »Brüder«. Und alle verneigten sich vor dem mächtigen Tavurek und schworen feierlich, ihm notfalls bis in die Feuergrube zu folgen und gegen die Dermos selbst zu kämpfen. Dass dieser Schwur ernst gemeint war, kann niemand bezweifeln, denn diese Männer erhielten keine Bezahlung mehr. Sie kamen als Söldner zu uns und blieben als treue Kether, und als solche starben sie auch.
Wie immer sind sich die Quellen über die Größe des kethischen Heeres uneins, doch war es mit Sicherheit im Verhältnis von eins zu zwei in der Unterzahl. Trotz dieses Unterschieds in der Stärke verlief der vier Tage später folgende Zusammenstoß keineswegs einseitig. Die beiden Armeen trafen etwa dreißig Meilen von Kethia entfernt aufeinander, eine Meile vor der Südküste des Arms von Lokar. Die Volarianer hatten sich klugerweise nahe der Küste gehalten, um die ständige Versorgung durch ihre Flotte zu sichern – ein weiterer Faktor, der zur Schnelligkeit ihres Vorrückens beigetragen hatte. Entril beschreibt das Schlachtfeld folgendermaßen:
… sanft geschwungenes Ackerland, ohne Hügel oder sonstige Besonderheiten, die es verdient hätten, benannt zu werden. Die Kether näherten sich in einer dichten Menge und sahen von jeglichen Täuschungsmanövern ab, um stattdessen einen direkten Angriff auf die Mitte unseres Heers durchzuführen. Am Ende dieses Tages erhielt die Gegend dann doch noch einen Namen: das verdorbene Land. Wie könnte auf solch vergifteter Erde auch jemals wieder etwas wachsen?
Entrils Schilderung des Kampfes besteht aus einem wirren Durcheinander von Begegnungen mit Männern, die er als »verrückte Bestien, ohne Vernunft oder Furcht …« beschrieb. Wir müssen deshalb den Bericht des volarianischen Kommandanten, eines gewissen General Derilev, zu Rate ziehen, um uns einen Eindruck von der Schlacht als solcher zu verschaffen. Derilev war ein erfahrener Offizier von einigem Ansehen; allerdings sprach seine Art der Durchführung des Feldzuges lediglich von einer gewissen Grundkompetenz denn von inspirierter Führerschaft. Sein Bericht muss mit Vorsicht genossen werden, handelt es sich doch eindeutig um die übertriebenen Behauptungen eines Offiziers, der die Verantwortung für eine Beinahe-Niederlage von sich weisen will: