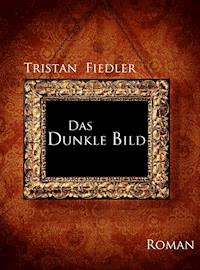
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Gemälde aus dem Nachlass seines verstorbenen Vaters lässt Benedikt keine Ruhe. Das Motiv, ein großes Anwesen irgendwo in den Bergen, scheint sich nachts zu verändern... Um dem Geheimnis des Bildes auf die Spur zu kommen, reist Benedikt in den Heimatort seines Vaters. Die Anwohner scheinen ihn erwartet zu haben und verweisen ihn auf ein altes Anwesen, das noch im Besitz seiner Familie ist. Benedikt erkennt in dem Haus jenes vom Gemälde wieder. Auf der Suche nach Hinweisen durchstöbert Benedikt das alte Gemäuer. Zusammen mit einem stummen Mädchen, das Benedikt im Ort kennenlernt, entschlüsselt er alte Aufschriebe seines Vaters. Nach und nach kommt er dabei der Vergangenheit seines Vaters auf die Spur, die für ihn immer ein Buch mit sieben Siegeln war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tristan Fiedler
Das Dunkle Bild
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Impressum neobooks
Kapitel 1
Die meisten würden es seltsam finden, dass ich überhaupt keine Reaktion zeigte, als ich es erfuhr. Aber weder Trauer noch sonst eine Emotion schienen es mir wert, an diese Person verschwendet zu werden. Ich spüre noch den harten Sitz unter mir, und ich weiß noch, dass ich mich fragte, warum es eigentlich so schwer ist, bequemere Stühle in dem kargen, fensterlosen Raum aufzustellen, in dem immerhin jeden Tag unzählige Leute wie ich sitzen und warten, während der Arzt mich durchdringend ansah. Er presste ein Clipboard an seine Brust. Dahinter ragte ein Bündel Kulis aus der Brusttasche seines Kittels. „Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe?“
Ich nickte nur. Der Arzt räusperte sich und warf einen Blick auf sein Clipboard, als könne er ihm etwas Neues abgewinnen. Meine Reaktion – oder besser gesagt, meine Nicht-Reaktion – schien ihn zu verwirren.
„Wenn Sie wollen, können Sie jetzt zu ihm.“
Ich schüttelte den Kopf. „Mein Vater ist doch tot“, erwiderte ich. „Oder nicht?“
Der Arzt nickte zögerlich.
„Wieso sollte ich dann nochmal zu ihm gehen?“
Der Arzt öffnete den Mund. Doch ich entschloss mich, ihm keine Zeit für eine Antwort zu lassen. Ich ahnte sowieso, was er sagen würde.
Natürlich, jeder muss Abschied nehmen. Und es war sicherlich schwer zu verstehen, warum ich das nicht tun wollte. Aber ich hatte nicht die Absicht, mich zu rechtfertigen. Der Arzt wusste nichts von meinem Vater. Oder mir. Oder der Beziehung, die wir geführt hatten. Außerdem fühlte ich mich von seiner Gegenwart erstickt. Fehlende Distanz zu einem Menschen hat diesen Effekt auf mich. Wenn der andere ein völlig Fremder ist, macht es das nicht unbedingt besser. Und dieser Blick, dieser einfühlsame, mitleidige Blick, war einfach zu viel für mich. Fehlte nur noch, dass er mir die Hand irgendwo auflegte.
„Ich hab es leider eilig“, sagte ich. „Muss ich irgendwas unterschreiben oder so?“ Mein Blick wanderte ruhelos durch den Raum. Hauptsache, ich musste dem Arzt nicht in die Augen sehen.
Im Hintergrund öffnete sich die Tür. Jetzt kam auch noch der Psychologe, der meinen Vater über die letzten Wochen begleitet hatte. Ich spürte, wie mir heiß wurde. Allerhöchste Zeit, hier wegzukommen. Das bedeutete, ich musste mir etwas überlegen, um mich einigermaßen elegant aus der Situation herauszuwinden. Keine leichte Aufgabe. Ich sah auf die Uhr und stammelte etwas von abendlichen Verpflichtungen, von schließenden Geschäften und von der Tagesschau. Der Arzt wirkte nicht überzeugt. Im nächsten Moment schon nahm mich der Psychologe freundlich an der Schulter und bot an, dass wir uns setzten. Ich fuhr wie elektrisiert zusammen. Doch der Psychologe ignorierte das. Mit eiserner Freundlichkeit im Blick drückte er mich zurück auf den Stuhl. Jetzt reichte es mir. Ich sprang auf, riss mich los und verließ eiligen Schrittes den Raum. Ich spürte die verdatterten Blicke im Rücken, doch es war mir egal.
Ich muss dazu sagen: Der Tod meines Vaters war abzusehen gewesen. Die letzten Monate hatte er nur noch im Bett gelegen und war wortwörtlich dahin gesiecht. Der Tumor in seinem Kopf muss außerdem Stellen seines Gehirns geschädigt haben. Er war in den letzten Tagen, die er noch zu Hause verbrachte, unerträglich geworden. Meine Aufgabe bestand darin, mich seinen Beschimpfungen auszusetzen und ihm – im schlimmsten Fall gleichzeitig – bei den unumgänglichen Pflichten beizustehen. Insofern kann ich sagen: Sein Tod war weniger ein Schock als mehr eine Erleichterung für mich.
Mein Vater muss geahnt haben, dass er aus dieser Operation nicht wieder lebend zurückkommen würde. Das merkte ich, als ich seine Sachen für ihn packte. Er lag zuerst wie leblos in seinem Bett. Dann packte er meinen Arm und zog mich zu sich herab. Mit undeutlichen Worten versuchte er, mir etwas mitzuteilen.
„Es gibt da noch ein paar Dinge“, sagte er heiser. „Dinge, die geklärt werden müssen.“
Ich sah die Dringlichkeit in seinem Blick. Aber er sprach schon seit Wochen verworren, deshalb beachtete ich das gar nicht.
Mein Vater musste das spüren. Er packte mich heftiger. „Es ist wichtig. Und ich schaff das nicht mehr. Deshalb musst du das jetzt machen.“
Seine weiteren Worte gingen in einem Hustenanfall unter. Er ließ mich los, und ich beeilte mich, seine restlichen Sachen zu packen. Als er mich dabei abermals am Arm nahm, befreite ich mich eilig und versicherte ihm in ruhigem Ton, dass ich mich schon um alles kümmern werde.
Das war das letzte Mal, dass wir miteinander sprachen.
Als ich das Krankenhaus verließ und in den Regen hinaustrat, dachte ich an all die unbequemen Pflichten, die jetzt auf mich zukommen würden. Eine Beerdigung musste organisiert werden. Ich hatte in den letzten Wochen immer wieder mit dem Gedanken gespielt, schon vor der Operation alles in die Wege zu leiten, aber irgendetwas hatte mich davon abgehalten. Vielleicht war es Moralempfinden. Ich weiß es nicht. Jetzt ärgerte ich mich darüber. Wenigstens ein Grab hätte ich organisieren können. Aber die unangenehmste Arbeit würde das kleine Haus am Rand der Stadt bedeuten, das jetzt leer geräumt, renoviert und wieder zum Kauf angeboten werden musste. Da ich keine Geschwister habe und damit das letzte Überbleibsel der Familie bin, fiel diese Aufgabe ganz alleine mir zu.
~
Es regnete noch immer, als am nächsten Morgen zwei Umzugswagen vor dem kleinen Haus vorfuhren, direkt am Rand eines Rapsfeldes. Die gelben Pflanzen tanzten unter den schweren Regentropfen, und ich erinnerte mich an den starken Geruch, der von diesem Feld ausging, wenn die Sonne schien. Meine Mutter liebte die Natur und ihre Düfte, Jasmin, Flieder und besonders Lavendel. Als sie noch am Leben gewesen war, hatte sie dieses Haus direkt am Feld ausgesucht, um hier gemeinsam mit meinem Vater in Ruhe ihren Lebensabend, wie sie es ständig nannte, verbringen zu können. Und das hatten sie dann auch getan, wenn auch der Lebensabend meiner Mutter um einiges kürzer ausgefallen war als der meines Vaters.
Im Haus gab es nur einen Gegenstand, den ich gleich an mich nahm, um ihn zu retten: Ein altes Foto von meiner Mutter, das auf der Anrichte im Wohnzimmer stand. Ich nahm es behutsam in die Hand und betrachtete es, während mehrere Arbeiter die Anrichte unter mir anhoben und wegtrugen. Das Schwarzweiß-Bild zeigte eine junge Frau mit zarten Gesichtszügen. Meine Mutter konnte damals kaum älter als zwanzig gewesen sein. Die alte Aufnahme hatte mich immer schon fasziniert. Sie ließ erahnen, wie schön meine Mutter damals gewesen war. Ihre dunklen Haare waren ordentlich zurückgelegt und glänzten seiden. Nur eine Locke hatte sich gelöst und fiel ihr frech in die Stirn. Sie schenkte dem Betrachter ein mildes Lächeln, das, wie ich immer fand, sehr traurig wirkte. Was meine Mutter damals gedacht haben muss, habe ich nie erfahren. Wenn ich sie zu der Zeit befragte, in der die Aufnahme gemacht wurde, dann hielt sie sich bedeckt. Ich erinnere mich an den einzigen Moment, in dem sie etwas von dem Geheimnis ihrer Vergangenheit Preis gab, nachdem ich keine Ruhe geben wollte. Sie sah mich mit verklärtem Blick an und sagte: „Weißt du, das ist so lange her... Vielleicht ist es besser, wenn man die Vergangenheit einfach vergisst und nicht mehr anrührt.“
„Entschuldigung?“
Ich fuhr aus meinen Gedanken hoch, als einer der schwitzenden Männer mich zur Seite schob. Ich steckte das Bild ein und verließ den Raum.
Mein restliches Interesse galt dem Weinkeller meines Vaters. Hier hielt ich mich fast die ganze Zeit über auf, während draußen herumgeschoben, -getrampelt und -geächzt wurde. Als die Arbeiter dann hereinkamen, um mir mitzuteilen, dass oben alles fertig war, wies ich sie an, auch hier alles auf den Müll zu werfen.
„Wie?“ fragte ein muskelbepackter Mann ungläubig, dessen Glatze vom Schweiß so sehr glänzte, dass sich die Deckenlampe darin spiegelte. „Das alles?“
Damit meinte er die knapp zweihundert Weinflaschen, die um uns herum aus den Wänden ragten.
„Ja“, sagte ich. „Die sind wertlos.“
Um meine Fachkundigkeit zu beweisen, zog ich eine Flasche hervor und deutete auf das Etikett. „Hier“, sagte ich. „Das ist ein Pinot Noir. Für den ist es viel zu kühl hier unten.“
Ich warf dem Arbeiter die Flasche achtlos zu. Erschrocken fing er den Rotwein auf. Dann sah er hinunter auf das Etikett.
„Alles wegschmeißen“, sagte ich.
Der Glatzkopf zögerte, während er auf die Weinflasche hinuntersah, die er in seinen Pranken hielt. Dann blickte er mich an. „Also, wenn Sie das hier nicht mehr brauchen...“
Ich erwiderte seinen Blick erwartungsvoll. Ich wusste schon, was er fragen wollte. Er hoffte ganz offensichtlich, ich würde ihm die Frage ersparen und einfach erlauben, dass er die Flaschen behielt. Aber ich wollte hören, wie er darum bat. Ich habe schon öfter gehört, ich hätte eine „schroffe Art“. Sogar mehr als einmal. Vielleicht stimmt das ja. Aber ehrlich gesagt: So ist es mir lieber, als wenn mir jemand zu nahe kommt. Ich finde es auf diese Art sogar angenehmer mit anderen in einem Raum zu sein. Schwer zu verstehen, dass es anderen nicht so geht. Der Glatzkopf jedenfalls sah mich nur verdattert an und sagte nichts mehr.
„Dann können sie in den Müll“, beendete ich seinen Satz.
Der Arbeiter nickte nur, und die Männer machten sich an die Arbeit.
Nun ereignete sich etwas, das eben die Geschehnisse in Gang setzte, derentwegen ich angefangen habe, all das hier aufzuschreiben. Als eines der schwersten Möbelstücke, ein großer Eichenschrank, von zwei der Männer in den Lastwagen für Schrott gebracht wurde, kam dahinter eine Tür zum Vorschein. Sie war über all die Jahre hinter dem Schrank verborgen gewesen. Mein Vater musste von der Tür gewusst haben, immerhin hatte er den Schrank hierher gestellt. Die Tür schien aber seit vielen Jahren nicht geöffnet worden zu sein, denn vom Boden herauf zog sich ein dichter weißer Mantel aus Staub und Spinnweben.
Ich zögerte einen Augenblick lang, ob ich die Tür öffnen sollte, um zu sehen, was dahinter war. Etwas an dem Gedanken, dass mein Vater mit Absicht diese Tür verbarrikadiert hatte, schreckte mich ab. Hatte er etwas verstecken wollen? Doch dann fand ich diesen Gedanken lächerlich. Wahrscheinlich hatte er einfach keinen Gebrauch von der Tür gemacht und den Schrank achtlos davor gestellt.
Nur um sicherzugehen, dass ich nichts im Haus übersah, betätigte ich die Türklinke. Die Tür war nicht verschlossen und öffnete sich mit einem kurzen Knarren. Dahinter befand sich nichts weiter als ein kleiner, stockfinsterer Raum. Ich suchte einen Moment lang an der Wand neben der Tür nach einem Lichtschalter, fand aber keinen.
Ich holte eine Taschenlampe und erhellte damit die Kammer. Der fensterlose Raum war nur sehr klein – und er war leer. Leer bis auf eine klapprige Staffelei, die einsam in der Mitte der Kammer stand. Sie war verhüllt von einem weißen Leintuch, das im Taschenlampenlicht gespenstisch leuchtete.
Ich ließ den Taschenlampenkegel eine Weile auf den Falten des Leintuches ruhen, bis ich mich langsam näherte. Der helle Lichtkreis auf dem Tuch wurde schärfer, bis ich direkt vor der Staffelei stand und das Laken langsam zur Seite zog. Der dünne Staubfilm auf dem Laken löste sich und hüllte mich in eine unangenehme Wolke, als das Laken zu Boden fiel und das Bild enthüllte.
Es war kein sehr großes Bild. Es maß vielleicht einen Meter in der Breite und einen halben in der Höhe, und es war eingefasst in einen schlichten Rahmen aus dunklem Holz. Es war anscheinend ein Ölgemälde, gehalten in sehr dunklen Tönen, soweit ich das im Licht der Taschenlampe beurteilen konnte. Es zeigte ein Haus, das einsam auf einer kleinen Anhöhe lag. Das Haus war sehr groß, es handelte sich eher um eine Art Anwesen, dessen dunkle Fenster keinen Blick auf das Innere zuließen. Es schien aber verlassen zu sein.
Ich beschloss, das Gemälde mitzunehmen, um es zu Hause genauer zu untersuchen. Mein Vater musste immerhin einen bestimmten Grund gehabt haben, es im Keller aufzuheben. Wer weiß, vielleicht war es ja wertvoll? Das hätte erklärt, warum mein Vater es über all die Jahre versteckt gehalten hatte. Verwundert hätte es mich nicht, dass er in diesem Fall nicht mal uns, seiner eigenen Familie, vertraute.
~
Der Tag war lang gewesen. Zu Hause wollte ich gleich schlafen gehen, nachdem ich alle Gegenstände, von denen ich mir noch Verwendung erhoffte, in meine Wohnung gebracht hatte. Ich stellte das Gemälde samt der Staffelei und dem Leintuch in den Flur vor der Eingangstür. Das Wohnzimmer war für mich ein heiliger Ort, den ich auf keinen Fall mit dem Schrott aus dem Haus meines Vaters entweihen wollte. Vielleicht wird jeder Ort der Zuflucht zu etwas Heiligem. Ich bin kein Gesellschaftsmensch. Das war ich noch nie. Die Nähe zu anderen macht mich nervös. Ich weiß nicht, weshalb das so ist, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Dazu gehört, dass ich einen Ort brauche, an den ich mich abends zurückziehen kann wie in einen Schildkrötenpanzer. Und das Gemälde, da bin ich mir sicher, hätte dieses Gefühl zerstört.
Als ich das Wohnzimmer betrat, weckte ich Ben auf. Er hatte auf der Couch gesessen und geschlafen. Als er mich sah, war er sofort wach.
Ich gebe ja zu: Vollkommen alleine zu sein, das würde auch mich auf Dauer mürbe machen. Das Bedürfnis nach Gesellschaft ist wahrscheinlich zu tief verwurzelt. Ein Relikt aus Zeiten, als man andere Menschen brauchte, um auf Mammutjagd zu gehen, vermute ich. All das ist jetzt überflüssig. Gott sei Dank. Aber auch ich kann mich der Angst vor der Einsamkeit nicht verschließen. Also habe ich eine Lösung gefunden.
„Na, hast du mich vermisst?“ fragte ich und strich Ben mit der Hand über den Kopf.
Während der Kater sich an meine Hand schmiegte, sah es aus, als nicke er. Er gab ein leises Schnurren von sich, dann räkelte er sich und gähnte herzhaft. Mit weit ausladenden Schritten tappte Ben zu seinem Napf.
„Ich hab keine Ahnung, was ich mit diesem Bild anstellen soll“, sagte ich, während wir aßen. „Behalten will ich es auf jeden Fall nicht.“
Ben hob den Kopf und sah mich überrascht an.
Ich lehnte mich über die Kante des Esstischs. „Ja, was schaust du denn so? Was soll ich damit? Hübsch ist es nicht. Aber mein Geschmack ist so was ja sowieso nicht.“
Ben senkte wieder den Kopf und aß weiter. Er musste eigentlich wissen, dass ich mir nicht viel aus Kunst mache. Es gibt keine Bilder an meinen Wänden. Ich habe keinen Gefallen an dem Artifiziellen. Ich bin der Meinung, dass der Mensch zu keiner beeindruckenden Leistung in der Lage ist, solange er sich dabei nur auf seine eigenen Fähigkeiten stützt. Ich habe einmal auf einer Weintour durch Frankreich einen Zwischenstopp in Paris gemacht und dort den Louvre besucht. Ich habe die Mona Lisa zwischen den Menschenmassen, die sich die Hälse verrenkten, hindurch gesehen. Und ich konnte nicht verstehen, was an ihr so besonders sein soll. Ein winziges Bild von einer nicht gerade ansehnlichen Frau. Mehr war es für mich nicht. Am beeindruckendsten war für mich das Gesamtbild, das sich mit ihr und den Besuchermassen ergab: Hunderte von Menschen, die sich vor dem Bild drängten, während diese kleine Frau mit gebieterischem, fast höhnischem Lächeln auf sie herabsah.
Nein, das ist wirklich nicht meine Sache. Spannend wird menschliches Schaffen für mich erst dann, wenn es dazu dient, Vorgänge in der Natur zu ihrer höchsten Entfaltung zu bringen. Zum Beispiel Beeren bei ihrem Wachstum zu unterstützen, im exakt richtigen Moment zu lesen und dann unter den perfekten Bedingungen alkoholischen Saft herzustellen. Deshalb zieren auch Weinflaschen und die verschiedensten Teile alter Fässer und Pressen meine Wohnung.
Mit einem Plopp zog ich den Korken aus einer Flasche Trollinger vom Vorjahr. Kein sehr guter Wein, aber ich hatte ihn geschenkt bekommen, da ich den Winzer sehr gut kannte.
„Wenn ich Glück hab, ist das Bild wertvoll“, sagte ich. „Vielleicht deckt das wenigstens einen Teil der Kosten, die ich jetzt habe.“
Ben sah mich an. Dann gähnte er breit.
Mit meinem Weinglas in der Hand, ging ich in den Flur. Hier nahm ich das Tuch vom Gemälde, um es mir im helleren Licht noch einmal anzuschauen. Während mein Blick über das finstere Gebäude mit seinen hohlen Augen fiel, entdeckte ich etwas, das mir im Licht der Taschenlampe entgangen war: In einem der obersten Fenster schien so etwas wie eine menschliche Gestalt zu stehen. Sie war nur schwach erkennbar gegen das hintergründige Schwarz. Aber dieses eine Fenster war eindeutig nicht leer. Ein dunkler Schemen zeichnete sich darin ab, der eher als menschliche Gestalt zu erahnen als zu erkennen war. Der Blick dieser Gestalt schien jedoch direkt vom Fenster aus auf den Betrachter, in diesem Fall also mich, gerichtet zu sein.
Aus irgendeinem Grund fröstelte ich bei diesem Gedanken, und einer unbestimmten Eingebung folgend, deckte ich das Gemälde wieder ab. So ließ ich die Staffelei im Flur zurück und ging ins Bett.
Kapitel 2
Den nächsten Tag nutzte ich, um die letzten Dinge zu erledigen. Während die Arbeiter die Kellerräume des kleinen Hauses meiner Eltern ausräumten, sah ich nochmal alles durch, was ich mitgenommen hatte. Mehr als die Hälfte davon war Schrott, den ich heute noch entsorgen wollte. Als ich wieder zu dem Bild kam, war mir klar, dass ich erstmal den Rat eines Experten einholen musste. Wenn es wertvoll war, dann würde ich es auf jeden Fall verkaufen.
Als ich das Leintuch abnahm, um das Bild nochmal anzusehen, war es mir, als führe mir jemand mit klammer Hand über den Rücken. Mir fiel sofort auf, dass das Fenster, in dem ich noch am Vorabend eine Person gesehen hatte, leer war.
Ich suchte die anderen Fenster des Hauses ab, in der Hoffnung, mich geirrt zu haben. Aber auch sie waren allesamt leer. Also nahm ich mir nochmal das Fenster vor, von dem ich mir sicher war, gestern Abend hier eine Gestalt gesehen zu haben. Doch ich konnte beim besten Willen nichts darin erkennen. Ich näherte mich mit dem Gesicht der Leinwand, betrachtete sie aus verschiedenen Winkeln und wendete sie im Licht der Deckenlampe. Doch das Fenster blieb einzig und allein von einem einheitlichen Schwarz erfüllt. Langsam kam mir der Gedanke, mich gestern Abend geirrt zu haben. Ich war immerhin todmüde gewesen von den Anstrengungen des Tages, als ich das Bild untersucht hatte.
Aus einem mir unerklärlichen, dafür aber umso stärkeren Bedürfnis heraus, deckte ich das Bild wieder ab, um es sofort wieder zu enthüllen. Es änderte sich aber nichts. Ich ließ das Laken darüber fallen und machte mich daran, den überflüssigen Krempel aus dem Flur zu schaffen.
~
Am frühen Nachmittag machte ich mich auf den Weg zu einem Antiquariat, das ganz in meiner Nähe lag. Eingehüllt in das weiße Leintuch, trug ich das Bild aus dem Haus. Ich widerstand der Versuchung, nochmal unter das Tuch zu sehen. Diesen Moment wollte ich mir für den Besuch beim Antiquar aufheben. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht wollte ich dabei nicht allein sein.
Wenig später trat ich mit dem eingehüllten Bild in einen engen Raum, der vollgestopft war mit Möbeln, Bildern, Vasen, Statuen und allerlei Kitsch. Ein enger Weg schlängelte sich zwischen dem Ramsch hindurch zu einem hölzernen Tisch, auf dem eine grüne Schirmlampe neben einer altmodischen Kassenmaschine stand. Ich setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Aber obwohl ich von ziemlich hagerer Figur bin, war zu wenig Platz. Rumpelnd viel ein hässlicher nackter Engel mit Pausbacken um. Er wälzte sich auf den Rücken und sah mich mit dämlichem Blick aus wässrig-blauen Augen an.
„Sagen Sie mal!“
Der Antiquar kam angerollt. Der Mann war von raumgreifendem Umfang, und sein geringelter Schnauzbart bebte vor Empörung. Mir war es sofort ein Rätsel, wie er sich hier drin bewegen konnte, ohne ständig irgendetwas platt zu walzen.
„Entschuldigung“, sagte ich. Ich musste aber wenig überzeugend geklungen haben. Wütend bückte sich der Antiquar nach dem Engel, wobei ein Goldkettchen mit einem winzigen Kreuz vor seinem Gesicht umherbaumelte. Er stellte den Engel auf eine brusthohe Anrichte, von wo er mich mit seinen wässrigen Augen trotzig anglotzte.
„Könnten Sie sich das hier mal ansehen?“ fragte ich. Dabei hielt ich dem Mann das eingehüllte Bild hin.
Der Antiquar nahm mir das Bündel wenig behutsam ab. „Was ist das?“ fragte er unwirsch.
„Ein Laken“, erwiderte ich.
Der Gesichtsausdruck des Antiquars ähnelte nun erschreckend dem des Keramik-Engels. Ich besann mich schnell. Es war keine gute Idee, den Mann zu verärgern. Immerhin wollte ich etwas von ihm. Und ich war von seiner ehrlichen Meinung abhängig, was den möglichen Wert des Gemäldes anging. Ich würde mir noch weitere Meinungen einholen, aber es war klüger, mir nicht mehr Arbeit als nötig zu machen.
„Es ist ein Bild“, sagte ich. „Ein Gemälde. Es hat meinem Vater gehört, jetzt ist er tot, und ich möchte es verkaufen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mal einen Blick darauf werfen könnten, um zu sehen, wie viel es wert ist.“
„Mhm“, machte der Dicke und sah mich noch einen Moment prüfend an. Ich versuchte, ein charmantes Lächeln aufzusetzen. Anscheinend funktionierte es. Der Dicke wirkte auf einmal weniger verdrießlich. „Na, dann wollen wir mal sehen“, sagte er und enthüllte das Bild.
Ich stellte mich neben ihn, um im selben Moment wie er den Blick auf das Gemälde werfen zu können. Als die Leinwand frei war, erkannte ich, dass das Fenster leer war. Erleichterung machte sich in mir breit. Ich hatte mich am Vorabend wirklich geirrt.
Der Antiquar ließ seinen Blick eine Weile auf dem Bild verweilen. Ich versuchte, seinen Gesichtsausdruck zu deuten, aber er blieb während seiner Prüfung völlig neutral.
„Was meinen Sie, wie alt ist es?“ fragte ich schließlich.
„Na ja, der Leinwand nach zu urteilen ist es nicht sehr alt“, sagte er.
Meine Enttäuschung blieb ihm nicht verborgen. Er sah mich fast hämisch an und besah dann das Bild noch einmal. Diesmal wendete er es etwas, als suchte er nach etwas Bestimmtem, und drehte es dann um.
„Hm“, machte er.
„Was, hm?“ fragte ich.
Wir sahen uns an. Der Blick des Antiquars war herausfordernd. Er erwiderte aber nichts. Stattdessen wandte er sich erneut der Rückseite des Gemäldes zu. Schließlich fragte er: „Wissen Sie, von wem das ist?“
„Ich weiß gar nichts über das Bild.“
„Es scheint keine Signatur drauf zu sein.“
Der Antiquar sah eine Weile ratlos auf das Bild, dann wandte er sich wieder mir zu. „Kann ich es aus dem Rahmen nehmen? Vielleicht finden wir auf der Rückseite der Leinwand etwas.“
Ich nickte nur, und der Antiquar nahm die Leinwand vorsichtig aus dem Rahmen. Die Rückseite war allerdings vollkommen leer. Nirgendwo ließ sich auch nur der geringste Hinweis auf den Maler finden.
„Tja, tut mir leid“, sagte der Mann, während er das Bild zurück in den Rahmen steckte. „Ich fürchte, sonderlich viel kann ich Ihnen nicht dafür nicht geben. Hübsch ist es auch nicht, wissen Sie...“
Ich sah den Antiquar verblüfft an. „Sie meinen, im Gegensatz zu...“ Anstatt weiterzusprechen, breitete ich die Arme zu einer allumfassenden Geste aus, in die ich besonders den dicken Engel hinter mir mit einschloss.
Mit einer energischen Bewegung hielt der Antiquar mir das Bild hin. „Verkaufen Sie es oder gehen Sie einfach wieder. 50 Euro.“
Ich überlegte kurz. Sollte ich es an ihn verkaufen? Ein unbestimmtes Gefühl deutete mir, dass es falsch wäre, dieses Bild so einfach loszuwerden. Es war immerhin von meinem Vater an diesem eigenartigen Ort aufbewahrt worden, unzugänglich für jeden, von dem er nicht wollte, dass er es fand.
Also entschied ich mich dazu, das Bild erstmal nicht wegzugeben.
„Ich denke, ich werde mir noch eine weitere Meinung einholen“, sagte ich.
„Tja, ich glaube, niemand wird Ihnen mehr dafür bieten“, erwiderte der Antiquar. „Aber falls Sie einen Experten zu Rate ziehen wollen, dann gehen Sie am besten zu der Pinakothek. Vormittags können Sie da das Bild vorlegen und es wird dann von einem Gutachter geprüft.“
Ich nickte nur dankend und verabschiedete mich.
Zu Hause stellte ich das Bild zurück auf die Staffelei und deckte es wieder zu, wie aus einer alten Gewohnheit heraus. So hatte ich es gefunden und so schien es mir auch zu gehören.
~
Am späten Abend befanden sich nur noch die Staffelei und mehrere Kartons mit übrig gebliebenen Unterlagen meines Vaters im Flur. Ich hatte diesen Moment lange mit Qual vor mir hergeschoben, aber jetzt schien es mir auf einmal angebracht, doch wieder einen Blick unter das Leintuch zu werfen. Aus welcher Eingebung heraus ich auch den Abend abgewartet hatte, ich musste einfach einen weiteren Blick auf das Fenster werfen. Mir war klar, wie lächerlich das war. Aber es war wie ein Zwang, der mich nicht mehr losließ. Und jetzt war es für mich soweit. Draußen war es schon dunkel und das Bild wurde nur noch durch das Deckenlicht meines Flurs erhellt, als ich das Leintuch abnahm und wie erstarrt auf diese eine Stelle auf dem Gemälde sah.
Das Fenster war nicht mehr leer. Wie am vorangegangenen Abend war schwach die Form einer Gestalt im Fensterrahmen zu erkennen. Während ich spürte, wie mich ein tiefes Frösteln befiel, ließ ich das Laken fallen. Ehe ich mich versah, hatte ich das verfluchte Bild gepackt und mit weit ausgestreckten Armen hinunter zum Müllcontainer getragen, in dem es krachend verschwand.
Ich blieb noch einen Moment lang so stehen, dann stieg ich die Treppe des Hauses wieder rauf in meine Wohnung. Eine Weile starrte ich aus dem Fenster hinunter auf den Container, in dem das Gemälde lag. Dann drehte ich mich auf dem Absatz um, verließ meine Wohnung und fischte das Bild wieder aus dem Müllcontainer. Mit hastigen Schritten trug ich es runter in den Keller, in dem es diese Nacht bleiben sollte. Ich konnte es nicht wegwerfen. Irgendetwas an diesem Gemälde ließ mir keine Ruhe. Ich hatte keine Ahnung, was es für eine Bedeutung hatte. Aber ich spürte, dass es mich ab jetzt verfolgen würde, egal, was ich tat. Ich würde es nicht mehr loswerden. Es sei denn, ich kam seinem Geheimnis auf die Spur.
Am nächsten Tag, so beschloss ich, würde ich tatsächlich in die Pinakothek gehen, um es dort einem Experten vorzulegen.
Kapitel 3
Soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen kann, ist das Bild keine hundert Jahre alt.“ Der ältere Mann rückte seine Brille auf der Nase zurecht. Dann hob er wieder die Lupe und musterte das Bild erneut. „Wahrscheinlich weitaus weniger.“
„Das hab ich mir schon gedacht“, sagte ich.
„Ein Urteil über den finanziellen Wert kann ich Ihnen leider nicht geben“, sagte der Alte und wischte sich mit der Hand die Haare zurecht. Eine absurde Geste, denn sie bestanden aus gerade mal fünf weißen Strähnen, die er von seiner linken Schläfe über die Kopfplatte zur rechten gelegt hatte.
„Das ist schon in Ordnung“, erwiderte ich. Es gab etwas, das mir jetzt wichtiger war. „Sagen Sie, ist es möglich, dass man bestimmte Farben so aufträgt, dass sie manchmal zu sehen sind und manchmal nicht?“
„Wie?“ Der Konservator sah mich an.
„Na ja...“ Ich überlegte, wie ich meine Frage in Worte kleiden konnte, ohne merkwürdig zu wirken. „Gibt es vielleicht Farben, die man nur bei Tageslicht sieht? Oder nur in bestimmten... Zeitintervallen?“
Der Konservator blickte verständnislos drein.
„Es ist so“, erklärte ich. „Ich hab das Gefühl, abends oder nachts immer etwas auf dem Bild zu sehen, das man jetzt nicht sieht.“
Der ältere Mann schüttelte langsam den Kopf. „Nein, so etwas gibt es nicht. Es gibt fluoreszierende Farbstoffe, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Die können zum Beispiel durch UV-Strahlung angeregt werden. Die emittieren dann sichtbares Licht und scheinen zu leuchten. Lumineszenz heißt das oder auch kaltes Leuchten. Aber das lässt meistens schon nach nicht mal einer Sekunde nach. Anders ist es bei der Phosphoreszenz -“
„Das meinte ich nicht“, unterbrach ich den Alten unwirsch. Er sah mich leicht beleidigt an, doch ich ignorierte das. Ich überlegte, wie ich weiter vorgehen sollte. „Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, herauszufinden, wo das Bild gemalt wurde?“ fragte ich schließlich.
„Wo es gemalt wurde?“
„Ja. Ich wüsste gerne, von wem das Bild stammt. Da es keine Signatur gibt, dachte ich, ich käme vielleicht weiter, wenn ich wüsste, wo das Bild herkommt.“
Der Konservator schüttelte wieder den Kopf. „Wenn das Bild älter wäre, würde es gehen. Dann könnte uns der Stil etwas sagen. Viele Bilder kann man auf Epochen datieren, in denen es gewisse künstlerische und stilistische Bewegungen gab. Aber die liegen über hundert Jahre zurück. Heute sieht ja alles irgendwie aus oder ahmt nur irgendwas nach. Nicht wie zu Zeiten, als ein Stil noch ein Ausdruck war -“
Die Stimme des Konservators verklang in meinen Ohren. Ich war enttäuscht. Ich hatte gehofft, hier vielleicht einen Schritt weiterzukommen bei der Suche nach der Bedeutung dieses Bildes. Jetzt hatte ich keine Ahnung, wie ich weitermachen sollte. Aber dann merkte ich, dass der Alte in seinem Referat inne gehalten hatte und auf einmal zu grinsen begann.
„Was ist denn so lustig?“
„Na ja“, sagte er. „Ich hab gesagt, mit meinen Mitteln hier ist der Ursprungsort nicht zu finden.“ Er deutete auf das Bild. „Aber es gibt auch andere Wege. Hier, sehen Sie!“
Mein Blick folgte seinem Zeigefinger zu einer Stelle auf dem Bild. Sie lag hinter dem großen Gebäude in der Dunkelheit.
„Was ist dort?“ fragte ich.
„Es ist nur schwer zu erkennen“, erklärte der Konservator. „Das Bild ist hauptsächlich in dunklen Tönen und nicht gerade sehr kontrastreich gehalten. Aber dieser Berg da, den kenne ich.“
Erst jetzt erkannte ich in einem der dunklen Schemen hinter dem großen Haus einen Berg, der sich schwach von dem dunklen Nachthimmel abhob.
„Sie kennen den Berg?“
„Ja. Das ist der höchste Berg der Sudeten. Die Schneekoppe.“
Ich sah den alten Mann an. „Die Schneekoppe?“
„Ja. Hier, ganz schwach erkennt man zwei Erhebungen auf der Bergspitze. Das soll wahrscheinlich das Observatorium sein. Na ja, hier verlieren sich die Details.“
„Sind Sie sich sicher?“
„Nein, sicher bin ich mir nicht. Ich meine, das hier ist Dunkelgrau auf Schwarz. Aber was zu erkennen ist, das sieht genauso aus wie der Berg, wo ich mit meiner Frau immer zum Skifahren hingehe. Seit meinem vierzigsten Geburtstag machen wir das jeden Januar. Bisher waren immer unsere Nachbarn mit, die Sundmachers, aber er hatte jetzt Nierensteine und -“
„Dankeschön!“ unterbrach ich und überlegte. „Das heißt, wenn das da die Schneekoppe ist...“
„...dann ist das Motiv irgendwo am Riesengebirge“, vollendete der Alte meinen Satz. „Wahrscheinlich in Tschechien.“
Bei der Erwähnung von Tschechien horchte ich auf. Mein Vater war in der Tschechoslowakei aufgewachsen, soweit ich wusste. Er kam aus einem kleinen deutschstämmigen Dorf, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnerte. Ich wusste, dass mein Vater irgendwann mit meiner Mutter nach Westeuropa gezogen war. Über seine Jugend wusste ich kaum etwas.
„Tschechien?“ wiederholte ich.
„Ja, wahrscheinlich. Viel weiter kann ich Ihnen leider nicht helfen. Tut mir leid.“
Ich nickte geistesabwesend und machte mich ans Gehen, bevor ich von einem neu anschwellenden Redefluss überschwemmt werden konnte. Das Treffen war enttäuschend gewesen. Aber womöglich reichte mir die spärliche Information, die ich bekommen hatte, ja schon aus.
Ich nahm das Bild an mich und fuhr zurück nach Hause, wo ich es erstmal wieder im Keller einschloss. Dann machte ich mich an die Durchsuchung der Kartons, die noch in meinem Flur standen.
Als ich die erste Kiste aufklappte, wurde mir bewusst, was ich mir da vorgenommen hatte. Der Karton war vollgestopft mit Aktenordnern und zusammengebundenen Papierstapeln, die von Unterlagen und Formularen nur so strotzten. Nur einen dieser Ordner durchzugehen würde Stunden dauern. Und ich hatte sechs weitere Kartons in meinem Flur stehen.
Ärgerlich leerte ich die Kiste auf dem Boden aus. Dann schob ich den Haufen an Unterlagen auseinander, so dass ich bald einen Überblick über alles bekam, was sich in dem Karton befunden hatte. Ich hoffte, auf diese Weise vielleicht einen Hinweis zu finden, ohne die Ordner durchsuchen oder die Papierstapel aufbinden zu müssen.
Ich ließ meinen Blick langsam über das Chaos wandern. Ein riesiger Haufen Papier – das blieb also übrig, wenn ein Mensch starb. Die letzten Zeugen und Beweise eines Menschenlebens befanden sich zwischen Aktendeckeln oder wurden von Paketschnüren zusammengehalten. Und das meiste davon würde sowieso auf dem Müll landen. Ein frustrierender Gedanke. Würde es bei mir auch irgendwann mal so aussehen? Würde nach meinem Ableben auch irgendjemand all die Unterlagen, die ich notgedrungen sammeln musste, fluchend in Kartons herumschleppen, um sie dann auf den Müll zu schmeißen? Wahrscheinlich schon. Aber wer? Ich war der letzte aus meiner Familie. Bei mir würde es wahrscheinlich irgendein Beamter sein. Irgendjemand, der meinen Namen auf einem der Ordner las – und am nächsten Tag schon wieder vergessen hatte.
In diesem Moment fiel mir etwas ins Auge. Es waren mehrere kleine Gegenstände, die unter einem Aktenordner hervorlugten. Ich bückte mich und zog sie hervor. Es waren abgelaufene Reisepässe. Zwei davon stammten aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Ich klappte den obersten auf. Er war im Jahr 1959 ausgestellt worden und gab einen Ort namens Byscovice als Wohnort meines Vaters an. Volltreffer. Das war der Name des Dorfes, von dem mein Vater einmal erzählt hatte. Das Datum konnte ungefähr mit der Entstehungszeit des Bildes zusammenfallen.
Was genau ich jetzt mit dieser Information anfangen sollte, wusste ich selbst nicht. Doch der Gedanke an dieses Bild, das unten in meinem Keller stand und wahrscheinlich viele Jahre bei meinem Vater in einem versteckten Raum geruht hatte, ließ mich nicht los. Und den ersten Hinweis auf seine Herkunft hielt ich jetzt in der Hand.
Ich griff zum Telefon und wählte die Nummer meines Chefs.
Als ahnte er mein Vorhaben, kam Ben zu mir und schmiegte sich an mein Bein. Ich ging in die Hocke und streichelte ihn besänftigend.
„Ich brauche noch eine Woche Urlaub“, sagte ich. „Ich muss einfach wissen, wer dieses Bild gemalt hat und warum es bei uns im Keller war.“
Ben sah mich fragend an. Eine sinnvolle Antwort konnte ich ihm leider nicht geben. „Wahrscheinlich wünsche ich mir einfach, dass es für alles eine ganz simple Erklärung gibt“, versuchte ich es. „Hauptsache, ich bekomme eine Erklärung. Und wenn mein Vater in Byscovice aufgewachsen ist, dann gibt es da bestimmt noch Leute, die ihn kannten. Vielleicht können die mir ja irgendwas über das Gemälde sagen.“
Bens Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Und erst jetzt verstand ich, was er wissen wollte. „Ich kann dich leider nicht mitnehmen“, sagte ich. „Die Reise ist zu anstrengend.“
Am Telefon erklang jetzt das wiederholte Tuten des Wartezeichens. Ben sah mich unverwandt an. „Jetzt schau nicht so!“ fuhr ich ihn an. Die durchdringenden, grünen Augen schienen etwas Vorwurfsvolles zu haben. Schließlich gab ich nach. „Na gut, in Gottes Namen! Du kannst mitkommen.“
Den Schwanz triumphierend aufgerichtet, trottete Ben davon. Wieder hat er mich um den Finger gewickelt, dachte ich ärgerlich, als die Sekretärin meines Chefs ans Telefon ging.
Kapitel 4
Ungeduldig trat ich von einem Fuß auf den anderen. Ich merkte, wie die Schlammschicht unter meinen Schuhsohlen dabei immer dicker wurde. Die Regentropfen trommelten auf den schwarzen Schirm ein, den ich in der Hand hielt. Hinter dem dichten Wasserschleier um mich herum erkannte ich vier Menschen. Einer von ihnen war der Priester, der mit Leibeskräften gegen das laute Prasseln des Regens anschrie. Die zweite Person war ein Ministrant, der, den linken Arm eng um sich geschlungen, neben ihm stand und ihm den Schirm hielt. Ich sah, wie am Rocksaum seines Talars der Matsch hinaufkroch. Die beiden anderen Männer kannte ich nicht. Wahrscheinlich waren es ehemalige Kollegen meines Vaters, die die Anzeige in der Zeitung entdeckt hatten.





























