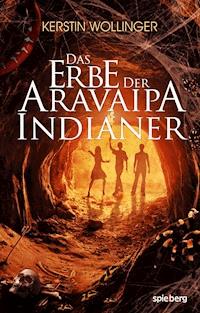
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Spielberg Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Tom versteht die Welt nicht mehr. Nicht nur, dass er aus seiner Heimatstadt an der Ostküste nach Arizona in das Haus seines neuen Stiefvaters mitumziehen musste, hat er dort im Keller auch noch ein seltsames Erlebnis. Woher kommen nur diese Trommelgeräusche und was ist eigentlich mit seinem mysteriösen Indianer-Nachbarn Wakanda los? Alles scheint mit einem einzigen Ereignis zusammenzuhängen: Einer furchtbaren Begebenheit, die den Aravaipa-Indianern vor 150 Jahren in der Gegend widerfuhr. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden Isabell und Mickey will Tom mehr darüber herausfinden und macht sich auf eine gefährliche Entdeckungsreise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Übersetzung
Kapitel 1
Nach einer endlosen Fahrt im alten, aufgeheizten Volvo erreichten wir endlich unser Ziel: Dudleyville. Dudleyville in Arizona. Dies sollte ab sofort mein neues Zuhause sein. Ohne meinen richtigen Vater, ohne meine richtigen Freunde, ohne meine alte Schule. Den Kopf an die Scheibe gelehnt, begutachtete ich nun genervt dieses Niemandsland, in dem anscheinend nicht einmal Pflanzen wachsen wollten. Wo man auch hinsah, überall nur Prärie. Prärie aus rotbrauner Erde. Alles war hier wohl rotbraun. Nur einzelne, halb verdorrte Sträucher zierten die endlose Landschaft wie grün-braune Tupfen.
Richard setzte den Blinker links und bog von der verlassenen Hauptstraße in eine noch verlassenere Nebenstraße ein. Diese führte einen kleinen Hügel hinauf, an deren Ende ganz oben ein allein stehendes Haus mit Holzfassade zu erkennen war. Alles wirkte wie aus einem schlechten Westernfilm.
Neben dem Haus erhob sich ein riesiger Baum und warf einen großen Schatten auf die Veranda.
„Ach du meine Güte“, motzte ich, geschockt von dem Bild, das sich mir da bot. Vicky, meine große Schwester, verpasste mir sofort einen gekonnten Schlag in die Rippengegend, der mich aufschreien ließ.
„Tom, es wäre nett, wenn du Richard und mir ein wenig Respekt entgegenbringen und dir das Haus zumindest erst einmal ansehen könntest, bevor du wieder mit dem Nörgeln anfängst!“, erwiderte meine Mutter genervt vom Beifahrersitz aus. Ich wollte mich wirklich zusammenreißen, denn sie hatte meinetwegen in letzter Zeit genug mitgemacht. Ich konnte ihr nicht schon wieder Sorgen bereiten. Aber diese Bruchbude konnte ja wohl nicht ihr Ernst sein!
Mein Vater, der geniale Geschichtsforscher Daniel Brown, „DER MANN MIT DEM RICHTIGEN RIECHER“, wie ihn die New York Times kürzlich in einem Artikel nannte, hatte unsere Familie vor etwa einem Jahr verlassen. Er hatte viele Monate vor der Küste Irlands nach einem versunkenen, britischen Handelsschiff gesucht und schließlich einen der bedeutendsten Schätze der Neuzeit entdeckt. Alle, inklusive meiner Mutter, hielten ihn damals für verrückt, doch am Ende hatte er wohl tatsächlich „den richtigen Riecher“ gehabt. Man hätte glauben können, dass sich die Streitereien zwischen Mama und Dad nach diesem Fund gelegt hätten, doch leider wurde es danach eher schlimmer. Hatten sie vorher immer diskutiert, dass er so viel Zeit, Kraft und Geld darin investierte, einen „alten Kutter“ zu finden, wie meine Mama es nannte, war er nach dem Fund wieder kaum zuhause wegen diverser Vorträge und Pressetermine.
„Ich kann einfach nicht Karriere und Familie unter einen Hut bringen! Nicht in meinem Job, in meiner Position!“, hatte er meiner Mutter bei einem der nächtlichen Streitigkeiten entgegengebrüllt. Auch sie hatte längst keine Lust mehr auf diese Ehe gehabt, ohnehin war sie die letzten Jahre meist mit uns allein gewesen. In dieser Zeit war sie oft mies gelaunt oder weinte sich in den Schlaf, wenn er wieder einmal einen Auslandsaufenthalt um einige Tage verlängert hatte und sie mit uns Kindern und dem Haus alleine ließ. Ich liebte meinen Vater. Natürlich, er war ja mein Vater! Aber wirklich viele gemeinsame Erinnerungen hatte ich nicht. Er war einfach nie da gewesen. Ausgrabungen in Griechenland, Tagungen in New York, Vorträge in Tokio, die ewige Jagd nach alten Schätzen und neuen Forschungsergebnissen, all das hatte ihn irgendwann mehr fasziniert als seine eigene Familie. Ich denke schon, dass er uns vermisst, aber seine Sucht nach der Entdeckung neuer, alter Schätze war wohl stärker.
„Eure Mama und ich werden auf jeden Fall immer Freunde bleiben!“, hatte er gequält erklärt, als er dann eines Tages mit den Koffern in der Tür stand, um uns endgültig zu verlassen.
„Manchmal geht es einfach nicht anders, doch wir lieben euch beide sehr und werden immer eine Familie bleiben!“
Nach dieser ergreifenden Rede hörte ich erst einmal drei Wochen lang kein Sterbenswörtchen von ihm. Füreinander da sein – dass ich nicht lache!
Ich war nun gerade mal 14 Jahre alt und musste mein Leben ohne Vater meistern. Musste der Starke in der Familie sein – für meine Mutter und für Vicky. Es ist und war ein ziemlich trauriger Gedanke, so im Stich gelassen zu werden und so gab es im letzten Jahr viele Tage, an denen ich einfach keine Lust auf gar nichts hatte. Nicht auf Schule, nicht auf meine alten Freunde, nicht auf Vicky, nicht auf Mama. Das mit dem Starksein wollte nicht so funktionieren, wie ich mir gedacht hatte.
Oft fühlte ich mich furchtbar, weil ich so wütend auf meinen Vater war. Besonders, wenn andere von ihren tollen Wochenenden erzählten und davon, was sie nicht alles mit ihren Daddys unternommen hatten.
Auch wenn wir uns oft in die Haare kriegten – aber mit Vicky konnte ich manchmal ganz gut über alles sprechen und rauslassen, was mich bedrückte. Meine Schwester war allgemein ein sehr kluger Mensch. Statt ihrer 16 Jahre hätte man sie auch auf 19 oder 20 schätzen können, weil sie älter aussah und immer auf alles eine Antwort wusste. Und sie machte sich nie etwas aus der Meinung anderer. Auf viele in der Schule wirkte sie deshalb arrogant, aber ich wünschte mir oft, so selbstsicher wie sie zu sein. Auch sie wollte nach der Trennung unserer Eltern stark sein für unsere Mama, kümmerte sich mehr um den Haushalt und um alles, was so anfiel.
Jedenfalls war das Jahr nach der Trennung für uns alle nicht leicht gewesen, besonders nicht für unsere Mutter. Noch dazu mussten wir, trotz Unterstützung meines Vaters, sehen, wo wir finanziell blieben. Das riesige Haus, in dem wir in Bridgewater lebten, war noch nicht abbezahlt und der Job in der Werbeagentur, den meine Mutter hatte, warf gerade mal so viel ab, um die laufenden Kosten zu decken. So veränderte sich mein Leben damals von einem Tag auf den anderen. Von einem Tag auf den anderen war alles anders.
Als Mama dann Richard kennenlernte, waren Vicky und ich erst einmal geschockt. Er war ein Kollege und arbeitete mit ihr in der Werbeagentur. Meiner Mutter ging es endlich wieder besser und sie blühte regelrecht auf. Doch je besser es ihr ging, desto genervter war ich von den beiden. Wie konnte sie uns jetzt schon wieder einen Ersatzvater vorsetzen? Ich konnte mich nicht für sie freuen, auch wenn Vicky ständig wie eine Blöde auf mich einredete, es einfach zu akzeptieren.
„Was aus uns wird, ist doch eh jedem egal!“, hatte ich Vicky einmal in meiner Wut entgegengeschrien. Seitdem hatten wir nicht mehr über das Thema gesprochen. Ich wusste zu der Zeit ja nicht, dass es noch viel schlimmer kommen würde.
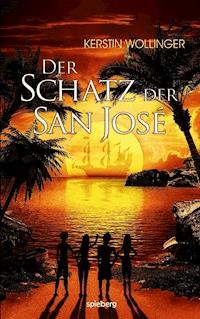













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














