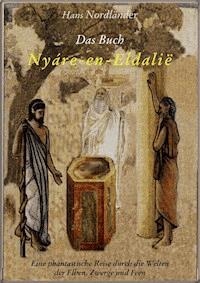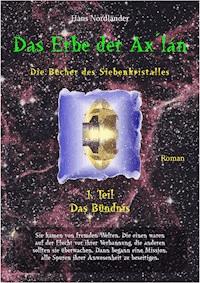
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jahrhunderte nach dem Untergang der prähistorischen Kultur der Ax´lán auf dem Planeten Elveran entdeckt der Freizeitarchäologe Meneas Dolgard zusammen mit einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten eine prähistorische Urwaldpyramide. Dort begegnen sie den außerirdischen Überlebenden einer lange zurückliegenden Mission, die sich die Sinaraner nennen, und die als Wächter über die ax´lánischen Kolonien auf den Planeten kamen. Aufgrund besonderer Umstände waren sie gezwungen, ihre Körper aufzugeben, und ein Dasein als körperlose Wesen zu führen. Ihrer Aufgabe seit langem entledigt, weil diejenigen, zu deren Überwachung sie nach Elveran kamen, inzwischen ausgestorben sind, ist ihnen dennoch die Rückkehr auf ihren Heimatplaneten versperrt. Noch bevor die Ax´lán ausstarben, war es ihnen gelungen, den Sinaranern die Energiequelle zu entwenden, die allein es ihnen ermöglicht hätte, ihre abgelegten Körper wieder einzunehmen, ohne die sie Elveran nicht verlassen können. Diese Energiequelle, die Sinaraner nennen sie den Chrysalkristall, wurde von den Ax´lán nicht zerstört, sondern in sieben Fragmente zerlegt und an unzugänglichen Orten verborgen. Die Sinaraner überreden Meneas und seine Freunde dazu, für sie diese Fragmente zusammenzutragen. Es ist der Beginn eine Reise in die abgelegendsten Gegenden des Kontinentes. Dabei erhalten sie Hilfe von einem gewissen Tjerulf, der ein besonderes Interesse an der Vergangenheit der elveranischen Völker teilt, und dessen bemerkenswerten Freunden. Dieses erste von sechs Büchern erzählt, wie die Ax´lán Elveran erreichen und ihr Versuch, eine dauerhafte Heimat zu schaffen, scheitert. Es schildert die Abenteuer von Meneas und seinen Freunden im azuranischen Urwald und ihr Zusammentreffen mit den Sinaranern. Seine spätere Begegnung mit dem Elveraner Tjerulf führt schließlich zu einem Bündnis der beiden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Nordländer
Das Erbe der Ax´lán
Die Bücher des Siebenkristalles - Teil 1: Das Bündnis
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Rettung in letzter Minute
2. Der Untergang von Ax´lûm
3. Eine Kultur erlischt
4. Erinnerungen
4.1. Die Vorgeschichte
4.2. Durch den Urwald Azurans
4.3. Die Sinaraner
4.4. Der Auftrag
4.5. Der Baumläufer
5. Eine schicksalhafte Begegnung
6. Das Bündnis
7. Vorbereitungen
8. Im Gasthaus »Zur Moorhexe«
9. Erste Enthüllungen
10. Ankunft auf Gut Wingert-Haus
11. Rückblick
Impressum neobooks
1. Rettung in letzter Minute
Dunkle Wolken trieben tief über die raue, von eigentümlicher Schönheit geprägte Landschaft. Die gelegentlichen Lücken erlaubten einen Blick auf den östlichen Horizont jenseits des aufgewühlten Meeres, das den Namen Meer von Ax´-lûm trug, wo gerade der Mond Folgar aufging, dessen Antlitz zu dieser frühen Abendzeit in den letzten schwachen Strahlen der im Westen untergehenden Sonne Nephys noch bleich und unheimlich wirkte.
Kreischende Möwen mühten sich, dem Sturm zu trotzen, wurden jedoch immer wieder wie trockenes Herbstlaub über das Land getrieben. Dann ließen die Vögel sich herabsinken und fanden im Schutz der Baumkronen ihren Weg zurück zur Steilwand. Dort ließen sie sich wieder emporheben und das Spiel begann von neuem. Und es schien für die Möwen tatsächlich ein Spiel zu sein, denn sie wurden nicht müde, es ständig zu wiederholen.
Die Bäume gehörten zu einem uralten Wald an der Ostküste eines berüchtigten Landstriches auf dem Kontinent Päridon. An dieser Stelle reichte der Wald bis an eine Steilküste heran, die im Laufe der Zeit von der Brandung des allzu oft sturmgepeitschten Meeres geformt worden war. Einst fiel die Küste dort seicht zum Meer hin ab und der Wald reichte bis an den Strand, doch in den Jahrhunderten war dieser flache Teil durch Sturmfluten und Meeresströmung hinweggespült worden.
Der Wald barg ein uraltes Geheimnis eines einst dort ansässigen Volkes, das vor langer Zeit ausgestorben war. Der für den Kundigen noch sichtbare Hinweis auf dieses Geheimnis war die Ruine eines mächtigen Gebäudes, in dem eine Entwicklung vollendet wurde, die schließlich die Geschichte aller Völker auf dem Planeten namens Elveran entscheidend beeinflussen sollte. Seither war jedoch viel Zeit vergangen. Das Bauwerk lag in Trümmern und wurde von dem Wald überwuchert.
Über die langen Zeiträume, wegen seiner Unzugänglichkeit und weil dieser weite Landstrich aus inzwischen vergessenen Gründen, die in jener Vergangenheit wurzelten, unbesiedelt geblieben war, war dieser besondere Ort bei den meisten Bewohnern in den fernen Gegenden Päridons in Vergessenheit geraten. Aber in wenigen Legenden, die immer noch einigen bekannt waren, lebte die Erinnerung daran weiter.
Und jetzt war eine Zeit angebrochen, die zu Ereignissen führen sollte, die diesen Wald und die Ruine in ihm für eine kleine Anzahl von Menschen zu einem Gegenstand von besonderer Bedeutung werden lassen würde. Neben einem fast so alten Orden, wie dieser Wald es war, gab es eine kleine Gruppe von Abenteurern, die in der Ruine den Nachlass einer untergegangenen Kultur erkannten und den Ausgangspunkt einer Macht, die sich bis in ihre Tage auswirkte.
Während diese Abenteurer also kurz davor standen, sich aufzumachen, die Geheimnisse um die Vorgänge von damals, als die legendäre Ax´lán-Kultur noch existierte, zu lüften, ohne auch nur die Tragweite ihrer Entscheidung zu ahnen, würde ihnen dieser Orden, der ihnen bis dahin fremd war, bald als Gegner gegenüberstehen. Dieser Orden, der sich der Orden von Enkhór-mûl nannte, sollte alles daransetzen, ihr Vorhaben zu verhindern, denn er betrachtete sich als alleiniger Erbe der Ax´lán-Kultur, und er wachte eifersüchtig darüber, dass niemand sich an deren Hinterlassenschaft vergriff.
Jener zerklüftete Landstrich an der Ostküste Päridons wurde von den Bewohnern des Kontinentes die Seemark genannt. Zum Landesinneren hin, an ihrer westlichen Grenze, wurde sie auf ganzer Länge von dem Fenharenwald gesäumt. Die Seemark war unbewohnt und nur selten verirrten sich Wanderer in diese Gegend. Zum einen, weil es nicht an Gerüchten mangelte, dass es dort nicht mit rechten Dingen zuging, zum anderen bildete der Fenharenwald einen schier unüberwindbaren, natürlichen Schutzwall.
Er war von dichtem, undurchdringlichem Bewuchs und wurde nur selten von künstlich angelegten Pfaden durchzogen, von denen kaum jemand anderes wusste, als ihre Urheber selbst: Einige der an seinem Rand lebenden Morain-Menschen, deren Volk auch als das Waldmenschenvolk bekannt war. Und selbst die Morain, wie sie kurz genannt wurden, mieden die dahinter liegende Seemark.
Und schließlich sollte in ihr auch nichts existieren, was den beschwerlichen Weg dorthin lohnte. Nur der eine oder andere Waghals hatte sich tiefer in die Seemark hineingetraut.
Weiter westlich des Fenharenwaldes, in den Wohngebieten, gab es Siedlungen und Städte, doch der Wald, nicht weniger geheimnisumwittert als die Seemark, galt wie diese als verbotenes Gebiet. Es war ein Urteil, dessen begründete Ursache ebenfalls in der Vorzeit lag.
In Wirklichkeit hatten die meisten, die darüber redeten, weder das eine noch das andere jemals zu Gesicht bekommen. Zumindest der Wald aber war von denjenigen, die sich in ihm aufgehalten hatten, eher als wunderbar, denn als bedrohlich empfunden worden, obwohl keiner dieser mutigen Besucher bestritt, dass es in ihm manche Gefahren gab. Nur Verrückte, meinten die übrigen Leute, gingen freiwillig in den Fenharenwald - und weiter.
Trotzdem gab es immer wieder solche Verrückten, die es wagten. Einige blieben tatsächlich verschollen, andere kamen wieder zurück. Von denen, die wieder auftauchten, wussten manche nur zu berichten, dass ihnen kein aufregenderes Schicksal widerfahren war, als die Schwierigkeit, den Rückweg zu finden. Dieser Umstand allerdings begründete nicht den Ruf des Waldes, sondern fand seine Ursache wohl eher in seiner undurchdringlichen Beschaffenheit und in dem Unvermögen dieser Wanderer, sich in ihm zurechtzufinden.
Andere jedoch machten Andeutungen, die so haarsträubend waren, dass ihnen zu ihrem größten Missfallen niemand Glauben schenkte. Und doch entstanden daraus im Laufe der Zeit einige wilde Gerüchte, die sich unter den Menschen verbreiteten. Und schließlich gab es Leute, die bis an ihr Lebensende über das, was sie erlebt hatten, schwiegen. Gerade ihr Verhalten trug dazu bei, den Fenharenwald umso geheimnisvoller erscheinen zu lassen.
Und einem dieser verwegenen Abenteurer war es an diesem Tag gelungen, sich bis an die Grenze zur Seemark durchzuschlagen.
Zögernd blieb der Mann am Waldrand stehen. Hinter einem Strauch verborgen, beobachtete er die weite Ebene vor sich. Zu dieser Tageszeit konnte er im Zwielicht der untergegangenen Sonne und dem noch tiefstehenden Mond Folgar nicht mehr viel erkennen. Nur als Schatten in unterschiedlichen Grautönen nahm er die nahen Hügel, Haine und Felsen wahr. Und doch war es ihm noch zu hell, um weiterzugehen. Er wollte warten, bis der Mond höher gestiegen und sein Bruder Duglar ihm gefolgt war. Dann würde er seinen Weg fortsetzen. Er brauchte nur etwas Geduld.
Bis zum westlichen Rand des Fenharenwald war seine Reise leicht gewesen. Es gab einige Straßen und Wege, mehr oder weniger gut ausgebaut, die ihn von Everbrück, der Stadt, in der er lebte, bis in das Dorf brachten, wo er sein Pferd zurückgelassen hatte. Die letzten Tage im Fenharenwald jedoch waren ungleich schwieriger. Immer wieder musste er sich neue Pfade suchen, wenn er feststellte, dass er die falsche Richtung eingeschlagen hatte. Da er keine künstlich geschaffenen Wege entdecken konnte, musste er sich mit den Wildwechseln der Tiere des Waldes zufriedengeben. Das war mühselig und führte oft in die Irre. Sicher gab es Pfade, die von den Waldmenschen benutzt wurden, aber die waren stets so unauffällig angelegt, dass sie von einem Fremden nur äußerst schwer zu entdecken waren. Der Wanderer war sich sicher, dass er hin und wieder solche Pfade gekreuzt hatte, ohne sie zu bemerken.
Er war zwar nicht das erste Mal in diesem berüchtigten Wald, hatte ihn aber noch niemals in seiner ganzen Breite durchquert und schon bei früheren Gelegenheiten hatte er manchmal nur mit Mühe seinen Weg gefunden. Aber schließlich war ihm sein schwieriges Vorhaben gelungen und endlich stand er am jenseitigen Waldrand und vor der Seemark. Doch bis er sein Ziel erreichte, war es noch ein weiter Weg, auf dem ihm manche Gefahren drohten. Selbst im Lichte des Tages wäre von seinem Standort der entfernte Wald, zu dem er wollte, nicht zu sehen gewesen. Wenn er auf keine Hindernisse traf, dann konnte er in drei Nächten, er hielt es für klüger, sich tagsüber zu verbergen, dort sein - bei dem unterirdischen Versteck nahe der Festungsruine, in dem ein Teil des Vermächtnisses der geheimnisvollen Kultur der Ax´lán ruhen sollte. Dort hoffte er die Schlüssel zu finden zu Dingen, die zusammenzutragen er Freunden versprochen hatte.
Einige Zeit später stand das volle Rund Folgars hoch genug und silbrig leuchtend am Himmel, um die Landschaft in ein milchiges Licht zu tauchen. Zu diesem Zeitpunkt erschien auch die waagerechte Sichel Duglars über dem Horizont, der ebenfalls bald als Vollmond aufsteigen würde. Nur noch gelegentlich wurden sie durch vorbeiziehende Wolken verdeckt, die der stürmische Wind vor sich hertrieb. Jetzt, dachte der Mann, und setzte sich mit schnellen Schritten in Bewegung. Fast im Laufschritt schlug er die Richtung ein, wo in der Nähe der Ruine nahe der Steilküste die geheimnisschwangere Kammer liegen sollte.
Die Gegend war menschenleer, denn die gesamte Seemark galt gemeinhin als unbewohnbar und er war sicher, weder auf Waldmenschen noch Ogmari oder Angehörige anderer Völker Päridons zu stoßen. Trotzdem wollte er vermeiden, dass ihn zufällig jemand entdeckte, der dort in dieser Nacht seinen eigenen Geschäften nachging, so unwahrscheinlich es auch war. Doch gab es Dinge, deren Anwesenheit in der Seemark er sich gut vorstellen konnte. Außerdem - und das erfüllte ihn mit größerem Unbehagen - hatte er während seiner Wanderung durch den Fenharenwald immer wieder das Gefühl gehabt, von irgendjemandem beobachtet und verfolgt zu werden. Obwohl sich dieses Wesen die ganze Zeit so geschickt verhielt, dass er es niemals zu Gesicht bekam, so war er doch sicher, dass es ihm ständig dicht auf den Fersen blieb.
Dass es einer der Bewohner des Dorfes war, in dem er bei einem befreundeten Bauern sein Pferd zurückgelassen hatte, weil es ihm im dichten Wald keine Hilfe gewesen wäre, hielt er für unwahrscheinlich. Keiner der Menschen dort würde es wagen, ihm zu folgen. Vor allem würde sich keiner von ihnen so sicher im Wald bewegen, dass er ihn nicht irgendwann einmal entdeckte.
Auch unter den Tieren, die im Fenharenwald hausten, mochte es welche geben, deren Neugierde durch seine Anwesenheit dort geweckt worden war. Und vielleicht war ihm eines derjenigen gefolgt, deren Nähe überaus unangenehm zu werden versprach. So hoffte der Wanderer, dass er seinen Verfolger im Schutz des nächtlichen Zwielichtes und bei schneller Fortbewegung abschütteln konnte.
Eilends lief er über die Ebene, überwand grasbewachsene Hügel, umging einige Haine, in denen böse Überraschungen auf ihn warten konnten, und durchquerte flache Senken. Der Wind verfing sich in seinem Haar und zerrte an seinem Mantel. Die Wolkenlücken wurden jetzt wieder seltener und immer öfter spürte er Regentropfen, die eisig auf sein Gesicht trafen. Trotz der Kälte schwitzte der Mann und daran war nicht nur die körperliche Anstrengung schuld. Die Seemark war ein gefährlicher Ort, hieß es, obgleich ihm niemand bisher genau sagen konnte, was mit diesen Gefahren gemeint war. Aber die Warnungen hatten sich in seinem Gedächtnis eingeprägt, und er zählte nicht zu den wagemutigsten Menschen unter Elverans Sonne. Er ahnte nicht, wie unvollständig sein Wissen über die Gefahren in der Seemark war.
Der Wanderer war schon ein weites Stück in die Ebene vorgestoßen, als plötzlich ein schwarzer Schatten vor ihm auftauchte, der sich langsam hinter einem Felsen hervorschob, nur wenige Schritte entfernt.
Folgar hatte seinen Zenit überschritten und Duglar stand kurz davor, seinen zu erreichen. Die Wolkendecke hatte sich inzwischen jedoch so weit geschlossen, dass die beiden Monde nicht mehr zu erkennen waren. Trotzdem war es nicht vollständig finster, denn ihr Lichtschein verursachte noch eine schwach schattenwerfende Helligkeit, die ausreichte, sich leidlich sicher zu bewegen.
Mit einem gehörigen Schrecken erkannte der Mann, dass der Schatten größer war als er selbst, und seine Befürchtung über dessen Urheber wurde im gleichen Augenblick bestätigt, als er zum Stehen kam. Es war einer der berüchtigten Dongas. Im Schein der jäh hervortretenden Monde erkannte er die vier leuchtenden Augen und - was schlimmer war - zwei Reihen weißer und unangenehm scharfer Zähne in einem beängstigend großen Maul.
Der Mann verharrte atemlos in seiner Stellung und zog vorsichtig sein Schwert. Mit erhobener Waffe, aber auf der Stelle erstarrt, beobachtete er das Tier.
Der Lebensraum der Dongas war nicht auf die Seemark beschränkt und es gab sie auch anderenorts auf Päridon. Sie wurden zwar manchmal scherzhaft als zu groß geratene und verblödete Hunde bezeichnet, das konnte aber nur mit Gelassenheit behaupten, wer nicht einem von ihnen nur wenige Schritte entfernt gegenüberstand.
Wenn der Mann auch bereits einige von diesen mächtigen Tieren beobachtet hatte, so war es doch stets aus sicherer Entfernung gewesen. Dongas waren zwar ziemlich träge und langsam, konnten aber überraschend flinke Sprünge vollführen und waren keineswegs langsamer als ein Mensch. Sie galten als gefährlich und unberechenbar - und noch nie war ihm einer so gefährlich nahe gekommen.
Langsam, jede rasche Bewegung vermeidend, wich der Wanderer zurück, gedeckt durch eine Wolke, die in just diesem Moment eine kurz zuvor entstandene Lücke vor einem der Vollmonde schloss. Trotzdem konnte er erkennen, wie der Schatten des Riesenhundes ihm ebenso langsam folgte. Ein verhaltenes und unheimliches Knurren ging von ihm aus. Das Tier hatte ihn ohne Frage als Beute ausgemacht, und seinen Lauten, die den Wanderer selbst durch den Sturm noch erreichten, war ein Appetit anzuhören, der seiner Größe entsprach. Der Mann hoffte, dem Tier entkommen zu können, wenn er den richtigen Augenblick zur Flucht abwartete, denn ein Kampf gegen diesen Gegner war aussichtslos. Prüfend blickte er sich zu den Seiten um, in der Dunkelheit fand er aber keinen Schutz, in den er sich retten konnte.
Wieder entstand eine kurze Wolkenlücke und er musste mit Schrecken feststellen, dass der Riesenhund sich ihm um einige Schritte genähert hatte. Speichel lief aus seinem Maul und das Knurren wurde lauter. Ein unangenehmer Geruch erreichte die Nase des Mannes. Er wich nun schneller zurück, denn es konnte nicht mehr lange dauern, bis der Hund zum Sprung ansetzte. Plötzlich stieß er mit seinem linken Fuß an ein Hindernis, strauchelte und fiel der Länge nach auf seinen Rücken.
Aus, dachte der Wanderer und für einen kurzen Augenblick befiel ihn eine lähmende Angst, die gleich darauf einer schicksalsergebenen Gleichgültigkeit wich. Er hob noch sein Schwert, obwohl er wusste, dass es ihm kaum noch nützen konnte. Aber wenn er schon sterben musste, dann wollte er es nicht völlig tatenlos tun. Hilflos wartete der Mann auf den Angriff des Dongas.
Der aber blieb aus. Stattdessen hörte er durch das Tosen des Sturmes das Sirren eines Pfeiles, der dicht über ihm hinwegschoss, dann einen zweiten und dritten, gefolgt von dem schmerzerfüllte Aufbrüllen seines Gegners. Als wollte sein Schicksal, dass er das Ende des Dongas miterlebte, öffnete sich erneut eine Wolkenlücke und er konnte sehen, wie sich das Tier - bereits im Sprung befindend - aufbäumte, auf die Seite drehte und dicht neben ihm aufschlug. Erde wirbelte auf und behinderte die Sicht. Der sterbende Donga zuckte noch einige Male, dann blieb er reglos liegen.
Es dauerte eine Weile, bis der Wanderer begriff, dass die Gefahr vorüber war, aber ehe er darüber nachdenken konnte, woher die unerwartete Rettung gekommen war, näherte sich ihm aus der Dunkelheit die schattenhafte Gestalt eines Fremden und trat ins Zwielicht der jetzt wieder wolkenverhangenen Monde. Sie beugte sich zu ihm herab und zog ihn mit einem kräftigen Griff wieder auf die Beine, während er in seiner anderen Hand den Bogen hielt.
„Das war knapp“, stellte er fest. „Wer seid Ihr und was treibt Ihr Euch zu dieser Zeit in dieser gefährlichen Gegend herum?“
Der Wanderer rieb sich den Schmutz aus den Augen und sah seinen Retter blinzelnd an.
„Wer seid Ihr?“, antwortete er mit einer Gegenfrage.
Beide mussten sie mit erhobener Stimme sprechen, denn der Sturm trieb alle Geräusche von ihnen weg.
Dem Wanderer kam der Verdacht, dass ihm hier sein Verfolger gegenüberstand und ihn erfüllte ein plötzliches Misstrauen, obwohl der Fremde gerade sein Leben gerettet hatte.
„Habt Ihr mich durch den Fenharenwald verfolgt?“, wollte er wissen.
Er zweifelte daran, dass der Fremde rein zufällig in seiner Nähe war.
„Wenn Ihr schon nicht Euren Namen nennen wollt, so bedankt Euch wenigstens dafür, dass ich Euch das Leben gerettet habe“, forderte der Fremde.
Ehe der Wanderer etwas entgegnen konnte, entstand wieder eine Wolkenlücke und nun erkannte er, wer sein Gegenüber war.
„Ihr seid ein Waldmensch, ein Morain!“, stellte er fest und gleichzeitig war für ihn die Frage beantwortet, wer ihn die ganze Zeit beobachtet hatte, denn von allen Menschen konnte ihm nur jemand aus diesem Volk so geschickt folgen. „Ich habe es mir fast gedacht. Seit ich den Fenharenwald betreten habe, wart Ihr in meiner Nähe. Ist es so? Warum verfolgt Ihr mich?“
Der Mann hörte das leise Lachen des Morain.
„Ihr könnt euch natürlich wundern, dass Ihr hier überhaupt einem anderen Menschen begegnet. Aber wen außer einen meines Volkes konntet Ihr sonst hier erwarten?“
Auf diese Frage wären dem Wanderer sicher einige Antworten eingefallen, aber in keinem Fall hätte er tatsächlich andere Menschen als Morain vermutet. Daher schwieg er.
Im fahlen und kurzen Mondlicht konnte der Wanderer nur wenig von seinem Retter erkennen. Der Morain war nicht viel größer als er und wirkte schmächtig, fast schwächlich, zu schwächlich für einen Vertreter dieses Volkes, doch das täuschte, denn er hatte seine Kraft bewiesen, als er den Wanderer wieder auf seine Beine gestellt hatte. Die Art seiner Kleidung war bisher verborgen geblieben und das, was er von dem Gesicht des Morain erblicken konnte, machte ihn sicher, diesem Waldmenschen noch niemals begegnet zu sein. Er hätte allerdings auch zugeben müssen, dass die Zahl seiner Bekannten in diesem Volk überschaubar war.
„Nun, was ist?“, beharrte der Morain darauf zu erfahren, wie er hieß.
„Ihr habt Recht, verzeiht. Und ohne Euch befände sich ein Teil von mir jetzt wohl in dem Leib dieser Bestie. Ihr habt meinen Dank und ich stehe in Eurer Schuld.“ Und nach kurzem Zögern ergänzte er: „Ich heiße Meneas. Wie ist Euer Name?“
Es trat ein kurzes Schweigen ein und Meneas spürte, wie der Fremde ihn durch die Dunkelheit musterte. Dann hörte er:
„Ich heiße Angrod.“
Trotz des sie umgebenden Sturmes dröhnten diese Worte in Meneas´ Ohren. Das lag nicht an der Lautstärke der Stimme des Morain, sondern an der Wirkung, die dieser Name bei Meneas hervorrief - Angrod. Es konnte nicht viele Waldmenschen dieses Namens geben. Und der, der ihm jetzt gegenüberstand, musste derjenige sein, der die Sinaraner auf ihn und seine Freunde aufmerksam gemacht hatte. Vielleicht war es sogar außer ihnen der einzige Mensch, der von der Existenz dieser Wesen wusste. Meneas spürte den Wunsch, ihn auf der Stelle auszufragen, doch dann entschied er sich anders. Vielleicht war es zunächst besser, den Unwissenden zu spielen, obwohl er ziemlich sicher war, es mit diesem Morain zu tun zu haben. Selbst, wenn Angrod von den Sinaranern wusste, kannte er möglicherweise nicht den Grund, warum Meneas in der Seemark war. Und es wäre töricht gewesen, ihn darüber aufzuklären, denn vielleicht irrte sich Meneas auch in der Überzeugung, wen er vor sich hatte.
„Ich glaube, Meneas, Ihr könnt Euer Schwert wieder wegstecken. Wenn ich Euch etwas antun wollte, dann hätte ich oft genug dazu die Gelegenheit gehabt.“
Meneas schob die Waffe zurück in die Schwertscheide und hob seinen Hut auf, der ihm bei seinem Sturz vom Kopf gefallen war und den er nach kurzer Suche wiederfand.
„Trotzdem habt Ihr meine Frage noch nicht beantwortet“, meinte er dann. „Warum verfolgt Ihr mich?“
„Neugierde“, gab Angrod offen zu, „reine Neugierde. Ich sah, wie Ihr den Wald betratet und wollte wissen, was Ihr vorhabt. Nicht allzu oft dringen Wanderer so mutig in den Fenharenwald ein. Ihr musstet irgendeinen Grund haben und den wollte ich herausfinden. Dabei scheine ich mich recht ungeschickt verhalten zu haben, denn offensichtlich habt Ihr meine Gegenwart bemerkt. Der Donga hat meine Absicht, unerkannt zu bleiben, endgültig vereitelt, sonst hätte ich mich Euch nicht, wenigstens vorerst nicht, gezeigt. Ich hatte nicht vor, Euch als Euer Beschützer zu folgen. Reicht Euch diese Antwort?“
Wieder herrschte eine kurze Stille. Meneas dachte nach. Wenn Angrod ihm auch sein Leben gerettet hatte, war ihm seine Anwesenheit gar nicht recht. Meneas musste den kleinen Wald allein erreichen. Er konnte dabei keinen Begleiter gebrauchen. Und vielleicht hatte der Morain noch andere Beweggründe, ihm zu folgen. Meneas überlegte, wie er ihn wieder loswerden konnte.
„Ich muss Euch warnen“, unterbrachen die Worte Angrods Meneas´ Gedanken und sie hatten plötzlich etwas Drängendes. „Wir befinden uns hier in einer sehr gefährlichen - .“
In diesem Augenblick wurde das Tosen des Sturmes von einem schrillen, markerschütternden Schrei durchbrochen. Meneas zuckte erschrocken zusammen.
„Verdammt, sie haben uns entdeckt!“, fluchte Angrod laut. „Folgt mir!“
Angrod packte Meneas am Ärmel seines Mantels und riss ihn unsanft mit sich fort. Erst als der ihm entschlossener folgte, ließ er wieder los. Es wird so gewesen sein, dass die nahen Kreischrufe Meneas in seiner Entscheidung, Angrod hinterherzulaufen, beflügelten, trotzdem hatte er Mühe, mit ihm Schritt zu halten.
In der Dunkelheit der Nacht konnte Meneas kaum den Schatten Angrods erkennen und es fiel ihm schwer, ihm an den Felsen vorbei zu folgen. Gerade jetzt verweigerten die Wolken den beiden ihre Mondlicht durchlassenden Lücken und zu allem Überfluss, begann es auch noch zu regnen.
Es war ein Glück für Meneas, dass er keine Zeit fand, hinter sich zu blicken, denn in diesem Augenblick schwebten zwei blasse, hellblau leuchtende Wolken, kaum größer als ein menschliches Kind, an dem Kadaver des Dongas vorbei, hinter den beiden Fliehenden her. Doch sie bewegten sich langsam und ruhig, unbeeinflusst von dem starken Wind, und als wären sie sicher, dass die Männer ihnen nicht entkommen konnten. Dann wurden die Leuchterscheinungen schneller und der Abstand zwischen ihnen und den Verfolgten geringer. Obwohl Meneas nichts sehen konnte, spürte er, dass sich ihnen etwas Grauenvolles nahte. Er versuchte, schneller zu laufen. Seine Lungen begannen zu schmerzen und bald glaubte er, dem Morain nicht mehr folgen zu können. Dann geschah etwas Unerwartetes und Unglaubliches.
Es war genau in dem Augenblick, in dem Duglar, der jetzt über ihnen im Zenit stand, wieder für einen kurzen Augenblick zum Vorschein kam. Meneas sah, wie die schlanke Gestalt des Waldmenschen geradewegs auf einen Felsen zulief - und darin verschwand. Meneas versuchte im letzten Augenblick noch anzuhalten, um nicht gegen den mächtigen Gesteinsbrocken zu prallen, denn wie immer Angrod das Kunststück fertiggebracht hatte, in dem Felsen zu verschwinden, Meneas war sicher, er würde für ihn ein undurchdringliches Hindernis sein. Doch dann trat er unglücklich in ein Erdloch und stolperte.
Er befand sich so dicht hinter dem Waldmenschen, dass er den erwarteten Aufprall nicht mehr verhindern konnte, und riss schützend seine Arme nach vorne. Schon rechnete er damit, schmerzerfüllt vor dem Felsen zu Boden sinken zu müssen, als er plötzlich mit einem Sprühregen bunter Funken vor seinen Augen, durch einen zähen Brei zu fallen glaubte. Dann war er ebenfalls in den Felsen eingetaucht.
Draußen waren jetzt die beiden blassblauen Wolken heran. Sie umschwebten einige Male unschlüssig den Felsen und verschwanden, einen letzten markerschütternden Schrei ausstoßend, wieder in der Dunkelheit. Im letzten Augenblick waren sie ihrer Opfer beraubt worden.
Meneas lag benommen und flach ausgestreckt auf dem harten Steinboden einer Höhle. Eine undurchdringliche Schwärze umfing ihn. Langsam kam er wieder zu sich. Vor seinen geschlossenen Augen leuchtete plötzlich ein schwaches Licht auf. Als er sie aufschlug, stand der Morain mit einer Fackel in der Hand an der Wand der Höhle. Meneas stöhnte leise auf und versuchte sich zu bewegen. Es gelang ihm mit einigen Mühen. Er hatte nicht das Gefühl, sich etwas gebrochen oder überhaupt verletzt zu haben. Eher fühlte sich sein Körper an, als wäre er vollkommen eingeschlafen gewesen und begann nun beim Aufwachen zu kribbeln. Und das war kaum angenehmer. Alles um ihn herum war ruhig. Nur das Tropfen von Wasser drang an seine Ohren und das leise Fauchen der Fackel.
Stumm lehnte Angrod an der Wand und wartete darauf, dass sich Meneas wieder erholte. Dann begann der Morain leise zu lachen. Meneas wusste nicht, ob es freundlich oder spöttisch gemeint war, aber er kam zu dem - falschen - Schluss, dass Angrod auch in unangenehmen Augenblicken ein heiteres Gemüt zu haben schien. Er musste sich zwingen, sich darüber nicht zu ärgern, zumal es ihm schlechter ging als Angrod. Ächzend versuchte er aufzustehen, kam aber nur dazu, sich so weit aufzurichten, um mit seinem Rücken an der Felswand zu lehnen. Mühsam blickte er sich um. Jetzt sah er den Morain deutlicher. Ihm schien der Sturz durch den Felsen nichts ausgemacht zu haben.
Nach einiger Zeit hatten sich Meneas´ Augen an das trübe Licht gewöhnt und er konnte mehr erkennen. So, wie es aussah, befanden sie sich in einer natürlichen Höhle, denn die Wände waren entweder nur roh behauen oder in ihrem ursprünglichen Zustand belassen worden und passten nicht recht zu einem Gebäude. Der Raum durchmaß vielleicht zehn Schritte und war etwa doppelt so hoch wie Angrod.
In der Zwischenzeit hatte der Morain eine weitere Fackel entzündet und in einen Spalt in der Felswand gesteckt. Meneas sah einen ganzen Stapel davon in einer der Ecken. Rußend verbreiteten sie eine ruhige Helligkeit in der Höhle. Daraus schloss Meneas, dass es dort keinen Luftzug gab. Daher erstaunte es ihn, dass die Luft alles andere als abgestanden und muffig war. Plötzlich packte ihn die Erkenntnis, sich in einem abgeschlossenen Raum zu befinden, als er feststellte, dass es nirgends einen Ausgang gab. Also mussten sie ihn wieder durch den Felsen verlassen. Aber dort erwarteten sie unheimliche Gegner.
„Wie fühlt Ihr Euch?“, fragte Angrod.
Meneas knurrte als Antwort irgendetwas wie:
„Geht so. Könnte besser sein.“
Angrod grinste.
„Ihr habt den Eintritt gut überstanden“, meinte er. „Besser als zu erwarten war.“
„Wo sind wir hier und wie sind wir hier hineingekommen?“, fragte Meneas.
„Zunächst einmal sind wir hier sicher“, antwortete der Morain ausweichend. „Und wieder einmal steht Ihr in meiner Schuld. Das war jetzt das zweite Mal in dieser Nacht, dass Ihr mir Euer Leben verdankt.“
„Danke“, erwiderte Meneas ein wenig halbherzig.
Er hatte sich den Verlauf dieser Nacht wirklich anders vorgestellt, vor allem nicht so, dass er buchstäblich von einer Todesgefahr in die nächste stolperte und immer wieder gerettet werden musste. Ein bitteres Lächeln huschte über sein Gesicht.
Jetzt endlich gelang es ihm, ganz aufzustehen. Mit noch etwas schwachen Beinen lehnte er sich ebenfalls gegen die Höhlenwand. Meneas hätte nicht sagen können, ob es an den Anstrengungen der Flucht lag oder an der Durchdringung des Felsens, wie immer es ihnen gelungen war.
„Ich hätte nicht erwartet, dass Ihr mir durch das Tor folgen würdet“, sagte Angrod.
„Warum habt Ihr dann mit mir diesen Weg genommen?“, fragte Meneas.
„Weil es keinen anderen gab, soweit ich weiß“, erklärte der Morain. „Ich musste es eben versuchen. Und ich hoffte, dass er auch Euch offenstand. Nicht mehr lange, und sie hätten uns erwischt. Außerdem, auch wenn ich noch niemals beobachten konnte, dass es einem anderen Menschen als einem Morain gelungen ist, ein Rhun-Tor zu durchschreiten, hatte Belhach schon vermutet, dass es unter bestimmten Bedingungen möglich sein könnte. Er hatte tatsächlich Recht. Vielleicht war es Eure Angst.“
„Was ist ein - Rhun-Tor?“, wollte Meneas wissen. „Und wer ist Belhach?“
„Ihr seid sehr neugierig“, stellte Angrod nachsichtig fest. „Bel-hach ist ein Freund von mir. Er beschäftigt sich mit dem Bau von Rhun-Toren. Es sind magische Öffnungen in festen Gegenständen, die nur von jemandem gefunden werden können, der weiß, wo sie sich befinden, denn sie unterscheiden sich nicht von ihrer Umgebung. Ihr habt Glück, dass ich zu diesen wenigen gehöre.“
„Wie baut man solche Tore?“, fragte Meneas.
„Darüber werde ich Euch nichts sagen, doch selbst wenn ich wollte, ich könnte und dürfte es Euch nicht erklären. Diese Begegnung eben kam nicht unerwartet“, lenkte Angrod ab. „Es war genau das, wovor ich Euch gerade warnen wollte, als sie auftauchten. Es waren die Telerin. Es sind schon so manche Ahnungslosen von ihnen aufgesogen worden.“
„Was sind Telerin?“, fragte Meneas, denn diesen Ausdruck hatte er tatsächlich bisher noch niemals gehört. „Und was heißt hier aufsaugen?“
Angrod lachte wieder auf, doch dieses Mal klang es bitter.
„Ihr seid schlecht vorbereitet in die Seemark eingedrungen“, stellte er fest. „Was immer Ihr vorhattet, von den Gefahren, die hier lauern, scheint Ihr nicht viel zu wissen. Und dabei rede ich nicht von dem Donga. Telerin sind Geister. Es sind die Geister eines ausgestorbenen Volkes, das vor langer Zeit in dieser Gegend zwischen dem Fenharenwald und dem Meer gelebt hat. Es war sehr grausam und verhielt sich außerordentlich rücksichtslos gegenüber anderen Völkern.“
„Die Ax´lán“, unterbrach Meneas Angrods Erklärungen.
„Dann habt Ihr wenigstens von diesem Volk gehört“, erwiderte Angrod. „Ja, es waren die Ax´lán.“
„Ich kenne sie nur aus Legenden“, gab Meneas zu und sagte damit - fast - die Wahrheit. „Und Ihr wisst, dass Legenden oft von zweifelhaftem Wert sind.“
„Gut, dann hört zu“, forderte ihn der Morain auf. „Also, die Ax´lán, die hier lebten, waren von ziemlich mieser Art. Ob es anderswo auf Elveran noch weitere gab, weiß ich nicht, aber einiges deutet darauf hin. [Zu diesem Zeitpunkt war sich Angrod zwar schon sicher, dass es so war, er hatte vor geraumer Zeit damit begonnen, ihnen nachzuforschen. Dabei war er auch tatsächlich auf die Sinaraner gestoßen. Darüber, und über seine gesamten Kenntnisse über die Ax´lán, wollte er Meneas bei dieser Gelegenheit jedoch nur wenig verraten. Aber seine überraschend bereitwilligen Erklärungen dienten einer bestimmten Absicht, deren Sinn Meneas erst einige Zeit später verstehen konnte, als sich immer mehr Rätsel aufklärten.] Wann sie hier ankamen, ist unbekannt, aber die Zeit ist wohl in Jahrhunderten zu bemessen. Sie erreichten die Seemark vom Meer her, denn von einem Zug dieses Volkes durch den Fenharenwald ist nichts bekannt. Es wird ebenso gesagt, dass sie ursprünglich hinter dem Meer auf einer großen Insel wohnten, die in wenigen Tagen untergegangen sein soll. Sie wurde Ax´lûm genannt und nach ihr gab sich das Volk seinen Namen. Welche Geheimnisse sie auch immer hüteten, sie sind in der Zeit verlorengegangen. Das Volk der Ax´lán war sehr klein. Es war zu klein zum Überleben, daher starb es aus. Nicht fern der Küste kann man heute noch die Ruine einer Festung finden. Sie war für das Ax´lán-Volk von besonderer Bedeutung, wie gesagt wird. Was für eine Bedeutung sie genau hatte, weiß ich nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Vielleicht liegen dort ja die Schlüssel zu den Geheimnissen dieses legendären Volkes.“
Bei diesen letzten Worten zuckte Meneas unmerklich zusammen, und er hoffte, dass sein Schreck von Angrod nicht bemerkt worden war. Er konnte verräterisch sein, denn genau dort oder wenigstens in der Nähe dieser Ruine wollte er nach diesen Schlüsseln suchen. Meneas hoffte, dass der Morain ihn nicht wörtlich gemeint hatte. Doch Angrod berichtete ungerührt weiter, ohne den Eindruck zu erwecken, dass ihm an Meneas etwas aufgefallen war.
„Doch es scheint, dass irgendetwas die Ax´lán überdauert hat, denn Geister machen seither die Seemark unsicher. Es sind Geister, die angeblich mit dem Aussterben dieser Leute zu tun haben. Ob es Verstorbene sind oder ob die Ax´lán die Mächte der Welt herausgefordert haben, weiß ich auch nicht, aber diese Geister sind schlimmer als alle anderen uns bekannten. (Angrod hatte mehrere Gründe dafür, die Erwähnung von Walgeistern in diesem Zusammenhang zu vermeiden). Sie scheinen jeden, der sich unvorsichtigerweise in der Seemark herumtreibt, zu jagen. Die Unglücklichen, die von ihnen eingeholt werden, werden ihrer Lebenskräfte beraubt und ihr Leib zerfällt. Das habe ich selbst bereits mitansehen müssen. Glaubt mir, es ist kein schöner Anblick. Was mit diesen ebenso unglücklichen Seelen geschieht, ist auch nicht bekannt, aber ein angenehmes Schicksal wird ihnen kaum vergönnt sein. Jetzt versteht Ihr, was für ein Glück wir hatten, dass sich gerade in unserer Nähe eines der Rhun-Tore befand.“
Meneas schluckte. Er hatte von dem Volk der Ax´lán schon einiges gehört, mehr, als er bisher zugegeben hatte. Es war überhaupt erst der Grund dafür gewesen, warum er in die Seemark eingedrungen war. Über die Telerin hatte ihn jedoch tatsächlich niemand vorher aufgeklärt. Es gab einige, die er vor dieser Gefahr unbedingt warnen musste. Und es gab andere, von denen Meneas erwartet hätte, dass sie ihn und seine Freunde vor diesen Geistern warnten, schließlich mussten sie alle wenigstens noch einmal in die Seemark, und das würde wahrscheinlich noch gefährlicher werden. Meneas hegte in diesem Augenblick leise Zweifel, ob sie die uneingeschränkte Freundschaft ihrer Auftraggeber genossen.
„Dann stehe ich wirklich in Eurer Schuld, Angrod“, sagte Meneas nachdenklich und dieses Mal klang es nicht mehr so oberflächlich wie zuvor. „Wie kann ich Euch Eure Hilfe vergelten?“
Angrod sah ihn an und überlegte. Dann schüttelte er mit dem Kopf.
„Nicht jetzt und nicht hier“, meinte er. „Ich habe Fragen, doch Ihr seid noch nicht in der Lage, sie zu beantworten. Aber sorgt Euch nicht, der Zeitpunkt wird kommen. Verlassen wir erst einmal diesen Ort.“
„Ah - bevor wir gehen -“, begann Meneas, denn jetzt war er sich über Angrod sicher und erwartete einige aufklärende Worte von ihm.
„Und ich bin ebenfalls noch nicht in der Lage, manche Antworten zu geben“, unterbrach ihn der Waldmensch. „Folgt mir.“
Angrod wandte sich um, nahm eine Fackel in die Hand und verschwand hinter einem Felsvorsprung.
Meneas hatte befürchtet, die Höhle auf die gleiche Weise verlassen zu müssen, wie sie in sie hineingekommen waren. Als er mit der zweiten Fackel hinter Angrod herging, tat sich vor ihm aber unerwartet ein Tunnel auf. Dessen Eingang war vorher durch den Felsvorsprung verdeckt gewesen, der wiederum in dem trüben Licht der Fackeln kaum zu erkennen gewesen war. Erleichtert betrat Meneas den Gang. Das war eher seine Sache, als feste Dinge zu durchdringen. Er beeilte sich, dem Morain zu folgen, der schon einen kleinen Vorsprung hatte und dessen Schritte nicht mehr zu hören waren.
Nachdem der Tunnel einige Kurven beschrieben hatte, standen die beiden vor einer glatten Felswand, die eindeutig künstlichen Ursprungs war. Angrod drehte sich zu Meneas um.
„Es tut mir leid, aber ich muss Euch für kurze Zeit Eure Augen verbinden“, sagte er, und ehe sich Meneas dagegen sträuben oder auch nur seinen Widerwillen äußern konnte, hatte Angrod ihm ein Tuch straff um die Augen gebunden. Damit war ihm jegliche Sicht genommen. Meneas zog es vor, sich nicht dagegen aufzulehnen und ergab sich in sein Schicksal.
„Ihr gebt Euch sehr geheimnisvoll“, meinte er.
„Nicht mehr als nötig, aber die Nähe zu dem Rhun-Tor erfordert es.“
Meneas hörte ein kurzes, schleifendes Geräusch, dann bemerkte er, wie es um sie herum merklich heller wurde. Was Angrod getan hatte, blieb Meneas verborgen, aber es gehörte nicht viel Phantasie dazu zu erraten, dass sich vor ihnen ein Tor, und zwar ein ganz gewöhnliches, nach draußen geöffnet hatte. Der Morain griff ihm an den Ärmel und zog ihn mit sich fort.
Frische, warme Luft empfing die beiden und ein Konzert von Singvögeln erfüllte die Umgebung.
„Bleibt einen Augenblick hier stehen“, forderte Angrod Meneas auf.
Erneut hörte er ein schleifendes Geräusch, das mit einem dumpfen Schlag beendet wurde. Dann war der Morain zurück.
„Gut, weiter“, sagte er und führte Meneas auf einem schmalen Pfad langsam weiter in den Wald hinein.
Kleine Zweige schlugen ihm ins Gesicht. Der Boden war weich und dämpfte das Geräusch ihre Schritte. So ging es eine ganze Weile weiter. Dann wurde es Meneas über.
„Was ist mit meinem Augenverband?“, fragte er ein wenig ungeduldig.
„Bald“, bekam er zur Antwort.
Meneas stellte fest, dass der Pfad einigen Biegungen folgte, dann blieb sein Führer plötzlich stehen und nahm ihm die Augenbinde ab. Blinzelnd blickte Meneas um sich. Doch außer den strahlendblauen Himmel über sich und den dichten Wald um sich herum, konnte er nichts erkennen, was ihm half, sich zurechtzufinden. Sie standen mitten auf der Kreuzung zweier Wege und den Höhleneingang hatten sie weit hinter sich gelassen.
„Aber warum nur diese Geheimnistuerei?“, fragte Meneas verständnislos. „Ich nehme an, vor dem Höhleneingang sah es nicht anders aus. Wolltet Ihr nur verhindern, dass ich sehe, wie Ihr das Tor öffnet und wieder schließt?“
Der Morain lachte.
„Das wäre kein Geheimnis“, stellte er fest. „Selbst Ihr könntet es öffnen. Es ist uns Waldmenschen aber nicht erlaubt, jemandem einen solchen Ort zu zeigen. Und von hier würdet Ihr dort nicht mehr hinfinden. Wir sind mehrere Pfade gegangen und einige davon würdet Ihr mit Sicherheit nicht wiederfinden.“
Meneas blickte prüfend zurück und warf auch einen Blick in den Himmel.
„Versucht es“, forderte Angrod ihn belustigt auf.
„Ach was“, entgegnete Meneas nur und winkte ab.
Er war sicher, dass der Morain die Wahrheit sprach. Und das war auch nicht der Grund für seine Verwunderung. Eher erstaunte ihn die plötzliche Veränderung des Wetters und der Umgebung. Dass sich die Wolken bis zum frühen Morgen vollends verzogen hatten, war nichts Besonderes. Aber die unerwartete Wärme machte Meneas stutzig. Mit ihr hätte Meneas erst wieder jenseits des Fenharenwaldes gerechnet. Und den dichten Wald hatten sie doch weit hinter sich gelassen, als sie auf den Donga stießen. Also mussten sie auf geheimnisvolle Weise eine beachtliche Strecke nach Westen zurückgelegt haben. Meneas war sicher, dass sie sich wieder im Fenharenwald befanden, hatte aber keine Ahnung, wo. Seine Vermutung wurde auch sogleich von dem Morain bestätigt.
„Den Gefahren der Seemark sind wir glücklich entronnen“, sagte Angrod. „Jetzt befinden wir uns wieder im Fenharenwald, nahe am westlichen Rand. Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Land der Beschen. Ich denke, ich gehe nicht fehl mit meiner Vermutung, dass Euer Versuch, ins Land der Telerin einzudringen, nicht Euer Letzter war, was immer Ihr dort gesucht habt. Vielleicht war es auch nicht der Erste. Doch nehmt meinen Rat an: Seid das nächste Mal auf der Hut und betretet das Land nicht bei doppeltem Vollmond wie gestern. Geht bei einem Neumond beider Monde und erst in den frühen Morgenstunden kurz vor Sonnenaufgang los. Dann ist die Gefahr ein wenig geringer. Am besten, Ihr kommt von der Meerseite.“
„Ihr habt Recht“, gab Meneas zu. „Und ich werde Euren Rat beherzigen. Doch fürs Erste will ich wieder in meine Heimat zurückkehren. Habt Dank für Eure unerwartete Hilfe. Ich werde sie nicht vergessen und vielleicht werde ich sie irgendwann einmal wieder gutmachen können.“
Angrod nickte, seine Miene zeigte aber keine Regung.
„Wenn Ihr diesem Pfad weiter folgt, dann könnt Ihr in wenigen Stunden den Rand des Fenharenwaldes erreichen“, erklärte er und zeigte in eine bestimmte Richtung. „Von dort werdet Ihr allein weiterfinden. Lebt wohl - Meneas.“
„Lebt wohl und danke“, wiederholte er, doch bevor seine Worte den Waldmenschen erreichten, war dieser zwischen den Bäumen verschwunden.
Nachdenklich machte Meneas sich auf den Heimweg. Seine Reise hatte eine ziemlich unerwartete Wendung genommen. Einerseits musste er seinem Schicksal dankbar dafür sein, dass es Angrod auf seine Fährte gesetzt hatte, denn ohne den Morain-Menschen hätte er diese Nacht bestimmt nicht überlebt - oder ihm wäre Schlimmeres zugestoßen. Andererseits glaubte er nicht daran, dass dessen Interesse an ihm wirklich zufällig war. Dafür war das Verhalten Angrods einige Male zu sonderbar gewesen - und sein Auftauchen zu schleierhaft, denn der Wald war sehr groß und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Angrod gerade in dem Augenblick, in dem er den Wald betreten hatte, ungewollt in seiner Nähe befand, gering. Hinter ihrer Begegnung musste also mehr stecken. In Meneas wuchs die Überzeugung, dass Angrod von seinem Vorhaben gewusst hatte.
Der Name Angrod klang merkwürdig vertraut. Obwohl er diesem Waldmenschen bestimmt noch nie begegnet war, erschien er Meneas nicht so fremd, wie es eigentlich hätte der Fall sein müssen. Schließlich ahnte Angrod vielleicht sogar, worauf Meneas aus gewesen war. Vielleicht hatte er die »Schlüssel zum Geheimnis der Ax´lán« auch nicht zufällig erwähnt.
Aber in einem war sich Meneas sicher, Angrod war ihm gegenüber nicht feindselig eingestellt. Auch wenn er Meneas einige Rätsel aufgab, so ahnte er, dass zwischen ihnen Bande bestanden, an deren Ursprung er sich nicht erinnerte. Und dieser Umstand erfüllte Meneas mit Besorgnis. Allem Anschein nach wusste Angrod mehr von ihm als umgekehrt, zumindest ließ manche Betonung seiner Worte darauf schließen.
Meneas hoffte, dass er eines Tages dieses Rätsel lüften konnte. Nun, seine Hoffnungen sollten sich erfüllen, aber bis dahin würde einige Zeit vergehen, eine Zeit voller unerwarteter Ereignisse.
2. Der Untergang von Ax´lûm
Seemark, 2371 Elveranjahre früher.
„Das Meer! Es zieht sich zurück!“, rief der junge Mann immer wieder, während er aufgeregt über die staubige Straße der kleinen Siedlung an der Küste des Meeres von Ax´lûm rannte.
Er hatte seit dem frühen Morgen am Strand zugebracht und dabei war ihm aufgefallen, wie sich das Wasser gegen die Flut, die zu dieser Tageszeit hätte herrschen müssen, stetig von der Küste entfernt hatte.
Schließlich erreichte der Mann die Hütte des Dorfältesten, der ebenso wie einige andere Bewohner des Dorfes auf die Rufe aufmerksam geworden und vor seine Hütte getreten war.
„Was schreist du denn so?“, fragte der Alte verwundert und ein wenig ärgerlich. „Du machst ja das ganze Dorf närrisch.“
„Das Meer! Es geht zurück. Es verschwindet. Ich war unten am Strand und habe meine Netze geflickt. Plötzlich sah ich, wie er immer breiter wurde. Die ersten Muschelbänke liegen schon frei.“
„Knurrhahn, ich frage mich, ob du heute nicht schon ein wenig zu früh angefangen hast zu trinken“, entgegnete der Alte, der dem Fischer kein Wort glaubte.
„Aber, Nestan, es ist, wie ich sage“, beharrte der Junge fast flehentlich und verzweifelt. „Ich habe nichts getrunken. Schau es dir selbst an. Irgendetwas geschieht dort draußen.“
Knurrhahn war, wie viele andere in dieser Siedlung, Fischer. Er stand in dem Ruf, ein umso größerer Aufschneider zu werden, je mehr er getrunken hatte. Wenn diese Ereignisse sich auch in ferner Vergangenheit, lange vor dem Dasein von Meneas, zutrugen, so war den Einwohnern dieser Siedlung die Herstellung von Wein doch bereits bekannt. Wahrscheinlich war auch einem von ihnen einmal das Missgeschick passiert, dass sich Obstsaft auf geheimnisvolle Art verändert hatte mit unerwarteten Folgen für denjenigen, der ihn dann trotzdem noch getrunken hatte. Gewitzte Leute mochten dann versucht haben herauszufinden, was mit dem Saft geschehen war und schließlich hatten sie, ohne genau zu wissen, was dabei wirklich vor sich ging, die Weinherstellung erfunden. Sehr zur Freude mancher ihrer Zeitgenossen.
Wegen seiner Trinkfreudigkeit hatte Knurrhahn auch nur wenige Freunde im Ort. Nestan, der Dorfälteste, gehörte nicht dazu. Knurrhahn war nicht sein wirklicher Name, doch seit seiner Kindheit wurde er allseits so genannt und mittlerweile hätte niemand mehr erklären können, warum das so war.
„Also gut“, meinte Nestan mürrisch. „Schauen wir es uns an. Wenn du dir aber wieder einmal etwas zusammengesponnen hast, dann fegst du für ein Jahr den Dorfplatz.“
Er hasste es, aus seiner Mittagsruhe gerissen zu werden, besonders dann, wenn es wegen solcher Leute wie Knurrhahn war.
Etwas mühsam nahm Nestan seinen Gehstock zur Hand und machte sich auf zum Strand. Glücklich und wie ein Hund neben seinem Herrn ging Knurrhahn an seiner Seite. Andere, die den heranstürmenden Fischer gesehen hatten und bis zur Hütte des Dorfältesten gefolgt waren, schlossen sich den beiden an.
Die Siedlung der sich selbst als Seemenschen bezeichnenden Bewohner, in der Nestan und Knurrhahn lebten, war die einzige ihrer Art in der Seemark. In diesem Landstrich im östlichen Teil des Kontinentes Päridon existierten zu dieser Zeit zwar auch und schon länger, als diese Siedlung bestand, noch andere Lebensgemeinschaften von Menschen, doch die befanden sich auf einem deutlich niedrigeren Entwicklungsstand als die Seemenschen. Es waren hellbraunhäutige, kleinwüchsige Ureinwohner, Eingeborene Päridons, die erst am Anfang ihrer gesellschaftlichen Entwicklung standen. Sie lebten in losen Sippenverbänden und ohne feste Behausungen zumeist unter freiem Himmel, wenn sie nicht die natürlichen Schutzmöglichkeiten wie Felshöhlen nutzten. Ihren Lebensunterhalt bestritten sie aus der Jagd, dem Fischfang in Binnengewässern, denn vor dem Meer scheuten sie zurück, und durch Sammeln dessen, was ihnen die Natur an Nahrung bot. Diese Eingeborenen hatten erst eine sehr einfache, für die hellvioletthäutigen Seemenschen kaum verständliche Sprache entwickelt.
So, wie die Eingeborenen Furcht vor dem Meer empfanden, obwohl sie an windstillen Tagen und bei abgelaufenem Wasser schon einmal wagten, Strandgut, das sie für sich nutzen konnten, einzusammeln, so waren ihnen auch die Seemenschen unheimlich, von denen sie um mehr als Kopfeslänge überragt wurden. Nur dann und wann kam einmal ein Jäger der Ureinwohner in die Nähe des Dorfes, um dann aber schnell wieder zu verschwinden. Daher begegneten sich diese verschiedenen Menschen nur selten.
Die Seemenschen hatten wohl festgestellt, dass sie anders waren als die übrigen Einwohner der Seemark, ohne auch nur eine blasse Ahnung davon zu haben, was der Grund dafür war. Da sie aber keine Erinnerung an ihren Ursprung besaßen, und genauso wenig ein ausgeprägtes Bewusstsein für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entwickelt hatten, war es ihnen fremd, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. So wussten sie auch nichts davon, dass über ihrer Existenz ein erschütterndes Geheimnis lag. Und die Einwohner der Seesiedlung würden auch niemals die Möglichkeit bekommen, Näheres über ihr unglaubliches Schicksal zu erfahren, das sie in die Seemark verschlagen hatte.
Es dauerte nicht lange, bis sich die Worte Knurrhahns im Dorf wie ein Lauffeuer verbreiteten und immer mehr Einwohner kamen hinzu. Noch ehe der Zug den Strand erreichte, sahen sie den weiten, in der Mittagssonne vor Pfützen glitzernden Meeresboden und den dunklen Saum der Muschelbänke. Einige Bewohner des Dorfes waren bereits dort und standen aufgeregt schwatzend auf den Dünen. Solange sie sich zurückerinnern konnten, war so etwas noch nicht geschehen. Sicher, Ebbe und Flut waren bekannt, wenn auch nicht ihre Ursachen, aber jeder wusste, dass jetzt die Zeit des Hochwassers war. Außerdem wehte der Wind von der See her und hätte das Wasser nicht aufs Meer hinaustreiben können.
„Was geht hier vor?“, fragte Nestan mit leiser, beinahe ehrfürchtiger Stimme. Er erwartete allerdings keine Antwort.
Langsam ging er zum Strand hinunter und blieb dort, wo zu dieser Zeit die Wasserlinie hätte sein müssen, stehen. Die anderen Leute hatten sich hinter ihm versammelt. Nur Knurrhahn stand stolz neben dem Alten.
„Na, was habe ich euch gesagt“, meinte er triumphierend. „Das Meer ist weg.“
Nestan sah ihn nicht an. Sein Blick war auf den Horizont gerichtet. Er war ebenfalls Fischer gewesen und seine Augen, deren Sehkraft im Alter nicht schwächer geworden war, waren an die Ferne gewöhnt. Nestan sah, dass sich das Meer fast bis zum Horizont zurückgezogen hatte und mit ihm zu verschmelzen schien. Er konnte aber nicht erkennen, ob es sich immer noch fortbewegte. Nestan wusste, die Leute hinter ihm erhofften sich eine Antwort auf die Frage nach der Ursache dieser Erscheinung, doch er musste zugeben, dass er genauso hilflos war wie sie. Plötzlich sah er etwas, was der Grund sein konnte, und wenn er es richtig deutete, bestand Veranlassung zu großer Sorge.
Wenn sich blasse Schatten vor einen hellen Hintergrund befinden, dann dauert es manchmal einige Zeit, bis die Augen sie erkennen, besonders, wenn diese Schatten weit entfernt sind. Das war bei Nestan jetzt der Fall. Während er seinen Blick über den Horizont schweifen ließ, traten zwei Dinge immer deutlicher zum Vorschein: eine fahle, aufsteigende Wolke, die langsam in den Himmel wuchs und dabei dunkler wurde, und nicht weit davon entfernt ein scheinbar dünner, leicht gebogener Schlauch, der sich von der vermuteten Meeresoberfläche ebenfalls in den Himmel erhob und in einer zweiten, weitspannenden Wolke einmündete.
Mit der ersten Erscheinung wusste der Alte nichts anzufangen. Kein Unwetter, woran er sich erinnern konnte, hatte jemals so ausgesehen. Und von Vulkanausbrüchen hatte er sein Leben lang nichts gehört, geschweige denn, jemals einen gesehen. Außerdem wusste niemand in dem Dorf, dass es jenseits des Meeres überhaupt Land gab, denn keines ihrer Boote war für so weite Fahrten geeignet. Den Schlauch jedoch konnte er deuten. So etwas hatten viele von schon einmal erlebt, auch wenn dieses Ereignis sehr lange zurücklag. Und wenn die Leute nicht so aufgeregt geredet hätten und so unaufmerksam gewesen wären, sondern wie Nestan das Meer beobachtet hätten, dann wäre es auch ihnen aufgefallen. Vor ihnen auf dem fernen Meer tobte der gewaltigste Wirbelsturm, den er je gesehen hatte.
Nestan wusste, dass sich unter Wirbelstürmen dieser Art die Meeresoberfläche anhob, wenn er auch keine Vorstellung hatte, warum das so war. Er wusste auch, dass das Wasser bald wieder zurückkommen würde, wenn sich der Sturm aufgelöst hatte. Und bei dieser ungewöhnlichen Entfernung musste es mit einer gewaltigen Flutwelle geschehen. Dass die Rauchwolke ein Hinweis auf eine mögliche Ursache einer viel größeren Flutwelle war, konnte er nicht einmal ahnen.
Plötzlich verstummten die Gespräche hinter Nestan und die ersten Arme zeigten auf den Horizont. Also war es jetzt auch anderen aufgefallen. Der Dorfälteste drehte sich zu ihnen um.
„Es ist ein Sturm“, sagte er.
Zu der zweiten Wolke schwieg er, weil er nicht wusste, was er dazu sagen sollte. Er wusste noch nicht einmal, ob der Sturm etwas mit dieser Wolke zu tun hatte. Nestan versuchte, seiner Stimme einen festen und ruhigen Klang zu geben, denn was er jetzt ankündigen musste, bedurfte der Ruhe und Ordnung.
„Der Sturm hat das Wasser an sich gezogen“, erklärte er. „Es wird wiederkommen und eine große Flut mit sich bringen. Unser Dorf liegt zu nah am Strand. Dort sind wir nicht sicher. Wir müssen in die Hügel vor dem Wald fliehen. Packt eure Sachen. Wenn wir diese Gegend ruhig und sofort verlassen, dann haben wir genug Zeit.“
Nestan wusste zwar nicht, wann der Sturm das Wasser wieder freilassen würde, aber er war sicher, dass er mit seiner Behauptung Recht behalten würde.
Noch ehe er seine Worte beendet hatte, geschah genau das, was er vermeiden wollte. Von Angst gepackt, begannen die Ersten zu ihren Hütten zu rennen. Nestan machte keine Anstalten, die Leute zurückzuhalten. Es wäre sinnlos gewesen. Schweigend beobachtete er ihre Flucht und schüttelte nur mit dem Kopf.
Nestan hatte keine Angst. Er war alt, sogar sehr alt für einen Menschen seiner Zeit. Fast einhundert Jahre hatte er auf Elveran gelebt, wenn ihn seine Erinnerung nicht täuschte, und er hatte die Aussicht, seinen einhundertsten Geburtstag im kommenden Jahr zu feiern. Doch er wusste, viele Jahre würden ihm danach nicht mehr bleiben. Schon als Fischer, und obwohl er stets gehofft hatte, er würde ihn nicht zu früh ereilen, hielt er den Tod im Wasser für den würdigsten für einen Menschen des Meeres, die sie alle waren. Jetzt bestand die Aussicht, dass dieser Zeitpunkt nicht mehr allzu fern war.
Knurrhahn stand immer noch neben ihm und blickte traurig aufs mehr Meer hinaus.
„Was ist?“, fragte der Alte. „Willst du dich nicht in Sicherheit bringen?“
Der junge Mann sah ihn an und Nestan erkannte eine Träne in seinen Augen.
„Soll ich das alles hier im Stich lassen?“, fragte er und zeigte auf seine beiden Boote, sein ganzer Stolz, und auf die Netze.
Nestan hatte sich oft über Knurrhahn geärgert und ihn auch nicht immer freundlich behandelt, doch in diesem Augenblick fühlte er eine gewisse Zuneigung zu ihm und Mitleid. Und zum ersten Mal bedauerte er, wie Knurrhahn oft darunter gelitten hatte, wenn die anderen Bewohner ihn wegen seiner geistigen Schwerfälligkeit verspotteten. Väterlich legte er ihm eine Hand auf die Schulter und sagte:
„Glaube mir, ich verstehe dich. Mir würde es an deiner Stelle kaum anders ergehen. Aber bedenke, wenn du am Leben bleibst, wirst du dir alles wieder neu erschaffen können. Bleibst du jedoch in Sorge um deinen Besitz hier, wirst du sterben und weder deine Boote noch die Netze werden dir an dem Ort, wo du hingehst, von Nutzen sein.“
Knurrhahn blickte auf die Erde und dachte nach.
„Ja, du hast Recht“, gab er nach kurzer Zeit zu und ging langsam ins Dorf.
Der Alte folgte mit unsicheren Schritten.
Während die meisten Einwohner der Siedlung ihre Habseligkeiten zusammenrafften, einige weigerten sich, ihr Dorf zu verlassen, weil sie nicht glaubten, dass die erwartete Flutwelle wirklich so stark werden würde, wie Nestan behauptet hatte, oder weil sie in ihren Häusern sterben wollten, wenn sie schon sterben mussten, geschah wieder etwas Unerwartetes und Bedrohliches. Obwohl der Sturm für sie weit weg war, erreichten sie die Vorboten des Unterganges.
Plötzlich begann die Erde sich unter ihren Füßen zu bewegen und ein dumpfes Grollen erfüllte die Luft. Heftige Stöße und ein mächtiges Schütteln durchfuhren den Untergrund und ließen alles schwanken. Das Unheil schien von überall her auf sie einzustürzen, denn es kam aus keiner bestimmten Richtung. Einige Dorfbewohner wurden sofort zu Boden gerissen, andere konnten sich gerade noch an verschiedenen Gegenständen festhalten, bis auch diese Stützen zusammenbrachen. Das Erdbeben sorgte dafür, dass jetzt endgültig Angst und Schrecken ausbrachen, die in einer heillosen Flucht mündeten.
Einige Hütten, nur leicht aus Holz und Schilf gebaut, fielen in sich zusammen und begruben unter sich, wer sich nicht schnell genug nach draußen retten konnte. Bald loderten die ersten Feuer auf und setzten weitere Hütten in Brand.
Das erste Beben war kaum abgeklungen, als das nächste folgte. Nestan, der langsamer war als die anderen Einwohner des Dorfes, stürzte auf dem Weg vor seinem Haus. Dabei fiel er so unglücklich, dass er sich ein Bein brach. In dem aufgekommenen Durcheinander, dem Geschrei und dem Hin- und Herhasten, fand sich jedoch niemand, der ihm helfen wollte oder konnte. Unter Schmerzen und einer großen Kraftanstrengung gelang es ihm, die Trümmer seiner Hütte zu erreichen.
Sie hatte kein Feuer gefangen, dennoch war sie in einem Zustand, der es ihm nicht mehr ermöglichte, in sie hineinzugelangen. Er schleppte sich an einen Platz, wo er seine letzten Stunden, und daran zweifelte er jetzt nicht mehr, hoffentlich so bequem wie möglich verbringen konnte.
Ein Beinbruch wäre kein Todesurteil gewesen, wenn die Verletzung schnell hätte versorgt werden können. Doch die Umstände ließen das nicht mehr zu und er selbst war kein Heiler. Daher wusste Nestan, dass er in diesem Leben an keinen anderen weltlichen Ort mehr gelangen würde. Trotz seiner kläglichen Lage war er jedoch nicht nur nicht verzweifelt, sondern sogar von einer überraschenden Gelassenheit erfüllt und, wie er verwundert feststellte, von einer gewissen Heiterkeit. Plötzlich spürte er die ganze Belanglosigkeit des irdischen Daseins. Es war ein Gedanke, der ihn seltsamerweise erst in der Stunde seines nahen Todes erfüllte.
So schnell, wie Nestan erwartet hatte, ging es dann aber doch nicht. Der Dorfälteste - jetzt ohne Dorf - beobachtete, wie die letzten Einwohner Hals über Kopf flohen. Seltsam, dachte er, wie schnell sie doch all ihre Vernunft und Überlegung verloren haben.
Viele der Hütten brannten und der Geruch, der im Rauch lag, ließ vermuten, dass sich nicht alle retten konnten und in ihren Behausungen umgekommen waren. Nestan schien der letzte lebende Mensch in der Siedlung zu sein. Bedauernd dachte er an seine Familie und Freunde, die, wenn sie nicht auf der Flucht waren, vielleicht tot unter Trümmern lagen. Und verbittert fragte er sich, warum ihm niemand geholfen hatte. War die Angst tatsächlich so groß, dass jeder nur noch an seine eigene Rettung dachte?
Verwirrte Haustiere, Hunde, Katzen, Hühner, Schafe und was es noch alles so gab, irrten zwischen den ehemaligen Gebäuden umher. Ihr Angstgeschrei erfüllte die Luft. Sie waren alles, was Nestan noch als Gesellschaft geblieben war. Sie verhieß jedoch nur wenig Trost.
Schließlich wurde es Abend und nur noch die zusammengefallenen Ruinen und die schwelenden Gluthaufen der ehemaligen Behausungen lagen verstreut vor Nestan. Seine eigene hatte am Rand eines Hügels gestanden. Von hier konnte er nicht nur die traurigen Überreste des Dorfes betrachten, sondern jetzt, wo die meisten Hütten in Trümmern lagen, auch bis zum Meer blicken. Das Wasser war immer noch nicht zurückgekehrt.
In der Dämmerung bot sich ihm am Horizont eine Erscheinung, die allen tagsüber verborgen geblieben war. Der Himmel in der Ferne war dort, wo Nestan in der Mittagszeit die geheimnisvollen Wolken aufgefallen waren, in ein trübes Rot getaucht. Er sah flackernde und beunruhigende Lichtspiele, und ein Teil der rätselhaften Wolken schien erleuchtet. Nestan beobachtete das Schauspiel gleichzeitig mit Schaudern und Faszination. Er war davon so beeindruckt, dass er für eine Weile sogar die Schmerzen in seinem Bein vergaß.
Später in der Nacht sah er einen gewaltigen Feuerausbruch, bei dem der Horizont in einem Glutball zerrissen zu werden schien. Eine lodernde Flammensäule stieg in den Himmel, wuchs an und verblasste wieder. Eine weitere folgte. Alles geschah vollkommen lautlos und schob jeden Gedanken Nestans an den Wirbelsturm, der draußen auf dem Meer immer noch mit mörderischer Gewalt, aber unsichtbar in der Dunkelheit, tobte, beiseite.
Das Inferno am Horizont ließ seine Bewunderung für diesen Anblick jäh ersterben und machte blankem Entsetzen Platz. War das der Beginn des Weltunterganges? Hatten sich schließlich die Götter gegen die Menschen und alle anderen Kreaturen dieser Welt gewandt?
Nestan war sicher, dass in Kürze das Ende über sie kommen musste, doch außer, dass auch der zweite Feuerball erlosch, geschah wieder nichts. Aber lange konnte das endgültige Unheil nicht mehr auf sich warten lassen. Trotz seiner verzweifelten Lage hielt sich sein Interesse an dem Geschehen immer noch wach und zu gern hätte er gewusst, was sich dort hinten wirklich abspielte und was der Grund dafür war.
Nach einiger Zeit riss ihn ein erneutes Erdbeben aus seinen Gedanken. Es warf ihn auf dem Erdboden hin- und her und der Schmerz in seinem Bein drohte Nestan für einen kurzen Augenblick bewusstlos zu machen. Ehe er jedoch in eine wohltuende Ohnmacht fallen konnte, war das Beben wieder vorbei. Und das Donnergrollen, das es begleitet hatte, war ihm in seiner Qual entgangen. Nestan war überzeugt gewesen, das letzte Beben würde ihn umbringen, aber noch immer war es ihm nicht vergönnt zu sterben.
Nachdem auch dieses Erdbeben vorübergegangen war, blieb es den Rest der Nacht ruhig. Selbst der Wind vom Meer legte sich allmählich, und bald zogen die letzten Rauchschwaden nur noch langsam und träge über die heruntergebrannten Hütten des ehemaligen Dorfes. Nestan fiel in einen unruhigen Schlaf.
Der Morgen wartete mit einem weiteren gewaltigen Schauspiel auf ihn, und das sollte das Letzte in seinem damaligen Leben werden - und das Ende der Seemark.
Nestan erwachte mit einem Hustenanfall. Eine Rauchfahne war über ihn und die Reste seiner Hütte hinweggezogen. Sie war tatsächlich eine der wenigen, die nicht in Flammen aufgegangen waren, weil er am vorherigen Tag kein Verlangen nach einer warmen Mahlzeit gehabt hatte und seine Feuerstelle kalt geblieben war. Aber das konnte sie schließlich auch nicht retten, denn stattdessen war sie den Erdbeben zum Opfer gefallen.
Mühsam schlug Nestan seine Augen auf. Er fühlte sich elend. Er hatte Schmerzen, wurde von Durst gequält und er sehnte sich nach dem erlösenden Zeitpunkt seines Todes. Nach allem, was er durchgestanden hatte, war er trotzdem noch in der Lage, sich zu wundern, dass sich das Leben so hartnäckig an seinen Körper klammerte. Erstaunlich, wie viel man doch aushalten kann, dachte er und lächelte bitter. Das war kein Geschenk des Schicksals. Inzwischen hatte sich seine Verfassung aber in einem Maße verschlechtert, dass er sich darüber keine Gedanken mehr machte, ob das einen tieferen Sinn haben konnte.
Die Dämmerung war bereits weit fortgeschritten und ließ einen weiten Blick über das Land zu - und über das Meer. Er riss entsetzt seine Augen auf. Plötzlich war er wieder hellwach. Was sich da näherte, war nichts anderes als das, wovor er die Dorfbewohner gewarnt hatte, doch noch gewaltiger, als er es sich ausmalen konnte. Zuerst undeutlich, dann immer klarer erkannte er die Flutwelle, die auf die Küste zurollte. Sie war noch gewaltiger, als er es sich vorgestellt hatte. Nestan besaß nicht mehr die Kraft, die alles erfüllende Stille zu bemerken. Selbst das Haus- und Hofgetier hatte die Gefahr gespürt und war über Nacht geflohen. Nestan war das letzte lebende Wesen an diesem Ort.
Es war gespenstisch, wie die Welle lautlos und immer höher anwachsend auf die Küste zurollte. Der Alte hatte schon einige Flutwellen im Laufe seines langen Lebens gesehen, aber diese hier übertraf alle anderen bei weitem. Es konnte nicht mehr lange dauern, und sie würde das Land erreichen und alles, was es dort gab, verschlingen.
Dann war sie heran. Zuerst mit einem schwachen Rauschen, das bald zu einem wilden Tosen und Brausen anwuchs. Nestan hatte Angst gehabt. Im Angesicht dieser Todeswelle hatte er die erbärmlichste Angst seines langen Lebens gespürt. Doch als das Wasser die Reste des Dorfes erreichte, war diese Angst schlagartig verschwunden. Fast im gleichen Augenblick wurde er hochgehoben und weggerissen. Ein mörderischer Schmerz durchfuhr sein verletztes Bein, dann umgab ihn eine kalte, nasse und trübe Welt. Unwillkürlich stockte seine Atmung. Nestan hörte das Gurgeln und Rauschen des Unterganges in seinen Ohren und erlebte noch, wie er sich drehte und überschlug. Mit einem dumpfen Stoß traf ihn ein Stück Holz am Kopf und endlich versank er in eine gnädige Bewusstlosigkeit. Dass er kurz darauf ertrank, bemerkte er nicht mehr. Erst von seinem Körper befreit, erfüllte seinen Geist das dankbare Gefühl, ihn so verlassen zu haben, wie er es sich immer gewünscht hatte - im Wasser.