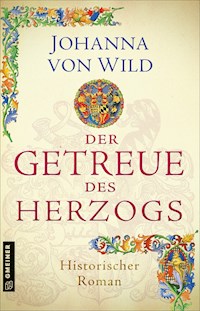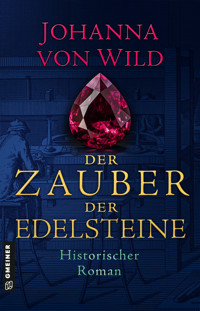Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Mitten im Dreißigjährigen Krieg begegnen sich Silas von Maringer, Sohn des Oberstallmeisters des Mainzer Kurfürsten, und Gräfin Alexandrine von Taxis. Beide fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Als ihr Ehemann stirbt, wird Alexandrine zur Generalpostmeisterin ernannt. Doch um das Erbe ihrer Kinder zu bewahren, darf sie nicht erneut heiraten. Als Silas in ihren Dienst tritt, wird es immer schwerer standhaft zu bleiben. Erst als er von einem Ritt nicht mehr zurückkehrt, ändert sich alles und Alexandrine muss um ihre Liebe fürchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johanna von Wild
Das Erbe derer von Thurn und Taxis
Historischer Roman
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Flugblatt_1648.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Workshop_of_Ferer_Bassa_-_Ceremonial_of_consecration_and_coronation_of_the_kings_and_queens_of_Aragon_-_Google_Art_Project.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thurn-und-Taxis-Wappen.png
Karte: © Iris Rist
ISBN 978-3-8392-7622-8
Widmung
Ralf – Die beste Nachricht bist du.
Zitat und Gedicht
Briefe haben schon ebenso viel geheimes wie öffentliches Unglück gebracht.
Honoré de Balzac (1799–1850)
»Ich komm von Münster her gleich Sporensteich geritten,
und habe nun das meist deß Weges überschritten.
Ich bringe gute Post und neue Friedenszeit,
der Frieden ist gemacht, gewendet alles Leid.
Man bläst ihn freudig auß mit hellen Feldtrommeten,
mit Kesselpaucken Hall, mit klaren Feld=Clareten.
Mercur fleugt in der Lufft und auch der Friede, Jo.
Gantz Münster/Oßnabrugg und alle Welt ist froh,
die Glocken thönen starck, die Orgeln lieblich klingen,
Herr Gott, wir loben dich, die frohen Leute singen.«
Beginn des Originaltextes des Flugblatts aus Münster mit dem friedensbringenden Postreiter, 25. Oktober 1648.
Personenverzeichnis
Historische Persönlichkeiten sind mit * gekennzeichnet
Familie von Maringer
Silas: reitender Bote
Karl: sein Stiefvater
Lina: seine Mutter
Hella: seine Halbschwester
Meta: seine Halbschwester
Familie von Taxis
Lamoral I.*: Generalpostmeister
Leonhard II.*: sein Sohn
Alexandrine de Rye*: Leonhards Frau
Lamoral Claudius Franz*: ihr Sohn
Genoveva Anna*: ihre Tochter
Erzbischöfe von Mainz
Johann Schweikhard von Kronberg*: 1604–1626
Georg Friedrich von Greiffenclau*: 1626-1629
Anselm Casimir Wambolt
von Umstadt*: 1629–1647
Familie Wambolt von Umstadt
Baron August: Bruder des Erzbischofs
Amalia: seine Tochter
Margaretha: seine Frau
Familie Wagner
Leopold: Waffenschmied
Ludwig: sein Bruder, Küfer
Hedwig: Ludwigs Frau
Lukas: Ludwigs Sohn
Weitere Personen
Viktor von Eisenberg: Reiter der Mainzer Hofgarde
Benedikt Grotheer: Verwalter derer von Taxis
Dr. Fabian Ponzon*: Rechtsgelehrter in Wien
Christoph Rieder: Bauer bei Trebur
Diethard Neustadt: Wirt in Frankfurt/Main
Sigismondo Sfondrati*: Generalkapitän der Spanischen Niederlande
Claude de Rye:de la Palud* Baron von Valançon
Armand Dubois: Verwalter der Burg in La Roche-en-Ardenne
Reiter und Hauspersonal in Diensten derer von Taxis
Raimund
Gottlieb
Amadeo
Gabriel
Lebrecht
Anike
Elise
Louise
Jean
Einige weitere historische Personen
Ferdinand II.*: Kaiser im Hl. Röm. Reich
Ferdinand III.*: sein Sohn
Maximilian I.*: Herzog von Bayern
Ferdinand*: Erzbischof von Köln
Gustav II. Adolf*: König von Schweden
Bernhard*: Herzog von Sachsen-Weimar
Isabella Clara Eugenia*: Infantin, Statthalterin vonBrüssel
Manuel de Moura de Corte-Real*: Statthalter in Brüssel ab 1644
Albrecht von Wallenstein*: Kaiserlicher Heerführer
Johann T’Serclaes von Tilly*: Kaiserlicher Heerführer
Axel Oxenstierna*: Schwedischer Kanzler
Postverwalter
Jacob Henot*: Köln bis 1625
Johann von den Birghden*: Frankfurt (1615–1627 und 1631–1635)
Gérard Vrints*: : Frankfurt (1627-1631 und ab 1635)
Johann von Coesfeld*: Köln ab 1626
Teil I
1623–1629
»Hat diese Zipollenjungfer dich endgültig deines Verstandes beraubt, sodass du nur noch mit deiner Rute denkst?« Leonhard schäumte vor Wut. Seit geraumer Zeit unterhielt sein Vater eine Liebschaft mit der blutjungen Jolanda, die er mit teuren Geschenken überschüttete. Jetzt stand Leonhard II. von Taxis ihm im holzvertäfelten Brüsseler Kontor vor dem riesigen Schreibtisch mit den gedrechselten Beinen, den sein Großvater in Augsburg hatte fertigen lassen, gegenüber.
»Wie kannst du es wagen?«, herrschte sein Vater ihn mit zorngerötetem Gesicht an und hob den Arm, als wollte er zuschlagen.
»Du wirst deine Kraft noch für Jolanda brauchen«, bemerkte Leonhard höhnisch. Dann wandelte sich seine Miene. Aus Verachtung wurde Mitleid. »Denkst du auch mal an meine Mutter?«
Lamoral von Taxis ließ den Arm sinken. »Genoveva ist eine alte Frau«, schnaubte er verächtlich. »Das Postamt in Frankfurt wird an Johann von den Birghden verpachtet, ob es dir gefällt oder nicht. Noch bin ich der Generalerbpostmeister, und nun scher dich raus.«
Leonhard blieb stur stehen. Da nannte sein Vater Genoveva eine alte Frau, völlig vergessend, selbst nur wenige Jahre jünger zu sein.
»Reicht es nicht, dass Jacob Henot das Kölner Postamt vom Kaiser wieder zugesprochen bekam und unser geschätzter Johann von Coesfeld das Feld räumen musste?«
Sein Vater schüttelte unwillig den Kopf. »Ich habe mich mit Henot vertraglich geeinigt. Und von den Birghden ist ein guter und verlässlicher Mann, der viel zuwege gebracht hat. Ihm haben wir die Einrichtung der Stafetten von Frankfurt bis nach Leipzig in Kursachsen und von Köln nach Hamburg zu verdanken.«
»Und uns hat er seinen Reichtum zu verdanken, vergiss das nicht. Innerhalb von zehn Jahren ist sein Vermögen um ein Vielfaches gestiegen. Das Haus Zum Kranich, das er jüngst erworben hat, soll zweihunderttausend Gulden gekostet haben. Es sollte keine unabhängigen Postmeister geben, vielmehr muss alles von Brüssel aus gelenkt werden«, erwiderte Leonhard missmutig. »Johann von Coesfeld hat beim Kaiser auf meinen Rat hin ein Gesuch zur Wiedereinsetzung eingereicht.«
Lamoral sah ihn scharf an.
»Hattest du deine Finger im Spiel, als die kurmainzischen Räte von den Birghden in Aschaffenburg festsetzen ließen?«
»Und wenn? Er ist längst wieder ein freier Mann. Ich denke eher, er hat diesen wenn auch unfreiwilligen Aufenthalt seinem protestantischen Glauben zu verdanken. Kurfürst Schweikard von Kronberg schätzt es ebenso wenig wie der Kaiser, wenn man dem Winterkönig zugeneigt ist.«
Leonhard spielte auf den protestantischen Wittelsbacher Kurfürsten Friedrich von der Pfalz an, der kurz vor Beginn des Krieges die böhmische Krone angenommen und sich damit gegen Ferdinand II. gestellt hatte. König von Böhmen war Friedrich längst nicht mehr, der Spottname »Winterkönig«, den ihm der Kaiser gegeben hatte, aber war geblieben.
Fünf Jahre war es her, dass die königlichen Statthalter unter der Führung des Grafen Heinrich Matthias von Thurn-Valsassina in der Prager Burg aus dem Fenster geworfen worden waren. Der böhmische Adel hatte genug von den Habsburgern und ihrer seit einem Jahrhundert währenden Herrschaft, zumal die Beschlüsse des Augsburger Religionsfriedens mehr und mehr unterlaufen wurden. Die Auflösung der Versammlung der protestantischen Stände hatte das Fass zum Überlaufen gebracht, und ihre Vertreter waren nach Prag marschiert, um deutlich zu machen, was sie davon hielten.
Seitdem herrschte nicht nur in Böhmen Krieg, sondern auch im Süden Deutschlands, nachdem der Mönch Dominicus a Jesu Maria mit einem geschändeten Gemälde aus einem gebrandschatzten böhmischen Schloss im Lager der Kaiserlichen aufgetaucht war. Die Protestanten hätten der Mutter Gottes die Augen ausgestochen, behauptete er, was solch einen Zorn unter den Soldaten des Heerführers Graf Johann T’Serclaes von Tilly hervorgerufen hatte, dass sie die böhmischen Stellungen am Weißen Berg überrannt und den Sieg davongetragen hatten. Von dort war Tilly mit seinem Heer nach Westen gezogen und hatte die Städte Heidelberg und Mannheim erobert. Vor nicht allzu langer Zeit war dann auf dem Fürstentag in Regensburg Friedrich von der Pfalz die Kurfürstenwürde aberkannt worden. Diesen Titel trug nun Herzog Maximilian von Bayern, ein Gefolgsmann des Kaisers. Zudem war ihm die Oberpfalz zugesprochen worden, was den Unmut der protestantischen Kurfürsten erst recht hervorgerufen hatte. Die habsburgischen Truppen unter Graf von Tilly waren derweil nach Norden gewandert, um den Herzog von Braunschweig, den man den »Tollen Halberstädter« nannte, einzuholen, bevor er in die Niederlande zum Winterkönig gelangen konnte, welcher sich dort im Exil befand.
Längst hatten die von Taxis erkannt, was ein Nachrichtendienst wert war. Schon seit mehr als hundert Jahren stand die Familie in habsburgischen Diensten. Kaiser Maximilian I. hatte die Möglichkeit der Taxis’schen Reitposten genutzt und Franz von Taxis eine erste Stafette von Innsbruck bis nach Mechelen sowie weitere nach Rom und Frankreich eingerichtet. Je schneller, desto besser, das war das Ziel gewesen und war es immer noch. Mehr und mehr Poststationen waren so im Laufe der Zeit entstanden, und aus den einzelnen West-Ost- und Nord-Süd-Kursen hatte sich durch Querverbindungen ein regelrechtes Wegenetz entwickelt.
Doch es waren viele Jahre der Ungewissheit und hoher Schulden vergangen, bis endlich Kaiser Matthias Leonhards Vater das Reichspostlehen als Mannlehen verliehen hatte. Bis zur Ausstellung dieses Lehensbriefes hätten sowohl der Kaiser als auch der spanische König Philipp III. den von Taxis das Lehen entziehen können. Doch jetzt war es ein Erblehen. Der jetzige Kaiser, Ferdinand II., hatte es vor zwei Jahren gar um ein Weiberlehen erweitert, was bedeutete, auch Töchter konnten die Amtsnachfolge antreten. Leonhard von Taxis war seiner Frau Alexandrine noch immer dankbar dafür, war es doch ihr Einfall gewesen, darauf zu drängen. Nach seines Vaters Tod würde nun Leonhard oberster Postmeister im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, in Burgund und den Spanischen Niederlanden werden. Es gab Tage wie heute, an denen er es nicht erwarten konnte.
»Ich hoffe, von den Birghden zahlt genügend Pacht, damit du Jolanda zufriedenstellen kannst.« Leonhard wandte sich zum Gehen, die Türklinke bereits in der Hand.
»Sechshundert Reichstaler scheinen mir eine erkleckliche Summe, und nun verschwinde endlich«, brummte sein Vater und schenkte ihm einen finsteren Blick.
Gräfin Alexandrine von Taxis stand auf einem Podest vor dem großen Kristallspiegel in einem der vielen Zimmer, die das Brüsseler Palais beherbergte. Sie regte sich nicht, während der Schneidermeister und sein Lehrjunge letzte Hand an ihr neues Reitkleid legten. Alexandrine ritt im Herrensitz, auch wenn dies für Frauen verpönt war. Unter dem Kleid trug sie Breeches und lange Lederstiefel. Nur so konnte man sich zu Pferd in schnelleren Gangarten fortbewegen. Auch Elisabeth I., Diane de Poitiers, Johanna von Kastilien und noch viele andere Frauen hatten den Herrensitz vorgezogen und sich nicht darum geschert, ob deswegen hinter ihrem Rücken über sie getuschelt worden war.
»Ich hoffe, Ihr seid zufrieden, Comtesse«, presste Peer van Snijder hervor, zwischen dessen Lippen drei Nadeln klemmten.
»Verschluckt Euch nicht, Maître, es wäre zu schade um Euch«, lächelte Alexandrine. »Wie immer verehre ich Eure Handwerkskunst. Allerdings wünsche ich noch Stickereien an den Ärmeln, so erscheinen sie mir zu fade.«
»Sehr wohl, Comtesse. Dachtet Ihr an ein bestimmtes Muster?« Nachdem er die Nadeln in den noch zu kürzenden Saum gesteckt hatte, war Peer van Snijder nun besser zu verstehen. Ächzend richtete er sich auf und rieb sich die schmerzenden Knie.
»Joris, setz die Nadeln weiter ringsum im Abstand von einer grote palm«, wies er seinen Lehrjungen an, der bisher die Spitze an den Handgelenken festgesteckt hatte. Jetzt kniete sich der Junge vor Alexandrine und markierte jede Handbreit Rocksaum mit einer Nadel.
»Ich wünsche Windhunde«, beantwortete die Gräfin des Schneidermeisters Frage. »Sie sollen rund um den Ärmel dahinjagen.«
Van Snijder hob die Augenbrauen, dachte kurz nach. »Diese Arbeit wird meine Frau übernehmen, sie ist eine ausgezeichnete Stickerin.«
»Gut, seid Ihr dann für heute fertig?«
»Ja, Comtesse.«
Alexandrine stieg vom Podest, kaum dass Joris die letzte Nadel gesetzt hatte, und winkte ihrer Zofe, die stumm in der Ecke wartete.
»Louise, hilf mir beim Ausziehen.« Sie zogen sich hinter den Wandschirm zurück, und vorsichtig entledigte sich Alexandrine des Rocks, um nicht von einer der Nadeln gepikt zu werden. Louise kam hinter dem Schirm hervor und reichte das Kleidungsstück dem Schneidermeister.
»Votre serviteur dévoué, Comtesse«, verabschiedete sich van Snijder und scheuchte seinen Lehrjungen vor sich her. »Los, los, Joris, wir müssen weiter zu Madame …« Mehr war nicht mehr zu verstehen, denn die beiden Männer waren bereits aus dem Zimmer geeilt.
»Louise, bring mir das dunkelblaue Kleid mit dem hohen Samtkragen«, forderte Alexandrine.
Die Zofe half ihr hinein, ordnete die Falten über den drei verschiedenen Unterröcken. Wohlwollend betrachtete sich die Gräfin im Spiegel. Für ihre vierunddreißig Jahre sah sie bemerkenswert jung aus, selbst die Schwangerschaften hatten ihrer schlanken Figur nichts anhaben können.
Erst vor sieben Jahren hatte sie Leonhard II. von Taxis geheiratet und ihm zwei Kinder geboren. Genoveva Anna, benannt nach ihrer Großmutter, und Lamoral Claudius Franz, dessen Rufname an seinen Großvater erinnerte. Niemand hatte damals daran geglaubt, Alexandrine würde noch in den heiligen Stand der Ehe treten. Ihr Vater, Graf Philibert de Rye von Varax, war schon lange tot, gefallen in der Schlacht von Turnhout, ihre Mutter nur drei Jahre später gestorben. Elf war Alexandrine gewesen und standesgemäß schon als Stiftsdame im einen Tagesritt von der Grafschaft Varax entfernten Mons aufgenommen worden, nur um gänzlich unverhofft den fünf Jahre jüngeren Leonhard zu ehelichen.
Sie war keine Schönheit, besaß nicht die feinen Züge einer Maria de’ Medici oder deren Tochter, der spanischen Königin Isabella. Alexandrines Nase war zu groß geraten, ihr Mund zu breit, und der Amorbogen ihrer Oberlippe war kaum zu erkennen. Dafür besaß sie ein unwiderstehliches Lächeln, ein strahlendes graues Augenpaar mit langen, seidigen Wimpern, und ihre dunkelbraunen Locken fielen bis knapp über ihre schmalen Schultern.
»Alexandrine, du wirst es nicht fassen.«
Leonhard kam mit gerötetem Gesicht hereingestürmt, gefolgt von seinem Windhund Vasco. Wie immer scherte er sich nicht darum, vorher anzuklopfen.
Alexandrine entstammte altem, burgundischem Adel, war hochgebildet, sprach mehrere Sprachen fließend und wusste, was sich geziemte. Leonhards Benehmen dagegen ließ oft zu wünschen übrig. Oft hatte sie darüber nachgesonnen, ob er sie nur zur Frau genommen hatte, damit er irgendwann selbst einen Grafentitel erhielt.
»Hat dein Vater dich einmal mehr verärgert?«, fragte sie, ohne in ihren Betrachtungen innezuhalten. »Louise, die Perlenkette mit dem Topas, bitte.«
Die Zofe legte ihr den Schmuck um, und der goldgefasste Anhänger mit dem blauen Halbedelstein kam in Alexandrines Halsgrube zu liegen. Ein zufriedenes Lächeln umspielte die Mundwinkel der Gräfin.
»Mein Vater hat von den Birghden die Frankfurter Station verpachtet. Ich habe den Eindruck, ihm entgleitet mehr und mehr die Führung, nur weil er jedem Rock hinterhersteigt«, erwiderte Leonhard aufgebracht.
Alexandrine wechselte im Spiegel einen Blick mit ihrem Gatten. »Wie heißt sie dieses Mal?«, fragte sie fast gelangweilt.
»Jolanda, gerade einmal zwanzig Jahre alt. Es macht mich fassungslos. Denkt er auch nur ein Mal an meine Mutter?«
Die Gräfin wandte sich um und bedeutete Louise, sie solle sich zurückziehen. Als die Zofe das Zimmer verlassen hatte, räusperte sich Alexandrine.
»Zwanzig? Sie werden immer jünger. Mon Dieu, dein Vater ist sechsundsechzig. Nun, deine Mutter ist seine Eskapaden gewohnt, ich glaube nicht, dass sie noch irgendeinen Gedanken an ihn verschwendet.« Unbewusst spielte sie mit einer Haarlocke. »Warum bist du nicht längst unterwegs nach Wien?«
Leonhard ließ sich in einen Sessel fallen, neben ihn setzte sich Vasco, verharrte dabei reglos wie eine Statue.
»Was meinst du damit?« Er zupfte einige hellbraune Hundehaare von seinem schwarzen Wams.
Alexandrine rollte mit den Augen.
»Sprich mit dem Kaiser. Sag ihm, dein Vater verprasst dein Erbe. Es steht Lamoral nicht zu, ein Afterlehen zu vergeben. Ferdinand wird dies sicher nicht gefallen, zumal du der nächste Generalerbpostmeister sein wirst und Habsburg für die Postdienste bezahlt.«
»Was habe ich nur für eine kluge Frau.« Leonhard lächelte breit, stand auf und zog sie an sich. Der Hund verfolgte jede Bewegung seines Herrn, entschied, dass dessen Tun nicht wichtig war, und ließ sich nieder. Leonhard bedeckte Alexandrines Hals mit Küssen, neckte sie mit seiner Zunge und schob sie zur Tür des angrenzenden Schlafgemachs.
Sanft, aber bestimmt legte ihm Alexandrine die Hände auf die Brust. »Dafür ist keine Zeit, pack deine Sachen und reise nach Wien.«
Widerstrebend ließ er sie los, hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. »Komm, Vasco, die Comtesse verzichtet auf unsere Anwesenheit.« Der Windhund streckte den Rücken durch, gähnte ausgiebig und folgte seinem Herrn nach draußen.
Alexandrine warf einen letzten Blick in den Spiegel, zupfte ein paar widerspenstige Locken zurecht und machte sich auf den Weg zu ihren Kindern, die mit der blutjungen Kindsmagd im Innenhof spielten. Ihre Miene verfinsterte sich, als sie bemerkte, wie Anike, ein zuckersüßes Lächeln zeigend, mit einem Bediensteten plauderte, anstatt auf die Kinder zu achten. Blass und teilnahmslos saß Lamo auf einer Decke im Gras, die vor ihm ausgebreiteten Spielsachen rührte er nicht an. Alexandrine lief zu ihm, bückte sich und nahm ihn auf den Arm, berührte seine Wange mit ihren Lippen.
»Lamo, mein Kleiner, du hast Fieber.«
Niemand nannte ihn Lamoral. Der Zweijährige schlang die dünnen Ärmchen um ihren Hals und drückte seinen Kopf an ihre Schulter. »Hast du nicht bemerkt, dass er krank ist?«, zischte sie die Kindsmagd an, die erst jetzt ihrer gewahr geworden war und hastig herbeikam.
»Nein, Comtesse, verzeiht«, antwortete Anike und senkte schuldbewusst den Kopf.
Alexandrine hätte ihr am liebsten eine Ohrfeige verpasst. Es war nicht das erste Mal, dass Anike ihren Pflichten keine besondere Bedeutung beimaß.
»Veva«, rief sie nach ihrer Tochter, die selbstversunken ein Sträußchen in den angelegten Beeten pflückte. Die Fünfjährige sah hoch und strahlte.
»Sieh nur, Mutter, diese sind für dich.« Genoveva kam angelaufen und reichte ihr die ersten Frühlingsboten.
»Das ist sehr lieb von dir, doch du solltest nicht wie ein Gassenkind rennen, und die Blumen sind nicht dafür gedacht, Sträuße zu sammeln«, tadelte sie sanft und strich ihr übers Haar. »Dein Bruder ist krank, Veva, bleib bei Anike.« Sie warf der Kindsmagd einen warnenden Blick zu, nicht erneut ihre Sorgfaltspflicht zu verletzen.
Damit machte sie auf dem Absatz kehrt und trug ihren Sohn eilig hinein. Sie beauftragte eine Magd, den Arzt zu rufen, heißes Wasser zu bereiten, und brachte Lamo in das Kinderzimmer. Dort entkleidete sie das Kind bis auf das Unterhemd und steckte es ins Bett, deckte es bis zum Hals zu. Inzwischen war der Junge glühend heiß. Alexandrine tauchte ein Leinentuch in die nahe stehende, mit Wasser gefüllte Waschschüssel und legte es Lamo auf die Stirn, betupfte seine unnatürlich rot glänzenden Lippen.
Ohne anzuklopfen, kam Doktor Ingenhousz ins Zimmer, eine lederne Tasche in der Hand. Ihm auf dem Fuß folgte die junge Küchenmagd mit einem Krug dampfenden Wassers und einem Becher und stellte beides auf einen kleinen Tisch neben dem Bett.
»Hier bin ich, Comtesse, à votre service«, grüßte der Arzt, warf seinen breitkrempigen Hut auf das himmelblaue Polster eines aus feinem Nussbaumholz gedrechselten Stuhls und öffnete seine Tasche.
»Lamo hat wieder Fieber«, seufzte Alexandrine und machte Ingenhousz Platz.
»Sehr bedauerlich, Comtesse, Euer Sohn ist leider von schwacher Natur«, sagte er und fühlte Lamos Puls. Schnell und flach. »Mach auf, Lamo, lass mich in deinen Rachen sehen.«
Folgsam öffnete das Kind seinen Mund. Der Rachenraum war gerötet, ebenso die Zunge, deren Oberfläche der einer Erdbeere ähnelte. Ingenhousz ließ Lamo den Mund wieder schließen und zückte einen Beutel mit einer Mischung verschiedener getrockneter Heilpflanzen: Gelber Enzian, Weidenrinde, Pfefferminze, Brennnessel, Linden- und Holunderblüten und Mädesüß. Es war nicht das erste Mal, dass er zu Lamo gerufen wurde, der Junge fieberte immer wieder auf. Doch dieses Mal kamen noch diese seltsam aussehende Zunge und die stark geröteten Lippen hinzu. Der Arzt gab zwei Löffel der Mischung in den Becher und übergoss sie mit heißem Wasser. Dann kramte er erneut in seiner Tasche und förderte eine Flasche zutage.
»In Antwerpen habe ich endlich diese Arznei erstanden, sie schmeckt sehr bitter, aber sie wird Lamo gegen das Fieber helfen.«
»Was ist das?«, wollte Alexandrine wissen.
»Tinktur aus Chinchonarinde. Es handelt sich um eine Baumrinde aus dem Vizekönigreich Peru.«
Misstrauisch beäugte die Gräfin die Flasche. »Und Ihr seid sicher, dieses fremdartige Gebräu hilft Lamo?«
»Comtesse, vertraut mir, unter Ärzten und Apothekern erzählt man sich, das Elixier habe die Gattin des Vizekönigs vom Wechselfieber befreit.«
»Also schön, dann gebt ihm auch davon.«
Vorsichtig legte Ingenhousz seine Linke unter Lamos Hinterkopf und flößte ihm einen halben Löffel der Tinktur ein. Der Junge verzog angewidert das Gesicht und spuckte die bittere Flüssigkeit wieder aus. Der Arzt ließ den Kopf zurück in die Kissen sinken.
»Dann soll er zuerst von den Kräutern trinken. Könntet Ihr für Honig sorgen? Er wird die Bitterkeit der Chinchonarinde verschleiern.«
»Du hast gehört, was Doktor Ingenhousz gesagt hat, geh in die Küche und bring einen Topf Honig hierher«, befahl Alexandrine der Magd. Diese knickste und eilte hinaus. Derweil trank Lamo kleine Schlucke von dem inzwischen abgekühlten Kräutersud.
»So ist es gut, mein Junge«, lobte Ingenhousz.
Nachdem Lamo knapp die Hälfte des Bechers geleert hatte, kehrte die Magd mit dem Honig zurück. In der anderen Hand hielt sie einen weiteren Becher und stellte ihn neben den Wasserkrug.
»Ich dachte, Ihr könntet noch einen zum Mischen gebrauchen, Doktor«, sagte sie leise.
»Sieh mal einer an, das findet man auch nicht alle Tage. Wie heißt du, mein Kind?«, freute sich Ingenhousz, goss ein wenig von dem bitteren Trunk in den Becher und gab einen Löffel Honig hinzu.
»Elise.«
»Du hast gut mitgedacht, Elise«, lobte er die junge Frau. »Comtesse, Ihr solltet Euch glücklich schätzen, so ein kluges Mädchen in Euren Diensten zu haben.« Dann flößte er dem kranken Jungen den gesüßten Trank ein. Zwar verzog Lamo erneut das Gesicht, aber er behielt die Arznei bei sich.
Alexandrine lächelte dünn. »Ich wünschte, Anike besäße genauso viel Verstand wie sie. Vielleicht sollte ich dich an ihre Stelle setzen. Was meinst du, Elise, möchtest du die Magd meiner Kinder werden?«
Das junge Mädchen starrte sie mit offenem Mund an.
»Ich … ich … weiß nicht, doch, sehr gerne, seid bedankt, Comtesse«, stammelte es dann. Ein Kindermädchen wurde besser entlohnt als eine einfache Küchenmagd, und jede Münze mehr im Geldbeutel war kostbar.
»So sei es«, bestimmte Alexandrine. »Doktor, wie oft muss Lamo davon bekommen?«
»Er soll von dem Kräutersud und dem bittersüßen Elixier so oft wie möglich trinken, bevor Ihr Euch zur Nachtruhe begebt. Elise soll ihm Essigwickel um die Waden legen und ihn nicht aus den Augen lassen.«
»Geh und kümmere dich um die Wickel, Elise«, scheuchte die Gräfin die neue Kindsmagd hinaus. »Ich danke Euch einmal mehr, Doktor. Albert, unser Kämmerer, wird Euch entlohnen.«
»Stets zu Euren Diensten, Comtesse.« Ingenhousz warf noch einen Blick auf Lamo, der inzwischen eingeschlafen war, und verabschiedete sich von Alexandrine.
Seufzend strich sie ihrem Sohn mit dem Zeigefingerrücken sanft über die blasse Wange. Jedes Mal wenn der Junge krank wurde, fürchtete sie um sein Leben, sollte Lamo doch später einmal Generalerbpostmeister werden. Sie wünschte, sie würde einen weiteren männlichen Erben gebären, doch bisher hatte Gott ihr keinen zweiten Sohn geschenkt. Erst im vergangenen Jahr hatte sie ein drittes Kind verloren und seither nicht wieder empfangen. Zwar hatte der Kaiser ein Weiberlehen vergeben, und sollte Lamo jung sterben, würde Veva an seine Stelle treten, um die Compagñia zu leiten. Doch Alexandrine sah das Erblehen lieber in den Händen eines Mannes. Vor allem in solch ungewissen Zeiten.
»Silas, sieh dir dieses Pferd an. Was hältst du davon?«, fragte Karl von Maringer seinen Sohn. Von Mainz waren sie zum Frankfurter Rossmarkt gereist, um Pferde für den Reichserzkanzler zu erstehen.
Eigentlich war der zwanzigjährige Silas kein Spross seiner Lenden, aber er liebte ihn, als wäre er sein eigen Fleisch und Blut. Nachdem die schwangere Magd Lina Hafner aus einem herrschaftlichen Haus in Umstadt geworfen worden war, hatte Karl sie geehelicht, obwohl sie keine standesgemäße Wahl gewesen war. Dem Oberstallmeister des Mainzer Kurfürsten, Erzbischof Johann Schweikard von Kronberg, hatte es nicht viel ausgemacht, dass die hübsche weizenblonde Frau nur eine einfache Magd gewesen war und zudem noch das Kind eines anderen unter ihrem Herzen getragen hatte. Hals über Kopf hatte er sich in Lina verliebt, als er einst zwei Pferde nach Umstadt gebracht hatte. Es war ein sehr heißer Tag gewesen, und Karl war in der gleißenden Sonne beinahe aus seinen Stiefeln gekippt. Lina, die in diesem Augenblick den Hof gequert hatte, hatte ihn bemerkt, ihm sogleich einen Krug mit verdünntem Wein zu trinken gegeben und ihm zu einer Bank im Schatten einer alten Buche geholfen. Das hatte gereicht, und um Karl war es geschehen gewesen. Wer jedoch Silas gezeugt hatte, darüber hatte sich Lina immer ausgeschwiegen.
Prüfend betrachtete Silas den Rappen, der regungslos neben einem Händler stand und von diesem angepriesen wurde.
»Ein Prachtkerl, eines Königs würdig. Drei Jahre alt, kerngesund und schnell wie der Wind.«
Neben Silas und Karl umringten weitere Männer den Verkäufer und begutachteten den Wallach.
»Seinen Vater lobte schon Hofstallmeister de la Broue, der sagte, Fier sei das beste Blutpferd, das er jemals unter dem Sattel gehabt habe. Und noch immer versieht Fier seinen Dienst als Beschäler im Zuchtstall des französischen Königs«, warb der Mann für den Rappen.
»Der Kerl ist ein Rosstäuscher«, raunte Silas seinem Vater zu.
»Sag mir, was dich zu diesem Urteil bringt«, wollte Karl wissen.
»Ich kann in diesem Ross keinen Tropfen spanischen Blutes erkennen. Außerdem ist der arme Kerl nicht gesund, seine Augen sind trübe, und sieh nur, wie flach seine Atmung ist. Die Flanken bewegen sich schnell, aber kaum wahrnehmbar«, murmelte Silas.
»Zwanzig Reichstaler«, rief ein bärtiger Mann.
Der Verkäufer schüttelte ungläubig den Kopf. »Dafür bekommt Ihr vielleicht einen Huf dieses Prachtburschen.«
»Fünfundzwanzig«, bot ein weiterer Kerl.
»Meine Herren, vierzig sind das Mindeste«, gab der Pferdehändler zurück.
»Du hast ein gutes Auge, Silas«, murmelte Karl.
Silas von Maringer lächelte. »Das hast du mir beigebracht.« Dann sah er wieder hinüber zu dem schwarzen Pferd.
»Ich biete fünfunddreißig.« Ein gut gekleideter Mann mit einem Spitzbart hob die Rechte.
»Nicht genug«, erwiderte der Verkäufer. »Was ist mit Euch dort drüben? Ihr seid jung und scheint mir ein geübter Reiter zu sein, der mit einem solchen Ross umzugehen weiß.« Er sah mit einem breiten, eine Zahnlücke enthüllenden Grinsen zu Silas und seinem Vater.
»Was sagtet Ihr noch, wie alt der Wallach ist?« Silas fragte sich, wie man einem Mann ansehen konnte, ob er ein guter Reiter war, wenn er nur herumstand. Dummes Geschwätz, nichts weiter.
»Drei Jahre, jung und kräftig. Nur zu, seht ihn Euch genauer an.« Der Mann winkte ihn herbei.
Silas schüttelte den Kopf. »Ich schaue mich lieber nach einem anderen Pferd um.«
»Ihr werdet kein besseres finden, glaubt mir.«
Der Rappe prustete durch die Nüstern, aus einem Nasenloch rann eine hellgelbe, leicht schleimige Flüssigkeit.
»Gesund soll er sein? Dieses Pferd hat den Rotz, und ich würde einen Reichstaler darauf verwetten, dass er älter als drei Jahre ist«, gab Silas zurück.
»Wollt Ihr etwa behaupten, ich sage die Unwahrheit?« Erbost starrte ihn der Mann an.
»Der Junge hat recht«, rief einer der Umstehenden, »das Ross ist nicht gesund. Sucht Euch andere, die Ihr täuschen könnt.«
»Und verschwindet, bevor der Gaul noch weitere Pferde ansteckt«, forderte ein anderer.
Der Händler öffnete den Mund zur Erwiderung, sah sich aber plötzlich einem Dutzend grimmig dreinblickender Männer gegenüber, die drohend auf ihn zukamen. Abwehrend hob er die Hände. »Ich gehe schon, aber seid versichert, er hat keinen Rotz.« Dann machte er kehrt, zerrte den Rappen hinter sich her und verließ den Rossmarkt.
Karl und Silas wandten sich ab und schlenderten über den Markt. Plötzlich tippte jemand Silas von hinten auf die Schulter.
»Verzeiht, ich wollte mich bei Euch bedanken. Ihr habt mich vor einem Fehler bewahrt.«
Sie blieben stehen, drehten sich um und sahen sich dem gut gekleideten Mann mit dem Spitzbart gegenüber, der vorhin fünfunddreißig Reichstaler geboten hatte.
»Sehr freundlich von Euch«, erwiderte Silas, »ich habe nur gesagt, was ich dachte.«
»Ihr scheint Euch gut auszukennen, die anderen Herren haben den Mangel nicht bemerkt. Diethard Neustadt«, stellte er sich vor.
Karl nannte ihre Namen und lachte.
»Die Mitbieter hätten irgendwann festgestellt, dass sie belogen wurden, doch vermutlich zu spät. Ihr habt recht, mein Sohn kann schnell ein gutes Pferd von einem schlechten unterscheiden.«
»Was haltet Ihr davon, mir beim Pferdekauf zu helfen? Ich bezahle Euch gut«, schlug Diethard vor.
Silas und sein Vater wechselten einen Blick.
»Warum nicht? Was sucht Ihr für ein Ross? Ein Arbeitstier? Ein Ross für die Jagd oder für den Krieg?«, wollte Karl wissen.
»Pferde für die Poststation«, lautete die Antwort.
»Ihr arbeitet für die von Taxis?« Neugierig musterte Silas den Mann.
»Für Johann von den Birghden, er ist der Postmeister von Frankfurt«, erwiderte Diethard.
»Wie viele Pferde braucht Ihr?«, fragte Karl.
»Zwei.«
»Was springt für uns dabei heraus?«, wollte Silas wissen.
Diethard Neustadt überlegte und rieb sich den Bart. »Ein Reichstaler.«
Karl hob die Augenbrauen. »Für jeden von uns.«
»Nein, für Euch beide«, wehrte der Mann ab.
Silas grinste. »Ich habe Euch davor bewahrt, fünfunddreißig Reichstaler für ein unbrauchbares Pferd auszugeben. Entweder für mich und meinen Vater je einen oder Ihr müsst Euch auf Euren Pferdeverstand verlassen, mit dem es ja offenbar nicht weit her ist.«
Neustadt sah ihn verblüfft an und begann schallend zu lachen. »Ihr seid nicht nur ein Pferdekenner, sondern auch ein guter Verhandler. So sei es, Ihr bekommt das Geld.« Zur Bekräftigung hielt er Silas die Hand hin und dieser schlug ein.
Gemeinsam bahnten sie sich einen Weg durch die unzähligen Menschen, gingen vorbei an der Pferdeschwemme, wo Knechte durstige Tiere tränkten. Meist waren die Verkaufspferde an Pfählen angebunden, doch dazwischen gab es Gatter, in denen sich manche Tiere frei bewegen konnten. Rund um den riesigen Rossmarkt hatten sich zahlreiche Gasthöfe angesiedelt, ebenso Buden, in denen Lederwaren wie Sättel und Zäume verkauft wurden. Aber auch andere Handwerke waren zu finden: Töpfer, Schmiede und Wagner.
Karl blieb stehen und deutete auf ein großes Gatter neben einer kleinen Sandbahn.
»Diese Rösser sollten wir uns ansehen.«
Sechs Pferde wurden innerhalb der Umzäunung gehalten. Trotz des um sie herum herrschenden Trubels standen sie gelassen da. Zwei Grauschimmel kraulten sich gegenseitig den Widerrist.
»Spanisches Blut«, sagte Silas mit leuchtenden Augen.
»Welches würdet Ihr auswählen?«, fragte Diethard.
»Auf den ersten Blick den Apfelschimmel und den Dunkelfuchs«, antwortete Silas. »Doch ich möchte sehen, wie sie sich bewegen.«
Ohne ein weiteres Wort schritt Silas zum Gatter und auf einen kleinen, dürren Mann zu, der entspannt am Zaun lehnte. Gesicht und Unterarme waren sonnengebräunt, zahlreiche Fältchen um seine Mundwinkel vervielfältigten sich zu einem breiten Lächeln, als Silas ihn ansprach.
»Seid Ihr für diese Pferde zuständig?«
»Ja, ich bin Anton. Wie kann ich Euch zu Diensten sein?« Dunkle Augen blitzten unter dem schwarzen, teils ergrauten Schopf hervor.
»Ich möchte den Fuchs und den Apfelschimmel in Bewegung sehen.«
Anton nahm ein Zaumzeug von einem ins Holz geschlagenen Nagel, schob die untere Stange des Einlasses zurück und tauchte unter der oberen hindurch. Silas beobachtete den Alten, der sich dem Fuchs näherte. Ruhig strich dieser dem jungen Hengst über die Nase, zog ihm mit einer flüssigen Bewegung den Kopfzaum über die Ohren und schob das Gebiss zwischen die Zähne auf die zahnfreie Lade. Erfreut stellte Silas fest, dass es sich um ein, wie man es nannte, lindes Mundstück für ein zartes Maul handelte. Er mochte die oft scharfen Gebisse nicht, die viele Reiter nutzten. Willig kam der Dunkelfuchs mit. Silas nahm sich der oberen Stange an und ließ Anton mit dem Pferd hindurch. Dann verschloss er das Gatter. Inzwischen waren auch Neustadt und sein Vater hinzugekommen.
»Gebt ihn mir«, verlangte Silas. »Wie lautet sein Name?«
»Nabil«, antwortete Anton, während er eine Lederleine am Gebissring befestigte, die er anschließend Silas in die Hand drückte. Silas streichelte die samtweiche Nase, klopfte den Hals und führte Nabil zur Sandbahn. Die drei Männer folgten ihm, und nachdem Silas das Tier zwei Runden im Schritt hatte gehen lassen, hob er die Hand. Nabil sprach sogleich darauf an und trabte schwungvoll los. Kurz darauf forderte Silas ihn zum Galopp auf. Was er sah, gefiel ihm. Er wechselte die Richtung, achtete genau auf jede Bewegung des Tieres.
»Das reicht, Silas«, rief sein Vater.
Das Pferd fiel in Schritt und blieb schließlich auf Silas’ Kommando hin stehen. Zufrieden lächelnd lobte er den Fuchs. »Nabil, du bist nicht nur ein hübscher Kerl, sondern auch ein sehr gutes Pferd«, raunte er.
»Seid Ihr zufrieden?«, wollte Anton wissen.
»Wie alt, sagtet Ihr, ist Nabil?«, fragte Karl.
»Kaum vier Jahre alt«, erwiderte der kleine, drahtige Mann.
»Das ist zu jung«, mischte sich Diethard ein. »Ich brauche ältere Pferde, keine fast rohen wie dieses hier. Was ist mit dem Apfelschimmel?«
Während die Männer sich unterhielten, sah Silas Nabil ins Maul. Die oberen Schneidezähne waren in Reibung mit ihren Gegenspielern im Unterkiefer getreten, die Eckzähne noch nicht, und die Hakenzähne waren gerade dabei, das Zahnfleisch zu durchbrechen. Nabils Verkäufer sprach die Wahrheit.
Anton führte den Apfelschimmel herbei, einen acht Jahre alten Wallach, und nach Begutachtung der Männer entschied sich Diethard Neustadt, das Pferd zu kaufen. Der Schimmel blieb in Antons Obhut, sie zogen weiter zu anderen Händlern, und Diethard erstand noch einen kleinen Braunen. Nachdem Neustadt den Apfelschimmel bei Anton bezahlt hatte, brachten sie gemeinsam beide Pferde in einem Mietstall unter. Diethard ließ die zwei versprochenen Reichstaler in Karls Handfläche klimpern.
»Als Dank für Eure Hilfe lade ich Euch noch auf einen Humpen Bier ein«, bot er an.
»Da sagen wir nicht Nein«, grinste Karl.
Kurze Zeit später saßen sie in einer Gaststube, jeder einen Krug Bier vor sich, und redeten über den Krieg.
»Was denkt Ihr, wie lange das noch geht?«, fragte Karl.
Diethard zuckte mit den Schultern. »Der Krieg wird bald vorüber sein. Tilly und Wallenstein schlagen die Protestanten zurück. Der Tolle Halberstädter hat im vergangenen Jahr ordentlich einstecken müssen«, antwortete er. »Allerdings ist Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel noch nicht am Ende, der Verlust seines linken Arms in der Schlacht von Fleurus hat ihn offenbar noch toller werden lassen. Wie man in der Zeitung liest, will er den Niedersächsischen Reichskreis verlassen, um in die Vereinigten Niederlande zu gelangen. Aber Tilly ist ihm auf den Fersen. Ich bin überzeugt, er wird ihn einholen und seine Truppen zum Teufel jagen.«
»Ein Gutes hat dieser Krieg, unser Geld ist wieder etwas wert«, brummte Karl.
In den letzten beiden Jahren war es zu einer sprunghaften Geldentwertung gekommen, immer weniger Silber war in den Münzen enthalten gewesen. Als dann nur noch Kupfermünzen die Prägestätten verlassen hatten, hatten viele Menschen genug von dem anhaltenden Wertverlust gehabt. Bauern hatten es abgelehnt, die Münzen für ihre Getreideernte anzunehmen, und Bäcker hatten ihre Arbeit ruhen lassen. Als schließlich die Söldner das wertlose Zahlungsmittel als Lohn für ihre Kriegsdienste ablehnten, war endlich ein Umdenken in den Köpfen der Obrigkeit erfolgt. Seither wurde wieder nach der alten Reichsmünzordnung geprägt, und die nutzlosen Kreuzer und Pfennige wurden eingezogen.
Silas hörte kaum zu. Seine Gedanken beschäftigten sich mit Nabil. Dieser Dunkelfuchs mit dem weißen Stern auf der Stirn und den fast golden wirkenden Strähnen in der Mähne, die vermutlich von der Sonne herrührten, hatte es ihm angetan. Er erhielt einen unsanften Rippenstoß von seinem Vater.
»Träumst du? Ich habe dich gefragt, ob du noch ein Bier willst.«
»Nein. Können wir noch einmal zu diesem Dunkelfuchs?«
»Wozu? Unser Freund hier hat zwei gute Pferde gefunden …«
»Aber wir sind hergekommen, um für den Erzbischof einzukaufen …«, unterbrach Silas seinen Vater.
»… und wir haben bereits eine Stute und zwei Wallache im Mietstall untergestellt«, beendete Karl ungerührt seinen Satz.
»Wozu haben wir uns dann das Pferd mit dem Rotz überhaupt angesehen? Wir hätten auch einfach unserer Wege gehen und längst wieder zu Hause sein können«, begehrte Silas auf.
Karl musterte ihn mit einem spöttischen Grinsen.
»Ich wollte dich bei dem Rappen nur prüfen. Außerdem schiebst du den Auftrag des Kurfürsten vor. Du willst den Fuchs für dich haben.«
Silas ging nicht darauf ein. »Ein Pferd wie Nabil findet man nicht so oft. Wir sollten ihn mitnehmen, wenn er nicht schon vergeben ist.«
»Na schön, wir gehen noch einmal zu Anton«, gab Karl nach.
Sie verabschiedeten sich von Diethard, der sich erneut überschwänglich für ihre Hilfe bedankte.
Als sie am Gatter eintrafen, befand sich Nabil allein darin. Seine Gefährten hatten offenbar neue Besitzer gefunden. Wiehernd lief der Fuchs unruhig am Zaun auf und ab. Von Anton war weit und breit nichts zu sehen. Silas näherte sich dem jungen Pferd und sprach beruhigend auf es ein. Er war zwar kein Ersatz für die verlorenen Kameraden, trotzdem zeigte seine Stimme Wirkung auf Nabil, der erleichtert schien, dass sich überhaupt jemand um ihn scherte.
»Vater, bitte, lass ihn uns kaufen, über den Preis werden wir uns sicher einig«, bettelte Silas, der den Dunkelfuchs am Hals kraulte. »Er wird sich wunderbar im Rossballett machen, wenn er einmal so weit ist.«
»Ah, die Herren sind zurück«, dröhnte Antons Stimme an ihre Ohren. Der Händler schwankte ein wenig, offenbar hatte er getrunken. »Hab schon gemerkt, dass Ihr nicht von Nabil lassen könnt, junger Herr.«
»Wie viel soll er kosten?«, fragte Karl und erntete einen verblüfften und dankbaren Blick von Silas.
»Vierzig Reichstaler«, erwiderte der Händler mit schwerer Zunge.
»Lass uns gehen.« Karl zog Silas am Ärmel und kehrte Anton den Rücken. Widerstrebend ließ Silas sich mitziehen.
»Haltet ein«, rief Anton ihnen nach.
Karl verkniff sich ein Grinsen und wandte sich um.
»Er ist jung und kann nichts. Ich gebe dir fünfundzwanzig.«
»Was?«, rief der Händler entsetzt. »Wollt Ihr mich ruinieren? Er kennt Sattel und Zaum und einen Reiter auf seinem Rücken. Und er ist kerngesund. Seht nur, wie stolz er aussieht und seinem Namen Ehre macht. Nabil, der Edle, der Erhabene.«
»Bring einen Sattel«, forderte der Oberstallmeister.
Wenig später schwang sich Karl auf Nabils Rücken. Schnell fand er heraus, dass der hübsche Dunkelfuchs zwar einen Reiter kannte, aber kaum mehr. Karl von Maringer war ein exzellenter Pferdemann, sein Lehrer war ein Schüler Pluvinels gewesen. Pluvinel, der Reitlehrer des französischen Königs Ludwig XIII., war vor drei Jahren gestorben, hatte aber durch seine Reitkunst ein großes Erbe hinterlassen, dem etliche nacheiferten.
Karl von Maringer stieg ab und klopfte den anmutigen Hals. »Er kann nichts, wie gesagt. Wie lautet dein neues Angebot?«, fragte er Anton.
»Fünfunddreißig. Ihr macht mich arm«, jammerte der Händler.
»Ich gebe dir dreißig, das ist mein letztes Wort.«
Anton fluchte und zeterte, doch Silas wusste, sein Vater würde Nabil für den genannten Preis bekommen.
In der Wiener Hofburg herrschte wie immer Hochbetrieb. Unzählige Diener, Boten und Amtmänner eilten durch die Gänge. Draußen ging es noch geschäftiger zu, weil die Residenz stetig weiter ausgebaut wurde. Maurer, Steinmetze, Zimmermänner hämmerten, klopften und sägten um die Wette, und der ohrenbetäubende Lärm drang durch die geschlossenen Fenster. Seit Stunden wartete Leonhard II. von Taxis im Schweizerhof darauf, beim Kaiser vorgelassen zu werden. Er unterdrückte ein Gähnen, die lange Reise steckte ihm noch in den Knochen. Immerhin hatte er einen Blick auf die junge Kaiserin werfen können, die umringt von ihren Hofdamen an ihm vorbeigerauscht war. Erst im vergangenen Jahr hatte Ferdinand II. die zwanzig Jahre jüngere Eleonore von Mantua geehelicht, nachdem sechs Jahre zuvor die Mutter seiner sieben Kinder verschieden war, wovon die ersten drei nach ihrer Geburt nicht lange gelebt hatten. Die Wittelsbacherin Maria Anna von Bayern war des Kaisers Cousine gewesen, und selbst Wilhelm Lamormaini, der kaiserliche Beichtvater, hatte die nahe Verwandtschaft mit Ferdinand nicht gutgeheißen.
Leonhard ließ seine Gedanken schweifen. Mehr Posten mussten gegründet werden, um das Netz weiter zu vergrößern, und neue Verbindungen sollte es geben. Der Zeitpunkt dafür war günstig, da die Truppen der Katholischen Liga diejenigen der Protestantischen Union erfolgreich zurückschlugen.
»Seine Majestät ist bereit, Euch zu empfangen«, riss ihn ein Hofdiener aus seinen Überlegungen.
Ferdinand saß in einem prunkvollen Sessel hinter einem prachtvoll gearbeiteten Schreibtisch. Gekleidet nach der spanischen Mode, trug er nur Schwarz, und um seinen Hals lag eine schwere Gliederkette, an der ein goldener Widder baumelte. Das Zeichen des Ritterordens vom Goldenen Vlies. Leonhard beugte das Knie und trat auf einen Wink des Kaisers näher.
»Leonhard von Taxis, seid willkommen. Was verschafft mir die Ehre Eures Besuchs?«, fragte Ferdinand und sah ihn aufmerksam an.
»Majestät, es geht um die Umtriebe meines Vaters«, antwortete Leonhard und erntete hochgezogene Augenbrauen.
»Fahrt fort.«
»Lamoral vergibt Posten als Afterlehen und verschleudert so mein Erbe. Vor wenigen Wochen hat er die Frankfurter Station an Johann von den Birghden verpachtet. Für sechshundert Reichstaler im Jahr. Und Frankfurt ist nicht der einzige Posten, den er verpachtet oder gar verkauft hat.«
Ferdinand runzelte die Stirn. »Weswegen tut er das?«
Leonhard schnaubte durch die Nase. »Er braucht Geld, um seine Gespielin, die gut und gerne meine kleine Schwester sein könnte, bei Laune zu halten.«
Der Kaiser war strenggläubig und fromm, verabscheute außereheliche Beziehungen. Ferdinand II. schob seine Unterlippe vor, die dadurch noch größer wirkte, als sie ohnehin schon war. Die prominente Lippe war ein Erbe seiner Vorfahren, denn viele seiner Sippe zeigten dieses Merkmal der oft zu nahen Verwandtschaft in der Habsburger Ehepolitik. Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Das kann ich nicht gutheißen, ich werde den Generalerbpostmeister zur Ordnung rufen. Sein schimpfliches Benehmen eines liederlichen Weibes wegen dulde ich nicht. Wie kann er es wagen, mit einem kaiserlichen Regal nach seinem Gutdünken zu verfahren?«, ereiferte sich Ferdinand. »Geht zur Kanzlei und nennt einem der Schreiber die Namen der betroffenen Posthalter. Dann schickt ihn zu mir. Sorgt Euch nicht, Leonhard, Euer Erblehen wird keine weitere Schmälerung erfahren.«
Leonhard bedankte sich, und der Kaiser bedeutete ihm, er dürfe sich nun entfernen. Eigentlich hatte er die Hoffnung gehegt, mit Ferdinand erneut über die Wiedereinsetzung von Johann von Coesfeld in Köln sprechen zu können. Nach wie vor gefiel es ihm nicht, dass Jacob Henot sich das Kölner Amt zurückgeholt hatte. Der Niederländer hatte schon zu Lebzeiten von Leonhards Großvater versucht, das Postgeneralat an sich zu reißen, und gar einen Streik unter den Posthaltern heraufbeschworen, weil er ihren berechtigten Geldforderungen nicht nachgekommen war.
Nun denn, Henot war alt, und Leonhard musste nur dafür sorgen, dass dessen Sohn Hartger seinem Vater nicht als Postmeister von Köln nachfolgte, wenn Jacob eines nicht allzu fernen Tages vor seinen Schöpfer trat.
Während Leonhard am kaiserlichen Hof weilte, sah Alexandrine in der Kanzlei des Brüsseler Palais die Post durch. Vierteljährlich wurde zwischen den Postmeistern der einzelnen Stationen und Brüssel abgerechnet. Außerdem waren die Avisi, die Begleitschreiben der Postreiter, zu prüfen. Alles wurde schriftlich festgehalten: das Gewicht der zu befördernden Sendungen, die Portokosten und wie viel Zeit die Reiter für ihre Strecke benötigten.
Ihrem Schwiegervater war ihre Beschäftigung mit den Abrechnungen ein Dorn im Auge. Viel lieber sollte sie sittsam am Kaminofen sitzen, sticken und lesen oder sich von Poeten und Musikern unterhalten lassen. Doch nur durch ihr Wissen konnte sie ihren Gatten unterstützen, alles andere langweilte sie ohnehin.
»Wo ist Leonhard?« Grußlos kam ihr Schwiegervater in die Schreibstube.
»Grüß dich Gott, Lamoral«, sagte Alexandrine, ohne von den Papieren aufzusehen.
»Bekomme ich nun eine Antwort?«, brummte der Generalerbpostmeister.
Alexandrine legte ein Schreiben auf den kleinen Haufen links neben sich und nahm sich den nächsten Zettel vor.
»Er ist nicht hier, und jetzt lass mich allein.«
»Das sehe ich selbst, und sei nicht so hochnäsig. Was denkst du, wer du bist, so mit mir zu sprechen?«, fauchte Lamoral.
Nun sah sie auf, ihre Augen sprühten Funken. »Ich bin eine Gräfin, und nur durch die Heirat mit Leonhard bist du samt der ganzen Familie die Gesellschaftsleiter eine Sprosse höher geklettert. Also lass mich zufrieden und mach die Tür hinter dir zu, wenn du gehst.«
Der Alte trat näher, stützte sich mit den Händen auf der glänzenden Schreibtischplatte auf und lehnte sich zu ihr. »Du wirst mir jetzt sagen, wo ich meinen Sohn finde.«
»Beim Kaiser. Und jetzt verlass meine Schreibstube. Hier in diesem Teil des Palais habe ich das Sagen, nicht du. So wurde es vereinbart. Ach, und richte deiner Frau meine besten Grüße aus, sofern du dich neben all deinen Gespielinnen erinnerst, wer Genoveva ist.« Ein spöttisches Lächeln legte sich auf ihre Lippen.
Lamoral stieß sich vom Tisch ab. »Spar dir deinen Hohn. Was will Leonhard von Ferdinand?«
»Ich weiß es nicht«, gab sich Alexandrine unwissend. »Vielleicht ist er unzufrieden damit, dass du sein Lehen schmälerst, und klagt dem Kaiser sein Leid. Oder er schlägt ihm neue Postlinien im Norden vor, jetzt, wo die Protestanten vor Tilly zurückweichen und Niedersachsen uns gute Gewinne bescheren könnte. Du dagegen kümmerst dich schon länger lieber um andere Dinge oder soll ich sagen Röcke, anstatt dich mit Wichtigerem zu beschäftigen.«
Ihre Worte hatten ihr Ziel nicht verfehlt, das konnte sie ihrem Schwiegervater ansehen. Ohne eine Erwiderung verließ er grußlos das Schreibkontor. Alexandrine genehmigte sich ein zufriedenes Grinsen und widmete sich wieder ihrer Arbeit. Hier und da fielen ihr kleine Unregelmäßigkeiten bei den Reitzeiten auf. Das sollte nicht sein und wurde mit einer Geldstrafe geahndet. Kam ein Postreiter zu spät an, wurde der nächste zusätzlich mit dessen Briefen belastet. Meist geschah dies in den Wintermonaten, wenn die Straßen schlammig waren und die Pferde langsamer gehen mussten, um nicht zu stürzen. Manche Reiter allerdings machten einen kleinen Umweg, um sich um persönliche Dinge zu kümmern. Ansonsten schien alles in Ordnung zu sein.
Sie begann, Zahlenreihen niederzuschreiben, um den erwirtschafteten Gewinn der jeweiligen Posthalterei zu errechnen. Der Postmeister erhielt seinen Lohn aus Brüssel, von dem er Reiter und Pferde bezahlen musste, dazu kamen die Einkünfte der Porti und, je nachdem, auch aus dem zugehörigen Herbergsbetrieb. Ausgaben für Papier, Schreiber und Siegelwachs waren eher gering und gingen zulasten derer von Taxis. Meist reichte das Geld bei den kleinen Streckenposten für den Posthalter jedoch nicht aus, um gut davon leben zu können. So waren mehr und mehr Gasthöfe Zur Post entstanden, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Stationen befanden. Reisende kamen dort mit ihren Pferden unter, und die Einkünfte aus der Herberge flossen in die Kassen der Posthalter. Den Löwenanteil des erwirtschafteten Überschusses strich jedoch Brüssel ein. Jahr für Jahr beträchtliche Summen, die es der Familie ermöglichten, hier und da Höfe und Wald- und Forstgebiete zu erwerben. So mehrten sich die Reichstaler zusätzlich durch Pachterträge. Doch das meiste Geld wurde bei Weitem mit der Beförderung der Post verdient. Denn auch die Bürger hatten das Briefeschreiben für sich entdeckt, und Jahr für Jahr wurde das Sendungsaufkommen größer und füllte die Kassen derer von Taxis.
Alexandrines Ehemann hatte hochfliegende Pläne, das Wegenetz weiterzuspinnen, nämlich die Nord-Süd-Linie zu erweitern und neue Querverbindungen in allen Reichsterritorien zu schaffen. Schneller und weiter bedeutete noch mehr Einnahmen. Müde rieb sich die Gräfin die Augen und legte die Dokumente in eine Schublade. Zeit, nach den Kindern zu sehen. Lamo hatte wieder einmal tagelang unter hohem Fieber gelitten, und an dem schmalen Jungenkörper hatte sich ein Ausschlag gezeigt. Doch nun ging es ihm langsam besser, wofür sie Doktor Ingenhousz fürstlich entlohnte. Täglich schaute der Arzt nach dem Kind und mahnte, auch wenn Lamo nun wieder aufstehen dürfe, solle die Kindsmagd darauf achten, ihn nicht allzu lange herumlaufen zu lassen. Alexandrine vertraute der jungen Elise, die sich rührend und aufmerksam um die Kinder kümmerte. Die junge Frau war bei Weitem eine bessere Wahl als Anike, die Alexandrine herabgestuft hatte und die nun einfache Arbeiten wie die Reinigung der Zimmer verrichten musste.
»Du wirst deine Aufgaben nicht vernachlässigen und jeden Kreuzer, den dieses Pferd gekostet hat und noch kosten wird, bezahlen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dir nachzugeben«, brummte Karl, als er in den Stall kam und Silas bei Nabil vorfand.
»Das werde ich«, gab Silas zurück und lächelte verzückt, als der Fuchs ihm durch seine samtweichen Nüstern in die Haare blies. Schon lange sparte er auf ein eigenes Pferd, und sein Lohn für die Arbeit in den kurfürstlichen Ställen war nicht schlecht. Bald würde er die Schulden bei seinem Vater beglichen haben.
»Warum bist du dann hier und kümmerst dich nicht darum, das Lederzeug zu putzen?«
Silas arbeitete als Reitknecht. Neben ihm gab es noch fünf weitere junge Männer, die die gleiche Arbeit verrichteten. Als Oberstallmeister hatte Karl die Aufsicht über sie, ebenso wie über die Fuhr- und Stallknechte, Kutscher, Schmiede, Wagenmacher, Heubinder und Futterschreiber und selbstredend über die Pferde. Karl von Maringer oblag es auch, Strafen zu verhängen, wenn notwendig. Nur er und der unter ihm stehende Stallmeister verfügten über die Herausgabe von Pferden und Wagen. Peinlichst genau wurde Buch geführt: über Löhne, Futterkosten, Ausgaben für Anschaffungen neuer Sättel, Zäume oder Kleidung. Jeder Reitknecht war für mehrere Pferde und die Fuhrknechte für die Gespanne zuständig. Karl achtete genau darauf, dass mit den Tieren gut umgegangen und die Stallordnung eingehalten wurde. Zu alldem kam noch die Reitausbildung junger Adelssprösslinge. Silas bewunderte seinen Vater für seine Umsicht, sein Wissen und sein Können. Dafür wurde Karl auch gut entlohnt. Sechshundert Reichstaler im Jahr waren ein ordentliches Sümmchen. Doch noch mehr blickte Silas zu den stolzen Reitern auf, die die Pferde tanzen lassen konnten.
»Ich mach mich gleich an die Arbeit«, erwiderte er und drückte seinem Pferd einen Kuss auf die samtige Nase.
»Nicht gleich, sondern auf der Stelle. Bald ist eine Aufführung des Pferdeballetts vorgesehen, und unser Kurfürst hat jede Menge Gäste von Rang und Namen geladen.«
Nahezu jeder fürstliche Hof leistete sich eine Reitschule, wo das Können der Reiter und ihrer Pferde nach italienischem Vorbild unter Beweis gestellt wurde. In ihren tadellosen Wämsern in den Wappenfarben des Kurfürsten mit den polierten, glänzenden Knöpfen erweckte die Hofgarde samt ihren stolzen Tieren einen Zauber, dem sich kein Zuschauer entziehen konnte.
Silas ließ von Nabil ab und trollte sich. Er ging zur Sattelkammer und gesellte sich zu den anderen Knechten, die sich schwatzend um Sättel und Zäume kümmerten. Auch jede Menge Stiefel standen herum, die noch geputzt werden mussten. Silas griff sich einen Lappen und einen Topf mit Bienenwachs. Als er sich einen Sattel von der Stange holen wollte, bemerkte Arnold: »Du kommst zu spät, also bist du es, der sich der Stiefel annehmen wird.« Der ältere Mann stand den Reitknechten vor, und jeder hatte sich seinen Anordnungen zu fügen.
Die Pflege der Reitstiefel war eine unliebsame Aufgabe, und wer konnte, drückte sich davor. Stanken doch die meisten Stiefel nach den schweißigen Füßen ihrer Träger bis zum Himmel.
»Aber ich …«, hob er an, doch Arnold fuhr ihm über den Mund.
»Hör zu, Silas, nur weil dein Vater der Oberstallmeister ist und du ein eigenes Ross besitzt, heißt das nicht, dass du Anspruch auf eine Sonderbehandlung hast. Du wirst tun, was ich sage, und jetzt mach dich an die Arbeit.«
Silas verzog den Mund, angelte mürrisch ein Stiefelpaar aus dem Regal und rümpfte die Nase, als er den Gestank wahrnahm. Stundenlang reinigte und bürstete er Stiefel, bis sie glänzten, tilgte Schweiß und Schmutz von Lederzäumen. Finger und Rücken schmerzten, und sein Magen knurrte vernehmlich. Kein Wunder, denn er hatte das Morgenbrot ausgelassen, um gleich nach dem Aufstehen nach Nabil zu sehen. Jeden Morgen und nach getaner Arbeit pflegte und bewegte er das junge Pferd. Der Hengst war gelehrig und besaß ein sanftes Wesen, und inzwischen brummelte er leise, wenn er nur die Tritte seines Herrn auf der Stallgasse vernahm.
Endlich war Zeit für das Mittagsmahl, das die Knechte gemeinsam einnahmen. Einige Frauen und Mädchen, darunter Silas’ Mutter und seine siebzehnjährige Schwester Hella, kümmerten sich darum, dass die Männer etwas in den Bauch bekamen. Heute gab es eine dicke Suppe aus Erbsen, dazu für jeden ein fettes Stück Speck und einen Kanten Brot. Hungrig schlang Silas das Essen in sich hinein. Als er mit dem letzten Stück Brot seinen Teller auswischte, kam Hella zu ihm.
»Vater braucht dich, soll ich dir ausrichten.«
Seine Schwester besaß die gleichen dichten blonden Haare wie er, die sie von ihrer Mutter geerbt hatten, und Silas war stolz auf seine Schwester, die nicht nur hübsch, sondern auch klug und gewissenhaft war und ein großes Herz für ihre Mitgeschöpfe besaß. Morgens half sie der Mutter, und ab der ersten Stunde nach Mittag arbeitete sie im Alexiusspital, wo sie alte und krank gewordene Bedienstete des kurfürstlichen Hofs versorgte, die dort ihren Lebensabend verbrachten.
»Was will er? Es gibt in der Sattelkammer noch genug zu tun, und die Pferde müssen auch noch bewegt werden«, erwiderte Silas.
Hella zuckte mit den Schultern. »Geh und frag ihn, ich muss zum Spital.«
Seufzend stand er auf und ging hinüber zu Arnold. »Mein Vater ruft nach mir, ich komme so schnell wie möglich zurück.«
Der ältere Mann runzelte verärgert die Stirn, sparte sich aber eine Erwiderung. Auch er hatte sich dem Oberstallmeister unterzuordnen. Silas fand seinen Vater bei der Reitbahn. Fünf Schüler ritten auf einem Zirkel um Karl von Maringer herum und versuchten, seinen Anweisungen zu folgen. Einer von ihnen würde wohl nie ein guter Reiter werden, stellte Silas fest. Aber die anderen machten ihre Sache bereits ziemlich ordentlich.
»Vater«, rief er, »du wolltest mich sprechen?«
Karl gönnte seinen Schülern eine Pause.
»Roland von Reiseck hat sich den Arm gebrochen, außerdem den Knöchel verstaucht und passt in keinen Stiefel. Du wirst deshalb statt seiner an der Aufführung teilnehmen und reitest Ariald«, beschied ihm sein Vater kurz und bündig.
Silas war wie vom Donner gerührt. Wie oft hatte er sich gewünscht, mitreiten zu dürfen. Dank seines Vaters saß er fest im Sattel. Doch nicht nur das, ihm war es gegeben, eine Einheit mit dem Tier zu bilden. Von Kindesbeinen an.
»Aber ich kenne die Figuren doch gar nicht«, wandte er mit klopfendem Herzen ein, »und der Tanz der Pferde findet bald statt.«
»Hör auf zu jammern, Roland wird dir helfen. Außerdem reitest du nicht an der Spitze, sondern in der Mitte. Du wirst dir schon alles merken können. Und nun geh zu Roland, er wartet im Stall auf dich.«
»Und was ist mit meiner Arbeit? Arnold wird …«
»Nichts wird er«, unterbrach ihn Karl. »Ich rede mit ihm.«
Kurz darauf stieg Silas in den Sattel. Ariald war ein fünfzehn Jahre alter feinfühliger Schimmelhengst, der sämtliche Lektionen beherrschte. Roland von Reiseck beschrieb Silas den Ablauf des Tanzes, während er auf dem Weg zur Bahn auf einen Stock gestützt mürrisch nebenher humpelte, den linken Arm trug er in einer Schlinge.
»Viktor von Eisenberg gibt die Kommandos, und der alte Knabe hier macht das fast von allein«, erklärte Roland mürrisch und klopfte den starken Pferdehals. Sie übten eine Stunde, und Silas stieg schwitzend ab. Zwischen Arialds Hinterbeinen hatte sich weißer Schaum gebildet, auch für ihn war die Arbeit anstrengend gewesen.
»Morgen reitest du mit den anderen, und nun reib den Burschen gut ab.« Kein Lob, nichts. Dabei war Silas stolz darauf, mit Ariald so gut zurechtgekommen zu sein.
»Habt Dank«, antwortete er, stieg aus dem Sattel und tätschelte den Hengst an der Schulter. Von Reiseck wandte sich ab und hinkte wortlos davon.
»Und, was hat Ferdinand gesagt?«, fragte Alexandrine.
Leonhard war vor zwei Stunden aus Wien zurückgekommen, hatte sich gewaschen und frische Kleider angezogen. Jetzt saßen sie im Salon bei gebratenen Rotaugen und Krebsen aus der Senne, dazu gab es frisches weißes Brot und Mangold. Goldgelbe, nach Zimt duftende Apfelküchlein und eine Mandel-Rosinen-Torte standen an der Seite, bereit, verzehrt zu werden.
Leonhard zog eine Gräte zwischen seinen Lippen hervor und legte sie an den Tellerrand.
»Der Kaiser wird Vater eine Ermahnung schreiben, dass es ihm nicht zusteht, ein Afterlehen zu vergeben.« Ein Schluck Torbato spülte den nächsten Bissen hinunter. Leonhard ließ den kühlen Weißwein im Glas kreisen und grinste seine Frau an.
»Es war ein guter Einfall, nach Wien zu reisen. Endlich wird mein Vater in die Schranken gewiesen.«
Alexandrine hob vielsagend die Augenbrauen. »Du weißt schon, wem du das zu verdanken hast.«
»Ich bin dir zutiefst verpflichtet, Comtesse«, spöttelte Leonhard, um gleich darauf zu fluchen. »Dieser verdammte Fisch besitzt mehr Gräten als Fleisch. Sag der Köchin, sie soll künftig Flussbarsche kaufen, keine Rotaugen mehr.«
»Du wirst schon nicht daran sterben«, erwiderte Alexandrine und nahm sich ein Stück Torte. Genüsslich spürte sie mit der Zunge dem feinen Geschmack nach, schmeckte das Rosenwasser heraus. »Morgen brechen wir nach Mainz auf, der Reichserzkanzler hat uns eingeladen.«
»Morgen?« Leonhard seufzte. »Ich habe genügend Stunden im Sattel verbracht, eigentlich wollte ich …«
»Nichts da, ausruhen kannst du dich später. Eine solche Einladung schlägt man nicht aus«, unterbrach ihn Alexandrine.
Als Erzbischof von Mainz und Kurfürst war Schweikhard von Kronberg gleichzeitig auch Reichserzkanzler und damit der wichtigste Mann neben dem Kaiser. Ihm oblag es, die anderen Kurfürsten zusammenzurufen, wenn nach dem Ableben eines Kaisers eine neue Wahl anstand. Er verwahrte das kaiserliche Siegel, leitete die Versammlung auf den Reichstagen, ernannte Amtmänner für die Reichskanzlei und übte die Schutzgerechtigkeit der Reichspost aus. Allein deswegen sollten die von Taxis ihn nicht vor den Kopf stoßen.
»Der Erzbischof ist tatsächlich in Mainz? Meist hält er sich doch in Aschaffenburg auf. In seiner dortigen Residenz und umgeben von den Wäldern des Spessarts verweilt er lieber, wie man sich erzählt, weil er dort der Jagd und dem Wein besser frönen kann«, erwiderte Leonhard belustigt.
Von Kronberg hatte vor einigen Jahren die im Zweiten Markgrafenkrieg zerstörte Burg in Aschaffenburg zu einem fürstlichen Schloss aus Rotsandstein für fast eine Million Gulden wiederaufbauen und nach sich benennen lassen. Seither führte er meist von dort aus seine Geschäfte. Einzig durch das Siechenhaus in Leider auf der anderen Flussseite wurde der Blick von Schloss Johannisburg über den ruhig dahinfließenden Main, über Wiesen und Wälder getrübt. Doch daran ließ sich nun nichts ändern.
Alexandrine lachte leise.
»Wohl wahr, der gute Johann ist ein trinkfester Bursche.«
Leonhard naschte von einem Apfelküchlein und schenkte seiner Gattin und sich Wein nach.
»Gut, reiten wir bei Tagesanbruch los, wir brauchen ohnehin neue Geleitbriefe, also ist der Weg nicht umsonst.«
Die Salvae guardiae, die Schutzbriefe, garantierten den Poststationen und Reitern den kaiserlichen Schutz vor räuberischen Übergriffen. Auch Kaufleute genossen dieses Privileg, um in Kriegszeiten ihre Waren sicher über die Grenzen zu bringen, und ebenso galten sie für bestimmte Häuser und Städte. Mit den gesiegelten Papieren gelangte man gefahrlos über Grenzen, und wurden ihre Halter trotzdem überfallen, drohten den Übeltätern harte Strafen.
Silas war noch nie so aufgeregt gewesen. Heute fand der Tanz der Pferde statt, und noch abends vor dem Einschlafen hatte er die zu reitenden Aufgaben vor sich hin gemurmelt. Eine Stunde lang hatte er Ariald gestriegelt und gebürstet, Mähne und Schweif gekämmt, bis die weißen Haare geschimmert hatten. Eigentlich übernahm ein Pferdeknecht diese Arbeit, aber Silas entspannte sich dabei und genoss die Zweisamkeit mit dem Pferd. Doch jetzt, kurz vor Beginn des Balletts, kehrte die Aufregung zurück. Alles war perfekt, einzig das Wams saß nicht ganz so tadellos wie es sollte, denn Roland von Reisecks Schultern waren breiter. Die Zeit war jedoch zu knapp gewesen, um Silas ein passendes Wams schneidern zu lassen. Seine Stiefel glänzten mit dem Zaumzeug um die Wette, und die Sporen funkelten im Sonnenlicht. Es wurde Zeit, die Pferde aufzuwärmen. Ariald spürte Silas’ Aufregung, als er ihn gesattelt nach draußen führte, und wurde unruhig.
»Wollen wir ein Stück zusammen reiten?«, fragte Viktor von Eisenberg, der gerade auf seinen Hengst stieg. Der Fünfzigjährige war ein abgebrühter Mann, den so schnell nichts erschüttern konnte, und Silas nahm das Angebot dankbar an. Sie lenkten ihre Tiere zum Rheinufer, und während sie nebeneinanderher ritten, erzählte von Eisenberg, wo er die Reitkunst erlernt hatte.
»Ich hatte das große Glück, bei Pluvinel selbst zu lernen. Ein unglaublicher Mann. Sein Leitsatz lautete: ›Wir sollten die Anmut des jungen Pferdes bewahren, denn sie ist wie der Blütenduft, der, einmal entschwunden, nie wiederkehrt.‹ Ist das nicht fabelhaft?«
»Ein schöner Gedanke«, erwiderte Silas und spürte, wie seine Anspannung langsam nachließ und der Schritt seines Pferdes gemäßigter und raumgreifender wurde.
»Wir Schüler haben uns Antoine de Pluvinels Ansicht zu Eigen gemacht: Strafe niemals ein Pferd, sondern belobige es, und es wird dir ein treuer Gefährte sein.«
»Sie sind die wunderbarsten Geschöpfe der Welt, und viel zu oft wird ihnen Leid zugefügt«, seufzte Silas und strich sanft über Arialds Hals.
»Wir sollten umkehren«, meinte Viktor nach einer Weile einvernehmlichen Schweigens und wendete sein Pferd. Silas folgte ihm und dachte darüber nach, Nabils Ausbildung in Viktors Hände zu legen.
Die Aufführung fand in der Reitbahn vor dem Schloss auf der Rheinseite statt. Auf den Tribünen der zwei langen Seiten hatten der Erzbischof und seine Gäste bereits Platz genommen. Die anderen acht Reiter der Hofgarde gesellten sich zu Silas und Viktor, waren gut gelaunt und ihre Pferde in einem Zustand aufmerksamer Gelassenheit. Als die Musiker zu spielen begannen, ritten sie paarweise hintereinander ein und stellten sich nebeneinander auf, um vor Johann Schweikhard von Kronberg die Hüte zu ziehen. Flöten, Posaunen, Theorbe, Pommer und Dulzian verstummten. Wohlwollend neigte der Erzbischof den Kopf. Viktor von Eisenberg nahm seine an einer Kette um seinen Hals hängende Pfeife und blies hinein. Das Zeichen zum Beginn. Bei den ersten Tönen trabten die Reiter aus dem Stand an, reihten sich wieder hintereinander ein, teilten sich bei Erreichen der kurzen Seite in zwei Gruppen, querten die Diagonale, sodass immer abwechselnd ein Reiter von links und einer von rechts kam. Beim nächsten Pfiff wechselten sie in einen gesetzten Galopp. Es folgten zwei ineinandergreifende Kreise. Silas hatte Mühe, Ariald zurückzuhalten, damit genug Platz für den entgegenkommenden Reiter blieb. Doch ansonsten genoss er es, den wunderbaren Hengst unter sich zu spüren.
Zu schnell war der Ritt vorbei, und sie zogen erneut die Hüte vor dem Kurfürsten. Die Gäste applaudierten, und Silas’ Blick fiel auf eine reich gekleidete Dame mit dunkelbraunen Haaren, die nur wenige Plätze entfernt vom Kurfürsten saß. Ihre Augen trafen sich, und die Lippen der Fremden verzogen sich zu einem unwiderstehlichen Lächeln. Scheu lächelte Silas zurück und konnte sich von den strahlenden Augen kaum losreißen, vergaß beinahe, den Hut wieder aufzusetzen und gemeinsam mit den anderen aus der Bahn zu reiten.