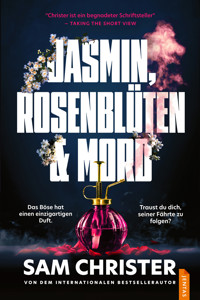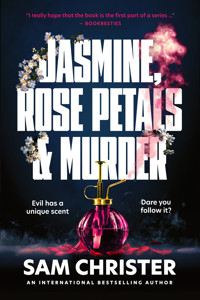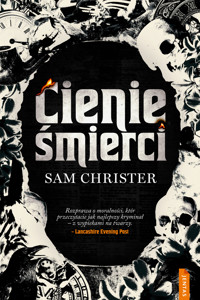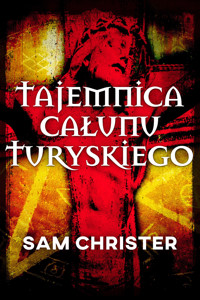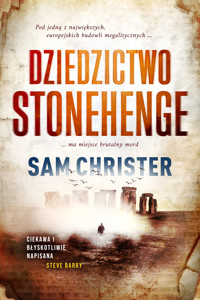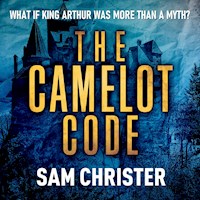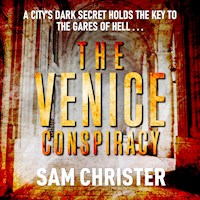Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Macht von Stonehenge ist 5000 Jahre alt. Sie ist kein Mythos. sie lebt. Und sie ist tödlich. Acht Tage vor der Sommersonnenwende stirbt in Stonehenge ein Mann bei einem grausamen Opferritual. Kann der junge Archäologe Gideon verhindern, dass am "Tag des Blutes" die uralten Kräfte des Steinkreises erwachen? Stonehenge ist die berühmteste Kultstätte der Welt. Ihre Mythen und Rituale sind aktueller denn je. Christers atemberaubend schneller, dramatischer Thriller enthüllt ihr uraltes Geheimnis. Der Top-Ten-Bestseller aus England. --- "Eine gute Empfehlung für alle Liebhaber von Thrillern mit religiösem beziehungsweise mystischem Hintergrund." - Kriminet "Intelligenter, spannender Psychothriller." - Samea "Es ist spannend, gut erdacht und lässt sich flüssig lesen." - DarkReader "Schnell, smart und echt spannend." - Daily Mail
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Erbe von Stonehenge
Das Erbe von Stonehenge
© Sam Christer 2011
© Deutsch: Jentas A/S 2021
Originaltitel: The Stonehenge Legacy
ISBN: 978-87-428-2034-6
–––
Für meinen Sohn Elliott –
ich könnte nicht stolzer auf dich sein
Erster Teil
Die Steine sind groß
Und voller Zauberkraft
Kranke Männer
Ziehen dorthin
Sie waschen den Stein
Und das Wasser spült ihre Krankheit hinfort
Laghamon
1
Sonntag, 13. Juni, Neumond
Stonehenge
Nebelschwaden rollen wie Steppenhexen aus Dampf über das nächtliche Wiltshire. Draußen auf den flachen, weitläufigen Feldern recken die Späher den Hals himmelwärts, um einen ersten Blick auf die schmale Silbersichel zu erhaschen. Es ist Neumond, so dass unter einer weiten Umhüllung aus samtschwarzer Dunkelheit nur ein Hauch von jungfräulichem Weiß hervorleuchtet.
Am Horizont wendet eine bleiche Gestalt unter ihrer Kapuze den Kopf. Eine alte Hand hebt eine wild flackernde Fackel hoch. Gedämpft, aber dennoch dringlich fliegen die Worte von einem Zuschauer zum anderen. Das Opfer ist bereit. Nach seinen Tagen des Fastens ist der Mann hergebracht worden. Sieben Tage ohne Nahrung. Kein Licht, kein Geräusch, keine Berührung, kein Geruch. Sein Körper ist gesäubert von den unreinen Dingen, die er sich einverleibt hat. Seine Sinne sind geschärft, seine Gedanken nur noch auf sein Schicksal gerichtet.
Die Späher sind in handgewebtes Leinen gehüllt. Als Gürtel tragen sie Schnüre, aus Pflanzenfasern geflochten. Ihre Füße stecken in groben Tierhäuten, genau wie einst bei den Alten, den Gründern der Zunft.
Die Säuberer entfernen die schmutzigen Kleider des Mannes. Er wird bei seinem Abschied von dieser Welt genauso wenig tragen wie bei seiner Ankunft. Sie ziehen ihm einen Ring vom Finger, eine Uhr vom Handgelenk und vom Hals eine klobige Goldkette, an der das Symbol eines falschen Gottes baumelt. Trotz seiner heftigen Gegenwehr schleppen sie ihn zum Fluss und tauchen ihn hinein. Kaltes Wasser füllt seinen Mund, gurgelt und schäumt in seinen verderbten Lungen. Er kämpft wie ein erschrockener Fisch, in der Hoffnung, dass ihn eine rettende Strömung aus den Händen seiner Fänger befreien wird.
Es soll nicht sein.
Sobald er gereinigt ist, zieht man den Hustenden ans Ufer. Die Träger stürzen sich auf ihn und binden ihn mit Rindenstreifen auf eine Trage, gefertigt aus dem Holz der Kiefer, jenes edlen Baumes, der sie schon seit der Eiszeit begleitet. Sie hieven ihn hoch auf ihre Schultern und tragen ihn wie stolze, liebende Männer den Sarg eines geliebten Bruders. Er ist ihnen teuer.
Ihr Weg ist weit – gut drei Kilometer. Südlich des alten Damms von Durrington marschieren sie in Richtung große Allee, hinunter an den Ort, wo die Blausteine und die vierzig Tonnen schweren Sarsensteine aufragen.
Die Träger beklagen sich nicht. Sie wissen, welche Qualen ihre Vorfahren litten, als sie die mächtigen Steine Hunderte von Kilometern transportierten. Die Astroarchitekten mussten damals Hügel überwinden und Täler durchqueren, ja sogar über stürmische Meere segeln. Mit den Geweihstangen von Rotwild und den Schulterblättern von Rindern hoben sie die Gruben für den Steinkreis aus, wie er heute noch steht. Hinter den Trägern folgen die Jünger – alle männlich und in raue Kapuzenmäntel gehüllt. Sie sind aus ganz Großbritannien, Europa und den entlegensten Ecken der Erde angereist, denn an diesem Abend vollzieht der neue Henge-Meister sein erstes Opferritual. Ein längst überfälliges Opfer an die Götter. Eines, das die spirituelle Kraft der Steine erneuern wird.
Die Träger erreichen den Fersenstein, jenen massigen, etwas geneigt stehenden Sandsteinblock, dem der Himmelsgott innewohnt. Er lässt alle rundherum wie Zwerge erscheinen, mit Ausnahme der riesigen, achtzig Meter entfernt stehenden Sarsensteine. In der Mitte des Megalithportals flackert ein Feuer, dessen Rauchfinger nach dem Mond zu greifen scheinen. Im Schein dieses Feuers hebt der Henge-Meister nun die Hände. Er hält einen Moment inne, ehe er langsam mit beiden Armen einen großen Bogen beschreibt, um auf diese Weise die Wand aus Energie zurückzuschieben, die zwischen ihm und dem Hufeisen aus hochaufragenden Trilithen besteht.
»Große Götter, ich spüre eure nie endende Gegenwart. Ewige Erdmutter, erhabener Himmelsvater, wir sind hier zusammengekommen, um euch anzubeten, und beugen in eurer Gegenwart ehrerbietig die Knie.«
Die geheime Versammlung von Kapuzenträgern sinkt lautlos zu Boden. »Wir, eure gehorsamen Kinder, die Jünger der Geheiligten, sind hier auf den Gebeinen unserer Ahnen versammelt, um euch zu ehren und euch unsere Hingabe und Treue zu beweisen.«
Der Meister legt über dem Kopf die Handflächen aneinander und verharrt in dieser Position, die Finger im Gebet himmelwärts gerichtet. Die Träger erheben sich und hieven den an die grobe Trage gebundenen jungen Mann auf ihre Schultern.
»Wir danken all euch großen Göttern, die ihr uns behütet und segnet. Euch und den Gebräuchen der Alten zu Ehren bringen wir nun dieses Opfer dar.«
Die Träger setzen sich in Bewegung, um das letzte Stück ihres Weges zurückzulegen, hinaus durch das riesige Steintor bis hin zur Opferstelle, die auf der Achse des Solstitiums, der Sonnenwende, liegt.
Der Opferstein.
Sie legen den jungen Mann auf den langen grauen Steinblock. Der Henge-Meister neigt das Haupt und senkt die gefalteten Hände, um damit die Stirn des Opfers zu berühren. Er hat keine Angst davor, in die vor Entsetzen geweiteten blauen Augen zu blicken, die zu ihm emporstarren. Er hat sich gewappnet und jedes Mitgefühl aus seinem Herzen verbannt – genauso gnadenlos, wie ein König einen Verräter in die Verbannung schicken würde.
Langsam lässt er die gefalteten Hände um das Gesicht des Mannes kreisen, während er weiter die Worte des Rituals spricht. »Im Namen unserer Väter, unserer Mütter, unserer Beschützer und Mentoren sprechen wir dich los von deinen irdischen Sünden, und durch dein tödliches Opfer reinigen wir deinen Geist und beschleunigen deine Reise zum ewigen Leben im Paradies.«
Erst jetzt löst der Henge-Meister seine Handflächen wieder voneinander und breitet die Arme weit aus. Die eine Hälfte seines Körpers wirkt im Mondlicht knochenbleich, die andere im Schein des Feuers blutrot. Er steht im Einklang mit der Mondphase. Vor den großen Steinen zeichnet sich seine Silhouette kreuzförmig ab.
In seine ausgestreckten Hände legen die Träger nun die heiligen Werkzeuge. Der Henge-Meister nimmt sie entgegen und schlingt die Finger um glatte Holzgriffe, die Jahrhunderte zuvor geschnitzt wurden.
Die erste Axt aus Flintstein trifft den Kopf des Opfers.
Dann die zweite.
Nun wieder die erste.
Blut regnet auf den Boden, bis Haut und Knochen wie eine Eierschale nachgeben. Mit dem Tod des Opfers kommt von der Menge lautes Gebrüll – ein triumphierender Aufschrei, während der Meister zurücktritt und dabei die Arme weit ausbreitet, damit sie das Opferblut auf seinem Gewand und seiner Haut sehen können.
»So wie du Blut vergossen und Knochen zerbrochen hast, um zu unserem Schutz diese göttliche Pforte zu schaffen, so vergießen auch wir unser Blut und brechen unsere Knochen für dich.«
Die Jünger treten vor. Einer nach dem anderen tauchen sie die Finger in das Blut des Opfers und zeichnen damit ihre Stirn. Dann kehren sie zurück in den Hauptkreis und küssen die Trilithen.
Gesegnet und mit Blut gezeichnet, verbeugen sie sich, ehe sie lautlos verschwinden, hinaus in die Weite der dunklen Felder von Wiltshire.
2
Stunden später
Tollard Royal, Cranborne Chase, Salisbury
Professor Nathaniel Chase sitzt im eichenvertäfelten Arbeitszimmer seines Landhauses aus dem siebzehnten Jahrhundert am Schreibtisch und sieht durch die bleiverglasten Fenster zu, wie das morgendliche Dämmerlicht einem Sommersonnenaufgang weicht. Dieses tägliche Ringen lässt er sich nie entgegen.
Ein farbenprächtiges Pfauenmännchen stolziert über den Rasen, hervorgelockt durch das erste Licht auf dem taunassen Gras. Hinter ihm folgen unauffällig gefärbte Weibchen, die erst einmal so tun, als wären sie gar nicht an ihm interessiert, und stattdessen nach fettgefüllten Kokosnussschalen picken, die Chases Gärtner für sie aufgehängt hat.
Stolz spreizt das Männchen seine Flügel zu einem Umhang aus schillerndem Kupfer. Kopf, Hals und Ohren des Vogels leuchten in einem tropischen Grün, Kehle und Wangen in einem exotischen, glänzenden Violett. Ein klar abgegrenztes weißes Band um den Hals verleiht ihm ein priesterliches Aussehen, während sein Gesicht und sein Kehllappen tiefrot gefärbt sind. Das Tier ist melanistisch – irgendeine Mutation des gewöhnlichen Pfaus. Bei genauerem Hinsehen kommt dem Professor der Verdacht, dass ein paar Generationen zuvor auch ein, zwei Exemplare des seltenen grünen Pfaus im Spiel gewesen sein müssen.
Chase ist ein erfolgreicher Mann – erfolgreicher, als es sich die meisten je zu erträumen wagen. Als brillanter Akademiker genießt er den Ruf, einer der klügsten Köpfe der Universität von Cambridge zu sein. Seine Bücher über Kunst und Archäologie finden weltweit großen Absatz, und zu den Käufern zählen längst nicht nur jene, die solche Bücher normalerweise zu Studienzwecken erstehen. Sein riesiges Vermögen und sein luxuriöser, eleganter Lebensstil gründen sich jedoch nicht auf seine akademischen Weihen. Er hat Cambridge schon vor vielen Jahren verlassen und seine Fähigkeiten dafür eingesetzt, einige der seltensten Kunstgegenstände der Welt aufzuspüren, zu identifizieren und zu kaufen, um sie anschließend wieder zu verkaufen. Dieser Vorgehensweise verdankt er einen Stammplatz auf der Liste der Reichen und den im Flüsterton verbreiteten Ruf, eine Art Grabräuber zu sein.
Der Sechzigjährige nimmt seine braungerahmte Lesebrille ab und legt sie auf den antiken Schreibtisch. Die Angelegenheit, die er zu erledigen hat, ist zwar dringlich, kann aber dennoch warten, bis die Varietévorstellung draußen vorüber ist.
Der Harem des Pfaus hört pflichtbewusst zu fressen auf, um dem Hahn die Aufmerksamkeit zu widmen, nach der er so lechzt. Er gibt einen kurzen, ruckartigen Tanz zum Besten und führt die gelbbraunen Weibchen dann zu einer sauber getrimmten Ligusterhecke. Chase greift nach einem kleinen Fernglas, das er immer am Fenster liegen hat. Zuerst sieht er nichts als graublauen Himmel. Als er den Gucker ein wenig nach unten neigt, tauchen die Vögel verschwommen in seinem Sichtfeld auf. Er dreht an dem Fernglas herum, bis schließlich alles gestochen scharf ist – so klar wie dieser kühle Sommermorgen. Das Männchen ist mittlerweile von sämtlichen Weibchen umringt und bricht immer wieder in einen kurzen, trillernden Gesang aus, um seine Freude darüber zum Ausdruck zu bringen. Ein Stück rechts von der Gruppe befindet sich am Fuß der Hecke ein flaches Nest.
Chase ist in empfindsamer, sentimentaler Stimmung. Das Schauspiel draußen rührt ihn fast zu Tränen. Ein männliches Wesen, auf dem viele bewundernde Blicke ruhen – auf der Höhe seines Lebens, voller Pracht und Potenz, im Begriff, eine Familie zu gründen. Er, Chase, kann sich noch gut an diese Tage erinnern. Dieses Gefühl. Diese Wärme.
Alles vorbei.
In dem vornehmen Haus gibt es keine Fotos von seiner verstorbenen Frau Marie und auch keine von seinem Sohn Gideon, der ihm fremd geworden ist. Das Haus ist leer. Die Zeit, in der der Professor sein Gefieder gespreizt hat, ist unwiederbringlich vorüber.
Er legt das Fernglas neben das Flügelfenster und kehrt zu seinem wichtigen Dokument zurück. Nachdenklich greift er nach einem alten Füllfederhalter, einem Pelikan Caelum, der in limitierter Auflage erschienen ist, und freut sich darüber, wie schwer und gut er in der Hand liegt. Von diesem Schreibgerät wurden nur insgesamt fünfhundertachtzig Exemplare hergestellt, und zwar zu Ehren der Fünfundachtzigmillionen-Kilometer-Umkreisung der Sonne durch den Planeten Merkur. Die Astronomie hat im Leben von Nathaniel Chase eine entscheidende Rolle gespielt. Zu entscheidend, geht ihm durch den Kopf.
Er taucht die Spitze des Füllers in ein antikes Tintenfass aus Messing, wartet, bis der Pelikan sich sattgetrunken hat, und nimmt dann seine Arbeit wieder auf.
Nathaniel braucht eine Stunde, um sein Vorhaben abzuschließen. Das schöne Papier, auf dem er schreibt, ist aus feinstem Bütten und trägt sein persönliches Wasserzeichen. Gewissenhaft liest er jede einzelne Zeile noch einmal durch und überlegt, welche Wirkung der Brief auf seinen Leser haben wird. Anschließend löscht er ihn ab, faltet ihn zweimal säuberlich, steckt ihn in einen Umschlag und versiegelt diesen mit altmodischem Wachs und seinem persönlichen Stempel. Zeremonien sind etwas Wichtiges. Besonders an diesem Tag.
Nachdem er den Brief auffällig mitten auf dem Schreibtisch platziert hat, lehnt er sich zurück. Er ist zugleich traurig und froh darüber, dass er das Schriftstück nun vollendet hat.
Mittlerweile steht die Sonne bereits über den Obstbäumen auf der gegenüberliegenden Seite des Gartens. An jedem üblichen Tag würde er jetzt zu einem Rundgang aufbrechen, vielleicht im Sommerhäuschen einen Happen essen, dabei das Tierleben im Garten beobachten und sich anschließend ein nachmittägliches Nickerchen gönnen. An jedem üblichen Tag.
Er öffnet die unterste Schreibtischschublade und hält einen Moment inne, den Blick auf den Inhalt der Schublade gerichtet. Mit einer entschlossenen Bewegung greift er nach dem Revolver aus dem Ersten Weltkrieg, hält ihn sich an die Schläfe und drückt ab.
Draußen vor dem blutbespritzten Fenster flattern die Pfaue kreischend auseinander, hinauf in den grauen Himmel.
3
Am nächsten Tag
Universität Cambridge
Gideon Chase legt wortlos auf und starrt mit leerem Blick an die Wände in seinem Büro, wo er eben noch damit beschäftigt war, die Ergebnisse einer Grabung bei einem megalithischen Tempel auf Malta durchzugehen.
Die Polizistin hatte sich völlig klar ausgedrückt. »Ihr Vater ist tot. Er hat sich erschossen.« Rückblickend kann er sich kaum vorstellen, wie sie es ihm noch deutlicher hätte sagen sollen. Da war kein Wort zu viel gewesen. Natürlich hatte sie irgendwo ein »Es tut mir leid« eingeflochten und ihm ihr Beileid ausgesprochen, aber zu dem Zeitpunkt hatte das brillante Gehirn des Achtundzwanzigjährigen, der kurz vor seiner Berufung zum Professor stand, bereits dichtgemacht.
Vater. Tot. Erschossen.
Drei kleine Wörter, die das größtmögliche Bild zeichneten. Als Antwort aber brachte er nur ein »Oh« heraus. Er bat sie, das gerade Gesagte zu wiederholen, um sicherzugehen, dass er sie richtig verstanden hatte. Wobei er durchaus wusste, dass er sich nicht verhört hatte. Es war ihm nur so peinlich, dass er nichts anderes sagen konnte als »Oh«.
Es war Jahre her, dass Vater und Sohn das letzte Mal miteinander gesprochen hatten. Eine ihrer schlimmsten Auseinandersetzungen. Gideon war wutentbrannt hinausgestürmt und hatte geschworen, nie wieder ein Wort mit dem alten Bock zu sprechen. Es war ihm nicht schwergefallen, sein Wort zu halten.
Selbstmord.
Was für ein Schock. Der große Professor hatte sein Leben lang davon gefaselt, ein kühner, wagemutiger und positiv denkender Mann zu sein. Wie konnte er sich da das Gehirn wegblasen? Gab es etwas Feigeres? Gideon verzieht das Gesicht. O Gott, geht ihm durch den Kopf, das muss ein grauenhafter Anblick gewesen sein.
Benommen wandert er in seinem kleinen Büro herum. Die Polizei will, dass er nach Wiltshire fährt und ihnen ein paar Fragen beantwortet – ihnen hilft, ein paar Leerstellen zu füllen. Dabei ist er im Moment nicht mal sicher, ob er zur Tür hinausfinden wird, geschweige denn den ganzen Weg nach Devizes.
Kindheitserinnerungen brechen über ihn herein wie eine Reihe kippender Dominosteine. Ein Weihnachtsbaum mit Kerzen. Ein schmelzender Schneemann auf dem Rasen vor dem Haus. Gideon im Vorschulalter, der im Pyjama die Treppe heruntergesaust kommt, um Geschenke auszupacken. Sein Vater, der mit ihm spielt, während seine Mutter eine Mahlzeit bereitet, von der ein ganzes Dorf satt geworden wäre. Er kann sich daran erinnern, wie die beiden sich unter dem Mistelzweig küssen, während er, Gideon, die Arme um ihre Beine schlingt, bis ihnen nichts anderes mehr übrigbleibt, als ihn hochzuheben und mit einzubeziehen. Dann kommt der große Schlag. Als Sechsjähriger muss er den Schmerz ertragen, seine Mutter zu verlieren. Die Stille des Friedhofs. Die Leere ihres Hauses. Die Veränderung seines Vaters. Die Einsamkeit des Internats.
Es gibt so vieles, über das er nachdenken muss, während er auf dem Weg nach Wiltshire in Richtung Süden fährt – in die Grafschaft, aus der seine Mutter stammte und die sie immer liebevoll in Andenken an den großen Dichter »Thomas-Hardy-Land« genannt hatte.
4
Wiltshire
Nur wenige wissen von seiner Existenz. Ein geheimes Gewölbe aus kaltem Stein, von prähistorischen Architekten zu epischen Dimensionen ausgehöhlt. Ein Ort, den kein Uneingeweihter je zu sehen bekommt.
Das Heiligtum der Jünger ist ein weithin unbekanntes Wunder. Obwohl es die Größe einer Kathedrale hat, ist von oben nur eine kleine Bodenwelle auf einem Feld zu erkennen, für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar. Unterirdisch aber handelt es sich um das Juwel einer alten Zivilisation, geschaffen von einem Volk, dessen Brillanz selbst den klügsten Köpfen der Gegenwart Rätsel aufgibt.
Dreitausend Jahre vor Christus entstanden, ist dieser Ort ein einziger Anachronismus: ein riesiger Tempel, von der Wirkung her ebenso unzeitgemäß, atemberaubend und irreal wie die Große Pyramide von Gizeh.
In seinen unterirdischen Gräbern sind die Architekten bestattet, die sowohl Stonehenge als auch das Heiligtum erbauten. Ihre Gebeine ruhen inmitten von mehr als zwei Millionen Steinblöcken, die alle gleichen Ursprungs sind. Genau so, wie das Monument von Gizeh eine nahezu vollkommene Pyramide ist, handelt es sich bei diesem Heiligtum um eine nahezu vollkommene Halbkugel, eine Kuppel über einem kreisrunden Boden, wie ein kalter, in der Mitte durchgeschnittener Mond.
Nun hallen Schritte den Abstieg hinunter, als würde plötzlich Regen in die Höhlenkammern fallen. Im Kerzenlicht der Kleineren Halle versammelt sich der Innere Kreis. Sie sind zu fünft, Repräsentanten der riesigen Trilithen, die innerhalb des Kreises von Stonehenge stehen. Alle tragen Umhänge mit Kapuzen: ein Zeichen des Respekts vor vergangenen Generationen, die ihr Leben hingaben, um diesen geheiligten Ort zu schaffen.
Wenn sie das Initiationsritual durchlaufen, werden alle Jünger nach einem Gestirn benannt, dessen Anfangsbuchstabe jeweils mit dem Anfangsbuchstaben ihres Vornamens übereinstimmt. Dieser Deckmantel der Heimlichkeit ist eine weitere alte Tradition, ein Echo aus einer Epoche, als die ganze Welt von Sternen geleitet wurde.
Draco ist groß und breit gebaut, was ihm eine machtvolle Ausstrahlung verleiht. Als Ältester der Fünf fungiert er als Hüter des Inneren Kreises. Sein Namen ist vom lateinischen Wort für »Drachen« abgeleitet, und gehört zu dem Sternbild, in dem vor fast dreitausend Jahren der Polarstern stand, der für die nördliche Welt von so großer Bedeutung war.
»Was hört man denn so?« Unter der Kapuze lässt er seine perfekten Zähne blitzen. »Was treiben sie?«
Mit »sie« ist die Polizei von Wiltshire gemeint, die älteste Grafschaftspolizei des Landes.
Grus, ein untersetzter Mann Anfang fünfzig, antwortet rasch: »Er hat sich erschossen.«
Musca wandert auf und ab, in Gedanken versunken. Die Kerzen werfen gespenstische Schatten auf die Steinwände hinter ihm. Obwohl er der Jüngste von ihnen allen ist, beherrscht er mit seiner körperlichen Präsenz den Raum. »Das hätte ich nie von ihm erwartet. Er war unserer Sache doch genauso ergeben wie wir alle.«
»Er war ein Feigling«, bellt Draco zurück. »Er hat gewusst, was von ihm erwartet wurde.«
Grus ignoriert den Ausbruch. »Das Ganze stellt uns vor gewisse Probleme.«
Draco tritt näher. »Ich kann die Zeichen ebenso gut lesen wie du. Uns bleibt vor dem heiligen Nexus noch genug Zeit, diesen Sturm zu überstehen.«
»Es war die Rede von einem Brief«, fügt Grus hinzu. »Aquila kennt jemanden im Ermittlungsteam. Demnach hat er seinem Sohn einen Brief hinterlassen.«
»Seinem Sohn?« Draco versucht sich zu erinnern. Vor seinem geistigen Auge entsteht ein verschwommenes Bild: Nathaniel mit einem Kind, einem mageren Jungen mit einem dichten schwarzen Haarschopf. »Ich hatte ganz vergessen, dass er einen Sohn hat. Ist der nicht Dozent in Oxford geworden?«
»Cambridge. Nun wird er nach Hause kommen.« Grus erklärt, was das bedeutet. »Zurück ins Haus seines Vaters. Und wer weiß, was er da womöglich alles findet.«
Draco runzelt die Stirn und fixiert Musca. »Tu, was getan werden muss. Wir hatten alle eine gute Meinung von unserem Bruder. Zu Lebzeiten war er unser größter Verbündeter. Wir müssen sicherstellen, dass er sich im Tod nicht als unser schlimmster Feind entpuppt.«
5
Abendlicher Nebel schwebt um den unteren Teil der Steine – ein meteorologischer Streich, durch den ein Archipel in einem Meer aus Wolken entsteht. Für die Autofahrer, die auf den nahe gelegenen Fernverkehrsstraßen vorbeibrausen, ist es ein besonders schönes Stimmungsbild, aber für die Jünger bedeutet es viel mehr.
Dies ist die Stunde des Zwielichts. L’heure bleue. Es gibt diese kurze, kostbare Zeitspanne zweimal am Tag, zwischen Morgengrauen und Sonnenaufgang und zwischen Sonnenuntergang und Dämmerung – eine Zeit, in der Licht und Dunkel sich die Waage halten und die Geister aus den verborgenen Welten ein fragiles Gleichgewicht vorfinden.
Der Henge-Meister kennt die Zeichen. Er weiß, dass zuerst das nautische Zwielicht kommt: wenn die Sonne sechs bis zwölf Grad hinter den Horizont sinkt und den Seeleuten die ersten verlässlichen Sternsichtungen liefert. Dann, wenn die Sonne zwölf bis achtzehn Grad unter den Horizont sinkt, folgt das astronomische Zwielicht.
Grade. Geometrie. Die Position der Sonne. Ein heiliges Dreieck, über das Männer wie er Jahrhundert um Jahrhundert als Meister wachen. Ohne sie würde es Stonehenge nicht mehr geben. Dass es sich genau hier befindet, ist kein Zufall. Gemäß den Vorahnungen der größten Wahrsager und Archäoastronomen des Altertums wurde dieser Ort von den fortschrittlichsten Köpfen entworfen und geplant. Sein Bau erforderte eine derartige Genauigkeit, dass es mehr als ein halbes Jahrtausend dauerte, bis der Kreis fertiggestellt war.
Nun, mehr als vier Jahrtausende später, widmen die Jünger den Steinen eine ebenso große Aufmerksamkeit für jedes Detail.
Der Henge-Meister bezieht genau im dem Moment Stellung, als das nautische Zwielicht ins astronomische Zwielicht übergeht. Er steht genauso still wie die Soldaten aus blauem Stein, die ihn kreisförmig umgeben, ihn bewachen und schützen.
Er ist allein.
Wie ein altrömischer Haruspex wartet er geduldig auf die Götter.
Schon bald beginnen sie mit sanft raschelnden Stimmen zu sprechen. Er saugt ihre Weisheit in sich auf und erkennt jetzt, was zu tun ist. Statt sich wegen des Selbstmords des Professors Sorgen zu machen, wird er seine Aufmerksamkeit mehr auf den Sohn richten. Und er wird überprüfen, ob das Opfer richtig bestattet worden ist. Falls seine sterblichen Überreste zum Vorschein kämen, wäre das eine Katastrophe. Vor allem aber wird er dafür sorgen, dass die zweite Phase der Erneuerung ihren baldigen Abschluss findet.
Die Zeremonie muss zu Ende geführt werden.
Langsam steigt der milchweiße Dampf an seinen Beinen empor. In diesem wundersamen Zwielicht erwachen die Sarsensteine zum Leben. Eine Sinnestäuschung? Ein trompe l’oeil? Er glaubt das nicht. Für einen Laien ist das Neulicht des Mondes kaum zu sehen, aber für einen Archäoastronomen wie ihn wirkt er wie ein Leuchtfeuer im Kosmos. Über den Himmelsgewölben bilden sich orbitale Landkarten, himmlische Zyklen nehmen ihren Anfang, und mit jedem Atom seines Körpers spürt er, wie die Sonne ihren Weg von Beltane in Richtung Sonnenwende allmählich vollendet.
Noch sieben Tage bis zum Solstitium – dem Moment, in dem die Sonne stillsteht. Das Augenmerk aller wird sich auf das Morgengrauen richten, während es in Wirklichkeit doch auf der Dämmerung liegen sollte.
Nach der Sonnwend-Mitternacht werden fünf volle Tage vergehen, bis schließlich an jenem mystischen Abend der erste Vollmond nach Solstitium kommen wird. Die Zeit der Erneuerung. Dann muss er zu den Geheiligten zurückkehren und vollenden, was er begonnen hat.
Inzwischen hat sich der Himmel verdunkelt. Der Meister hält Ausschau nach dem Nordstern Polaris, dem Leitstern, dem hellsten Licht von Ursae Minoris. Ein göttliches Blinzeln in nächster Nähe des Himmelspols. Während der Blick des Meisters am schwarzen Vorhang des Himmels hinuntergleitet und auf die prähistorische Erde fällt, auf den Opferstein, hört er schaudernd die Befehle der Geheiligten.
Die Götter werden ein Scheitern nicht dulden.
6
Polizeipräsidium von Wiltshire in Devizes
Detective Inspector Megan Baker möchte diesen Tag am liebsten gleich abhaken. Dabei ist er längst noch nicht zu Ende. Die drahtige Einunddreißigjährige hat ein krankes Kind zu Hause, aber niemanden mehr, der ihr hilft, seit sie ihren Ehemann hinausgeworfen hat. Zu allem Überfluss hat ihr irgend so ein dämlicher Professor einen scheußlichen Selbstmord beschert, so dass sie nun länger bleiben und von Angesicht zu Angesicht mit dem trauernden Sohn sprechen muss. Das und die bunte Mischung aus unbezahlten Rechnungen in ihrer Handtasche reicht eigentlich aus, um sie schon wieder zum Kochen zu bringen. Aber sie beherrscht sich.
Ihre Eltern haben sich ein weiteres Mal bereit erklärt, auf Sammy aufzupassen – und es ist »nie ein Problem«, abgesehen von dem besserwisserischen Vortrag und den vielsagenden Blicken, wenn sie ihre kränkelnde vierjährige Tochter Stunden später als versprochen bei ihnen abholt. Aber sie wird nicht aufgeben. Es war immer ihr Wunsch, als Polizistin zu arbeiten, und trotz ihrer gescheiterten Ehe ist dem immer noch so.
Ein Schluck Kaffee und mehrere Kaugummis lindern ihre Gier nach Nikotin. Als ihr Handy klingelt, wirft sie erst einen Blick auf das Display. UM, die Abkürzung für untreuer Mistkerl. Sie hat es einfach nicht geschafft, den richtigen Namen ihres Ex-Mannes einzugeben. Untreuer Mistkerl erschien ihr passender. Er arbeitet als uniformierter Inspektor in einer anderen Abteilung, aber ihre Wege kreuzen sich nach wie vor. Viel zu oft. Nicht nur beruflich, sondern auch privat, wenn er sein Besuchsrecht als Vater wahrnimmt. Was für sie immer noch schmerzhaft ist.
UM hält nichts von vorab vereinbarten Besuchen. O nein. Das wäre mit seinem Lebensstil nach dem Motto »Leg alles flach, was einen Puls hat« zeitlich nicht zu vereinbaren. Er hält es für sein Recht, aufzutauchen, wann immer ihm der Sinn danach steht, Sammy zu sehen. Sie findet das einfach nicht fair. Weder ihrer Tochter noch ihr selbst gegenüber.
Sie kann dem Drang, ihr läutendes Handy an die Wand zu pfeffern, kaum widerstehen. Eine Sekunde, bevor es auf die Mailbox umschaltet, reißt sie es von ihrem Schreibtisch. »Ja?«, faucht sie.
UM hat auch keine Zeit für Nettigkeiten. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass Sammy krank ist?«
»Sie hat Fieber, das ist alles. Bald ist sie wieder auf dem Damm.«
»Machst du neuerdings einen auf Ärztin?«
»Machst du neuerdings einen auf Vater?«
Er stößt einen gepressten Seufzer aus. »Meg, ich sorge mich um meine Tochter. Würde ich nicht anrufen, würdest du mich anschreien, und jetzt schreist du mich an, weil ich anrufe.«
Sie zählt bis zehn, ehe sie seinen Namen hervorstößt, als müsste sie ihn ausspucken: »Adam, Sammy geht es gut. Im Kindergarten schnappen sie ständig irgendwas auf. Sie hat erhöhte Temperatur, und gestern war ihr ein bisschen übel, das ist alles.«
»Es sind nicht die Masern oder so was in der Art?«
»Nein.« Plötzlich kommen Megan selbst Zweifel. »Ich glaube nicht. Mutter kümmert sich um sie, es besteht also kein Grund, sich Sorgen zu machen.«
»Du solltest dich um sie kümmern. Ein krankes kleines Mädchen braucht seine Mum, nicht seine Oma.«
»Fahr zur Hölle, Adam!« Mit wild klopfendem Herzen legt sie auf. Er schafft es jedes Mal, sie auf die Palme zu bringen, bis sie sich kaum noch beherrschen kann.
Als das Telefon auf dem Schreibtisch zu läuten beginnt, würde sie am liebsten aus der Haut fahren. Es ist der Kollege aus dem Eingangsbereich. Gideon Chase wartet unten auf sie. Sie antwortet, dass sie sich gleich auf den Weg machen werde, und trinkt einen letzten Schluck von ihrem mittlerweile kalten Kaffee. Mit den Angehörigen eines Verstorbenen zu sprechen ist niemals einfach.
Vor dem verwaisten Schreibtisch im Eingangsbereich wartet ein hochgewachsener dunkelhaariger Mann, dem der Schock ins bleiche Gesicht geschrieben steht. Sie holt tief Luft, ehe sie auf ihn zusteuert. »Ich bin Detective Inspector Baker. Megan Baker.« Im selben Moment, als sie ihm die Hand hinstreckt, fällt ihr auf, dass das blaue Pflaster an ihrem Zeigefinger ziemlich mitgenommen aussieht, als würde es sich jeden Moment lösen.
»Gideon Chase«, murmelt er und gibt ihr die Hand, wobei er sich sichtlich bemüht, das dubiose Pflaster nicht zu verschieben. »Entschuldigen Sie die Verspätung. Der Verkehr.«
Sie lächelt mitfühlend. »Ja, um diese Zeit ist immer viel los. Danke, dass sie so schnell gekommen sind. Mir ist klar, dass dieser Moment für Sie sehr schwierig sein muss.« Mit Hilfe ihrer Karte öffnet sie eine Tür. »Lassen Sie uns nach hinten gehen. Da finden wir bestimmt einen freien Raum, wo wir in Ruhe reden können.«
7
Devizes
Für einen Archäologen wie Gideon Chase sind Örtlichkeiten und der erste Eindruck von besonderer Bedeutung. Ein Streifen ausgedörrten, roten ägyptischen Sandes oder ein dunkelgrünes Feld auf dem englischen Land sagen viel aus über die Entdeckungen, die einen dort möglicherweise erwarten. Die billige, fensterlose Holztür, die DI Baker für ihn aufhält, hat dieselbe Aussagekraft.
Sie führt in einen tristen, rechteckigen Raum, der mit schwarzen Teppichfliesen ausgelegt ist. Die abgewetzten Wände sind in Grautönen gehalten. Einladend wie ein Grab. Das einzige Lichtblick in dem Raum ist die Polizistin. Sie hat rötlich braunes Haar und wirkt mit ihrem rostroten Jersey-Oberteil und der schwarzen Schneiderhose sehr schick. Gideon lässt sich auf einem unbequemen Stuhl aus Formplastik nieder und drückt aus reiner Neugier ein wenig gegen die Kante des vor ihm stehenden Tisches. Er ist am Boden festgeschraubt.
Megan Baker versteht sich ebenfalls auf den ersten Eindruck. Dank ihrer Kenntnisse in Psychologie und Profiling ist sie bereits damit beschäftigt, den dunkelhaarigen Mann mit der Hugh-Grant-Frisur einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Er hat braune Augen, einen vollen Mund und gutgeschnittene Wangenknochen. Seine Fingernägel zeigen keine Spur von Nikotin und sind kurzgeschnitten, nicht gekaut. Kein Ehering. Viele verheiratete Männer tragen den ihren nicht, es sei denn, sie haben ausgeprägte Wertvorstellungen, und dieser Mann strahlt eine sehr traditionelle Einstellung aus. Ein Symbol dafür ist sein blauer Wollblazer mit den Lederflecken an den Ellbogen – ein Kleidungsstück, das eher in College-Kreuzgängen als in Sozialwohnungssiedlungen getragen wird. Hinzu kommt, dass der Blazer weder zu dem schwarzen Kaschmirpulli noch zu dem lässigen grünen Hemd passt. Gäbe es in seinem Leben eine Frau, hätte sie ihm das bestimmt gesagt.
Sie schiebt ihm einen geöffneten Umschlag über den Tisch. »Das ist der Brief, den Ihr Vater hinterlassen hat.«
Gideon wirft einen Blick darauf, rührt sich aber nicht von der Stelle. Der Umschlag ist mit dunklen Spritzern übersät.
Sie begreift, was seine Aufmerksamkeit erregt hat. »Es tut mir leid. Ihn in einen anderen Umschlag zu stecken erschien mir nicht angemessen.«
Angemessen.
Ein Großteil seiner Erziehung drehte sich um angemessenes Verhalten. Ingesamt eine recht unangemessene Vorbereitung für den Moment, an dem einem jemand einen Umschlag überreicht, der mit dem Blut des eigenen Vaters bespritzt ist.
»Alles in Ordnung?«
Er schiebt sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und blickt zu ihr hoch. »Ja, es geht mir gut.«
Sie wissen beide, dass das nicht stimmt.
Erneut wirft er einen Blick auf den Umschlag, von dem ihm sein eigener Name entgegenstarrt, geschrieben in der gestochenen Handschrift seines Vaters.
GIDEON
Zum ersten Mal in seinem Leben ist er froh, dass sein Vater sich seinen exzentrischen Stil bewahrt und einen Füllfederhalter benutzt hat, statt wie der Rest der Welt mit Kugelschreiber oder Filzstift zu schreiben.
Gideon ertappt sich dabei, dass er gerade einen liebevollen Gedanken für den alten Herrn hegt, und fragt sich, ob das nur ein vorübergehender Moment ist oder ob ein Effekt des Todes darin besteht, dass man plötzlich Respekt für die Dinge empfindet, die man früher verachtet hat. Macht der Tod irgendwie reinen Tisch und bringt einen dazu, nur noch gut von den Menschen zu denken, von denen man bisher eine schlechte Meinung hatte?
Vorsichtig berührt er die Ecken des Umschlags. Dann hebt er ihn ein wenig an, dreht ihn aber noch nicht um.
Noch nicht.
Sein Herz klopft genauso heftig wie früher, wenn sein Vater und er sich stritten. Er kann den alten Herrn in dem Brief spüren, seine Gegenwart durch das Papier wahrnehmen. Entschlossen dreht er den Umschlag um und zieht die Lasche heraus. Während er den Brief auseinanderfaltet, muss er sich darüber ärgern, dass die Polizei ihn vor ihm gelesen hat. Ihm ist klar, warum: Sie waren gezwungen, ihn zu lesen. Trotzdem hätten sie es nicht tun sollen. Schließlich war er an ihn adressiert, und der Inhalt ist sehr privat.
Liebster Gideon,
ich hoffe, im Tod wird die Distanz zwischen uns nicht mehr so groß sein wie im Leben.
Nun, da ich nicht mehr bin, wirst du viele Dinge über mich erfahren. Nicht alle sind gut, nicht alle schlecht. Unter anderem wirst du vielleicht entdecken, wie sehr ich dich geliebt habe. Jeden Moment meines Lebens habe ich dich geliebt und war stolz auf dich.
Mein geliebter Sohn, bitte verzeih mir, dass ich dich derart von mir weggeschoben habe. Dich jeden Tag zu sehen, war für mich, als sähe ich ständig deine Mutter. Du hast ihre Augen. Ihr Lächeln. Ihre sanfte, liebevolle Art. Mein lieber Junge, es war zu schmerzhaft für mich, sie in jedem deiner Atemzüge zu erkennen. Ich weiß, das war egoistisch von mir. Mir ist klar, dass es falsch war, dich an jene Schule zu verbannen und all deine Bitten, zurückkommen zu dürfen, zu ignorieren, aber bitte glaube mir, dass es nur aus Angst geschah: Hätte ich anders gehandelt, wäre ich wahrscheinlich daran zerbrochen.
Mein liebes, wundervolles Kind, ich bin so stolz auf das, was aus dir geworden ist und was du erreicht hast.
Stelle keine Vergleiche zwischen uns an. Du bist ein weitaus besserer Mann, als ich es je sein konnte, und ich hoffe, eines Tages wirst du auch ein weitaus besserer Vater sein.
Vermutlich fragst du dich, warum ich mir das Leben genommen habe. Die Antwort ist nicht einfach. Im Leben muss man Entscheidungen treffen. Wenn man dann gestorben ist, wird man für immer nach diesen Entscheidungen beurteilt. Doch nicht alle Richter sind gute Richter. Ich hoffe, du wirst ein gutes und gnädiges Urteil über mich fällen.
Du musst mir glauben, dass mein Freitod edle Motive hatte und keineswegs so sinnlos und feige war, wie es scheinen mag. Du hast ein Recht darauf, zu verstehen, wovon ich spreche, und ebenso das Recht, dich keinen Deut darum zu scheren und dein Leben zu leben, ohne einen weiteren Gedanken an mich zu verschwenden.
Ich hoffe, du entscheidest dich für Letzteres.
Mein Anwalt wird sich mit dir in Verbindung setzen. Wie du feststellen wirst, ist alles, was ich angehäuft habe, nun dein. Du kannst darüber verfügen, wie du willst, doch ich rate dir, nicht zu großzügig damit umzugehen.
Gideon, als du noch ein Kind warst, haben wir immer Spiele miteinander gespielt – erinnerst du dich?
Ich habe mir Schatzverstecke ausgedacht, und du bist den Spuren gefolgt, die ich hinterließ. Auch im Tod hinterlasse ich dir Spuren und die Lösung eines Rätsels. Der größte Schatz von allen ist zu lieben und geliebt zu werden – ich hoffe inbrünstig, dass du ihn finden wirst.
Es wäre besser, wenn du nicht versuchen würdest, andere Rätsel zu lösen, aber mir ist klar, dass das dennoch dein Wunsch sein könnte. Falls dem tatsächlich so ist, hast du auch dafür meinen Segen, doch ich rate dir, vorsichtig zu sein. Traue niemandem als dir selbst.
Liebster Sohn, du bist ein Kind der Tagundnachtgleiche. Blicke weiter als nur bis zur Sonne des Solstitiums, und konzentriere dich auf das Aufgehen des neuen Mondes.
Dinge, die du erst für schlecht hältst, werden sich als gut entpuppen. Dinge, die du für gut hältst, werden sich als schlecht entpuppen. Im Leben geht es um Gleichgewicht und Urteilskraft.
Verzeih mir, dass ich nicht für dich da war – dass ich dir nie gesagt und gezeigt habe, wie sehr ich dich und deine Muter geliebt habe, mehr als sonst etwas in meinem Leben.
Dein ergebener, reumütiger und dich liebender Vater,
Nathaniel.
Es ist zu viel für ihn – zu vieles auf einmal, was es zu verstehen gilt.
Behutsam fährt er mit den Fingerspitzen über den Brief. Spürt die Worte »Liebster Gideon«. Legt die Finger beider Hände auf die Zeile »Mein liebes, wundervolles Kind, ich bin so stolz auf das, was aus dir geworden ist ...« Schließlich, fast als würde er Braille lesen, finden seine Finger die Worte, die ihn am meisten gerührt haben: »Verzeih mir, das ich nicht für dich da war – dass ich dir nie gesagt und gezeigt habe, wie sehr ich dich und deine Mutter geliebt habe, mehr als sonst etwas in meinem Leben.«
Tränen steigen ihm in die Augen. Paradoxerweise hat er das Gefühl, als würde sein Vater gerade die Arme nach ihm ausstrecken. Es kommt ihm vor, als wären sie wie ein Gefängnisinsasse und dessen Besucher durch eine Glasscheibe voneinander getrennt und würden beide die Hände aneinanderlegen, um sich zu verabschieden und sich dabei zwar nicht körperlich, aber doch gefühlsmäßig zu berühren. Getrennt durch Leben und Tod wie durch eine unsichtbare Wand. Der Brief ist zu einer Glaswand geworden, durch die sein Vater von ihm Abschied nimmt.
Megan sieht zu, ohne ihn zu stören. Nur hin und wieder wirft sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. Obwohl sie allmählich ein schlechtes Gewissen bekommt, weil sie ihre kranke Vierjährige so lange bei Grandma warten lässt, versucht sie, sich ihre Unruhe nicht anmerken zu lassen. Sie merkt, wie sehr der Selbstmordbrief Gideon aufwühlt.
»Möchten Sie eine Weile allein sein?«
Er reagiert nicht. Der Kummer hat seinen Kopf wie in Watte gepackt.
Sie räuspert sich. »Mr. Chase, es ist schon sehr spät. Könnten wir vielleicht einen Termin für morgen vereinbaren?«
Langsam taucht er aus seiner Benommenheit auf. »Wie bitte?«
Sie lächelt mitfühlend. »Morgen.« Sie macht eine Kopfbewegung in Richtung Brief. »Es gibt da ein paar Dinge, zu denen wir Sie gern befragen würden. Außerdem vermute ich, Sie werden selbst auch Fragen haben.«
Er hat eine Menge Fragen, die nun schlagartig aus ihm herausbrechen. »Wie genau ist mein Vater gestorben?« Sein Blick wirkt gequält. »Ich weiß, Sie haben gesagt, er habe sich erschossen, aber was genau ist passiert? Wo war er? Um welche Zeit ...« Die Stimme versagt ihm den Dienst. »Wann hat er es getan?«
Megan verzieht keine Miene. »Er hat sich mit einer kleinen Handfeuerwaffe erschossen.« Sie kann nicht anders, als die Details hinzuzufügen: »Einer Webley Mark IV. Das ist eine Pistole aus dem Ersten Weltkrieg.«
»Ich wusste nicht mal, dass er überhaupt eine Waffe besaß.«
»Sie war auf seinen Namen registriert. Auf einer Schießanlage hier in der Gegend hatte er damit ein paarmal geschossen.«
Sein Schock wird immer größer.
Sie kommt auf den schwierigen Teil zu sprechen. »Sie können ihn sehen. Offiziell identifiziert wurde er von seiner Putzfrau, die ihn gefunden hat, es besteht also keine Notwendigkeit, aber wenn Sie wollen, kann ich das für Sie arrangieren.«
Er weiß nicht so recht, was er sagen soll. Einerseits will er das, was von seinem Vater übriggeblieben ist, nachdem er sich eine Kugel durch den Kopf gejagt hat, ganz bestimmt nicht sehen, andererseits fühlt er sich dazu verpflichtet. Wäre es nicht falsch, es nicht zu tun? Wird es nicht von einem erwartet?
Die Polizistin streicht ihr Haar zurück und steht auf. Wenn sie nicht die Initiative ergreift, wird der Sohn des toten Professors vermutlich dafür sorgen, dass sie um Mitternacht immer noch hier sitzt. »Es tut mir leid, wenn ich Sie jetzt ein wenig drängen muss.«
»Verzeihen Sie. Mir ist klar, dass es schon spät ist.« Er greift nach dem Brief, faltet ihn zusammen und lässt ihn zurück in den bespritzten Umschlag gleiten. »Ist es in Ordnung, wenn ich den mitnehme?«
»Ja. Ja, natürlich.«
Behutsam schiebt er ihn in die Innentasche seiner Jacke. »Danke. Auch dafür, dass Sie so lange geblieben sind.«
»Kein Problem.« Megan zieht eine Visitenkarte heraus. »Rufen Sie mich morgen früh an, dann können wir einen Termin vereinbaren.«
Er nimmt die Karte entgegen und folgt ihr aus dem Raum. Sie geleitet ihn durch die Sicherheitstüren hinaus in die dunkle Kälte der Nacht. Die Straßen sind inzwischen menschenleer.
Als die Tür hinter ihnen mit einem Klicken ins Schloss fällt, wird Gideon bewusst, wie benommen er sich fühlt.
Er sperrt seinen alten Audi auf, steigt ein und bleibt für einen Moment wie erstarrt vor dem Lenkrad sitzen. Der Schlüssel in seiner Hand zittert.
8
Tollard Royal, Cranborne Chase,
Salisbury
Das Anwesen liegt auf einem außerordentlich schönen, historischen Kalksteinplateau, das Dorset, Hampshire und Wiltshire überspannt.
Gideon ist noch nie hier gewesen und braucht über eine Stunde, um in der Dunkelheit den Weg zu finden, was sich als höchst schwierig und anstrengend erweist. Er wünschte, er hätte vorher ein wenig mehr nachgedacht und sich ein Hotelzimmer reservieren lassen oder die Polizei gebeten, eine Bleibe für ihn zu finden. Nun hat er keine Übernachtungsmöglichkeit, es sei denn, er bricht in das Haus ein.
Die Früchte der dubiosen Arbeit seiner toten Eltern sind durchaus beeindruckend. Das Herrenhaus ist bestimmt zehn Millionen Pfund wert, womöglich noch mehr. Vielleicht war der »Beruf« seines Vaters – Grabräuberei, wie Gideon dazu oft gesagt hatte – einer der Gründe, weshalb er sich das Leben genommen hatte.
Gideon fährt durch hohe Metalltore in einen dunklen Garten, der auf ihn so unheilverkündend wie ein Friedhof wirkt. Die Zufahrt schlängelt sich knapp einen Kilometer dahin, ehe sie schließlich in einen Hof mündet. In der Mitte steht ein aufwendiger Marmorbrunnen, der zwar beleuchtet, aber nicht angeschaltet ist. Gelbe Gartenlampen werfen ein weiches, gelbliches Licht durch das Laub alter Bäume. Gideon stellt den Motor ab, bleibt jedoch mindestens eine Minute lang im Auto sitzen und betrachtet das alte Haus. Es ist eine leere Hülle – ohne jedes Leben.
Schließlich steigt er aus und wandert auf einem gepflasterten Weg um den Ostflügel herum. Er hat zwar keinen Schlüssel, nimmt aber an, dass er wohl kaum in Schwierigkeiten geraten wird, wenn er in ein Haus einbricht, dessen Erbe er soeben geworden worden ist.
Er löst irgendeinen Bewegungsmelder aus. Grelles weißes Licht lässt ihn blinzeln. In den Hecken und Büschen nahe dem Haus herrscht plötzlich rege Betriebsamkeit – Füchse oder Kaninchen, vermutet er. Sein Blick fällt auf den Kasten einer Alarmanlage, die an einer abseits gelegenen Wand angebracht ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Anlage nicht eingeschaltet. Wenn man Selbstmord begeht, schaltet man nicht vorher die Alarmanlage an, und nachdem die Polizei schon so schlampig war, die Zufahrtstore nicht abzuschließen, ist auch nicht damit zu rechnen, dass sie sich bei der zuständigen Firma bereits über den Schlüsselcode informiert und einen Wachmann organisiert haben.
Er späht durch die Fenster einer entzückenden kleinen Orangerie, die an der Seite des Gebäudes angebaut ist, und bringt es nicht so recht übers Herz, dort einzubrechen. Ein Stück weiter hinten entdeckt er einen Wasch- und Vorratsraum. Die Tür ist modern, also weniger kostspielig zu ersetzen als alles andere, was er bisher zu Gesicht bekommen hat.
Ein kräftiger Tritt mit dem Absatz seines Stiefels sollte ausreichen. Er nimmt die Tür genauer in Augenschein. Am besten, er bringt die Sache gleich hinter sich, bevor er den Mut verliert und einen Rückzieher macht.
Rund um den Griff sieht das Holz der Tür bereits gesplittert aus.
Als er ihr einen Stoß verpasst, schwingt sie weit auf.
»So eine Schlamperei!« Gideon flucht über die Polizei. Offene Tore, und jetzt auch noch eine kaputte, ungesicherte Tür.
Im Haus empfängt ihn dumpfe, abgestandene Luft. War etwa die Polizei selbst auf diese Weise ins Haus gekommen? Hatten ein paar Dorfgendarmen im Eifer des Gefechts diese Tür eingetreten und waren dann das Haus gestürmt, nachdem bei ihnen der Anruf einer hysterischen Haushälterin eingegangen war?
Während er das Licht anschaltet, wird ihm klar, dass sein letzter Gedanke keinen Sinn ergibt. Die Putzfrau, die seinen Vater gefunden hat, war höchstwahrscheinlich selbst im Besitz eines Schlüssels, so dass für die Polizisten keine Notwendigkeit bestand, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.
Demnach war jemand anderer ins Haus eingebrochen.
Oder war – eine noch schlimmere Vorstellung – gerade dabei.
9
Musca hat nichts gefunden.
Er hat sich zunächst die Eingangshalle vorgenommen und dann alle acht Schlafzimmer, mehrere Bäder und zwei Empfangsräume durchsucht, bisher aber nichts entdeckt, was ihm irgendwie wertvoll erschienen wäre. Auch wenn das Haus des alten Kerls natürlich mit lauter sündteurem Zeug vollgestopft ist. Zweifellos wäre jeder normale Einbrecher längst fröhlich pfeifend auf dem Rückweg durch die vornehmen Gänge, einen prall gefüllten Sack voller Diebesgut über der Schulter. Musca aber geht es nicht um irgendwelche Luxusgegenstände.
Bücher, Tagebücher, Dokumentationen, Fotografien, Computerdateien und Tonaufnahmen jeder Art – das ist es, was er in der Behausung des Schatzsuchers sucht.
Die Bibliothek hat er ebenfalls schon verwüstet. Hunderte von alten Bänden hat er heruntergerissen und durchgeblättert oder mit den Seiten nach unten ausgeschüttelt. Nun ist er auf dem Weg ins Arbeitszimmer – den Raum, in dem sich der Professor seinen Informationen zufolge umgebracht hat.
Er geht zu dem Flügelfenster hinüber und zieht den dicken roten Vorhang zu. Dann richtet er den Strahl seiner Taschenlampe auf den Schreibtisch, findet dort eine antike Messinglampe vor und schaltet sie ein. In ihrem sanften Licht fällt sein Blick als Erstes auf den scheußlichen Stuhl aus Walnussholz, dann auf den viktorianischen Schreibtisch und die dunkelrote Landkarte aus Blutspritzern über dem ursprünglich cremeweißen Löschpapier.
Er schaudert. Plötzlich empfindet er die Dunkelheit im Haus als beklemmend, er fühlt sich von ihr umschlossen wie von einem düsteren Turm.
Klack.
Musca wirbelt herum, den Blick auf die Tür gerichtet. Sind das nur die üblichen Geräusche eines alten Hauses?
Knarz.
Rasch schaltet er die Lampe aus, entfernt sich auf Zehenspitzen vom Schreibtisch und schleicht zurück in Richtung Tür. An die Wand gelehnt, versucht er seinen Herzschlag unter Kontrolle zu bringen und möglichst flach zu atmen.
Alles ist still.
Dann hört er erneut das leise Knarren von Holz.
Er kann nicht genau sagen, woher das Geräusch kommt. Im hinteren Teil des Hauses gibt es jede Menge alter Bodendielen, und viele davon sind verzogen oder locker – wie er vorhin beim Hereinkommen selbst feststellen konnte. Er lässt seine Werkzeugtasche von der Schulter gleiten und steckt eine Hand hinein. Seine Finger schließen sich um eine kleine eiserne Brechstange. Perfekt dafür geeignet, eine wackelige Hintertür oder einen Schädel einzuschlagen.
Eine paar Augenblicke verstreichen, ohne dass er etwas hört.
Langsam fragt er sich, ob er allein ist oder nicht. Ob noch jemand das Haus betreten und ihn entdeckt hat. Vielleicht sogar die Bullen gerufen hat. Musca kann das Warten nicht länger ertragen. Er durchwühlt seine Hosentaschen und stößt auf sein Feuerzeug. Auch wenn es ihm nicht gelungen ist, hier irgendetwas Verfängliches zu finden, kann er zumindest dafür sorgen, dass auch kein anderer etwas findet.
Er schleicht zurück zum Schreibtisch, zieht vorsichtig eine Schublade heraus und entdeckt darin eine Packung A4-Druckerpapier. Perfekt. Er reißt die Verpackung auf und hält die Flamme an einen Stapel Blätter, bis sie zu qualmen beginnen und Feuer fangen. Dann trägt er das brennende Bündel, dessen züngelnde Flammen bereits die Dunkelheit erhellen, hinüber zu den Vorhängen und hält das Feuer unter die langen Stoffbahnen, bis sie ebenfalls zu lodern beginnen.
Schnell entsteht an den Vorhängen eine fauchende Feuersäule, ein wütendes Wabern aus Orange und Schwarz. Musca tritt zwei Schritte zurück. Eine Welle aus Rauch steigt um ihn herum hoch.
Als er sich umdreht, sieht er in der Tür eine große Gestalt.
Für einen Moment blitzt Licht auf, als würde jemand eine Lampe ein- und sofort wieder ausschalten, dann zieht die gespenstische Silhouette plötzlich die Tür zu. Musca lässt das brennende Papier fallen und stürmt zu der dicken Mahagonitür. Der Schlüssel dreht sich zweimal im Schloss.
Er sitzt in der Falle.
10
Gideon ist kein Held.
Das erste und letzte Mal hat er sich als Junge in der Schule geprügelt und schon damals nicht gerade als großer Kämpfer geglänzt. Ganz im Gegenteil, er musste mehrere Schläge von dem Jungen einstecken, der damals in seiner Klasse alle schikanierte, und stand am Ende mit einer blutigen Nase und ohne Geld für Süßigkeiten da.
Seit damals hat er ziemlich zugelegt, er ist nicht nur größer, sondern auch breiter geworden. Ersteres führt er auf seine Gene zurück, Letzteres auf jahrelanges Rudern in Cambridge. Seit jenem beschämenden Erlebnis aber hat er einen ausgeprägten Sinn für Gefahr entwickelt und erkannt, dass ein scharfer Verstand gegenüber den harten Fäusten eines brutalen Schlägers fast immer im Vorteil ist.
Gideon hat bereits die Notrufnummer angerufen, noch bevor er das Haus durch die aufgebrochene Hintertür betreten hat. Nun schleicht er so leise wie möglich durch die Räume – nur um sicherzugehen, dass er nicht einen dummen Fehler gemacht hat.
Die Tür zum Arbeitszimmer schwingt langsam auf, und das Licht aus dem Gang fällt auf das Schloss, in dem ein großer, massiver Schlüssel steckt. Als Gideon die Gestalt sieht, die gerade die Vorhänge in Brand steckt, durchfährt ihn spontan der Gedanke, die Tür abzusperren und den Kerl in dem Raum gefangen zu halten, bis die Polizei eintrifft.
Nun aber denkt er noch einmal über seinen Entschluss nach.
Er hat jemanden in einem brennenden Raum eingesperrt, und wenn er den Betreffenden nicht wieder herauslässt, wird er sterben. Na und? Ein kleiner Teil in ihm stellt sich tatsächlich diese Frage. Was, wenn der Kerl tatsächlich stirbt? Wird die Welt einen Gauner, der ins Haus eines Verstorbenen einbricht und ihn bestiehlt, noch ehe sein Leichnam unter der Erde ruht, wirklich vermissen?
Gideon öffnet die Tür.
Prasselnd lodern die Flammen hoch, als der Luftzug frischen Sauerstoff in den Raum saugt. Gideon weicht zurück und reißt die Arme vor das versengte Gesicht. Durch eine orangeglühende Hitzewand stürmt eine schwarze Gestalt auf ihn zu. Er wird so heftig gegen die Tür geschleudert, dass er die Erschütterung im ganzen Körper spürt. Eine Faust landet auf seinem linken Kieferknochen, ein Knie rammt sich in seinen Schoß. Er krümmt sich vor Schmerzen und bekommt dadurch einen Stiefel voll ins Gesicht.
Mittlerweile liegt er auf dem Boden und atmet nur noch ganz flach. Aus seinem Mund läuft Blut, und das Letzte, was er wahrnimmt, ehe er das Bewusstsein verliert, ist die riesige Welle aus Flammen und Rauch, die auf ihn zugerollt kommt.
11
Musca stürmt über die weite Rasenfläche hinter dem Haus. Das Herz will ihm fast aus der Brust springen. Über das Zischen der Flammen hinweg hört er die Sirene. Dem Klang nach zu urteilen handelt es sich nur um einen einzigen Wagen. Mitternacht ist längst vorbei, weshalb ihm klar ist, dass die Polizei nicht gleich mit einer ganzen Schar anrücken wird. Schlimmstenfalls werden sie ihren einzigen örtlichen Einsatzwagen losschicken, bemannt mit zwei, drei Landgendarmen.
Trotzdem war es schlau von ihm gewesen, in einer Straße weit hinter dem Anwesen zu parken. Die Rasenflächen sind weitläufig und nicht mit Bäumen bestanden, so dass er es bald geschafft hat, dem grellen Schein der Bewegungsmelder zu entkommen. Das Problem ist nun eher, dass es um ihn herum derart stockdunkel ist, dass er die genaue Stelle nicht mehr finden kann, an der er über die Mauer geklettert ist – die Stelle, die ihn zurück zu seinem Wagen leiten wird.
Er stolpert durch ein Gestrüpp aus dicken Rosenzweigen und fällt fast über einen Maulwurfshügel, der so riesig ist, dass sein Besitzer vermutlich als Gouverneur von Kalifornien kandidieren könnte. Schließlich aber findet er das Erkennungszeichen, das er sich eingeprägt hat: ein Gewächshaus, dessen untere Hälfte aus Ziegelsteinen gebaut ist, während der obere Teil aus Hartholz und Doppelverglasung besteht. Er zählt dreizehn Schritte entlang der Wand und findet die Stelle, an der er hinüberklettern muss.
Die Sache hat nur einen Haken.
Auf der anderen Seite war er zunächst auf einen kleinen Baum geklettert. Sich die knapp drei Meter von der Mauer hinunterzulassen war nicht allzu schwierig gewesen. Immerhin ist er knapp eins fünfundachtzig groß, so dass er einfach seine Tasche auf die andere Seite geworfen hatte, um sich mit beiden Händen festhalten zu können, bis er mit ausgestreckten Armen an der Mauer hing und sich das letzte kleine Stück nur noch fallen lassen musste.
Nun kommt er nicht mehr zurück.
Egal, wie hoch er springt, er kann die Oberkante der Mauer nicht erreichten. Selbst mit einem Anlauf schafft er es nicht. Musca legt seine Werkzeugtasche ab und sucht hektisch nach irgendetwas, auf das er steigen kann. Eine alte Komposttonne, vielleicht auch einen Spaten oder einen Gartenrechen, mit dem er sich abstemmen kann, oder mit richtig viel Glück sogar eine Leiter.
Nichts.
Er lässt den Blick über die dunklen Rasenflächen schweifen. Aus der Seite des Hauses quellen bereits Flammen, so dass die Bullen erst einmal beschäftig sind. Er beruhigt sich ein wenig. Die Zeit reicht aus, um das durchzuziehen, ohne Fehler zu machen.
Das Gewächshaus.
Er rüttelt an der Tür. Abgeschlossen. Durch das Fenster sieht er Holzregale voller Pflanzen. Eines von denen wäre genau richtig. Er stürmt zurück zu seiner Tasche, wo er feststellen muss, dass er das Brecheisen im Arbeitszimmer des alten Mannes zurückgelassen hat. Egal. Mit roher Gewalt wird es auch gehen.
Wieder am Gewächshaus angekommen, tritt Musca einen Schritt zurück und rammt einen Absatz durch das hartholzumrahmte Glas. Rasch entriegelt er die Tür und schiebt sich hinein.
Er hat recht, die Holzregale sind perfekt für seinen Zweck. Dutzende von Tomaten platschen zu Boden, während er die Holzbeine aus dem Boden löst, in den sie ein Stück weit eingesunken sind, und das Regal dann nach draußen zerrt. Wieder blickt er zum Haus hinüber.
In der Schwärze bewegt sich etwas, das aussieht wie ein auf und ab hüpfender Lichtball. Das Licht einer Taschenlampe. Ein Bulle mit Taschenlampe sieht sich auf dem Gelände um – und steuert dabei in schnellem Tempo auf ihn zu.
Musca schreckt nicht davor zurück, einen Menschen zu töten. Er hat es schon getan und ist bereit, es jederzeit wieder zu tun, falls es nötig sein sollte. Er wendet sich nach links, ein Stück weg von dem näher kommenden Licht und schmeißt einen schweren Stein gegen die Seite des Gewächshauses.
»Stehen bleiben, Polizei!«
Lächelnd wartet er, bis die Taschenlampe die Quelle des Geräuschs erreicht hat. Eine Sekunde befindet er sich hinter dem Lichtstrahl, und der Polizist liegt besinnungslos auf dem Boden.
Musca kehrt zu dem Pflanzenregal zurück und lehnt es gegen die Gartenmauer.
Zehn Sekunden später ist er weg.
12
Megan lauscht dem Schniefen ihrer schwer atmenden vierjährigen Tochter. Alle halbe Stunde steht sie auf und lässt die Hand über den Kopf des Kindes gleiten. Sammy glüht. Zum achten Mal in dieser Nacht befeuchtet Megan einen Waschlappen und legt ihn ihrer Tochter sanft auf die Stirn.
Das Klingeln ihres Handys reißt sie aus einem angespannten Halbschlaf. Rasch greift sie danach, ehe das Läuten Sammy weckt.
»Detective Inspector Baker«, meldet sie sich.
»Frau Inspektor, hier spricht Jack Bentley aus der Zentrale.«
»Moment«, flüstert sie, während sie sich aus dem Bett kämpft. Schlaftrunken wankt sie hinaus auf den Gang. »So, nun schießen Sie los!«
»Uns wurde eben ein Zwischenfall in Tollard Royal gemeldet. Der für das Revier zuständige Beamte hat mich gebeten, Sie anzurufen.«
»Das ist nicht ganz meine Ecke, Jack.« Sie blickt den Gang hinunter. Ihre Mutter steht mit gerunzelter Stirn vor ihrer Schlafzimmertür.
»Ich weiß, Ma’am. In einem der großen Häuser dort hat es gebrannt. Dem Bericht zufolge wurde außerdem eingebrochen. Ein Polizeibeamter ist vom fliehenden Täter niedergeschlagen worden.«
»Und deswegen rufen Sie mich an?«
»Eine Zivilperson wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Man hat Ihre Karte bei ihm gefunden.«
Megan kann den vorwurfsvollen Blick ihrer Mutter nicht länger ertragen und wendet ihr den Rücken zu. »Haben Sie einen Namen? Wie hat er ausgesehen?«
»Dazu habe ich noch keine Informationen, aber wir haben einen Wagen überprüfen lassen, der dort parkt, einen alten Audi A4. Als Halter ist ein gewisser Gideon Chase aus Cambridge eingetragen.«
Obwohl sie die Antwort bereits zu kennen glaubt, stellt sie die Frage trotzdem: »Wem gehört das Haus?«
Sie hört Bentley die Information per Computer abrufen. »Der Besitzer heißt Nathaniel Chase. Er ist als alleiniger Bewohner eingetragen.«
»Er war der alleinige Bewohner. Der Mann, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist sein Sohn. Ich habe erst vor ein paar Stunden mit ihm gesprochen. Er war nur deswegen in der Gegend, weil ich ihn angerufen und über den Tod seines Vaters informiert hatte.«
»Der arme Kerl. Keine tolle Nacht für ihn, was?« Erst jetzt fällt bei Bentley der Groschen. »War das der Professor, der sich erschossen hat?«
»Genau der.«
»Jedenfalls waren zwei Beamte vor Ort, Robin Featherby und Alan Jones. Jones wird gerade wegen einer Halsverletzung behandelt, und Featherby hat mich gebeten, Sie anzurufen. Ich soll Ihnen von ihm ausrichten, dass er Sie nur ungern so spät nachts herausklingeln lässt, es aber trotzdem für besser hielt, Sie sofort zu informieren, als sich morgen einen Anschiss abzuholen.«
»Da hatte er recht. Danke, Jack. Gute Nacht.«
Als sie ihr Telefon ausschaltet, verschwindet ihre Mutter gerade im Schlafzimmer, um nach Sammy zu sehen. Nun werden sie sich wieder streiten, das weiß sie genau. Statt sich in ihr Schicksal zu fügen, geht sie lieber hinunter, um sich eine Tasse Tee zu machen.
Während das Wasser kocht, lässt Megan ihr kurzes Treffen mit Gideon noch einmal Revue passieren. Sie muss an den seltsam aufwühlenden Brief seines Vaters denken.
Auf keinen Fall war dieser Vorfall in Tollard Royal nur ein schiefgelaufener Einbruch.
Auf gar keinen Fall.
13
Dienstag, 15. Juni
Salisbury
Als Gideon an diesem Morgen die Augen aufschlägt, glaubt er im ersten Moment, zu Hause in seinem eigenen Bett zu liegen. Ein kurzes Blinzeln belehrt ihn eines Besseren. Er ist im Krankenhaus. Im Haus seines verstorbenen Vaters hat jemand eingebrochen und Feuer gelegt, und die Ärzte im Bezirkskrankenhaus von Salisbury haben darauf bestanden, ihn über Nacht dazubehalten, »zur Beobachtung«.
Er kämpft sich gerade in eine sitzende Position, als die matronenhafte Gestalt von Oberschwester Suzie Willoughby in der Tür erscheint. »Sie sind ja schon wach. Wie fühlen Sie sich?«
Er berührt seinen Kopf, der aus Protest mittlerweile heftig pocht. »Bescheiden.«
Sie hebt das Krankenblatt an, das am Fußende des Bettes hängt, wirft einen raschen Blick darauf und nimmt dann ihren Patienten etwas genauer in Augenschein. »Sie haben einen Schlag auf den Kopf davongetragen, außerdem eine geplatzte Lippe und einen hässlichen Schnitt an der linken Wange, aber die Röntgenuntersuchung hat ergeben, dass nichts gebrochen ist.«
»Man muss für alles dankbar sein.«
»So in der Art.« Sie betrachtet die Wunde in seinem Gesicht. »Es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus wie gestern, aber vielleicht sollten wir doch ein paar Stiche nähen.«
»Das wird schon wieder, ich heile schnell.«
Sie sieht ihm an, dass er vor dem Nähen Angst hat. »Das tut nicht weh. Zumindest nicht so wie früher. Haben Sie in letzter Zeit eine Tetanus-Impfung bekommen?«
»Nicht, seit ich ein Kind war.«
»Dann werden wir Ihnen eine verpassen und Ihr Blut auf eine mögliche Infektion untersuchen. Besser, man geht auf Nummer Sicher. Wie fühlt sich denn Ihr Hals an?«
Er kommt sich vor wie damals am Internat. Als würde ihm die Schulschwester auf den Zahn fühlen, um herauszufinden, ob er versucht, ein paar Stunden zu schwänzen. »Ein bisschen rau, aber es geht schon. Eigentlich fühle ich mich gut genug, um nach Hause zu fahren, wenn das für Sie in Ordnung ist.«
Ihr Blick sagt ihm, dass er das vergessen kann. »Der Arzt kommt in etwa zwanzig Minuten. Er wird Sie noch einmal von Kopf bis Fuß durchchecken, und wenn tatsächlich alles in Ordnung ist, entlassen wir Sie.« Sie fummelt an den dünnen Decken herum. »Ich bringe Ihnen etwas gegen die Kopfschmerzen und ein Glas Wasser für den Hals. Am besten, Sie trinken viel Wasser. Damit ihr Organismus richtig durchgespült wird. Das Feuer, in dem Sie letzte Nacht waren, hat ziemlich gequalmt, und Sie haben den Rauch tief in Ihre Lungenflügel hinuntergesaugt. Sie werden vermutlich noch ein paar Tage unter starken Halsschmerzen und Husten leiden.«
Er nickt schicksalsergeben. »Danke.«
Während sie davonwatschelt, denkt er über ihre Worte nach. Das Feuer. Nun kann er sich wieder genau an alles erinnern: der Einbrecher im Arbeitszimmer seines Vater, die brennenden Vorhänge, der Kampf auf dem Gang.
Die Schwester kehrt mit einem Plastikbecher Wasser und ein paar kleinen Pillenbehältern zurück. »Sind Sie allergisch gegen Paracetamol oder Ibuprofen?«
»Nein.«
Sie schüttelt zwei Tabletten heraus. »Nehmen Sie die. Falls sie nicht helfen, wird Ihnen der Arzt etwas Stärkeres geben.«
Er muss das ganze Wasser trinken, um sie hinunterzubekommen. Vicky – seine Ex – konnte Pillen aller Art schlucken, egal wie groß, ohne dafür auch nur einen einzigen Schluck Wasser zu benötigen. Er aber muss die halbe Themse austrinken, um auch nur eine hinunterzubekommen. Seltsam, dass sie ihm ausgerechnet in diesem Moment einfällt. Bestimmt eine Auswirkung des Schlages, den er auf den Kopf bekommen hat. Inzwischen ist es schon über ein Jahr her, dass sie sich getrennt haben. Queen Vic kehrte nach Abschluss ihrer Promotion nach Edinburgh zurück, wie sie es immer angedroht hatte, und die Trennung ließ sie beide erkennen, dass es an der Zeit war, zu neuen Ufern aufzubrechen. Schade, denkt Gideon. Manchmal fehlt sie ihm immer noch. Zum Beispiel jetzt.
Schwester Willoughby weicht nicht von seiner Seite.
»Fühlen Sie sich schon fit genug, um Besuch zu empfangen?« Ihr Ton klingt nun fast entschuldigend.
Gideon weiß nicht recht, was er antworten soll. »Welcher Art?«
»Polizei. Ein weiblicher Detective Inspector ist gerade an der Rezeption eingetroffen.« In ihren Augen blitzt eine Spur von Boshaftigkeit auf. »Sie brauchen nicht mit ihr zu sprechen, wenn Sie sich dem noch nicht gewachsen fühlen. Ich kann veranlassen, dass man sie wieder wegschickt.«
»Nein, das geht schon in Ordnung. Ich rede mit ihr. Danke.« Sein Kopf ist anderer Meinung und tut das durch heftiges Pochen kund. In puncto Einfühlungsvermögen ist Megan Baker wirklich nicht die Art Gesellschaft, die Gideon sich in dem Moment wünscht.
14
In einer der äußeren Kammern des Heiligtums tagt der Innere Kreis. Ein Ring aus Kerzen wirft ein gespenstisches Licht auf die vom Hüter einberufene Krisenversammlung. Die Kerzen bestehen alle aus reinstem Bienenwachs und sind so groß, dass sie den Männern bis zur Taille reichen.