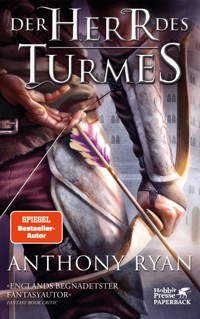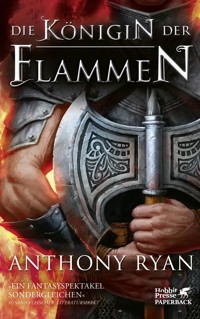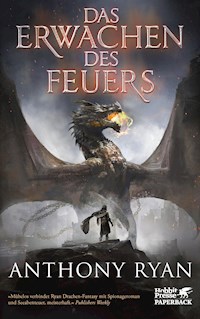
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im riesigen Gebiet von Mandinorien gilt Drachenblut als das wertvollste Gut. Rote, grüne, blaue und schwarze Drachen werden gejagt, um an ihr Blut zu kommen. Das daraus gewonnene Elixier verleiht den wenigen Gesegneten übernatürliche Kräfte. Doch das letzte Zeitalter der Drachen neigt sich seinem Ende zu. Kaum jemand kennt die Wahrheit: Die Drachen werden immer weniger und schwächer. Sollten sie aussterben, wäre ein Krieg Mandinoriens mit dem benachbarten Corvantinischen Kaiserreich unausweichlich. Alle Hoffnung des Drachenblut-Syndikats beruht auf einem Gerücht, nach dem es eine weitere Drachenart gibt, die weitaus mächtiger ist als alle anderen. Claydon Torcreek, ein Dieb und unregistrierter Blutgesegneter, wird von der obersten Herrschergilde in das wilde, unerforschte Inland geschickt, um einem Geschöpf nachzuspüren, das er selbst für reine Legende hält: dem weißen Drachen. »Mühelos verbindet Ryan Drachen- Fantasy mit Spionageroman und Seeabenteuer, meisterhaft und glaubwürdig.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1062
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anthony Ryan
Das Erwachen des Feuers
Draconis Memoria Buch 1
Aus dem Englischen von Sara Riffel & Birgit Maria Pfaffinger
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Waking Fire. Book One of the Draconis Memoria« im Verlag ACE Books, The Penguin Group (USA) New York
© 2016 by Anthony Ryan
Für die deutsche Ausgabe
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlag: © Birgit Gitschier, Augsburg
Cover-Illustration: Jaime Jones, designed by Nico Taylor – LBBG
Datenkonvertierung: Fotosatz Amann, Memmingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94974-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10897-2
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Prolog
I Die Roten Sande
II Übereinstimmungen und Anomalien
III Die Gesegneten und die Verdammten
Dramatis Personae
Für Paul. Wenn man für die gute Sache kämpft, ist das Wissen darum oft die einzige Belohnung.
Prolog
An: Vorstand des Eisenboot-Handelssyndikats
Zentrale Niederlassungen in Feros
Von: Lodima Bondersil – stellvertretende Direktorin der Abteilung Kerberhafen, Niederlassungen auf dem arradsianischen Kontinent
Datum: 29. Settemer 1578 (166. Tag des 135. Unternehmensjahrs nach Firmenzeitrechnung)
Betreff: Die Ereignisse in Zusammenhang mit dem Ableben von Mr. Havelic Dunmorn, Direktor der Abteilung Kerberhafen, Niederlassungen auf dem arradsianischen Kontinent
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie dieses Schreiben in Händen halten, werden Sie bestimmt schon mittels Blau-Trance vom Ableben meines Vorgesetzten, Mr. Havelic Dunmorn, erfahren und eine erste Schätzung der mit diesem tragischen Ereignis in Verbindung stehenden Todesfälle und beträchtlichen Materialschäden erhalten haben. Ich verfasse diesen Bericht in der Hoffnung, dass er mit jeglichen unsinnigen und falschen Gerüchten aufräumt, die von Konkurrenten oder Syndikatsmitarbeitern verbreitet werden. (Im Anhang finden Sie eine Liste der Personen, für die ich eine Kündigung bzw. vorzeitige Vertragsauflösung nahelege.) Es ist meine Absicht, eine vollständige und sachliche Darstellung der Ereignisse zu liefern, um dem Vorstand einen besseren Überblick über die Geschehnisse zu ermöglichen und die Entscheidungsfindung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise zu erleichtern.
Der fragliche Vorfall ereignete sich am 26. Settemer im und um das Hafen- und Erntearealvon Kerberhafen. Der Vorstand mag sich an Mr. Dunmorns Blau-Trance-Mitteilung vom 12. Dimester erinnern, in der er vom erfolgreichen Fang eines wilden Schwarzen durch die Freie Dienstleistergesellschaft der Kettenmeister im Rahmen einer ausgedehnten Expedition in die südwestlichen Regionen des arradsianischen Inlands berichtete. Außerdem möchte ich auf die letzten zehn Quartalsberichte dieser Außenstelle verweisen, in denen die zunehmende Sterblichkeit von in Gefangenschaft gezüchteten Exemplaren beschrieben wird, die bei Schwarzen besonders hoch ist. Bestimmt bedarf der Vorstand keiner Erinnerung, was die eingeschränkte Wirksamkeit von Produkt angeht, das von Jungtieren und Tieren aus Inzucht stammt. Deshalb wurde der Fang eines lebenden und gesunden wilden Schwarzen (dem ersten seit über zwölf Jahren) von allen Angestellten des Syndikats, gleich welchen Ranges, mit beträchtlicher Freude aufgenommen, bot er doch die Aussicht auf verbessertes Erbmaterial und hochwertige Erzeugnisse auf Jahre hinaus. Leider stellten sich diese Einschätzungen schon bald als voreilig heraus.
Der Schwarze – ein ausgewachsenes, zirka fünf Meter langes Männchen – erwies sich als äußerst schwer zu bändigen und ausgesprochen reizbar und neigte selbst sediert und mit angelegtem Maulkorb zu gefährlichen Angriffen. Mehrere Erntemeister wurden beim Ringen mit dem Tier verletzt, einer davon schwer. Das Ungetüm drückte ihn gegen die Wand des Pferchs, nachdem es sich mehrere Stunden lang schlafend gestellt hatte. Die Verschlagenheit der verschiedenen hierzulande heimischen Gattungen wurde zwar mehrfach von Erntemeistern und Naturkundlern dokumentiert, doch muss ich gestehen, dass ich angesichts der bösartigen Hinterlist dieses Exemplars ein gewisses Unbehagen verspürte, habe ich doch in all meinen Jahren auf diesem Kontinent dergleichen nie erlebt.
Neben seinen zahlreichen Gewaltausbrüchen weigerte der Schwarze sich auch noch, mit den in Gefangenschaft gezüchteten Weibchen zu kopulieren, und reagierte auf ihre Gegenwart entweder gleichgültig oder aggressiv. Auch scheuten die schwarzen Weibchen die Nähe ihres wilden Artgenossen. Allein bei seinem Anblick wurden sie unruhig und stießen laute Schreie aus. Als nach vier Monaten immer noch keine Aussicht auf eine erfolgreiche Paarung bestand und die Kosten für Futter und Pflege sich summierten, ordnete Mr. Dunmorn an, das Untier zu ernten. Ich füge eine Niederschrift meiner Unterhaltung mit Mr. Dunmorn bei, die meine Meinung in dieser Angelegenheit vollständig wiedergibt und hier nicht wiederholt werden muss.
Mr. Dunmorn wollte den Anlass mit einem Fest begehen, um die Moral der Bevölkerung zu heben, die angesichts der jüngsten Markteinbrüche und der daraus resultierenden Vertragsanpassungen einen Dämpfer erfahren hatte. Aus diesem Grund wurde die Ernte auf den Tag des Blut-Loses gelegt, der andernorts nur selten als Tag der Freude gilt, sich hier in der Abgeschiedenheit jedoch zum jährlichen Fest entwickelt hat. Die Vorstellung, dass einem Kind durch pures Glück ein Leben in Reichtum beschert wird, erfreut sich vor allem bei jenen großer Beliebtheit, deren eigene Ambitionen an ihren beschränkten Fähigkeiten scheitern.
Um den Feierlichkeiten eine besondere Note zu verleihen, beabsichtigte Mr. Dunmorn, ein Fünfzigstel des gewonnenen Produkts im Rahmen einer Verlosung unter dem Volk zu verteilen. In Anbetracht des gegenwärtigen Marktpreises für unverdünntes Schwarz dürfte der Vorstand sich der Attraktivität dieses Versprechens bewusst sein und verstehen, weshalb zum entscheidenden Zeitpunkt ein solches Gedränge in der Umgebung des Erntebottichs herrschte.
Persönlicher Bericht
Der Vorstand möge mir meine Unfähigkeit verzeihen, den genauen Ablauf der dem Unglück vorangegangenen Ereignisse wiederzugeben. Trotz größter Bemühungen war ich leider nicht in der Lage, sie zu rekonstruieren. Viele Augenzeugen weilen leider nicht mehr unter den Lebenden, und die verbleibenden sind oftmals unzurechnungsfähig oder gar dem Wahnsinn anheimgefallen. Der Kontakt mit unverdünntem Produkt kann unvorhersehbare Folgen haben. Ich selbst war weder beim Blut-Los noch bei der Ernte zugegen, da ich in der Akademie geblieben war, um mich meiner Korrespondenz zu widmen.
Etwa zwanzig Minuten nach der vierzehnten Stunde bewog mich lautes Geschrei von draußen dazu, die Arbeit niederzulegen. Beim Blick aus dem Fenster sah ich zahlreiche Stadtbewohner aufgebracht, nein, in Panik durch die Straßen rennen, darunter manch einer mit erschrockenem oder tränenüberströmtem Gesicht. Als ich eine meiner Schülerinnen erspähte, öffnete ich das Fenster und rief ihren Namen. Da sie, wie alle meine Mädchen, ausgesprochen klug und erfinderisch ist, gelang es ihr, sich aus der Masse zu lösen und den Balkon der Akademie zu erklimmen. Am Geländer hängend berichtete sie mir: »Er ist ausgebrochen, Madame! Der Schwarze läuft frei durch die Stadt! Es gibt viele Tote!«
Ich muss gestehen, dass ich zu diesem Zeitpunkt einen schändlichen Mangel an Entschlusskraft an den Tag legte, wofür ich den Vorstand vielmals um Verzeihung bitten möchte. Wie Ihnen allerdings sicherlich bekannt ist, habe ich mich während meiner drei Jahrzehnte auf diesem Kontinent nie einer vergleichbaren Situation gegenübergesehen. Nach einer unverzeihlichen Verzögerung von mehreren Sekunden war ich schließlich so weit bei Sinnen, dass ich meiner Schülerin eine Frage stellte: »Wie?«
Ein untypischer Ausdruck von Verwirrung trat auf das Gesicht des Mädchens, und eine halbe Minute verstrich, ehe es zögernd und unpräzise antwortete. »Das Blut-Los … Da war eine Frau … Eine Frau mit einem Kind …«
»Es ist ganz normal, dass sich Eltern mit ihren Kindern zum Blut-Los einfinden«, entgegnete ich, nicht ohne Ungeduld. »Drück dich genauer aus!«
»Sie …«, jetzt sprachen Schrecken und Verwunderung zu gleichen Teilen aus ihrer Miene, »… sie ist gesprungen.«
»Gesprungen?«
»Ja, Madame. Mit dem Kind … Sie hat das Kind genommen und … ist gesprungen.«
»Wohin?«
»In den Bottich, Madame. Genau in dem Moment, als der Erntemeister den Schwarzen anstach … Sie ist einfach in den Bottich gesprungen.«
In Anbetracht des verwirrten Blicks des Mädchens und der zahlreichen Brand- und Blutflecken auf ihrem Kleid kam ich zu dem Schluss, dass von ihm keine weiteren nützlichen Informationen zu erwarten seien. Ich schickte es deshalb in den Schlafsaal und trug ihm auf, für die Sicherheit der jüngeren Schülerinnen zu sorgen. Dann holte ich ein komplettes Set Phiolen aus dem Tresor in meinem Büro und machte mich unverzüglich auf den Weg zum Ernteareal. Ich werde den Vorstand nicht mit meinem Bericht darüber belasten, was ich unterwegs erlebte oder am Ziel angekommen vorfand, ebenso wenig werde ich in meiner Erzählung innehalten, um die Anzahl der Toten anzuführen. Nur so viel sei gesagt: Was ich sah, genügte, um die Aussagen meiner Schülerin zu bestätigen.
Der Bottich war völlig zertrümmert, die dicken Holzbretter zersplittert und weiträumig verteilt. Dasselbe galt für das Blut der Bestie. Es bildete zähe Pfützen auf dem Kopfsteinpflaster und besudelte die Wände der umliegenden Häuser, deren Fenster weit geöffnet waren, weil die Bewohner Mr. Dunmorns Spektakel hatten verfolgen wollen. Die Zuschauer, die nicht auf der Stelle getötet worden waren, stolperten benommen umher oder wälzten sich, sei es vor Schmerzen oder aus Wahnsinn, auf dem Boden. Dank meiner Immunität gegen das Blut konnte ich mich den Überresten des Bottichs nähern und stellte fest, dass in der größten Blutlache der Körper einer Frau lag. Ihre Haut war vom direkten Kontakt mit der Flüssigkeit schwarz und verkohlt, weshalb ich weder ihr Alter noch ihre Identität zu bestimmen vermochte. Ihr zarter Körperbau ließ jedoch auf eine junge Person schließen. Das Einzige, was auf den Schwarzen hinwies, waren die Reste seiner geborstenen Ketten. Von dem Kind, das meine Schülerin erwähnt hatte, fehlte jede Spur.
Eine Gewehrsalve lenkte meine Aufmerksamkeit auf den Kai, der von meinem gegenwärtigen Standort aus gut erkennbar war, da sich ein Pfad der Zerstörung durch etliche Häuserreihen dorthin zog. Begleitet wurden die Schüsse von einem unverkennbaren Brüllen. Ich beschloss, dass dies der richtige Zeitpunkt sei, eine größere Portion Grün zu mir zu nehmen; auf diese Weise gelangte ich in Windeseile zu den Hafenanlagen, wo ich einen ersten Blick auf die entfesselte Bestie erhaschte. Sie hatte sich einen Weg zur Hafenmauer gebahnt, und obwohl aus dem Zapfen an ihrem Hals nach wie vor Blut troff, richtete sie mit ungebremster Energie Verwüstungen an. Das Haus des Hafenmeisters verwandelte sie vor meinen Augen mit ein paar Schwanzschlägen in einen Trümmerhaufen und wandte sich dann den am Kai vor Anker liegenden Schiffen zu. Einige davon waren bereits dabei abzulegen; ihre Besatzungen gingen mit großer Eile ans Werk, um sich auf die offene See zu retten. Einem halben Dutzend fehlten jedoch wohl die für eine erfolgreiche Flucht erforderlichen Männer oder die nötige Entschlossenheit.
Mit einem Satz landete der Schwarze auf einem robusten Küstendampfer, der ERS Angemessene Beteiligung. Sein schieres Gewicht brachte das Schiff zum Kentern, und er schnappte nach den im Wasser schwimmenden Matrosen. Anschließend richtete er seine Aufmerksamkeit auf einen nahe gelegenen Frachter der Küstenstrahl Mineraliengesellschaft mit einer Verdrängung von zweihundert Tonnen und demolierte dessen Ruderhaus und Schornsteine, wobei er in dem vergeblichen Versuch, Feuer zu speien, wiederholt das Maul aufriss. An dieser Stelle muss ich kurz die Erntemeister loben, die das Tier gefangen und ihm in weiser Voraussicht die Naphtha-Kanäle durchtrennt hatten. Nicht auszudenken, was es sonst noch angerichtet hätte. In diesem Augenblick traf den Schwarzen eine Gewehrkugel in die Flanke. Er bäumte sich auf und stieß ein wütendes Brüllen aus, ehe er sich auf das nächste Schiff am Kai stürzte. Dabei schlug er instinktiv mit seinen verstümmelten Flügeln, um sich in die Luft zu schwingen. Der Schütze war schnell ausgemacht: eine Gestalt auf einem der kleineren, noch intakten Kräne am Kai. Dank der Wirkung des Grüns, das ich zu mir genommen hatte, erklomm ich den Kran innerhalb weniger Sekunden. Oben angekommen stieß ich auf einen Mann, der mit einem Langgewehr auf den Schwarzen zielte. Er drückte ab, woraufhin die Bestie sich erneut aufbäumte und zu einem weiteren Sprung ansetzte, diesmal auf das breite Deck der ERS Drachentrutz, ein auf die Blauen-Jagd spezialisiertes Schiff, das erst kürzlich aus dem Südmeer zurückgekehrt war. Die Besatzung hatte den unklugen Entschluss gefasst, der Bestie entgegenzutreten, und rückte ihr mit allerlei Feuerwaffen zu Leibe, von denen jedoch keine das nötige Kaliber besaß, um das Ungeheuer ernsthaft zu verletzen. Der Schütze stieß beim Nachladen eine Reihe derber Flüche aus, verstummte aber, als ich neben ihn trat. »Verzeihung, Ma’am«, sagte er im Akzent der alten Kolonien, und auch seine dunkle Hautfarbe ließ seine Herkunft erkennen. In Anbetracht der Umstände verzichtete ich auf einen Vortrag über gutes Benehmen. Neben seiner abgetragenen, aber robusten Kleidung fiel mir vor allem seine Waffe auf: ein Vactor-Massin .6 Einzelschuss-Hinterlader, wie er von den erfolgreicheren Auftragsunternehmen verwendet wird.
»Persönliche Waffen sind bei Betreten von Kerberhafen beim Protektorat abzugeben, Sir«, sagte ich.
Der Mann verzog den Mund zu einem Lächeln und deutete mit dem Kinn auf die tobende Bestie. »Wenn ich das Vieh erledige, wird man mich hoffentlich begnadigen, Ma’am. Er müsste nur mal lang genug stillhalten, damit ich ihm einen Kopfschuss verpassen kann.« Der Schwarze fegte soeben mit dem Schwanz die letzten verbleibenden Matrosen von Bord der Drachentrutz. Dann warf er den Kopf in den Nacken und stieß ein triumphierendes Brüllen aus, wobei aus dem Stahlzapfen in seinem Hals immer noch Blut lief. »Ein gutes Stück lebendiger, als er sein sollte«, stellte der Freie fest. Er zielte erneut und unterdrückte einen Fluch, als das Tier zum nächsten Sprung ansetzte. »Wenn man bedenkt, wie viel Blut er verloren hat.«
»Wie lautet Ihr Name, Sir?«
»Torcreek, Ma’am. Braddon Torcreek, Fünftelaktionär bei der Freien Dienstleistergesellschaft der Langgewehre.«
Ich leerte die Phiolen Rot und Schwarz, die ich eingesteckt hatte, und nahm einen weiteren kräftigen Schluck Grün zu mir. »Ich werde ihn für Sie festhalten, Mr. Torcreek«, sagte ich. »Dann wollen wir doch mal dafür sorgen, dass man Sie begnadigt.« Ich machte einen Satz über den Schützen hinweg, sprintete über den Kran und sprang auf den schiefen Mast eines gekenterten Frachters – eines der älteren Schiffe, die für den Fall eines Motorschadens noch immer Segel besaßen. Der Abstand betrug etwa zehn Meter, für eine mit Grün gestärkte Blutgesegnete also ohne Weiteres machbar. Ich packte die Takelage, um mich unter Nutzung der Zentrifugalkraft weiter zum Schwarzen zu schwingen – ein einfaches Manöver, das ich meinen Mädchen seit über zwei Jahrzehnten beibringe. Während ich mit beträchtlicher Geschwindigkeit auf das Tier zuflog, sammelte ich meine Rot-Reserven, um es von hinten anzugreifen. Selbstverständlich blieb seine Haut unter dem Hitzestoß weitgehend unversehrt und war nur wenig verkohlt, doch wie alle seine Artgenossen konnte der Schwarze der Herausforderung nicht widerstehen.
Inzwischen befand er sich auf einem anderen Frachter, dessen Besatzung weniger angriffslustig reagierte als die der Drachentrutz und sich stattdessen eilig über die Reling stürzte. Meine vom Rot entfachten Feuersalven beschleunigten zweifellos noch ihre Flucht. Der Schwarze wirbelte durch das brennende Chaos aus Holz und Takelage und riss das Maul auf, um eine feurige Erwiderung zu geben, heulte jedoch wütend, als keine Flammen kommen wollten. Etwa fünfzehn Meter von ihm entfernt legte ich eine unsanfte Landung hin und entging nur dank des Überflusses an Grün einer schlimmen Verletzung. Ich blickte dem Tier direkt in die Augen – eine Herausforderung, die kein männlicher Drache lange hinnehmen kann. Brüllend ging er zum Angriff über. Seine Klauen machten Kleinholz aus den Deckplanken, und sein Schwanz holte gerade zum Schlag aus, als die Bestie erstarrte und reglos stehen blieb, denn jetzt brachte ich das Schwarz zum Einsatz, das ich kurz vorher zu mir genommen hatte.
Dass es sich bei dem Tier um ein furchteinflößend starkes Exemplar handelte, war offenkundig, doch hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Vorstellung davon gehabt, wie kräftig es wirklich war. Mit aller Macht kämpfte es gegen meinen Griff an, und meine Produktreserven schwanden so schnell, dass mir der Schweiß auf die Stirn trat und ich zugegebenermaßen ungeduldig darauf wartete, dass Mr. Torcreek sein hochtrabendes Versprechen einlöste. Umso merkwürdiger, dass sich ausgerechnet in diesem Moment ein anderes Gefühl einstellte, ein Begreifen, das die Gefahr und Dringlichkeit der Situation überlagerte. Denn während ich dem Tier weiterhin fest in die Augen blickte, erkannte ich darin etwas, das über sein animalisches Verlangen nach Fleisch und Triumph hinausging: eine enorme, tiefsitzende Furcht, aber nicht vor mir. Mir wurde klar, dass der Schwarze sich nicht für seine Gefangenschaft und die erlittenen Qualen rächen wollte, ebenso wenig dafür, dass man ihm einen stählernen Zapfhahn in den Hals gepflanzt hatte. Er hatte versucht zu fliehen, allerdings vor etwas weitaus Schlimmerem als uns kleinen, zweibeinigen Plagen. Als ich im Geiste gerade den Fluchtweg der Bestie durchging – von dem kaputten Bottich mit der mysteriösen Leiche durch die dicht bevölkerten Straßen zum Hafen –, bewies Mr. Torcreek endlich, dass er kein Maulheld war.
Mit leisem Pfeifen zog die Gewehrkugel über mich hinweg und traf den Schwarzen genau in die Mitte seiner abfallenden Stirn. Er zuckte einmal kurz, ein Schauer durchlief seinen langen Körper vom Kopf bis zum Schwanz, dann brach er erstickt gurgelnd auf dem halb zerstörten Deck zusammen.
Schlussfolgerung
In Anhang II finden Sie eine vollständige Auflistung aller Todesfälle und Sachschäden sowie eine Schätzung der Kosten für die anfallenden Reparaturen. Wie oben erwähnt, ist die Erstellung eines exakten, stichhaltigen Berichts nicht möglich, allerdings scheinen gewisse Fakten unwiderlegbar festzustehen.
Erstens ist tatsächlich eine Frau unbestimmter Herkunft in Begleitung eines Kindes von unbekanntem Geschlecht zu Mr. Dunmorn auf die Plattform gestiegen, während dieser über die Vorteile der Firmenloyalität schwadronierte. Um die Wahrheit zu sagen, galt Mr. Dunmorn nicht gerade als begnadeter Redner, was möglicherweise die mangelnde Aufmerksamkeit der meisten Anwesenden zum entscheidenden Zeitpunkt erklärt. Dennoch ist es mir gelungen, Augenzeugenberichte von sechs Einzelpersonen von gutem Charakter und zuverlässigem Urteilsvermögen zu sammeln. Sie alle erklärten, dass die Frau die Schlange der auf das Blut-Los wartenden Eltern und Kinder verließ und ohne Eile und unbemerkt von Mr. Dunmorn und den Erntemeistern, die gerade den Zapfhahn im Hals des Schwarzen verankerten, auf die Plattform stieg. Abgesehen davon, dass sie jung war, konnte ich nichts Näheres über ihr Äußeres in Erfahrung bringen. Ein männlicher Zeuge erklärte, sie sei durchschnittlich attraktiv gewesen, doch sei die Entfernung zu groß gewesen, als dass er genauere Aussagen zu ihrer Haar- und Hautfarbe machen könne. Die Beschreibungen des Kindes sind ähnlich vage, doch deutet seine Größe auf ein Alter von etwa acht Jahren hin, was dem üblichen Alter für die Teilnahme am Blut-Los entspricht.
Augenscheinlich hatte Mr. Dunmorn gerade den Befehl zum Anstechen gegeben, als die Frau das Kind packte und sich mit ihm in den Bottich stürzte. An dieser Stelle werden die meisten Berichte verständlicherweise etwas wirr. Allerdings bin ich beim Vergleichen der verschiedenen Zeugenaussagen auf einige Übereinstimmungen gestoßen. Offenbar explodierte der Bottich von innen und tötete Mr. Dunmorn und die Erntemeister. Dieses eine Unglück ist also nicht dem Schwarzen anzulasten, da er zu diesem Zeitpunkt noch am Zapfturmfestgekettet war. Infolge der Zerstörung des Bottichs wurde eine große Menge Produkt freigesetzt, was zu allgemeiner Panik führte. Allerdings hatten drei Zeugen genug Ruhe bewahrt, um zu bestätigen, dass die Ketten des Schwarzen nirgends zu sehen waren, als das Produkt herabregnete und das Tier seine verzweifelte Flucht antrat.
Meine Schlussfolgerung ist beunruhigend, aber unausweichlich: Der Schwarze wurde durch die Einwirkung eines Blutgesegneten befreit; dieser hat den Tod von Mr. Dunmorn und so vieler anderer verursacht. Die Liste der Verdächtigen, die den Interessen des Syndikats auf diesem Kontinent schaden wollen, ist lang, wobei das Corvantinische Kaiserreich wohl an erster Stelle steht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, welchen Vorteil sie aus diesem Vorfall ziehen sollten. Ebenso bleibt es ein Mysterium, welche Verbindung zwischen dem Saboteur und der unbekannten Frau oder ihren Absichten besteht. Wie oben erwähnt, wurde die Leiche der Frau geborgen, wenn auch in unkenntlichem Zustand. Das Kind, mit dem sie in den Bottich sprang, ist jedoch nach wie vor verschollen. Zwar kamen bei dem Vorfall mehrere Kinder ums Leben, vor allem solche, die sich für das Blut-Los eingefunden hatten, doch wurden ihre Leichen allesamt von trauernden Familienmitgliedern identifiziert. Identität und Verbleib des Kindes sind womöglich das unerklärlichste Rätsel in dieser Angelegenheit.
Ich versichere dem Vorstand, dass meine Anstrengungen zur Aufklärung dieser Fragen noch nicht erschöpft sind und ich alles daransetzen werde, Antworten zu finden.
Bis zum Eintreffen von Mr. Dunmorns Nachfolger verbleibe ich, Ihre loyalste Mitarbeiterin und Aktionärin, mit freundlichen Grüßen
Lodima Bondersil
Stellvertretende Direktorin der Abteilung Kerberhafen
Niederlassungen auf dem arradsianischen Kontinent
I
Die Roten Sande
•••
Was meinen wir, wenn wir den Begriff »Produkt« verwenden, dieses ansonsten so harmlose Wort, das im Laufe des letzten Jahrhunderts und seit Anbruch des Unternehmenszeitalters so an Bedeutung gewonnen hat? Die meisten Leser würden, da bin ich mir sicher, mit einem einzigen Wort antworten: »Blut.« Redseligere Zeitgenossen würden ihre Erwiderung vielleicht folgendermaßen ergänzen: »Drachenblut.« Das ist zwar grundsätzlich richtig, verschleiert jedoch mitunter die enorme Komplexität des Gegenstands, dem dieses bescheidene Werk gewidmet ist. Denn wie selbst der abergläubischste dalzianische Wilde oder der ungebildetste Inselrohling bestätigen wird, gibt es nicht nur eine Art von Produkt. Ich werde Ihnen, verehrter Leser, eine umfassende technische Beschreibung der verschiedenen Varianten ebenso ersparen wie die immer länger werdende Liste von Derivaten, die aus dem Körper des arradsianischen Drachen gewonnen werden. Stattdessen finde ich es angebrachter und womöglich unterhaltsamer, ein Mantra zu wiederholen, das den Schülerinnen der Eisenboot-Akademie für Frauenbildung, zu deren stolzen Absolventinnen ich mich zählen darf, beigebracht wird:
Blau für den Geist.
Grün für den Körper.
Rot für das Feuer.
Schwarz für die Kraft.
Aus Plasmologie für Laien von Miss Amorea Findlestack. Eisenboot-Verlag – Unternehmensjahr 190 (1579 nach mandinorianischem Kalender).
Kapitel 1
Lizanne
Kurz nach Sonnenuntergang trat Mr. Redsel zu ihr an den Bug. Sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, sofern das Wetter es erlaubte, abends hierher zu gehen, um Sterne und Monde zu betrachten, die Meeresbrise auf der Haut zu spüren und dem steten, rhythmischen Schlag der beiden Schaufelräder der Gegenseitiger Vorteil zu lauschen. Heute war der Takt langsamer als sonst; sie näherten sich den Barriere-Inseln mit ihren versteckten Gefahren, und der Kapitän hatte die Geschwindigkeit gedrosselt. Am Morgen würden sie von den starken Strömungen der Meerenge umgeben sein, und die Schaufelräder würden wieder Geschwindigkeit aufnehmen, jetzt jedoch waren ein gemächliches Tempo und eine genaue Kontrolle der Karten und des Kompasses gefragt.
Obwohl sie Mr. Redsels Schritte deutlich hörte, wandte sie sich nicht zu ihm um. Stattdessen blickte sie weiter zu den Monden empor, zu Serphia und Morvia, und bedauerte, dass deren größere Schwester heute Nacht nicht zu sehen war. Nelphia mit ihren zahllosen Bergen und Tälern war im Gegensatz zu ihren pockennarbigen Schwestern fast frei von Kratern. Die Vorzüge einer vor kurzem noch aktiven Oberfläche, so ihr Vater. Aber nichtsdestotrotz eine tote Welt.
»Miss Lethridge«, sagte Mr. Redsel und blieb hinter ihr stehen. Auch ohne sich umzudrehen, wusste sie, dass er gebührenden Abstand hielt. Sie hatte ihn während der Überfahrt genau beobachtet. Er war viel zu erfahren, um sich an einem derartig wichtigen Punkt eine Ungeschicklichkeit zu erlauben. »Mir will scheinen, Sie sind in das Flüstern der Nacht versunken.«
Marsal, dachte sie. Er eröffnet das Gespräch mit einem Zitat. Ein wenig banal, aber unbekannt genug, um einen gebildeten Eindruck zu erwecken.
»Mr. Redsel.« Sie legte einen Hauch Wärme in ihre Stimme. »Die Karten waren Ihnen heute nicht wohlgesonnen, nehme ich an?«
Die anderen Passagiere vertrieben sich die Abende vor allem mit Kartenspielen und stümperhaftem Herumgeklimpere auf dem alten Klavier im luxuriösen, aber überschaubaren Salon. In der Regel ließen Lizannes Mitreisende sie in Ruhe und belästigten sie nur selten mit belangloser Konversation. Der Aktionärsstatus hatte durchaus seine Vorteile, und niemand an Bord war hochrangig oder unverschämt genug, sich ihr übermäßig aufzudrängen. Mr. Redsel hatte ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt als die meisten anderen, obwohl der Annäherungsversuch, auf den sie wartete, seit der Mann in Feros an Bord gegangen war, bislang ausgeblieben war.
»Trauerbube war noch nie mein Spiel«, sagte er. »Miss Montis hat mir zehn Scheine abgeknöpft, ehe ich so schlau war auszusteigen.«
Sie ließ eine kurze Pause entstehen, ehe sie sich zu ihm umwandte, in der Hoffnung, ihr Zögern könnte ihm noch mehr entlocken. Allerdings legte er eine bemerkenswerte Disziplin an den Tag und hüllte sich in Schweigen. Nur die Geste, mit der er eine Zigarilloschachtel aus der Jackentasche zog, verriet leichte Ungeduld.
»Danke«, sagte sie, als er ihr die geöffnete Schachtel hinhielt, und nahm eine der dünnen, in Blätter gerollten Köstlichkeiten. »Sogar welche aus Dalzia«, fügte sie hinzu und hielt sich den Zigarillo unter die Nase, um daran zu schnuppern.
»Alles andere ist meiner Meinung nach nur ein trauriger Abklatsch.« Mr. Redsel riss ein Streichholz an. Rauch stieg auf, als Lizanne den Zigarillo in die Flamme hielt und anzog. Ein Anfänger hätte die Gelegenheit vielleicht genutzt, um die Nähe andauern zu lassen, vielleicht sogar einen Kuss zu erhaschen, aber Mr. Redsel wusste es besser.
Er sagte: »Seinen Leidenschaften sollte man nach Möglichkeit frönen«, trat einen Schritt zurück, entzündete seinen eigenen Zigarillo und schnippte das verlöschende Streichholz in die Dunkelheit jenseits der Reling. »Finden Sie nicht?«
Sie zuckte mit den Achseln und zog sich das Tuch fester um die Schultern. »Eine alte Lehrerin von mir sagte immer, seinen Leidenschaften zu frönen, sei ein Ausdruck von Schwäche. ›Denkt daran, Mädchen: Aktionärin wird man nicht durch Tändelei, sondern durch Fleiß.‹« Die Anekdote hatte sich wirklich zugetragen, und beim Gedanken daran musste Lizanne lächeln. Madame Bondersils stets strenger Blick war ihr nur allzu gut in Erinnerung. Ich freue mich schon, Sie wiederzusehen, Madame, dachte sie und blickte hinaus zu den zwei Monden, die auf den dunkler werdenden Wellen schimmerten. Sofern ich diese Nacht überlebe.
»Sie waren offenbar eine aufmerksame Schülerin«, antwortete Mr. Redsel. Mit ihren Worten hatte sie ihm die stillschweigende Erlaubnis erteilt, den Blick über ihr Mieder gleiten zu lassen, wo unter dem dünnen Seidenschal das Funkeln einer Aktionärsnadel zu erkennen war. »So jung und schon Vollaktionärin. Nur wenige von uns können davon träumen, es in so kurzer Zeit so weit zu bringen.«
»Fleiß gepaart mit Glück ist eine effektive Kombination«, erwiderte Lizanne und nahm einen weiteren Zug von ihrem Zigarillo, der nur nach bestem dalzianischem Tabak schmeckte. Wenigstens ist er kein Giftmörder. »Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass Sie dergleichen Bestrebungen etwas abgewinnen können. Sie sind doch ein Freier, oder?«
»So ist es, derzeit bin ich ein Ein-Mann-Syndikat.« Er unterstrich seine Worte mit einer selbstironischen Verbeugung. »Nach meinem letzten Auftrag dachte ich, es sei endlich an der Zeit, einen Teil meiner Gewinne zu investieren und das Land zu besuchen, aus dem all der Reichtum fließt, der uns zu Sklaven macht.«
Ein weiteres Zitat, diesmal von Bidrosin, vorgebracht in einem spöttischen Ton, der Redsels mangelnde Sympathie für die berüchtigte corvantinische Radikale durchblicken ließ. »Dann haben Sie Arradsia also noch nie mit eigenen Augen gesehen?«, fragte Lizanne.
»Ein Versäumnis, das ich nachzuholen gedenke. Wohingegen Sie, wie ich annehme, mit dem Kontinent bestens vertraut sind.«
»Ich wurde in Feros geboren, besuchte jedoch in Kerberhafen die Schule und hatte Gelegenheit, einen Teil des Inlands zu bereisen, ehe der Vorstand mich in die Zentrale berief.«
»Dann müssen Sie mich herumführen.« Lächelnd lehnte er sich an die Reling. »Wie ich hörte, wird es in wenigen Monaten eine Konjunktion geben, und angeblich soll man in Arradsia die beste Sicht haben.«
»Dann sind Sie also Astronom, mein Herr?« Sie ließ einen Hauch zweifelnden Spotts anklingen, als sie neben ihn trat.
»Lediglich ein Freund von Spektakeln«, antwortete er und blickte zu den Monden empor. »Drei Monde am Himmel, und dahinter, nur ganz kurz sichtbar, die Planeten aufgereiht. Das wird ein Anblick, den man so schnell nicht vergisst.«
Wo hat man Sie gefunden?, dachte sie und studierte sein Profil. Zerfurcht, aber nicht wettergegerbt, gutaussehend, aber nicht verweichlicht, klug, aber nicht arrogant. Man könnte fast meinen, sie hätten Sie speziell für diesen Zweck gezüchtet.
»In Kerberhafen gibt es ein Observatorium«, sagte sie. »Es verfügt über alle möglichen optischen Instrumente. Ich kann sicherlich dafür sorgen, dass Sie dem Direktor vorgestellt werden.«
»Das ist ausgesprochen freundlich von Ihnen.« Er verstummte und runzelte zögernd die Stirn. »Ich muss Sie einfach fragen, Miss Lethridge, denn Neugier war immer schon mein größtes Laster: Sind Sie wirklich die Enkelin von Darus Lethridge?«
Ganz schön schlau, dachte sie. Um Vertrautheit herzustellen, riskiert er es, mir zu nahe zu treten, indem er ein so heikles Thema anschneidet. Mal sehen, wie er auf einen kleinen Rückschlag reagiert. Sie seufzte und stieß eine Rauchwolke aus, die vom Wind davongetragen wurde. »Und ein weiterer Bewunderer des großen Mannes gibt sich zu erkennen.« Sie trat von der Reling zurück und wandte sich zum Gehen. »Er starb vor meiner Geburt, ich habe ihn also nie kennengelernt, mein Herr. Daher kann ich leider nicht mit Anekdoten dienen und wünsche Ihnen eine gute Nacht.«
»Ich bin auch nicht an Anekdoten interessiert.« Seine sorgfältig modulierte Stimme war sanft drängend, und er stellte sich ihr in den Weg, wobei er weiterhin gebührenden Abstand wahrte. »Und ich entschuldige mich in aller Form, wenn ich Sie aus Versehen beleidigt habe. Aber wissen Sie, ich benötige eine zweite Meinung zu einer von mir getätigten Anschaffung.«
Den Zigarillo zwischen den Lippen verschränkte sie die Arme und zog fragend eine Augenbraue hoch. »Anschaffung?«
»Ja. Es geht um die Skizzen einer Maschine, von denen der Verkäufer behauptete, sie stammten aus der Feder Ihres Großvaters. Allerdings muss ich gestehen, dass ich meine Zweifel daran habe.«
Sein verwirrter Blick, als sie auflachte, bereitete ihr eine gewisse Befriedigung. »Ein Ein-Mann-Syndikat. Ist das etwa Ihr Geschäft, mein Herr? Der Erwerb von Skizzen?«
»Der Erwerb und Verkauf. Und nicht nur von Skizzen, sondern von allen möglichen originalen Kunstwerken und Antiquitäten. Mit Betonung auf ›original‹.«
»Und Sie glauben, dass ich die Herkunft dieser Entwürfe für Sie bestimmen kann – mit meinem geübten, anverwandten Auge?«
»Ich dachte, Sie kennen vielleicht seine Federführung, seine Handschrift …« Er verstummte und machte ein verlegenes Gesicht. »Eine dumme Idee, wie mir jetzt bewusst wird. Bitte verzeihen Sie, wenn ich Sie gekränkt habe.« Er neigte reuig den Kopf und wandte sich zum Gehen. Sie wartete, bis er ein gutes Dutzend Schritte zurückgelegt hatte, ehe sie die Frage stellte, die er hören wollte.
»Worum handelt es sich? Um was für eine Maschine?«
Er blieb abrupt stehen und drehte sich zu ihr um. Die Überraschung in seinem Blick wirkte beeindruckend echt. »Die einzig wahre«, sagte er und deutete auf die sich langsam drehenden Schaufelräder und die beiden Schornsteine über dem Steuerhaus, aus denen Dampfwolken in den Nachthimmel aufstiegen.
»Der thermoplasmische Motor«, flüsterte sie mit aufrichtiger Neugier. Wie weit sind sie wohl gegangen, um mir diese Falle zu stellen? »Das ganz große Ding also«, fügte sie mit lauterer Stimme hinzu. »Welche Version?«
»Die allererste«, erwiderte er. »Wenn die Entwürfe echt sind. Ich kann sie Ihnen morgen mit Vergnügen zeigen …«
»Nicht doch.« Sie trat neben ihn, hakte sich unter und steuerte ihn in Richtung der Passagierkabinen. »Neugier ist auch mein schlimmstes Laster, und wenn sie einmal geweckt ist, duldet sie keinen Aufschub.«
•••
Den Leidenschaften frönen?, dachte sie wenige Stunden später, während Mr. Redsel zufrieden neben ihr schlummerte. Sie ließ den Blick über seinen Oberkörper schweifen und auf seinen von Schweiß glänzenden Bauchmuskeln verweilen. Wie sich erwiesen hatte, war er in den körperlichen Künsten ebenso gewandt wie in allem anderen. Sie hatte nichts anderes erwartet. Ich glaube aber kaum, dass Madame diese Strategie gutgeheißen hätte.
Bei diesem Gedanken stahl sich ein Lächeln auf Lizannes Lippen, und sie stieg aus dem Bett. Sie blieb kurz stehen, um ihr Mieder vom Boden aufzuheben, und ging dann weiter zur Kommode, wo Mr. Redsel nach Betreten der Kabine die Skizzen ausgebreitet hatte. Seine komplizierte und originelle Erklärung über die Herkunft der Zeichnungen war von ihrem Kuss unterbrochen worden. Seine Überraschung hatte ihr ebenso viel Vergnügen bereitet wie das, was darauf folgte. Eine Zeit lang hatte sie sich in Feros einen Liebhaber gehalten, einen diskreten Offizier des Eisenboot-Protektorats, der am anderen Ende des Ozeans eine Frau hatte und entsprechend wenig Interesse an einer dauerhaften romantischen Beziehung. Allerdings war Kommandant Pinefeld vor einigen Monaten auf einen entfernten Posten versetzt worden. Das soeben Geschehene hatte also wohl doch auch dem Frönen von Leidenschaften gedient, vornehmlich aber dem Beseitigen kleiner Zweifel, die sie noch an Mr. Redsels wahren Absichten gehegt hatte.
Kurz vor seinem Höhepunkt hatte sie es ganz klar in seinen Augen gelesen. Sie hatte Arme und Beine fest um ihn geschlungen, während er immer schneller zustieß, und im richtigen Moment die richtigen Geräusche gemacht, um ihn in der Illusion zu wiegen, dass er das erforderliche Band zwischen ihnen erfolgreich geknüpft hatte. Sie hatte das Gefühl, ihm etwas schuldig zu sein. Schließlich war er wirklich ausgesprochen erfahren.
Der Schein der beiden Monde fiel durch das offene Bullauge und spendete Lizanne genügend Licht, um die Skizzen zu studieren. Es waren drei, das Papier war vergilbt und an den Ecken leicht eingerissen, die präzise gezeichneten Umrisse der größten Erfindung der Welt waren jedoch immer noch deutlich zu erkennen. Über dem ersten Entwurf standen die Worte ›Plasmischer Lokomotivenantrieb‹ in krakeligen, fast schon fieberhaft hingekritzelten Buchstaben, die auf die Aufregung schließen ließen, die mit dieser neuen Idee einhergegangen sein musste. Das Datum 36.04.112 befand sich in ähnlich schwungvoller Schrift in der rechten unteren Ecke. Die unbeholfenen Buchstaben bildeten jedoch einen enormen Kontrast zur Darstellung der Maschine selbst. Jedes Rohr, jede Muffe und jede Mutter war bis ins kleinste Detail wiedergegeben, die Schatten so genau schraffiert, wie es nur ein überaus begabter Zeichner vermochte.
Lizanne besah sich die nächste Skizze, die ebenso meisterhaft ausgeführt war, wobei die Maschine hier bereits ihren bekannten Namen trug: »Thermoplasmischer Motor«. Darüber hinaus enthielt der Entwurf etliche Zusätze und Verbesserungen im Vergleich zum ersten. Diese Zeichnung trug das Datum 12.05.112, während die dritte, eine ähnlich beeindruckende Darstellung der endgültigen Inkarnation des Apparats, auf den 26.07.112 datiert war. Zwei Tage vor Anmeldung des Patents. Sie musterte nacheinander die obere rechte Ecke der Skizzen, wo in derselben unverwechselbaren Handschrift das Monogramm DL stand.
»Und, was denken Sie?«
Sie drehte sich um und sah Mr. Redsel aufrecht und hellwach dasitzen. Ein schwaches Leuchten erhellte die Kajüte, als er die Öllampe über dem Bett entzündete. Sein Gesichtsausdruck war der eines Mannes, der soeben Feuer gefangen hat. Wirklich perfekt, dachte sie mit leichtem Bedauern.
»Ich fürchte, mein Herr«, sagte sie und zog eine Phiole Produkt aus dem Spitzenbesatz ihres Mieders hervor, »dass wir andere Dinge zu besprechen haben.«
Es klickte leise und metallisch, dann brachte er einen kleinen Revolver unter dem Kopfkissen zum Vorschein. Als er ihn auf ihre Stirn richtete, konnte sie das Modell erkennen: ein Tulsome .21 mit sechs Kammern, weithin auch als Glücksspielers Salzstreuer bekannt, da die mehrzylindrige Waffe eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Gewürzbehälter aufwies und sich bei professionellen Kartenspielern großer Beliebtheit erfreute. Trotz ihres kleinen Kalibers war sie in den Händen eines erfahrenen Schützen absolut zuverlässig und tödlich.
Lizanne zog lediglich eine Augenbraue hoch. Gleichzeitig entstöpselte sie die Phiole mit dem Daumen und führte sie an die Lippen. Es war ihre Notfallphiole, die eine der Geheimmischungen des Eisenboot-Labors enthielt. Die effektive Kombination verschiedener Produkttypen war eine Kunst, die nur die wenigsten Erntemeister beherrschten. Das Produkt musste mit größter Geduld und Sorgfalt auf der Molekularebene bearbeitet und mit verschiedenen synthetischen Bindemitteln vermengt werden. Um die benötigte Präzision zu erreichen, waren äußerst leistungsstarke Magnaskope nötig – eine weitere Erfindung, die die Welt ihrer Familie verdankte.
»Nicht!«, warnte Mr. Redsel und erhob sich vom Bett. Er hielt den sechszylindrigen Revolver jetzt mit beiden Händen umklammert, Blick und Tonfall waren gleichermaßen entschlossen. »Ich will nicht …«
Sie leerte die Phiole, und er drückte den Abzug. Die Waffe gab ein trockenes Klicken von sich, als der Hammer auf eine leere Kammer traf. Nach kurzem Zögern sprang Redsel vom Bett, drehte den Revolver in der Hand und holte aus, um Lizanne einen Schlag gegen die Schläfe zu verpassen. Der Inhalt der Phiole hinterließ einen bitteren und komplexen Geschmack auf ihrer Zunge, bevor er sich in vertraut rasantem Tempo durch ihre Adern brannte. Siebzig Prozent Grün, zwanzig Prozent Schwarz und zehn Prozent Rot. Mit von Grün verstärkter Schnelligkeit bekam sie Redsels Handgelenk einen Zoll vor ihrer Schläfe zu fassen. Ihr Griff war fest, aber nicht so fest, dass er Druckstellen hinterlassen oder Knochen gebrochen hätte. Auffällige Verletzungen könnten später Fragen nach sich ziehen.
Redsel holte mit der freien Hand aus. So wie er die Faust hielt, würde der Schlag tödlich sein. Lizanne entfesselte ihr Schwarz, was ihn erstarren ließ. Zitternd versuchte er, sich aus ihrem Griff zu befreien, doch vergeblich. Hinter zusammengepressten Zähnen formte seine Zunge Beschimpfungen oder flehentliche Bitten. Ohne ihren Griff zu lockern, schob sie ihn ein paar Schritte rückwärts und ließ ihn über dem Bett in der Luft schweben. Das Schwarz schwand schnell, sie hatte nur wenig Zeit.
»Wer ist Ihre Kontaktperson in Kerberhafen?«, fragte sie und gewährte ihm gerade so viel Spielraum, dass er sprechen konnte.
»Sie …«, stieß er nach Luft ringend hervor, »… machen … einen Fehler.«
»Im Gegenteil, mein Herr«, entgegnete sie, ging zur Kommode und zog den kleinen Lederbeutel hervor, der dahinter versteckt war. Sie löste die Bänder und brachte die vier darin befindlichen Phiolen zum Vorschein. »Sie haben einen Fehler gemacht, die hier nicht sorgfältig genug zu verstecken. Es hat mich nur wenige Sekunden gekostet, sie zu finden, als ich gestern Ihre Kabine durchsucht habe, und den Salzstreuer ebenfalls.« Sie legte den Kopf schief und unterzog seinen nackten Körper einer genauen Betrachtung, wobei sie ihn unter Zuhilfenahme des Schwarz um seine Achse drehte. Keine Spur vom Zeichen. Nicht einmal an den Fußsohlen.
»Sie sind nicht beim Kader«, sagte sie. »Ein Söldling. Das Corvantinische Kaiserreich hat einen unregistrierten Blutgesegneten auf mich angesetzt. Normalerweise legen die Agenten des Kaisers mehr Vernunft an den Tag. Ich muss zugeben, mein Herr, dass ich das gewissermaßen als persönliche Beleidigung auffasse. Worauf machen Sie üblicherweise Jagd? Auf reiche Witwen und hohlköpfige Erbinnen?«
»Ich wurde nicht geschickt, um Sie zu töten.«
»Daran hege ich keinerlei Zweifel, Mr. Redsel. Nach dem Austausch von Intimitäten, der sich in Kerberhafen zweifelsohne fortgesetzt hätte, hätten Sie Ihren Auftraggebern genug Informationen liefern können, um das Zwölffache Ihres Honorars wert zu sein.«
Ein resignierter Ausdruck trat auf sein Gesicht, und sie fühlte kurz Bewunderung in sich aufflackern für seine offenkundige Entschlossenheit, sie nicht anzuflehen. Stattdessen stellte er eine Frage: »Wie … habe ich mich … verraten?«
»Ich mochte Sie zu sehr.« Sie zwang ihre Bewunderung nieder und verstärkte den Griff. »Söldling oder nicht, Sie und ich haben denselben Beruf, und ich verspüre nicht den Wunsch, Sie leiden zu sehen. Also frage ich Sie erneut und rate Ihnen, mir zu antworten: Wer ist Ihre Kontaktperson in Kerberhafen?«
Sein Gesicht war jetzt fast vollständig gelähmt, und er konnte seinen Gefühlen nur mit den Lippen Ausdruck verleihen, was er tat, indem er mit gefletschten Zähnen erwiderte: »Sie sollten … Kontakt zu mir aufnehmen … Ich weiß … keine Namen.«
»Der Deckname?«
»Wahre Liebe.«
Trotz der Umstände konnte sie sich ein amüsiertes Lachen nicht verkneifen. »Wie passend.« Sie merkte, wie das Schwarz langsam abebbte und das scharfe Brennen zunahm, das mit dem Schwinden des Produkts in ihrem Blut einherging. »Ach, und falls es Sie interessiert«, sagte sie und deutete mit dem Kinn auf die Zeichnungen. »Das sind Fälschungen. Mein Großvater hat nie den mandinorianischen Kalender verwendet. Außerdem litt er in der zweiten Hälfte seines Lebens unter Arthritis und hatte verkrüppelte Hände, was er jedoch aus Stolz und Eitelkeit verbarg.«
Als sie mit dem letzten Rest Schwarz sein Herz zum Stehen brachte, verzogen sich seine Lippen zu etwas, das ein Lächeln oder ein erneutes Zähnefletschen war. Er zuckte einmal in der Luft und fiel dann aufs Bett; schlaff und leblos lag sein wohlgeformter Körper da.
•••
Beim Frühstück kam der Erste Offizier zu ihr und setzte sie förmlich und respektvoll von Mr. Redsels Ableben in Kenntnis. »Wie schrecklich!«, rief sie aus, legte ihren Toast beiseite und nahm zur Kräftigung einen Schluck Tee. »Ein Herzinfarkt, sagen Sie?«
»Laut Schiffsarzt, ja, Miss. Ungewöhnlich für einen Mann seines Alters, aber offensichtlich kein Einzelfall.« Ein Besatzungsmitglied hatte gesehen, wie Lizanne sich mit Redsel am Bug unterhalten hatte, deshalb war der Erste Offizier genötigt, ihr ein paar Fragen zu stellen. Wie zu erwarten, erwies er sich jedoch als wenig beharrlicher Ermittler; nachdem sie ihr Unwissen über Mr. Redsels trauriges und verfrühtes Ableben bekundet hatte, hätte kein halbwegs intelligenter Syndikatsmitarbeiter es gewagt, sie als Aktionärin weiter zu bedrängen.
Als der Mann gegangen war, setzte sie ihr Frühstück fort, obschon es ihr bald von einem hysterischen Ausbruch an einem der Nachbartische verleidet wurde. Die Nachricht von Mr. Redsels Tod hatte sich offenbar bis dorthin herumgesprochen, und Mrs. Jackmore, eine vollbusige Frau von etwa vierzig Jahren, brach in Tränen aus, während ihr blasser Gatte, ein Gebietsleiter und deutlich älter als sie, in eisigem Schweigen vor sich hin starrte. Schließlich begleitete Mrs. Jackmores Dienstmädchen ihre Herrin unter heftigem Wehklagen aus dem Speisesaal. Die anderen Passagiere gaben sich größte Mühe, ihre Belustigung oder peinliche Berührtheit zu verbergen, während Mr. Jackmore weiteraß und sich mit stoischer Entschlossenheit durch Speck, Eier und ganze vier Scheiben Toast kaute.
Da konnte wohl jemand einer zusätzlichen Übungseinheit nicht widerstehen?, fragte sie Mr. Redsels Geist und erhob sich vom Tisch, ohne ihr Frühstück zu beenden. Ich habe mich schon gefragt, ob ich Grund haben würde, mein Vorgehen zu bereuen. Jetzt kann ich es mit Gewissheit unter bedauerlich, aber notwendig verbuchen.
Sie holte die Skizzen aus ihrer Kabine und begab sich damit an den Bug. Jetzt, da sie sich in der Meerenge befanden, hatte sich die Geschwindigkeit der Schaufelräder verdreifacht. Zweifellos hatte der Blutgesegnete im Maschinenraum mindestens zwei Fläschchen Rot zu sich genommen und mit ihrer Hilfe den Motor maximal beschleunigt. Das hier war Lizannes dritte Reise durch die Meerenge, und wie jedes Mal empfand sie den Anblick des Wassers als verstörend; das Fehlen von Wellen so fern der Landmasse erschien ihr merkwürdig, und das stetige Wirbeln und Strudeln der Gezeiten hatte etwas Unheimliches. Wie ein optisches Echo der Naturgewalt, die vor zweihundert Jahren einen so großen Kanal zwischen die Barriere-Inseln getrieben hatte.
Lizanne hielt die Zeichnungen hoch und unterzog sie einer letzten Prüfung. Es war schade darum, denn sie waren wirklich gut gemacht. Aber Mr. Redsel hatte bei seinen Anstrengungen, sich eine Identität zu erschaffen, möglicherweise Spuren hinterlassen, und selbst wenn es sich bei den Entwürfen um Fälschungen handelte, könnte ihre bloße Existenz Aufsehen erregen, was es besser zu vermeiden galt. Sie in Redsels Kajüte zu lassen, hätte nur weitere Fragen aufgeworfen, in Anbetracht des erstaunlichen Zufalls, dass sich an Bord des Schiffes die Enkelin ihres mutmaßlichen Urhebers befand. Sie entfachte ein Streichholz und hielt es an die Ecken der Zeichnungen. Dann wartete sie, bis die Flammen das Papier zu zwei Dritteln verzehrt hatten, und übergab es der See.
Den größten Fehler des Fälschers habe ich Ihnen gar nicht verraten, Mr. Redsel, dachte sie bei sich und sah zu, wie die Asche in die Bugwelle des Schiffes getragen wurde und im von den Schaufelrädern aufgewirbelten Schaum verschwand. Allerdings hätte er es auch unmöglich wissen können. In Wirklichkeit hat nämlich mein Vater das ganz große Ding erfunden, als er gerade mal fünfzehn Jahre alt war. Mein Großvater hat es von ihm gestohlen. Mein Vater ist der wahre Urheber dieses wundersamen Zeitalters – ein Mann von außergewöhnlichem Genie und mit einzigartigem Weitblick, der sich jedoch kaum die Tinte für seine Entwürfe leisten kann.
Sie erlaubte ihren Gedanken, kurz zum letzten Treffen mit ihrem Vater zu schweifen. Am Tag bevor sie in Feros an Bord gegangen war, hatte sie ihn in seiner Werkstatt aufgesucht, wo er, umgeben von zahllosen neuen Erfindungen, mit ölverschmierten Händen und der Brille auf der Nase gearbeitet hatte. Sie hatte sich stets gefragt, wie das Gestell dort hielt. Bei seiner Rastlosigkeit schien das vollkommen unmöglich, und doch war es in all den Jahren nicht einmal verrutscht. Sie dachte gern an jenen Tag zurück, trotz der Worte, die sie gewechselt hatten. Du arbeitest für eine Bande von Dieben, hatte er gesagt und dabei kaum von seiner Tüftelei aufgesehen. Sie haben dich deines Geburtsrechts beraubt.
Wirklich, Vater?, erwiderte sie. Ich dachte, Großvater sei ihnen zuvorgekommen.
In den darauffolgenden Wochen machte der verletzte Ausdruck, der sich bei diesen Worten auf seinem Gesicht eingestellt hatte, ihr ziemlich zu schaffen. Er beschwor eine andere Erinnerung herauf, nämlich an den Tag des Blut-Loses, als der Erntemeister ihr mit der Pipette einen Tropfen Produkt auf die Handfläche geträufelt hatte. Im Gegensatz zu den anderen Kindern, die rings um sie heulten und brüllten, hatte sich bei ihr weder eine Verbrennung noch schwarzer Schorf gebildet. Bis zu jenem Tag hatte sie ihren Vater nie traurig erlebt, und sie hatte sich gefragt, warum er nicht lächelte, als sie die Hand hob, die bis auf einen milchweißen Fleck auf der Innenfläche unversehrt war. Schau, Vater, es hat nicht wehgetan. Da, schau!
Sie schob die Erinnerung beiseite und blickte wieder aufs Meer hinaus. Nach Süden verjüngte sich die Meerenge, und am Horizont waren die Barriere-Inseln bereits als kleine grüne Punkte zu erkennen; sie würden Kerberhafen also in weniger als zwei Tagen erreichen. Kerberhafen, dachte sie, und ein schiefes Lächeln trat auf ihre Lippen. Wo ich Wahre Liebe finden werde.
Kapitel 2
Clay
Cralmoors Faust traf Clay so wuchtig in die Seite, dass er taumelte. Clay stieß ein frustriertes Ächzen aus, als der größere Mann seinem schwerfälligen Konter auswich und ihm einen Tritt gegen die Brust verpasste. Zwar gelang es Clay, den Angriff mit überkreuzten Armen abzuwehren, doch warf ihn der Aufprall nach hinten in die Menge. Für einen Moment war die Welt ein Durcheinander aus Gerempel, Gejohle, Beleidigungen, Alkoholfahnen und nicht wenigen Hieben. Er musste sich freikämpfen und mit Fäusten und Ellbogen die betrunkenen Gesichter wegstoßen, um zurück in den Kreidekreis zu gelangen, wo Cralmoor auf ihn wartete. Der Insulaner stand mit in die Hüften gestützten Händen da, seine mit Tätowierungen bedeckte Brust hob und senkte sich kaum, und sein wissendes Grinsen entblößte strahlende Zähne. Ein Straßenschläger ist nicht automatisch auch ein guter Kämpfer, Junge, sagte das Grinsen. Du schwimmst jetzt mit den großen Fischen.
Clay widerstand dem Drang, das Grinsen zu erwidern, aus Angst, dadurch seine Zuversicht vorzeitig zu verraten. Stattdessen führte er eine Serie sorgfältig einstudierter Bewegungen aus. Tratter nannte sie die Markeva-Kombination, eine Folge von Tritten und Schlägen, die auf den ältesten und berühmtesten dalzianischen Kämpfer zurückging. Clay hatte einen Monat gebraucht, sie zu erlernen, und unter Tratters erfahrenem, gnadenlosem Blick geschwitzt, bis sein Lehrer erklärt hatte, wenn er jetzt nicht bereit sei, dann nie. »Vielleicht gewinnst du bei der Sache sogar ein bisschen Anerkennung, wenn du’s richtig anstellst«, hatte der alte Trainer mit einem anerkennenden Zwinkern gesagt.
»Ich bezahle Sie dafür, dass Sie mir den Kampf gewinnen helfen«, hatte Clay erwidert. Die Erinnerung an das herzhafte Lachen des Alten holte ihn ein, als Cralmoor jeden seiner Schläge mit Leichtigkeit abwehrte und anschließend einen schnellen, harten Treffer auf seinem rechten Auge landete, der Clay ein paar Mal blinzeln und dann zu Boden gehen ließ. Kurz bevor er aufschlug, hörte er noch den dumpfen Schlag des Gongs und war sich ebenso dumpf bewusst, dass Derk ihn zu seinem Hocker zog, wobei seine nackten Fersen eine Spur im Sand hinterließen. Er kam erst wieder vollständig zu sich, als Derk ihm einen halben Eimer Wasser über den Kopf goss.
»Ich glaube, es ist so weit«, sagte Derk und griff in die Tasche, wo sich ihre zwei Feldflaschen befanden, eine mit normalem Deckel, die andere mit einem eingeritzten Kreuz.
Doch Clay schüttelte den Kopf, sodass die Tropfen nur so von seinem kahlgeschorenen Kopf flogen. »Noch eine Runde.«
»Du stehst keine Runde mehr durch.«
»Es ist noch zu früh«, beharrte Clay und zuckte zusammen, als Derk ein Stück Stoff auf die blutende Wunde unter seinem Auge drückte. »Das war erst der dritte Gong. Keyvine wird es merken. Scheiße, sogar seine Mutter würde es merken.«
Derk warf unwillkürlich einen Blick zu der erhöhten Plattform im hinteren Teil der höhlenartigen Schenke. Jeden Venastag war Kampfnacht in der Kolonistenrast, und ihr Besitzer ließ sich keinen Wettbewerb entgehen. Keyvine saß allein auf der Plattform, eine kleine Lampe und eine Flasche Wein auf dem Tisch neben sich – eine schlanke, reglose Silhouette, die nur vom Glanz des silbernen Drachenkopfs erleuchtet wurde, der den Knauf des Gehstocks auf seinem Schoß bildete. Weder ein Leibwächter noch eine Waffe in Reichweite, dachte Clay und spürte eine lang gehegte Eifersucht in sich aufsteigen. Und trotzdem ist er der König der Klingen und Huren.
Die Eifersucht erwies sich als nützlich, denn sie befeuerte seinen Zorn und linderte den Schmerz. Er nahm einen Schluck Wasser aus der Flasche mit dem blanken Deckel und rappelte sich noch vor Ertönen des Gongs auf. Scheiß auf Markeva, dachte er und hob die Fäuste, als Cralmoor auf ihn zukam. Und Scheiß auf Tratter.
Es gab Regeln – kein Beißen und Würgen, keine Tritte in die Eier –, aber abgesehen davon waren sämtliche Arten des Blutvergießens erlaubt, solange keine Waffen zum Einsatz kamen. Allerdings hatte Clay schon immer ein besonderes Talent dafür gehabt, Worte in Waffen zu verwandeln, und er wusste, wie sehr sie verletzen oder zumindest ablenken konnten.
»Wenn ich gewinne, darf ich bei deiner Frau ran, stimmt’s?«, fragte er seinen Gegner im Plauderton und wich gerade noch einem weiteren, auf sein Auge zielenden Schlag aus. »Oder hast du einen Mann?«
»Beides«, erwiderte der Insulaner fröhlich, während er Clays linken Haken abwehrte und ihm einen schmerzhaften Hieb in die Rippen versetzte. »Und du wärst weder ihr noch ihm gewachsen.« Er trat einen Schritt zurück, schlug Clays ausgestreckten Arm beiseite und holte zu einem kreisförmigen Tritt gegen seinen Kopf aus, dem Clay nur mit Glück entging. »Nichts für ungut.«
»Stimmt, ich vergaß«, antwortete Clay, als wäre es ihm gerade erst wieder eingefallen, und versuchte es mit einer erfolglosen Dreierkombination gegen Cralmoors Kopf. »Auf Geheiß eurer Geister steckt ihr euren Schwanz in alles, was einen Puls hat.« Er musste grinsen, als sich das Gesicht des Insulaners verfinsterte. Als Ungläubiger ihre Geister zu erwähnen, war eine sichere Methode, sie auf die Palme zu bringen.
»Vorsicht, Kleiner.« Cralmoor nahm eine entschlossenere Haltung ein, und sein Blick wurde konzentrierter. »Bis jetzt bin ich behutsam mit dir umgegangen. Mr. Keyvine schuldet Braddon einen Gefallen.«
Jetzt erhitzte sich auch Clays Temperament, eine unweigerliche Reaktion auf die Erwähnung seines Onkels. »Ach ja? Dann befehlen deine Geister dir also auch, ihm den Arsch hinzuhalten …?«
Cralmoor ging zum Angriff über – zu schnell, als dass Clay hätte ausweichen können. Er rammte ihm die Schulter in den Magen und packte ihn mit beiden Armen um die Hüften. In den wenigen Sekunden, bevor Clay in die Luft gehoben und auf den Boden geschmettert wurde, hämmerte er auf seinen größeren Gegner ein. Alle Luft wich aus seinem Körper, als der Insulaner sich mit ganzem Gewicht auf ihn warf und ihm die Stirn gegen die Nase drosch. Dann richtete Cralmoor sich auf und hob die Fäuste, um erneut auf ihn einzuprügeln – ohne zu merken, dass dies ein Fehler war.
Das hier war Clay vertraut, im Gegensatz zum Ring oder einstudierten Bewegungsabläufen. Das jetzt war ein Straßenkampf, und wer kannte die Straße besser als er?
Er wand sich unter seinem Kontrahenten, schwang sein rechtes Bein herum und hakte es unter dessen linke Achsel. Dann riss er kraftvoll an, um ihn auf die Seite zu werfen. Flink wie ein Wiesel kletterte er auf seinen Gegner und versetzte ihm mit der flachen Hand einen Hieb gegen das Ohr, der in der Regel betäubend wirkte. Cralmoor stieß einen Schrei aus, und die Augen quollen ihm wegen des plötzlichen Schmerzes aus den Höhlen. Das verschaffte Clay die zwei Sekunden, die er brauchte, um mit den Knien die Schultern seines Gegners am Boden festzunageln. Seine Schläge prasselten wild auf Cralmoor ein, und seine mit Lederbändern umwickelten Fingerknöchel brannten, während der Kopf seines Kontrahenten mit jedem Aufprall zur Seite geschleudert wurde und einer seiner Wangenknochen unter lautem Krachen nachgab. Clay machte weiter, bis ihm die Arme wehtaten. Dann packte er mit einer Hand Cralmoors Kinn und holte mit der anderen zum letzten Schlag aus. Wer braucht schon die andere Feldflasche …
Cralmoors Tritt traf ihn am Hinterkopf, und Sterne explodierten vor seinen Augen. Als sie verblassten, lag er erneut auf dem Rücken, das Knie des Insulaners drückte ihm gegen den Hals, und sein Gegner starrte mit finsterem, mordlüsternem Funkeln in den Augen auf ihn herunter. Als der Gong ertönte, ließ Cralmoor nicht von ihm ab, sondern verstärkte den Druck noch. Er hörte erst auf, als ein anderes Geräusch den Lärm durchschnitt: das hohe, rhythmische Klirren von Metall auf Glas.
Als Cralmoor Clay freigab und sich zu Keyvines im Dunkeln liegender Plattform umwandte, zog Clay rasselnd Luft in die Lunge. Der König der Klingen und Huren klopfte mit dem silbernen Drachenkopfknauf seines Gehstocks ruhig, aber nachdrücklich gegen die Weinflasche. Der Insulaner atmete tief durch und warf Clay einen letzten Blick zu, ehe er zu seinem Hocker zurückstolzierte, ein finsteres Versprechen in seinem blutigen, entstellten Gesicht.
Derk musste Clay mehr oder weniger in seine Ecke tragen und ihn stützen, damit er nicht umfiel, als er ihm die Feldflasche an die Lippen setzte, diesmal die mit dem Kreuz. »Jetzt?«, fragte er mit einem schiefen Grinsen. Clay fasste die Flasche mit beiden Händen und stürzte den Inhalt hinunter. Obwohl das Produkt stark und unsachgemäß verdünnt war, hinterließ es das verräterische Brennen auf der Zunge, gefolgt von dem Kribbeln, das mit dem Konsum von Schwarz einherging und sich anfühlte wie ein Hornissenschwarm in der Brust.
Obwohl jeder Blutgesegnete von allen vier Produktarten Gebrauch machen konnte, unterschieden sich die Fertigkeiten im Umgang mit den einzelnen Sorten erheblich. Die meisten kamen am besten mit Grün zurecht und waren dank der gesteigerten Kraft und Geschwindigkeit, die es verlieh, vor allem als Elitearbeiter und Schauerleute gefragt. Andere wiederum waren besonders begabt im Umgang mit Rot und erzielten in der Regel ein lukratives Einkommen in den Maschinenräumen ausgewählter Unternehmensschiffe, wo sie mit den von ihnen erzeugten Flammen das Produkt in den Blutverbrennungsmotoren befeuerten. Nur wenige waren in den Geheimnissen der Blau-Trance ausreichend bewandert, um einen Vertrag auf Lebenszeit in einem der Unternehmenshauptquartiere zu bekommen, wo sie in Minuten statt Monaten Mitteilungen in die ganze Welt schickten. Und noch weniger teilten Clays Begabung in der Nutzbarmachung von Schwarz, eine Fertigkeit, die bei den abergläubischen Dalzianern »die unsichtbare Hand« hieß. Allerdings war diese Gabe ausgesprochen frustrierend, denn Schwarz war von allen Produktsorten mit Abstand am teuersten und für einen Mann von Clays Stellung – sofern man in seinem Fall überhaupt von Stellung sprechen konnte – nicht leicht zu beschaffen. Die Feldflasche hatte kaum einen Fingerhut voll enthalten, was dem Diebesgut von zwei Monaten entsprach. Während er Cralmoor mit mörderischem Glitzern in den Augen und angespannten Muskeln am Rand des Rings auf und ab laufen sah, fragte Clay sich zum ersten Mal, ob es reichen würde. Der Gong hatte kaum geläutet, da stürzte Cralmoor sich schon auf ihn. Das Brüllen der Menge schwoll an, denn jetzt ging es auf Leben und Tod, ein seltenes aber äußerst beliebtes Vergnügen für jene, die zu den verbotenen Kämpfen kamen. Clay nahm Abwehrhaltung ein und ließ zu, dass der erste Schlag traf, allerdings schwächte er ihn mithilfe einer winzigen Menge Schwarz ab, indem er Cralmoors Faust abbremste, bevor sie ihn erreichte. Er stieß einen überzeugenden Schmerzensschrei aus und sprang zurück, sodass der zweite Hieb an seinem Ohr vorbeipfiff. Mit wütendem Knurren ging der Insulaner erneut zum Angriff über. Clay gestattete ihm einen weiteren Treffer, minderte jedoch den Aufprall, damit sie beide auf den Beinen blieben. Sie rangen miteinander und wirbelten wahnsinnigen Tänzern gleich durch den Ring, und Cralmoor schimpfte in einer Stammessprache auf ihn ein. Der Insulaner landete mehrere Treffer in Clays Magengrube, die alle das Schwarz in seinen Adern verringerten. Nicht mehr lange, und es würde ganz verbraucht sein. Clay löste sich aus dem Clinch, zog sich zurück und täuschte einen linken Haken gegen Cralmoors Kopf an. Dann duckte er sich unter dessen Konter weg und visierte den rechten Fuß seines Gegners an. Es war nur ein kleiner Schubser, der leicht für einen Ausrutscher gehalten werden konnte, aber ausreichte, um den Insulaner aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn für einen Augenblick seine Deckung vergessen zu lassen. Clay ließ alles verbliebene Schwarz in den Schlag fließen, konzentrierte sich auf die Stelle, wo seine Faust Cralmoors Kiefer traf, und spürte den Knochen unter dem Aufprall bersten. Der Insulaner wirbelte herum, aus seinem Mund spritzte Blut in die Menge. Die Zuschauer verstummten, als er schwankend und mit abwesendem Blick durch den Ring taumelte, sich jedoch weiterhin aufrecht hielt.
»Scheiße«, murmelte Clay, sprang auf Cralmoors Rücken und schlang ihm die Beine um den Oberkörper. Sein Gewicht reichte aus, um den Insulaner endlich zu Boden zu werfen, wo er weiterkämpfte, mit den Ellbogen wild um sich schlug und den Kopf hin und her riss, weil sein Kampfinstinkt ihm nicht erlaubte, sich zu ergeben. Es dauerte noch eine Weile, vielleicht drei Minuten, in denen Clay auf ihn einprügelte und seinen Kopf gegen den Boden schmetterte, bis Lemuel Cralmoor, Champion des Kreiderings und der gefürchtetste Preiskämpfer in Kerberhafen, bewusstlos liegen blieb. Die Menge buhte sich heiser.
•••
»Dreitausendsechshundertundzweiundachtzig in Interimsscheinen«, sagte Derk und rollte das Bündel zu einem hübschen Zylinder. »Plus vierhundert in Wechseln und verschiedene Wertgegenstände.«
Clay grinste und zog scharf die Luft ein, als Joya erneut die Nadel durch seine Wunde führte. »Und was kosten drei Fahrscheine nach Feros?«, fragte er.
»Fünfzehnhundert. Ein Preis, dem langwierige Verhandlungen vorausgegangen sind, wie du mir glauben kannst.« Derk lehnte sich von dem schwer mit Geld beladenen Tisch zurück, das attraktive Gesicht eher nachdenklich als fröhlich. »Wir haben es geschafft. Nach all den harten Jahren geht es endlich aufwärts.«
»Das glaube ich erst, wenn wir in Feros an Land gehen«, entgegnete Joya, trennte den Faden und wischte Clay das getrocknete Blut aus dem Gesicht. »Und keine Sekunde vorher.«
Als Clay sich im Bett aufsetzte, hielt sie ihm einen Becher hin. Er schnupperte an dem leicht säuerlich riechenden Inhalt. »Grün?«
»Sechs Tropfen. Alles, was noch da war.«
Mit einem Kopfschütteln stellte er den Becher zur Seite. »Dann heben wir es besser auf.«
»Du musst gesund werden.«
»Ist nicht so schlimm«, stöhnte er und spürte jeden von Cralmoors Schlägen, als er sich aus dem Bett hievte. »Wie du selbst sagst: Noch sind wir nicht in Sicherheit. Sollten wir auf dem Weg zum Hafen in eine brenzlige Situation geraten, sind wir für ein paar Tropfen Grün dankbar.«
»Ich kann auch losgehen und uns welches kaufen«, bot Derk an. »Hier in der Gegend gibt es ein halbes Dutzend Händler.«
»Nein.« Clay ging zum Fenster. Es war sorgfältig mit Brettern vernagelt, damit der Schein ihrer Lampe nicht nach draußen drang, aber Derk hatte ein kleines Guckloch gebohrt, als Vorsichtsmaßnahme. Clay blickte auf das Labyrinth aus Straßen und Gassen hinab, sah oder hörte jedoch nichts Verdächtiges. Wie es sich für die frühen Morgenstunden gehörte, herrschte im Blinden Viertel eine kurze Waffenruhe, bevor am Hafen die ersten Hörner dröhnten und der tägliche Krieg von vorne begann. Bevor die Huren, Diebe, Händler, Falschspieler und ein Dutzend anderer altehrwürdiger Berufe sich nach den Exzessen der letzten Nacht erhoben, um alles wieder von vorn zu tun und sich dabei zu fragen, ob der heutige Tag wohl die letzte Schlacht bringen würde – oder um vielleicht sogar darauf zu hoffen.
»Nein«, sagte er noch einmal. »Wir bleiben die nächsten zwei Tage unsichtbar. Wenn wir Keyvine an unsere Existenz erinnern, schaltet sich vielleicht noch sein scharfer Verstand ein. Und das wäre nicht gut für uns.«
Sie hatten sich im Turm der alten Seherkirche in der Zapferstraße verschanzt. Dies war ihr geheimstes und bestes Versteck, und sie griffen nur in Notfällen darauf zurück. Etliche Schauergeschichten rankten sich um diesen Ort, die meisten davon handelten vom Geist des bleichäugigen Priesters, der angeblich hier umging. Einer jahrhundertealten Legende zufolge hatte er im Keller ein Dutzend oder mehr Huren ermordet und anschließend zerstückelt, um ihre Leichen zu Puppen zu verarbeiten. Seine Beweggründe waren nach wie vor unbekannt und Thema unzähliger abartiger Spekulationen. Clay bezweifelte, dass es den Priester je gegeben hatte, doch einige der älteren Einwohner des Blinden Viertels schworen Stein und Bein, dass das Ganze wirklich so vorgefallen war. Wie dem auch sei, die alte Geistergeschichte hielt unerwünschte Besucher erfolgreich fern, denn nicht einmal die verzweifeltsten obdachlosen Säufer wagten sich in die Nähe der Kirche. Die Treppe schien auf den ersten Blick halb verrottet, allerdings hatten Clay und Derk im Laufe der Jahre einige Reparaturen daran vorgenommen, die zwar von außen nicht erkennbar waren, jedoch für genug Stabilität sorgten, um ein schnelles Erklimmen zu ermöglichen, sofern man die Füße richtig zu setzen wusste. Sie bewahrten eine kleine Menge Interimsscheine und verschiedene Vorräte im Turm auf, hielten sich aber ansonsten davon fern, um nicht zu sehr mit dem Ort in Verbindung gebracht zu werden. Was den bleichäugigen Priester anging, so hatte Clay nie auch nur die geringste Spur von dem verrückten Spinner gesehen.