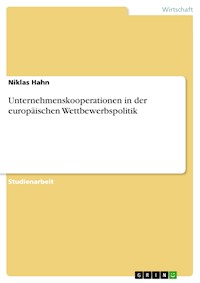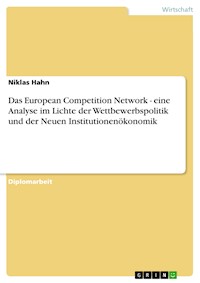
Das European Competition Network - eine Analyse im Lichte der Wettbewerbspolitik und der Neuen Institutionenökonomik E-Book
Niklas Hahn
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Note: 2,0, Universität Münster (Institut für Genossenschaftswesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Seit dem 01. Mai. 2004 arbeiten die nationalen Wettbewerbsbehörden und die Europäische Kommission (EK) in Fragen des Kartellrechts zusammen. Die Zusammenarbeit im Rahmen des European Competition Network (ECN) soll den geänderten Rahmenbedingungen des europäischen Binnenmarkts zukünftig Rechnung tragen. Diese Kooperation der Behörden soll dabei effizienter und gebündelter gegen transnationale Kartelle vorgehen. Zu demselben Zeitpunkt ist die neue Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Europäischen Rates in Kraft getreten. Die Verordnung, die im Dezember 2002 durch den Europäischen Rat verabschiedet wurde, bestimmt die Durchsetzung der in den Artikeln 81 und 82 des EG-Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln. Die vorherigen kartellrechtlichen Regeln führten im zunehmend integrierten und wachsenden Europa vermehrt zu Koordinationsproblemen zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union (EU). Die fortschreitende Globalisierung und die ökonomischen sowie sozialen Verflechtungen der verschiedenen Märkte innerhalb der EU, aber auch weltweit, haben eine solche Anpassung erforderlich gemacht. Die Erweiterung der EU um zehn Mitgliedsstaaten, ebenfalls zum 1. Mai 2004, macht diese Notwendigkeit unmittelbar deutlich. Dies stellt die EU auf der einen Seite vor eine Vielzahl an Herausforderungen, die sie bewältigen muss. Auf der anderen Seite bedeutet die EU-Erweiterung vor allem aber eine Chance für die Wirtschaftskraft der EU, sofern es gelingt, ein stabiles Wirtschaftswachstum als Grundlage für Wohlfahrtssteigerungen der gesamten Bevölkerung dieser Gemeinschaft zu schaffen. Der Erfolg eines stabilen Wachstums liegt in erster Linie in einer effizienten Koordination aller Wettbewerbsfragen, die den europäischen Binnenmarkt betreffen, begründet. Besonders die Möglichkeit einzelner Wirtschaftsobjekte, den transnationalen Handel durch Absprachen zu verfälschen oder zu hindern, gilt es dabei zu unterbinden. Dies impliziert, dass der ökonomische Wandel in der EU unmittelbar auch einen erfolgreichen institutionellen Wechsel notwendig macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 4
Page 5
Page 1
- 1 -1.Einleitung
Seit dem 01. Mai. 2004 arbeiten die nationalen Wettbewerbsbehörden und die Europäische Kommission1(EK) in Fragen des Kartellrechts zusammen. Die Zusammenarbeit im Rahmen desEuropean Competition Network(ECN) soll den geänderten Rahmenbedingungen des europäischen Binnenmarkts zukünftig Rechnung tragen. Diese Kooperation der Behörden soll dabei effizienter und gebündelter gegen transnationale Kartelle vorgehen.
Zu demselben Zeitpunkt ist die neue Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Europäischen Rates in Kraft getreten.2Die Verordnung, die im Dezember 2002 durch den Europäischen Rat3verabschiedet wurde, bestimmt die Durchsetzung der in den Artikeln 81 und 82 des EG-Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln.4Die vorherigen kartellrechtlichen Regeln führten im zunehmend integrierten und wachsenden Europa vermehrt zu Koordinationsproblemen zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union (EU).5Die fortschreitende Globalisierung und die ökonomische n sowie soziale n Verflechtungen der verschiedenen Märkte innerhalb der EU, aber auch weltweit, haben eine solche Anpassung erforderlich gemacht.6Die Erweiterung der EU um zehn Mitgliedsstaaten, ebenfalls zum 1. Mai 2004, macht diese Notwendigkeit unmittelbar deutlich. Dies stellt die EU auf der einen Seite vor eine Vielzahl an Herausforderungen, die sie bewältigen muss. A uf der anderen Seite bedeutet die EU-Erweiterung vor allem aber eine Chance für die Wirtschaftskraft der EU, sofern es gelingt, ein stabiles Wirtschaftswachstum als Grundlage für Wohlfahrtssteigerungen der gesamten Bevölkerung dieser Gemeinschaft zu schaffen. Der Erfolg eines stabilen Wachstums liegt in
1Die Europäische Kommission ist die Regierung der Europäischen Union und ist für die
Umsetzung der Verträge zuständig.
2Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1/2003, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L1/1
vom 04.01.2003.
3Der Europäische Rat ist das oberste Gremium der Europäischen Union. Er setzt sich aus
Staats- und Regierungschefs sowie dem Präsidenten der Europäischen Kommission und
den Außenministern zusammen.
4Vgl. Art. 81, 82 EG-Vertrag.
5Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss 25 europäischer Staaten als
Staatenverbund.
6Vgl. Herdegen, M. (2003), S. 74 f.
Page 2
Wirtschaftsraumes führte dazu, dass sich die Aufgaben der nationalen und europäischen Wettbewerbsinstitutionen oft überschnitten, was
Kompetenzstreitigkeiten und Parallelbearbeitungen verursachte. Mit der Installation des ECN und der VO 1/2003 haben die Vertreter der Mitgliedsstaaten7eine Rechtsordnung vorgelegt, die den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen der EU besser begegnen und existierende Probleme beheben sollen.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, das ECN als institutionellen Lösungsansatz der europäischen Wettbewerbspolitik für die genannten Probleme, zu analysieren. Die Analyse versucht dabei heraus zufinden, ob das ECN aus wettbewerbspolitischer Sicht sowie im Rahmen der Neuen Institut ionenökonomik8eine effiziente und zukunftsfähige Wahl im Kampf gegen europaweite Kartelle sein kann.
7Eine komplette Liste der europäischen Mitgliedsländer findet man hier:
http://europa.eu.int/abc/index_de.htm.
8Vgl. Richter, R./Furubotn, E. (1999), S. 1 ff.
Page 3
Wirkungsmechanismus aus Sicht der Wettbewerbspolitik und Neuen Institutionenökonomik detailliert untersucht. Das fünfte Kapitel wird eine Zusammenfassung der gesammelten ökonomischen Erkenntnisse liefern und das ECN aus der Sicht der Wettbewerbspolitik und NIÖ bewerten.
2. Die europäische Wettbewerbspolitik
Für das Verständnis im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird zunächst ein grundlegender Rückblick über die wettbewerbspolitischen Regelungen der EU bis zum Inkrafttreten der VO 1/2003 ge geben. Dies ist erforderlich, um die daraus entstandenen Probleme der wettbewerbspolitische n Praxis innerhalb der EU zu verdeutlichen. Zugleich soll hieraus hervorgehend die Notwendigkeit einer kartellrechtlichen sowie auch institutionellen Neugestaltung der europäischen Wettbewerbspolitik aufge zeigt werden. Zunächst werden hier jedoch nur die w esentlichen Eckpunkte der europäischen Wettbewerbspolitik dargestellt. Schwerpunkt der Arbeit sind die institutionellen Neuerungen der VO 1/2003, und die Zusammenarbeit der europäischen Wettbewerbsbehörden.
9Vgl. EWG-Vertrag vom 25.03.1957, Rom.
Page 4
Eine grenzüberschreitende Wettbewerbspolitik innerhalb der EU ist für einen funktionsfähigen Wettbewerb und einen uneingeschränkten europäischen Binnenmarkt unentbehrlich.10Das Ziel grenzüberschreitender und integrierter Märkte ohne Binnengrenzen bestand im Kern schon zu Zeiten der Gründung der EU11. Daneben ist es das primäre Ziel der EU die Wohlfahrt aller Europäer zu erhöhen. Freier Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr innerhalb der Union sollten dies sicherstellen.12Der mittlerweile weit fortgeschrittene Wandel der Marktstrukturen, von nationalen Märkten hin zu transnationalen Binnenmärkten, erfordert entsprechend ein Umdenken im Bereich der Wettbewerbspolitik. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Wettbewerbsintensität der vereinten Märkte, sehen sich Unternehmen zunehmend gezwungen, auf europäischer aber auch internationaler Ebene mit anderen Unternehmen Kooperationen zu schließen. Die Unternehmen müssen solche Partnerschaften eingehen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Konkurrenz zu bewahren bzw. um überhaupt im Markt bestehen zu können.13
Die Wettbewerbspolitik darf bei der Analyse relevanter Märkte14an den Grenzen vo n Staaten nicht Halt machen. Vielmehr muss sie die tatsächlich relevanten Märkte europaweit lokalisieren u nd zusammenhängend wettbewerbspolitisch bewerten. Nur so lassen sich die Chancen von Kooperationen richtig erfassen und Gefahren von A bsprachen nachhaltig verhindern.
Daher ist es richtig und konsequent, dass die EU diesen Weg schon früh eingeschlagen hat, und bereits mit dem EWG-Vertrag von 1957 eine Wettbewerbspolitik geplant hat, die den gesamten europäischen Markt inklusive aller Mitgliedsstaaten erfassen und bewerten soll. So kann sichergestellt werden, dass kartellrechtlich relevantes Verhalten generell in der gesamten EU berücksichtigt werden soll.
10Vgl. Kerber, W. (2003), S. 306 ff.
11Vgl. EGKS, 18.04.1951, Paris; EWG 25.03.1957, Rom.
12Vgl. Herdegen, M. (2003), S. 103.
13Vgl. Böge, U. (2003a), S. 5 f.
14Vgl. Schmidt, I. (2001), S. 49 f., vgl. Herdzina, K. (1999), S. 73 f.