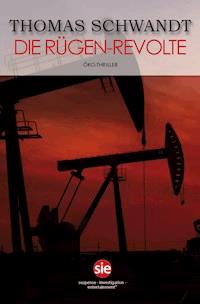Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Schwedenfähre „Mecklenburg“ nimmt während des traditionellen Großsegler-Treffens 2018 in Rostock ungewöhnlich Kurs auf den Stadthafen. Ein Coup zu Ehren der Hansestadt, die in jenem Jahr ihr 800-jähriges Stadtjubiläum feiert? Die Fähre rammt in voller Fahrt das Festgelände, eine gewaltige Detonation zerreißt die maritime Idylle. Mehr als 1000 Menschen sterben. Der monströse Anschlag scheint dem Muster von Terrorattacken zu folgen. Aber es ist alles anders. Von Rostock soll ein Fanal ausgehen, von dem Sicherheitskreise wussten – und es geschehen ließen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Schwandt
Das Fanal – Terrorschiffaus Trelleborg
Thomas Schwandt
Das Fanal – Terrorschiff aus Trelleborg
T·H·R·I ·L·L·E·R
swb media publishing
Die Handlung und die handelnden Personen sind frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden und bereits verstorbenen Personen ist zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist unzulässig und strafbar.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2017
ISBN 978-3-946686-25-5
© 2017 swb media publishing, Gewerbestraße 2, 71332 Waiblingen
Lektorat: Ole Becker
Titelgestaltung: Dieter Borrmann
Titelfotoanimation: © Dieter Borrmann
Satz: swb media publishing
Druck, Verarbeitung: Rosch-Buch, Scheßlitz
Für den Druck des Buches wurde chlor- und säurefreies Papier verwendet.
www.suedwestbuch.de
Das Verhängnis nistet unter einer dünnen Schicht
Kapitel 1
Der Bug des großen Schiffes wuchs bedrohlich aus dem Wasser. Er schob auf der bleiernden Warnow eine hohe Welle vor sich her. Das bräunlich-grüne Flusswasser wurde an dem Stahl des Vorschiffs nach oben gedrückt, schlug kurz darauf über und fiel auf die nachdrängende Wasserwulst zurück. Der Tanz der wirbelnden Gischt vor dem Bug der „Mecklenburg“ wurde hektischer. Das Fährschiff verringerte seine Geschwindigkeit nicht. Es hielt direkt auf die Haedge-Halbinsel zu. Vielleicht 70 Meter trennten das Schiff vom nördlichen Kai der Halbinsel, die in einem länglichen Rechteck in die Warnow ragte und den Vorposten des Rostocker Stadthafens bildete.
Auf dem Areal drängten sich am 11. August 2018 tausende Besucher der Hanse Sail. Der Sonnabend des alljährlichen, vier Tage währenden Stelldicheins von Windjammern und Traditionsbooten war stets gefühlter Höhepunkt des Schiffegucken-Spektakels. Mit dem anbrechenden Morgen zog es Scharren von Menschen aus der Hansestadt, aus dem Umland und von sonstwoher an die Warnow. Am späten Vormittag gab es kaum noch ein Durchkommen auf der zu schmal gehaltenen Flaniermeile zwischen dem Fluss auf der einen Seite und den aufgereihten Verkaufsständen für Folklore, Hausmannskost und Naschereien, den bunten Los- und Schießbuden und den provisorischen Cocktail- und Südseebars auf der anderen Seite. An dem langen Kai hatten mehrere Segelschiffe, zumeist Schoner, Briggs und Brigantinen, festgemacht. Sie rüsteten zur Ausfahrt.
An der Nordkante der Haedge-Halbinsel lagen aneinander gebunden zwei graue Schnellboote. Deren Bordgeschütze auf dem Vorschiff waren unfreiwillig auf die Stadt gerichtet. Die Deutsche Marine lud zum Open-Ship auf die ungemütlichen Kriegsschiffe. Der kalte Stahl entfaltete magnetische Wirkung. An der Gangway stoppte der Wachhabende von Zeit zu Zeit den Andrang, um die Boote nicht von Menschen volllaufen zu lassen.
Mitten auf der Halbinsel buhlte eine Showbühne um die Gunst der wandelnden Sail-Besucher. Shanty-Schunkelmusik schallte aus den Verstärkerboxen. Sie wehte bis zum anderen Warnow-Ufer hinüber. Unweit des fragilen Bühnenkonstrukts überspannte der robuste alte Haedge-Brückenkran die Halbinsel in ihrer ganzen Breite. Auf der Laufschiene in luftiger Höhe thronte das Maschinen- und Führerhaus des Krans. Der hoch angestellte Ausleger zeigte gen Norden. Im Sonnenlicht von Osten her strahlte satt das Dunkelblau des Industriedenkmals. Ein Rostocker Bierhersteller hatte die kräftigen Streben der Konstruktion mit einem riesigen Werbetuch verhangen, auf dem die Brauerei sich und der Hansestadt zuprostete. Rostock feierte in diesem Sommer 2018 ausgiebig den 800. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung. Die Ziffern des Jubiläums prangten weithin sichtbar auf der Bierwerbung.
Im morgendlichen Schatten des Krans überragte ein anderes stählernes Monstrum alles. Das Riesenrad der Hanse Sail. Einen Steinwurf dicht an der Wasserkante lud es die herbeiströmenden Menschen ein, sich aufzuschwingen in schwindelnde Höhe. Mit jedem Meter, den die Gondeln im Halbbogen gen Himmel fuhren, schrumpften der eben noch gewaltige Brückenkran und die grauen Schnellboote zu winzigen Objekten. Das Spielzeugformat nahm ihnen das Bedrohliche schierer Größe und militärischer Pose. Ganz oben versöhnte die Aussicht auf das weite und schöne Küstenland die Menschen mit der Welt. Ganz unten verschwammen die Wandelnden und Wartenden zu einem buntgetupften Bild. Jeder Kopf ein Pixel.
Anders als sonst starrten in dieser Vormittagsstunde des 11. August 2018 die Besucher unten nicht staunend zu den Gondeln hinauf. Warfen nicht fasziniert von der Himmelsnähe die Köpfe in den Nacken. Sie hatten sich abgewendet. Irgendeinem Impuls folgend, der wellenartig durch die Massen lief. Die abrupte Abkehr von der Attraktion Riesenrad signalisierte eine kollektive Beunruhigung. Eine andere Überdimension konfrontierte die Menschen unvermittelt mit der physischen Mickrigkeit und Verletzlichkeit ihres Daseins. In den Augen spiegelte sich kindliches Überraschtsein. Die anfängliche natürliche Hoffnung auf etwas Gutes und Schönes unterdrückte die instinktive Urangst.
Ein großes Schiff steuerte auf die Haedge-Halbinsel zu. Friedlich sah es aus und drang doch ein in die maritime Idylle ringsum. Oberhalb des kurzen Bugs der „Mecklenburg“ stand eine weiß leuchtende Wand. Den breiten haushohen Schiffsaufbau begrenzte eine endlose Glasfensterreihe. Die Kommandobrücke. Sie ragte beidseitig gut eineinhalb Meter über die Bordwände hinaus. Die Glasfront erinnerte an ein Panorama-Café. Die Fähre der Reederei Swedish-Lines war keine Unbekannte auf der Warnow. Die Silhouette des Schiffes prägten zwei markante blaue Schornsteine. Designt waren sie als flache Trapeze. Sie bildeten parallel angeordnet auf dem Hinterschiff den Abschluss der Decksaufbauten. Seit zwei Jahrzehnten pendelte die „Mecklenburg“ im Gegenlauf mit dem Schwesterschiff „Schonen“ zwischen Rostock und dem südschwedischen Hafen Trelleborg. Die Route gehörte zu den Ostsee-Fährlinien, auf denen neben Pkw, Lkw und Bussen auch Eisenbahnwaggons über das Meer transportiert wurden. Doch das schwimmende Gleisbett blieb immer häufiger verwaist. Die meisten Züge zwischen Deutschland und Schweden rollten via Dänemark über die festen Querungen am Großen Belt und am Öresund. Die Gleise im Waggondeck der „Mecklenburg“ waren an diesem Augustmorgen ausnahmslos mit Lkw zugestellt. Im Turnus hätte das Fährschiff längst am Warnow-Kai des Seehafens Rostock festgemacht haben und seiner Ladung entledigt werden müssen. Stattdessen kreuzte es im Stadthafen auf.
Die Irritierten auf der Haedge-Halbinsel suchten hektisch nach einer plausiblen Erklärung. Das große Schiff drehte nicht bei, die Wand mit dem Panorama-Café schob sich näher heran. Hatte sich Swedish-Lines einen Coup einfallen lassen? Sollte mit der Fähre zur schönsten Sail-Stunde der 800-jährigen Hansestadt die Reverenz erwiesen werden? Spektakulär und zum Vergnügen und Staunen der schaulustigen Masse. Die Gedanken zimmerten nicht weiter an einer Antwort. Der Bug des Schiffes hatte die Distanz einer ungefährlich anmutenden Vorbeifahrt unterschritten. In der Ferne erscheint eine Tsunami-Welle dem Ahnungslosen am Strand als faszinierendes Naturschauspiel. Weit weg vom Gefühl der Bedrohung. Die tödliche Gewalt dringt erst in den trägen Verstand, wenn es zu spät ist. Vom tonnenschweren Stahl eines Schiffsrumpfes geht für gewöhnlich keine Beängstigung aus. Doch die „Mecklenburg“ war binnen weniger Augenblicke der Kaimauer so nahe gerückt, dass sich der angstbeladene Begriff Kollision ins Gehirn stanzte. Die Kollision würde im nächsten Moment geschehen, sie ist unabwendbar geworden. Die Springflut von Adrenalin sorgte für Klarheit im Kopf. Gleich stürzte der Himmel ein.
Das Vorschiff der „Mecklenburg“ bohrte sich direkt hinter den beiden Hecks der Marine-Schnellboote in den Nordkai der Haedge-Halbinsel. Die Boote wurden vom Rumpf der Fähre weggedrückt, so dass sich die dicken Taue, die sie achtern an der Kaimauer festhielten, bis zum Äußersten spannten. Der Zustand überdauerte nur den Bruchteil einer Sekunde. Eines nach dem anderen zerriss unter extremen Zug. Wie Peitschenhiebe schnellten die Seilenden auseinander und schlugen auf alles zerstörend ein, was ihnen auf ihrer Bahn in die Quere kam. An Bord der Boote erwischte es einige Besucher, die unglücklicherweise bereits bis zur Reling auf dem Achterschiff vorgedrungen waren. Die Körper, von einer ungeheuren Kraft getroffen, wurden an die grauen Schiffsaufbauten geschleudert und sackten leblos zusammen.
Ein wachhabender Oberstabsgefreiter hockte auf einer Kiste, von wo er den Besucherstrom beobachten sollte. Er war erstarrt sitzengeblieben. Die von der „Mecklenburg“ plötzlich und unwirklich hereinbrechende Gefahr lähmte ihn. Er konnte den Gedanken nicht zu Ende denken. Eines der energiegeladenen Taue säbelte seinen Kopf von den Schultern. Mit entgeistertem Blick und aufgerissenem Mund kullerte der abgetrennte Kopf wenige Meter über das Deck und plumpste in die Warnow. Die entsetzlichen Schreie zweier älterer Frauen, die der Peitschenhieb nicht erreicht hatte und die alles aus nächster Nähe mitansehen mussten, gingen unter in einem ohrenbetäubenden Lärm, welcher sich über die Halbinsel ergoss.
Der Bug der „Mecklenburg“ kerbte sich tief ein in die verwitterte Kaimauer. Der ungebremste Aufprall tausender Tonnen Schiffsmasse samt Ladung ließ die Haedge-Halbinsel erzittern, jagte erdbebenartig eine gewaltige Druckwelle durch den Untergrund. Den Menschen riss es den Boden unter den Füßen weg, viele stürzten. Endlos lange hielten sich das Ächzen des zerberstenden Betons und das Kreischen des eindringenden Schiffsstahls in der Luft. Beides verstummte auf Schlag, als die „Mecklenburg“ in ihrer Fahrt voraus gestoppt und verkeilt zum Stillstand gekommen war. Im gleichen Moment erhob sich ein anderes, nicht minder bedrohliches überlautes Geräusch. Die acht Stützstreben, auf denen die Achse des Riesenrades lagerte, waren durch die Druckwelle angehoben worden. Nur für den Bruchteil einer Sekunde. Dieser genügte, um das gesamte Konstrukt aus dem Gleichgewicht zu werfen. In der Höhe neigte sich das Rad in Richtung des zwei Dutzend Meter entfernten alten Hafen-Brückenkrans. Der Neigungswinkel erreichte einen so weiten Ausschlag, dass es kein Zurück mehr gab. Das Riesenrad kippte um.
In der von den Konstrukteuren nicht vorgesehenen Querbewegung zum vertikalen Rundlauf schwangen die Gondeln wie ein Pendel aus. Sie lösten sich aus den Halterungen und stürzten in die Tiefe. Die meisten Gondeln waren an diesem klaren Vormittag, der eine exzellente Sicht auf die Stadt und ihre Umgebung verhieß, besetzt. Menschen fielen beim Absturz heraus und klatschten auf den staubigen harten Boden des Festgeländes. Einige durchschlugen die dünnen Abdeckungen von Imbissbuden und provisorischen Cocktailbars. Die losgerissenen schweren Gondeln krachten wie Bomben ohne Sprengladung vom Himmel. In der Wucht des Aufpralls blieb nichts unzerstört. Menschen verloren auf eine wenige Augenblicke zuvor für undenkbar gehaltene skurrile Art und Weise ihr Leben.
Vielen der zufällig Verschonten blieb keine Zeit zum Entsetzen, zur Schockstarre. Der Tod bemächtigte sich ihrer nur Sekunden später. Das Riesenrad traf laut berstend auf den nahen Haedge-Brückenkran. Dessen breite Kranbahn wirkte in diesem Moment wie eine übergroße Abschlagkante. Das stabile Stahlkonstrukt hielt dem fallenden Koloss stand. Die obere Hälfte des Riesenrades knickte hinter dem Brückenkran ab und zerrte das Maschinen- und Führerhaus samt Ausleger mit zu Boden. Allen Trubel diesseits unter sich begrabend. Als der Stahl sich gelegt hatte, ergriff die unverletzt gebliebenen Besucher heillose Panik. Nichts wie weg von dem unfassbaren Geschehen, bloß runter von der Haedge-Halbinsel, die zu drei Seiten von Wasser umschlossen war. Hier und da sprangen Sail-Gäste irrational getrieben in die Warnow. Andere wurden von der fliehenden Menge über die Kaikante abgedrängt. Wer stolperte und fiel, für den gab es keine Gnade. In Todesangst walzten die anderen Menschen wie eine entfesselte Horde wilder Stiere über die am Boden liegenden hinweg. Jedes geringste Erheben wurde im Ansatz vielfüßig niedergetrampelt. Arme und Beine brachen, verdrehten sich anormal wie die ungelenken Gliedmaßen einer Marionette. Eingedrückte Brustkörbe quetschten den Atem ab. Tritte malträtierten bereits zertrümmerte Schädel, warfen sie hin und her. Binnen weniger Sekunden wandelten sich sommerlich leicht bekleidete Körper in Klumpen aus Textilien und organischer Masse, übersät von Hämatomen und Blutschmieren.
Die Entfesselten rannten auf die Menschen zu, die in genügend weitem Abstand vor der Haedge-Halbinsel innegehalten hatten und fassungslos und neugierig den Katastrophenfilm ansahen. Ein Dutzend Smartphones standen in der Luft. Sie speicherten die Fährschiff-Kollision, den Riesenrad-Crash und den Totentanz für das Volk der nimmersatten Voyeure. Die ersten Fliehenden tauchten ein in das verbliebene heile Bild der Sail. Sie atmeten auf, fühlten einem Albtraum entkommen zu sein. Ihre entgeisterten Blicke, ihre demolierten Körper katapultierten die Schaulustigen aus dem Film in die dreckige Realität. Wildfremde Menschen fielen sich in die Arme, gegenseitig Halt suchend. Aneinandergepresst starrten sie zur Halbinsel hin, von wo das Trampeln, Stampfen, Stöhnen und Schreien zu versiegen begann. Wo der aufgewirbelte Staub sich allmählich lichtete. Wo sich vor dem durchsickernden Blau des Himmels die brachiale Zerstörung in scharfen Konturen abzeichnete. Das auf dem Brückenkran zerschellte Riesenrad mutete an, als hätte es vor dem ungetümen Fährschiff fliehen wollen und wäre schon beim ersten Schritt gestolpert. Die „Mecklenburg“ saß ihm auf den Fersen, fest und bewegungsunfähig.
Es war nicht zu Ende. Der Himmel stürzte ein zweites Mal ein. Wie in einer Inszenierung schien die Explosion den Augenblick von Stille abgewartet zu haben, der sich im Abspann des Grauens über die Halbinsel gesenkt hatte. Urplötzlich zerriss eine ungeheure Detonation das Vorschiff der „Mecklenburg“, verstümmelte den mächtigen Schiffskörper. Die Druckwelle fegte zu allen Seiten das Jetzt hinweg. Die Fähre zuckte, ähnlich dem Korpus eines gestrandeten Wals, aus dem das letzte Lebenszeichen entwich. Reihenweise knickten die Masten um auf den Segelschiffen, die an der Haedge-Halbinsel vertäut lagen. Kleinere Boote auf der Marina-Seite wurden aus dem Wasser emporgewirbelt und schlugen auf der Strandpromenade zwischen Hafen-Brauhaus und Hafenterrassen auf. Zwei, drei leichtere Exemplare segelten bis zur nahen Durchgangsstraße, dem Warnowufer, und krachten in den Autostau, der sich in den Minuten zuvor gebildet hatte. Als wären sie die Protagonisten eines Massendominos stürzten die von der Halbinsel drängenden Menschen um. Die Buden und Verschlage klappten, jeglicher Festigkeit beraubt, in sich zusammen. Das ruinierte Riesenrad krächzte in den verbogenen Stahlstreben. Auf dem Brückenkran erzeugte das aufliegende und vom enormen Druck für einen kurzen Moment bewegte Gerüst ein metallenes Geheul, das den Donnerhall der Explosion durchstach.
Der Feuerschwall erinnerte an eine ausfahrende Zunge. Sie schleckte die Haedge-Halbinsel ab, um kurz darauf steil aufsteigend orangerot am Himmel zu verglühen. Rauchschwaden folgten. Alles brannte. Buden, Werbetafeln, Boote, Menschen. Die heiße Brunst fraß sich im Verhängnis jedes außer Kontrolle geratenen Feuers rasend schnell in die Sail. In der Ferne jaulten die ersten Sirenen von Rettungswagen und Feuerwehren aus der Rostocker Südstadt heran. Auf der Warnow nahmen patrouillierende Polizeischiffe, darunter einige schnelle Motorschlauchboote, die von den Beamten wie ein Holzpferd geritten wurden, Kurs auf die Halbinsel. Den Wasserpolizisten bot sich sehr bald ein kriegsähnliches Szenario. Rußiger Qualm hüllte das Vorschiff der „Mecklenburg“ ein, schwärzte das Weiß des Rumpfes. Vom Brückenkran fielen die restlichen Fetzen des brennenden Bier-Transparents herab. Am Riesenrad waren alle Farbanstriche und Verzierungen weggebrannt. Grässlich dunkles Metall hob sich aus dem Trümmer- und Totenfeld ab.
Ole Dormark erschien das Bild der wundersam am 11. September 2001 nicht zermalmten Fassadenteile des New Yorker World Trade Centers. Diese waren nach den Terroranschlägen aus der Staubfinsternis aufgetaucht, in die an jenem verheerenden September-Vormittag ein Teil Manhattans verschwunden war. Die Sonne über New York erleuchtete den gelblich-weißen Nebelschleier. Darin nahmen sich die gitterhaften Fassadenbruchstücke wie schief stehende Kreuze auf einem verwitterten Friedhof aus. Ole, der damals erst wenige Monate im neu gegründeten Investment-Center der Hanseatischen Vereinsbank in Rostock arbeitete, ist dieses Bild nie losgeworden. Er erinnerte sich haarklein an die erste Konfrontation mit dieser mystisch empfundenen Visualität. Unreligiös aufgewachsen, überkam ihn in diesem Moment eine Ahnung von übersinnlicher Symbolik. Die verreckten Fassadenteile auf dem Trümmerhaufen der Twin Towers bewahrte er sich auf als eigenen subjektiven Ausdruck vom Ende der Welt. Früher ängstigten ihn „Die vier Apokalyptischen Reiter“ von Albrecht Dürer. Sie waren der mittelalterlichen biblischen Fantasie des Malers entsprungen und galoppierten todbringend über die Menschheit hinweg. Das tote Metall von New York bedrängte ihn mit ungeheurer Wucht. Wie sollte es weitergehen? Es würde anders weitergehen.
Dormark blickte von seinem Tisch vor dem Hafen-Brauhaus auf die sich unweit davon erstreckende Haedge-Halbinsel. Der aufgekommene Wind an diesem späten Sommernachmittag vier Wochen vor Beginn der Hanse Sail 2018 zerrte an dem Bier-Transparent am blauen Brückenkran. Würde dieser nach dem Einschlag des Terrorschiffes in seiner widerstandenen totalen Zerstörtheit dem New Yorker Menetekel nahe sein? Dormark hoffte es. Das war der Plan. Danach würde es anders weitergehen. Er blinzelte über den Rand des Bierglases, ließ den letzten Schluck Schwarzbier in die Kehle rinnen. Bedächtig, gedankenbeschwert. Dormark schob den Stuhl zurück, stand auf und entfernte sich von dem unversehrten Ort.
Kapitel 2
Vorweihnachtszeit 2014. Ein rauer Wind suchte sich seinen Weg durch die engen Straßen und Gassen rund um die Nikolaikirche, deren mächtiger viereckiger Turm die Rostocker Altstadt überstrahlte. An diesem späten neblig-trüben Novembertag strebten viele dunkle Mäntel eilig auf den Seiteneingang des mittelalterlichen Baus zu. Das Gotteshaus diente seit langem vornehmlich als Konzertraum. Ole Dormark zwängte sich mit seiner Frau Catrin-Louise zwischen zwei der zahllos um das Kirchenareal parkenden Autos hindurch. Calli, wie Oles Ehefrau von ihm und guten Bekannten einfachhalber genannt wurde, hing schwer in seinem rechten Arm. Sie strengte sich an, auf dem feuchten Kopfsteinpflaster der Straße nicht umzuknicken. Die meisten ihrer Ausgehschuhe zierten hochhackige Absätze. So auch die schwarzen, bis an die Knie reichenden Lederstiefel, die sie passend zum kurzen, ebenfalls schwarzen Lederrock trug. Auf die Straße blickend suchte sie zu vermeiden, mit den Pfennigabsätzen zwischen die rundgewetzten Steine zu geraten.
„Dieses fiese holprige Pflaster ist nichts für High Heels“, seufzte Calli. Im nächsten Moment spannte Ole den Bizeps. Seine Frau war leicht aus dem Tritt geraten, krampfte sich fest.
„Ist der Absatz noch dran?“
„Ja, aber frage mal nach meinem Knöchel.“
„Was ist damit? Alles okay?“ Dormark sorgte sich. Er verspürte nicht die geringste Lust, das anstehende Weihnachtskonzert in der Nikolaikirche zu verpassen und stattdessen in der Notaufnahme des Südstadt-Klinikums den restlichen Abend zu verbringen. Der Gedanke zerstob sogleich. Calli neigte dazu, Wehwehchen zu dramatisieren. Sie hatten sich am letzten Tag von 1999 auf einer Jahrtausend-Silvesterparty in Rostock kennengelernt. Sehr bald dämmerte es Ole, warum sie Zahnärztin geworden war und nicht Chirurgin oder Orthopädin. Nach einer durchliebten Nacht säbelte sich Calli mit dem Brotmesser in den linken Daumen. Ein langer Schnitt, aber nicht bedrohlich. Trotzdem schrie sie nach einem Notarzt. Ole verhinderte diesen mit einem beherzten Druckverband. Später lachten sie über den dicken Daumen. Es war auch ein Fingerzeig. In der Silvesternacht begegneten sich ihre Blicke erst verstohlen, dann eindringlicher. Ihn beeindruckten schöne Augen. Callis sanftbraunen Augen fassten ihn an. Sie gefiel ihm. Das lange schwarze Haar reichte bis über die Schultern. Ihr kurzer Rock offerierte anmutig schlanke Beine. Diese verstärkten eine erotische Ausstrahlung, welche ihr mehr natürlich, denn beabsichtigt anhaftete.
Der Knöchel war unversehrt. Calli stakte über die Steine. Nach dem Wechsel der Straßenseite atmete sie auf, als hätte sie soeben ein rettendes Ufer betreten. Am Seiteneingang der Kirche hakten junge Damen in schwarzen Kostümen die Namen auf der Gästeliste ab. Eines der großen Steuerberatungsunternehmen in der Hansestadt hatte zum traditionellen Weihnachtskonzert eingeladen. In den Sitzreihen im säulengetragenen hohen Innenraum der Nikolaikirche verloren sich erste wenige Honoratioren. Die Gastgeber hatten den Dormarks Plätze im mittleren Bereich des Kirchenschiffs zugewiesen. Von dort bot sich freie Sicht auf den tiefen Ostflügel, dem Bühnentrakt. Nordisch schlicht waren die backsteinernen Wände und himmelhohen Säulen weiß getüncht. Die handgeformten Backsteine wichen in ihren Maßen voneinander ab. Indes die Fugenschatten zeichneten das Bemühen der Erbauer, trotz unpräziser Bautechnik mit meisterlichem Geschick der erhabenen Ästhetik der Architektur zu genügen. Die kräftigen Säulen stützten die alles überspannenden Kreuzbögen. In vollendeter Akkuratesse verliehen sie dem Kirchendach den Charakter eines Himmelgewölbes. Was es erschwerte, die Höhe einzuschätzen. Ole betrachtete die sakralen Dimensionen ehrfurchtsvoll. Religion konnte er jedoch nur kulturhistorische Beachtung abgewinnen. Er glaubte an nichts.
Die hochragenden Fenster liefen gotisch spitz zu. In der dunklen Neige des Tages blieben sie glanzlos. Brach sich hingegen im imposanten Kirchenglas das Sonnenlicht, überkam Ole eine Ahnung von göttlicher Bemächtigung. Der Klerus und seine Architekten nutzten dereinst die Macht aufgetürmten Gesteins, den ungebildeten Gläubigen die Demut und Untertänigkeit in die Knochen fahren zu lassen.
Calli zupfte Ole am Jackett. „Schau mal, wer da kommt?” Sie deutete zum Eingang hin. „Das ist doch die Rechtsanwältin aus unserer Straße.“ Calli stockte kurz. „Aber ihr Begleiter sieht nicht aus wie ihr Mann.“ Sie sah zu Ole und vergewisserte sich in Richtung des Paares.
„Ich habe ihn eine Weile nicht gesehen. Es erklärt sich gerade, warum.“
„Meinst du wirklich?“
Ole nervte Beziehungsgetratsche. „Da brauche ich nicht lange zu rätseln. Er hält Händchen und Madame ist offenbar dem neuesten Modemagazin entsprungen.“ In seiner Beobachtung lag ein verächtlicher Unterton. Calli verblüffte wieder mal, wie blitzschnell Ole die Details einer plötzlich entstandenen Situation erfasste und pragmatisch schlussfolgerte. Die Rechtsanwältin trug in der Tat stylischen Fummel, auch ihren halblangen Haaren hatte sie einen neuen, strengeren Schnitt verpasst. Calli bemerkte es und spürte eine Dosis giftigen Neids in ihre Adern schießen. Eine abwegige Reaktion. Oles Ehefrau war mit 40 Jahren eine attraktive Erscheinung, die viel begehrliche Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie setzten sich.
Dormark musterte die Damen und Herren des Chores, die sich in die erhöhten Aufstellreihen im Ostflügel schoben. Ihnen zu Füßen rückten die Musiker des kleinen Kirchenorchesters Stühle und Notenständer zurecht. Dem Rostocker Investmentbanker gefiel es, in der Ansammlung musisch ambitionierter Menschen über die einzelnen Charaktere zu spekulieren. Er glaubte sie so verschieden wie die Instrumente. Einige Musiker harrten routiniert des Konzertbeginns, während andere neugierig in die sich füllende Konzertkirche blinzelten. Die Damen in schwarzen Kleidern, Blusen, Röcken und vereinzelt Hosenanzügen wirkten unisono streng und spröde. Was garantiert nicht zutraf. Die Unterordnung in ein Ensemble zwang zur Disziplin, ließ keinen Zentimeter Spielraum für individuelle Leidenschaft und Emotionen.
Ole grinste in sich hinein. Vor ihm tauchte die berühmte Cellistin-Szene aus dem Hollywood-Streifen „Die Hexen von Eastwick“ mit Jack Nicholson auf. Der grandiose Macho-Mime mit dem unwiderstehlichen Jack-Nicholson-Blick – schläfrige schmale Augen, auf die auch tagsüber die Lider lasten – betört auf teuflische Weise eine junge selbstzweifelnde Cellistin. Sie verkrampft an ihrem Spielgerät, statt es lustvoll zu traktieren. Nicholsons Magie legt die weggesperrten Gefühle frei. Bis die Enthemmung in einem paganinischen Furioso gipfelt.
Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium mündete in viel Beifall für den Chor und das Orchester. Die erste Zuschauerreihe mit dem Oberbürgermeister der Hansestadt, dem Vorstandschef der gastgebenden Steuerberatung und weiteren honorablen Vertretern aus Politik und Wirtschaft erhob sich. Die Reihen dahinter folgten. Kurz darauf lief der Menschenpulk auseinander und der Innenraum mutierte zum Bankettsaal. Verteilt über das gesamte Kirchenschiff fanden sich die Gäste in Gruppen zusammen. Ole und Calli standen rücklings an einer der mächtigen Innensäulen. Hin und wieder nickten oder winkten sie Bekannten zu. Eine Gruppe nahe dem alten Kirchengemäuer erweckte mit einem Schlag Dormarks Neugierde. Der Blick klebte an einem Gesicht, das vom Schatten einer Säule gestreift nur ungenau zu erkennen war. Doch zeichneten sich Konturen ab, die ihm irgendwie vertraut vorkamen. Alle anderen Anwesenden wechselten ins Schemenhafte. Ole strengte sich an, mehr aus dem einen Gesicht zu lesen. An wen erinnerte es ihn?
„Hey“, Calli drückte sanft den Ellenbogen in Oles Seite, „der neue Sparkassenchef macht seine Aufwartung. Ist das seine Frau neben ihm?“
„Glaubst du etwa, der kreuzt hier mit einer Freundin auf?“ Ole zog missfallend die Augenbrauen hoch. Es wurmte ihn, wegen einer solchen überflüssigen Frage aus den Gedanken gerissen worden zu sein.
„Schon gut, sorry.“ Calli widmete sich dem nächsten Paar.
Der vermeintlich bekannte Unbekannte plauderte angeregt in der Runde, aus der sich die ersten Gäste lösten, um dargereichtes Fingerfood zu ergattern. Ole engte den Kreis der Namen ein, die auf den smarten Typ mit dem naturkrausen hellen Haar zutreffen könnten. Es wollte keiner passen. Aber Ole war inzwischen überzeugt, ihn zu kennen. Er ließ Calli stehen und schlenderte auf die nächstbeste Kellnerin zu. Unvermittelt schaute der Hellblonde kurz in seine Richtung, wendete sich aber sogleich wieder den Gesprächspartnern zu. Ole konnte ihn jetzt besser fixieren und war sich plötzlich absolut sicher. Dort im Halbdunkel der Nikolaikirche stand sein Schulfreund Erik Klapproth. Sie hatten in der Wendezeit 1990 gemeinsam das Abitur in Rostock abgelegt. Unter surrealen Umständen. Die Lehrer in der Erweiterten Oberschule versuchten das Bildungssystem in der zerbröselnden DDR zusammenzuhalten. Wenigstens solange, bis Dormark, Klapproth und die anderen Zwölftklässler ihre Abitur-Prüfungen absolviert hatten. Was den Volksbildungspädagogen gelang, auch wenn die Verunsicherung und Ungewissheit auf den Fluren der Oberschule mit den Händen zu greifen waren. Nach den letzten Sommerferien liefen Dormarks und Klapproths Wege auseinander. Viele junge Leute nutzten die neuen Freiheiten und Möglichkeiten und schwärmten gen Westen aus. Bye, bye andere deutsche Republik. Bye, bye sozialistischer Traum.
Erik begann in Hamburg Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Im einsetzenden Hype um erneuerbare Energien geriet er über ein Praktikum an den dänischen Windkraftanlagenbauer Blow. Die Wikinger segelten in der aufstrebenden Branche forsch vorweg. Sie heuerten Klapproth an mit der Maßgabe, in Hamburg eine Dependance von Blow aufzubauen. In Rostock ward Erik nur noch selten gesehen. In jenen Jahren der rasanten Transformation von zahllosen Biografien und sämtlichen Lebensumständen blieb kaum Luft zum Durchatmen. Und noch weniger Zeit zu fragen, wohin es den einstigen Banknachbarn in der Schule, den Nebenmann am verlorenen Arbeitsplatz und die ausgezogene Familie aus der zweiten Etage verschlagen hatte. Die Ostdeutschen flatterten wie die gelinkten Hühner bei Wilhelm Buschs geplagter Witwe Bolte auseinander. Sie hatten die Brotkrumen des golden schimmernden Westens geschluckt und hingen doch aneinander am Faden der gemeinsamen Herkunft.
Ole verwarf den ursprünglichen Plan, Schiffbau zu studieren. Im Eilzug zur Marktwirtschaft waren sehr viele Plätze zu besetzen in den Abteilen Versicherungen, Banken, Autohandel, Behörden. Er entschied sich, eine Ausbildung zum Bankkaufmann aufzunehmen bei der Hanseatischen Vereinsbank. Das norddeutsche Traditionsbankhaus hatte sich unmittelbar nach der Währungsunion im Sommer 1990 in exklusiver Lage in Rostocks Geschäftsmeile Kröpeliner Straße niedergelassen. Mit der Region vertrauten jungen Menschen standen bei der Hanseatischen die Türen weit offen. Die Tage des Niedergangs trugen unkonventionelle Gelegenheiten des raschen Aufstiegs in sich. Nach der Banklehre wechselte Ole an die Rostocker Universität zum Studium der Finanzwirtschaft. Im Sog des Ende der 1990er-Jahre in der Branche losbrechenden Turbokapitalismus spülte es ihn schnell an die Spitze des Investment-Centers der Hanseatischen Vereinsbank.
Dormark blieb vor der Kellnerin stehen. Sie hielt ein Tablett mit gefüllten Schinkenröllchen und Käsespiekern. Er nahm von beidem. Der Käse schmeckte herzhaft nach Mecklenburger Art. Klapproth lauschte geduldig einem sehr redseligen älteren Herrn, lachte zwischendurch. In Eriks Augen senkte sich plötzlich Erstaunen, wie nahe ihm dieser großgewachsene Mittvierziger mit dem Käsespieker zwischen den Zähnen gekommen war. Wollte der Typ etwas von ihm? Er schien darauf zu lauern, an ihn heranzutreten. Sollte er den drahtigen Mustergeschäftsmann kennen? Es hielt Erik nicht mehr. Er gab mit einer knappen Geste der Runde zu verstehen, sich entfernen zu wollen. Nach wenigen Schritten stand er vor Ole. Der sah ihn erwartungsvoll an.
„Sie entschuldigen, sind wir uns schon mal begegnet?“, fragte Klapproth umständlich. Die Druckserei erübrigte sich im gleichen Moment. Er entdeckte im Gesicht seines Gegenübers ein Detail, das diesen zweifelsfrei als den Schulfreund Ole Dormark identifizierte. Oles Nase wies im oberen Teil einen kleinen Höcker auf. Bei einem Fahrradunfall in Kindheitstagen hatte er sich die Nase gebrochen. In der Notaufnahme war dies aber übersehen worden, der angeknackste Knochen hätte gerichtet werden müssen. Die Diagnose des nachbehandelnden Arztes nützte nichts mehr. Entscheidende Zeit war verstrichen. Der Höcker blieb. Ole sah darin später ein unverwechselbares Zeugnis seiner Individualität.
„Erik Klapproth, richtig?“ Oles Lippen spreizten sich zu einem breiten Lächeln.
„Mensch Ole“, erwiderte Erik. Die Anspannung löste sich mit einem Stupser der rechten Hand gegen Oles linke Schulter. „Komm, lass’ uns da drüben hingehen.“ Erik schob ihn sanft vor sich her in Richtung Orchesterplatz. Calli blickte fragend herüber. Ole bedeutete ihr, sie möge sich ein Weilchen ohne ihn begnügen.
„Darauf müssen wir anstoßen.“ Erik erleichterte eine der beflissenen Kellnerinnen um zwei Bier. „Prost!“
„Prost!“
„Wie lange ist es her, dass wir uns nicht gesehen haben?“
„Seit du nach Hamburg abgehauen bist. Das war vor mehr als 20 Jahren.“
„Mein Gott, und dann treffen wir uns bei einem Weihnachtskonzert wieder. Ich glaube es nicht.“ Erik hob das Glas und trank einen kräftigen Schluck.
„Schon eigenartig, mit Kirche hatten wir ja nie was am Hut. Aber was machst du in Rostock?“
„Ich bin wieder hier, in meinem Revier“*, trällerte Erik in lästerndem Ton. Er war kein Freund von Marius Müller-Westernhagen. Aber diese Zeile des Deutschrock-Barden hatte sich ihm eingebrannt. Simple Worte, die Beginn und Endpunkt manch umtriebigen Lebenslaufs markierten. In etwa so fühlte es sich für ihn an.
„Bis zum Sommer vorigen Jahres war ich Leiter der deutschen Niederlassung des dänischen Windkraftanlagenbauers Blow. Ich habe für die Jungs das Geschäft in Norddeutschland aufgebaut. Die drehen echt am großen Windrad.“
„Warum bist du denn weg dort?“, unterbrach Ole.
„Zufall, blanker Zufall. Bei einer Veranstaltung in der Hamburger Handelskammer bin ich mit dem alten Chef der Lenker GmbH aus Rostock ins Gespräch gekommen. Die sind auf automatisierte Transportsysteme in der Produktion spezialisiert und in Hamburg im Flugzeugbau gut dabei.“
„Die Firma sagt mir was, nur zählt sie nicht zu unseren Kunden.“
„Was heißt Kunden, bist du immer noch bei den Bankern?“
„Ja. Du warst in der Handelskammer“, warf Ole den Ball zurück.
„Entschuldige. Jedenfalls fragt mich der Lenker-Chef unvermittelt, nachdem er gehört hatte, ich stamme aus Rostock, ob ich bei ihm einsteigen wolle. Richtig einsteigen, als Gesellschafter. Er müsste seine Nachfolge regeln.“
„Offenbar muss das Angebot gestimmt haben, sonst wärst du nicht hier.“
„Es war die Überlegung wert. Ich bin jetzt 25-Prozent-Teilhaber und Geschäftsführer.“
„Bist du auch wieder übergesiedelt?“
„Nein, ich pendle. Meine Frau Monique hängt sehr an Hamburg.“
„Was macht sie denn?“
„Hausfrau.“
„Hausfrau?“
„Sie hat Architektur studiert und reich geerbt. Ihr Vater besaß ein Verlagsimperium und ist sehr früh gestorben.“
Ole spürte, Erik erzählte von seiner Frau kurz angebunden. Er ersparte ihm die Frage nach Kindern.
„Ich bin verheiratet mit einer Zahnärztin.“
„Wie praktisch.“ Erik grinste.
„Catrin-Louise betreibt eine eigene Praxis. Unser Sohn Rico ist jetzt dreizehn und spielt leidenschaftlich Fußball.“
„Bei Hansa?“
„Würde er gern, aber sein Talent ist nicht so überragend. Es kostet mich momentan viel Überzeugungsarbeit, ihm die Idee von der Profikarriere auszureden.“
Erik griff nach zwei weiteren Biergläsern, die auf einem Tablett vorbeischwebten.
„Da wäre eine Bankerlaufbahn doch was Solides.“ Klapproth reichte Ole ein volles Glas.
„Das würde ich nicht mehr ohne Weiteres unterschreiben. Ich leite das Investment-Banking in der Hanseatischen Vereinsbank in Rostock, habe den Bereich aufgebaut. Risikobewertungen sind wir immer eher konservativ angegangen. Aber gegen den hemmungslosen Handel mit ungedeckten Schecks in der Branche bist du als regionale Bank machtlos. Die Krise spüren wir noch heute. Wenn Rico eines Tages die Praxis seiner Mutter übernehmen würde, wäre ich ihm nicht böse.“ Sie prosteten sich zu. „Apropos Catrin-Louise, meine Frau ist ebenfalls da.“
„Wo? Hier? Und warum stellst du sie mir nicht vor?“
Ole blickte sich suchend um. „Wollte ich gerade eben machen“, stammelte er. Zu etwas gedrängt zu werden, hasste er.
Calli stand nicht mehr an der Säule. Irritiert spähte Ole in den Kirchenraum. Plötzlich tippte sie ihm von hinten auf die Schulter.
„Da bist du ja. Ich möchte dir Erik Klapproth vorstellen.“
„Ich bitte darum. Sollte ich an den Backsteinen Wurzeln schlagen?“ Calli schaute auf Klapproth. In seiner gedrungenen kräftigen Gestalt reichte er nicht an sie heran. Die High Heels verschärften die Diskrepanz. Erik vertraute seinem Charme und Selbstbewusstsein. Er sah gern zu attraktiven weiblichen Wesen auf.
„Catrin-Louise, angenehm.“ Sie streckte ihm die Hand entgegen.
„Es freut mich. Erik Klapproth. Ole hätte Sie mir fast verheimlicht.“
„Erik, lassen wir das Sie. Meine Freunde nennen mich Calli.“
„Calli, Erik ist ein alter Schulkamerad. Wir haben zusammen das Abitur in Rostock gemacht und uns seitdem nicht mehr gesehen. Vielleicht habe ich ihn mal erwähnt. Auf jeden Fall taucht er heute Abend so mir nichts, dir nichts einfach auf.“
„Na, das ist doch ein Grund, woanders noch einen Drink zu nehmen“, nutzte Calli die Gunst, der versammelten Gemeinde in der Nikolaikirche zu entfliehen. Sie hatte genug gesehen.
„Gern.“ Erik versicherte sich bei Ole.
„Gute Idee. Bis zur Havanna Bar im Hotel Sonne ist es nicht weit.“
Ole hielt Calli den Arm hin. Erik folgte den beiden in genügendem Abstand, um Calli von hinten betrachten zu können. Im schwarzen Lederrock und in den hohen Stiefeln lief ihr prickelnder Esprit bei Erik nicht ins Leere. Olle Ole hatte nicht nur mit der Zahnärztin praktisch gut gewählt.
* Aus dem Song „Wieder hier“, Marius Müller-Westernhagen, Album „Radio Maria“, 1998
Kapitel 3
Strähter trommelte ungeduldig auf dem Lenkrad herum. „Nun hör’ doch mal auf damit, die kommen gleich.“ Martin Paroso rutschte auf dem Beifahrersitz nach vorn. Der Geldtransporter war nicht zu sehen. Dieser steuerte auf seiner Tour stets pünktlich den Baumarkt in Bordesholm an. Auf der Hinterseite in der Lade- und Lieferzone, wo sich gegen 18 Uhr kaum eine Menschenseele herumtrieb. Die Miettransporter waren abgestellt, die Materiallieferanten längst von dannen. Eine breite Zufahrt führte vom nahen Dieselweg in einem leichten Bogen zum Baumarkt. Im Kurvenscheitel versperrte auf der rechen Seite ein kleineres Wirtschaftsgebäude die Sicht auf das Gelände. Täglich bog der Geldtransporter von der Dieselstraße in die Zufahrt ein und passierte nach halber Strecke rechterhand einen kleinen Parkplatz von der Fläche sechs nebeneinander abgestellter Autos. Er war Kunden eines benachbarten Getränkeladens vorbehalten.
Der mit drei Männern besetzte silbergraue VW Golf III Variant stand unauffällig zwischen zwei anderen parkenden Autos. Hinter Gerolf Strähter und Martin Paroso saß im Fond Fiete Last. Er wirkte angespannt, die Knie hatte er dicht an die Sitzbank herangezogen. Auch ihn nervte Strähters Trommeln. „Gerda, es ist gut. So ein Geldtransporter hat nicht immer freie Fahrt.“ Den Weibernamen hatten sie Gerolf Strähter verpasst, weil er nicht von seinen schulterlangen Haaren lassen wollte. Grauer Reif nistete inzwischen darin. Der Schädel indes war kahl. Die hohe Stirn des 55-Jährigen reichte bis zum Hinterkopf. Fiete neidete Gerda zuweilen die Haarlänge. Sein eigenes dünnes Haar taugte nicht zu üppigerem Wuchs. Mit einem bunten Stirnband hielt er seine spärlichen Strähnen zusammen. Seine schmächtige Figur, das wachsblasse Gesicht und die leer dreinblickenden Augen verrieten den Süchtigen. Der 53-Jährige wich seit seiner Jugendzeit keiner Droge aus. Durch sein Leben zog sich eine weiße Linie. Die beiden anderen duldeten Fietes Pillenkonsum. Sie selbst mieden seit langem jedwede Highmacher. Ein anderer Rausch hielt sie verschworen beieinander. Revoluzzertum. Strähter, Paroso und Last lebten im Untergrund. Seit zwei Jahrzehnten. Zu Beginn der 1990er-Jahre bildeten sie mit anderen Gefährten im Geiste die dritte Generation der Roten Armee Fraktion RAF. Wie viele Mitstreiter diese zählte, wusste keiner genau. In dem Terrornetzwerk kannte ein Aktivist höchstens drei andere Mitglieder. Sie agierten in kleinen Kommandos. Die drei aus dem Norden spezialisierten sich auf Sprengstoffanschläge. Ihr größter Coup war die massive Zerstörung des Gefängnisneubaus in Filderstadt 1993. Der Komplex sah nie einen Gefangenen. Er musste nach der RAF-Attacke komplett abgerissen werden. Strähter, der den Anschlag perfekt geplant hatte, sowie Paroso und Last konnten entkommen. Um den Preis, ihr weiteres irdisches Dasein in falscher Identität zu verbringen. Mit neuen Namen in den Ausweisen und erfundenen Lebenslegenden tauchten sie ab.
Sie beschlossen zusammen zu bleiben und mieteten in Kiel im unaufgeregten Stinkviertel in der Howaldtstraße zwei Wohnungen, nicht weit auseinander liegend. Fiete kannte sich hier einigermaßen aus, war in seiner Jugend ab und an in der Stadt. Das Stinkviertel wurde dominiert von zumeist fünfstöckigen Wohnhäusern, errichtet zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Blöcke schmiegten sich nahtlos aneinander und bildeten geschlossene und begrünte Karrees. Seinen Namen verdankte das Viertel einer nahen Chemiebude, die anno dunnemals die Luft verpestete. In dieser Gegend interessierte man sich wenig dafür, was jemand machte, woher er kam, wohin er ging. Die drei Ex-RAF-Mitglieder gaben sich als Freiberufler aus. Strähter beriet große Firmen in Sicherheitsfragen, Paroso entwarf Wahlkampfstrategien für Politiker, Last ersann Vermarktungskonzepte für Bio-Produzenten. Alles Alibi-Jobs, über die kaum gesprochen und besser geschwiegen wurde.
Aus den Tagen des Terrors verwalteten sie zudem einen unentdeckten Unterschlupf. Ein verlassenes und halb verfallenes Gehöft in einem dichten Waldstück bei Westermühlen unweit von Rendsburg. Das scheunenhohe Gebäude stand auf einer kleinen unbeachteten Lichtung abseits befahrener Wege. Die Erben der einstigen Eigner hatten es vor Jahrzehnten aufgegeben, einen Käufer zu finden. Sie ließen alle Türen und Fenster zumauern und übereigneten den Rest dem Schicksal. Bei einer heillosen Flucht vor der Polizei waren zwei RAF-Terroristen zu Beginn der 1980er-Jahre auf den Rückzugsort gestoßen. Schon nicht mehr wissend wohin, rumpelten sie mit ihrem gestohlenen Wagen auf einem holprigen Waldweg direkt auf den Backsteinbau zu. Größere Mengen an Waffen, Sprengstoff, gefälschten Ausweispapieren und sogar Fahrzeuge konnten darin verborgen werden. Der RAF gelang es unbemerkt, das Gebäude teilweise zu entkernen und eine Giebelseite mit einer torangelweiten Einfahrt auszustatten. Diese wurde mit einer großen Schiebetür verschlossen. Zur Tarnung ähnelte die gestaltete Toraußenseite einer Wand aus rotem Backstein. In den letzten drei Jahrzehnten war das Versteck von wucherndem Grün fast verschluckt worden. Strähter, Paroso und Last nutzten den Schlupfwinkel, um ihren Golf Variant von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Sein Zweck beschränkte sich darauf, bei Raubüberfällen auf Märkte und Banken die Gangster und ihre Beute zu befördern.
„Da kommt er.“ Paroso stieß Strähter in die Seite. Der straffte sich und drehte den Kopf zur Dieselstraße hin. Ein grauer mittelgroßer Geldtransporter tauchte in der Zufahrt auf. In blauen Lettern prangte der Firmenname Moneten-Trans auf der Seitenfront. Paroso, mit 47 Jahren der Jüngste im Trio, und seine beiden Kumpane drückten sich in die Sitze. Der Fahrer des Transporters und sein Nebenmann rollten an dem silbergrauen Golf Variant vorbei, ohne ihm nähere Beachtung zu schenken. Martin Paroso wusste, was jetzt weiter geschah. In den letzten drei Wochen hatte er die Tour des Moneten-Trans-Sicherheitswagens penibel studiert. Er verfolgte ihn mehrfach auf der Rückfahrt zur Firmenzentrale in Kiel. Dabei war ihm eine regelmäßige Routenänderung aufgefallen. Jeweils am späten Freitagnachmittag fuhr der Geldtransporter vom Baumarkt aus nicht wie sonst nördlich von Bordesholm auf die Autobahn A215 nach Kiel. Aus dem Moorweg bog der Wagen auf die Landstraße L49 statt nach links, freitags nach rechts ab. Er nahm Kurs auf die gut zwölf Kilometer entfernte Gemeinde Nettelsee. Dort sackte das Moneten-Trans-Team die Tageseinnahmen eines Fahrrad- und Motorradshops ein. Die Strecke zwischen Bordesholm und Nettelsee glich den unzähligen typischen Landstraßen im flachen Hinterland der holsteinischen Ostseeküste. Wiesen und Äcker, vereinzelte Gehöfte und Stallanlagen säumten die Fahrbahn. Überschaubare Waldstücke und hoch stehendes Buschwerk unterbrachen zwischendurch die weite Flur. Paroso registrierte an der Strecke jede Böschung, jeden Feldrain, jeden angrenzenden Weg. Jede Möglichkeit lotete er aus, wo und wie der Transporter am schnellsten und unauffälligsten gestoppt werden und binnen 90 Sekunden die Geldherausgabe erzwungen werden konnte. Er wurde rasch fündig. In einer langgezogenen Linkskurve, in der die L49 vom Straßennamen Kluven in Dosenbeker Straße wechselte, fielen mehrere begünstigende Umstände zusammen. Auf der linken Seite in Richtung Nettelsee bot ein ackergroßes Waldareal besten Sichtschutz. Im Beginn der Kurve gab es rechts eine Feldauffahrt. Diese wurde im weiteren Verlauf der Landstraße und in der Tiefe des Ackerweges von ausgedehnten Buschreihen flankiert. Das Risiko unverhofft aufkreuzender Fahrzeuge schätzte Martin gering ein. Die L49 erwies sich als nicht besonders viel befahren.
Nach 15 Minuten passierte der Geldtransporter erneut den Golf Variant. Mit eingeschalteten Scheinwerfern. Über Holstein hing an diesem frühen Märzabend eine dunkle Regenfront. Strähter wartete ab, bis der graue Wagen nach links in der Dieselstraße verschwand. Ab jetzt dirigierte Paroso. Gerda verließ sich vollends auf Martins Ansagen. Widerreden oder Nachfragen sah ihr Plan nicht vor. Alle vorherigen Raubzüge, mit denen sie seit Jahren ihren Lebensunterhalt sicherten, blieben auch deshalb für sie folgenlos, weil sie nahezu automatisiert abliefen. Die Rollen waren verteilt. Paroso genoss die seine als Vordenker. Der gebürtige Hamburger besaß südeuropäisches Temperament und einen ausgeprägten Hang zu Anarchie. Sein portugiesischer Vater schuftete zeitlebens in einer Aluminium-Hütte in der Hansestadt. Dem Gastarbeiter bedeutete der Job einst die Chance auf ein geregeltes Einkommen. Er blieb in Deutschland, nachdem er Parosos Mutter, eine Kellnerin, kennengelernt hatte. Sohn Martin streunte nach dem Abi 1987 durch Westeuropa, jobbte gelegentlich. Zuletzt in Hamburg. Vater Eduardo missfiel dieses Lotterleben. Er gedachte seinem Sohn eine weniger entbehrungsreiche, von harter Arbeit gezeichnete Existenz zu. Martin gab dem väterlichen Drängen schließlich nach und begann im Frühjahr 1990 in der Hansestadt Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Es hielt ihn nur kurz in der Spur. Das neue Jahrzehnt startete nicht im gewohnten Trott. Drüben in der DDR zerbrach ein ganzer Staat. Dieser totale Umbruch faszinierte Paroso. Mit Kommilitonen fuhr er einige Male nach Berlin, sich die Sache näher anzusehen. Im Osten geriet alles aus den Fugen. Revolution war möglich. Nicht mehr nur in den Geschichtsbüchern und unblutig zudem. Im Westen versuchte die RAF seit zwei Jahrzehnten, mit mörderischem Terror eine revolutionäre Lunte an das System Bundesrepublik zu legen. Der Funken wollte nicht überspringen auf die Massen. Einige Häupter zu liquidieren aus der oberen Riege der gesellschaftlichen Hierarchie, ob Generalbundesanwalt, Deutsche-Bank-Chef oder Arbeitgeberpräsident, sorgte allenfalls für Empörung, verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und letztlich in der RAF selbst zu Debatten über weniger Blut in der Konfrontation mit dem Staat. In diesen Wirren zu Beginn der 1990er-Jahre traf Paroso in einer arg verrauchten und auch sonst ziemlich üblen Kiezkneipe auf St. Pauli den langhaarigen Gerolf Strähter. Der zapfte hinterm Tresen Bier und füllte die Schnapsgläser. Beide Männer fanden nach wenigen Worten eine gemeinsame Sprache. Sie verloren sich nicht in oberflächlichem Palaver über Autos, Frauen und Fußball. Strähter war seit der Schulzeit politisch engagiert.
In Hitzacker an der Elbe aufgewachsen, erlebte er die Anti-Atombewegung im Streit um das nukleare Zwischenlager im nahen Gorleben. Er mischte bei den Protesten vor Ort mit und erfuhr, wie sich der Gummiknüppel der Polizei anfühlt. Einmal schlug er mit einer kurzen Eisenstange zurück. Heftig. Das Plastikvisier des Polizisten zersprang, das Blut schoss aus der Nase wie die Fontäne eines Tischbrunnens. Strähter konnte flüchten und verbarg sich seitdem in der Anonymität der Millionenmetropole Hamburg. Friedlichem Protest konnte er nichts mehr abgewinnen. Wenige Tage nachdem sich Strähter und Paroso kennengelernt hatten, kam es in der Kiezkneipe zur schicksalhaften Begegnung mit dem Dritten im Bunde. Fiete Last. Er war ein in Hamburg gestrandeter Gitarrenvagabund. Von seiner Heimatstadt Flensburg an der Ostsee trampte er kaum zwanzigjährig in den Laster- und Sündenpfuhl an der Elbe. Das Musikstudium erledigte sich nach zwei bemühten Jahren. Fiete schlug sich lieber durch die Kaschemmen und Clubs, betörte sein Publikum mit den schwebenden Songs von Leonhard Cohen, Bob Dylan und Neil Young. Sein buntes Stirnband und eine doktorandenhafte Nickelbrille verliehen ihm die Attitüde eines aus der Zeit gefallenen Flower-Power-Kindes. Selbst entfloh er der Zeit zu häufig auf Drogentrips, was ihm dauerhaft Geldprobleme bescherte. Die Einnahmen aus dem Kneipengetingel reichten dafür nicht hin. Strähter und Paroso luden Last nach einem Auftritt zum Bier ein. Er entpuppte sich als Gleichgesinnter.
In Westdeutschland gärte unter der Kohlschen Machtglocke erheblicher Verdruss im Volke. Die Wirtschaft rutschte in die Krise, die Arbeitslosenzahl stieg steil an, das Rentensystem drohte zu kollabieren. Politisch kam niemand am Zwei-Zentner-Kanzler vorbei. Zumal sich der beschleunigende Zerfall der DDR zum Glücksfall für die lethargische Bundesrepublik und den Pfälzer Patenonkel wendete. Ein Markt mit 17 Millionen ausgedörrten Verbrauchern fiel dem Westen über Nacht vor die Füße. Die Krise vertagte sich.
In der Kiezkneipe auf St. Pauli wurde dieser historische Segen als Fluch wahrgenommen. Die Einheitseuphorie verschüttete die Chance, in den alten Bundesländern grundlegend etwas zu verändern. Irgendwann fiel in der Runde das Kürzel RAF. Die kompromisslosen Jungs und Mädels an der unsichtbaren Front wollten sich nicht mit dem eingefrorenen Status quo abfinden. Strähter hegte schon einige Zeit ernsthaft den Gedanken, sich den unerschrockenen Kameraden anzuschließen. Hinter dem Tresen fühlte er sich zunehmend gefangen. Paroso sympathisierte, seit er politisch dachte, mit der radikalen Form des Widerstandes. Er wusste von sich, gäbe es die Gelegenheit dazu, würde er sich nicht verweigern. Fiete Last hörte konzentriert zu. Fahrig wurde er, wenn der Moment heranrückte, sich eine Pille einzuwerfen. Die zwei neuen Bekannten konnten nicht wissen, er hatte Kontakt zur RAF. Von der Kommandoebene war er als Kader eingestuft und beauftragt worden, eine Terrorzelle aufzubauen. Strähter und Paroso kamen wie gerufen.
Eineinhalb Jahrzehnte später verfolgten sie in einem in die Tage gekommenen Golf Variant einen Geldtransporter. Sie vermuteten in diesem mehrere zehntausend Euro, womöglich sogar über 100.000. Die Leute schleppten zum Wochenende und in Vorfreude auf den Frühling aus dem Baumarkt, was sie im Haus und Garten zum Zeitvertreib benötigten. Neben Bankfilialen waren Baumärkte die erquicklichsten Geldquellen. Je größer die erbeute Summe, desto länger hatte der VW im Versteck bei Westermühlen seine Ruhe.
Auf der Landstraße nach Nettelsee erhöhte der Geldtransporter das Tempo. Strähter durfte nicht abreißen lassen, denn nach nur sechs Kilometern erreichten sie die von Paroso ausgekundschaftete Kurve. Ein hinter ihnen plötzlich heranfahrender Pkw fiel nach dem Ortsschild Bordesholm wieder ab und verließ die L49. Gegenverkehr gab es keinen.
„So, Jungs, gleich rollt der Rubel.“ Martin schaute nach hinten zu Fiete und seitlich zu Strähter. Beide nickten. Wortlos zogen sich die Drei die vordere Seite der Stoffschläuche, die krausenartig ihre Hälse umhüllten, hoch bis über die Nase und setzten sich dunkle Basecaps auf. Fiete griff neben sich nach einer halb ausgebreiteten Decke und warf sie in den Fußraum. Zum Vorschein kam auf dem Rücksitz eine russische Maschinenpistole des legendären Typs Kalaschnikow. Das gekrümmte Magazin, gefüllt mit 30 Schuss, lag neben der Waffe. Routiniert schnappte sich Fiete die Kalaschnikow und drapierte sie mit dem Lauf zur linken Seite auf seinen Oberschenkeln. Dann rastete das Magazin ein. Am fingerlangen Hebel, mit dem er über Einzelschuss oder Dauerfeuer entschied, zögerte er fast ebenso routiniert. Noch nie hatte er einen Schuss abgeben müssen. Jedes Mal hoffte er innig, es möge so bleiben. Jedes Mal drückte er schließlich den Hebel auf die Stellung Dauerfeuer. Im Fall des Falles sollte er für sich und die beiden anderen den Fluchtweg freischießen. Für Einzelschuss blieb keine Zeit, die Erfolgsaussichten würden gen Null tendieren.
Vorn befreite Martin eine ungleich mehr Erfolg verheißende Waffe von einem abgegriffenen Stoffbeutel. Den hatte er einer Panzerfaust übergeworfen, ebenfalls russischer Fabrikation. Senkrecht auf dem Boden aufgesetzt klemmte sie zwischen den Knien. Wenige Sekunden verblieben bis zu ihrem gemeinsamen Auftritt. Kein Geldtransporter-Fahrer kam je auf die Idee, sich dem durchschlagenden Argument des unheimlichen Geschosses zu widersetzen. Es sei denn, er litt an übertriebener Loyalität seinem Arbeitgeber gegenüber. Martin träumte manchmal von den aufgerissenen Augen der geschockten Fahrer. Alle hatten in Bruchteilen von Sekunden kapiert, was auf sie gerichtet wurde. Ihre Transporter waren gut gepanzert, aber keine Panzer. Strähter trat auf das Gaspedal, scherte aus und überholte den Moneten-Trans-Wagen. Gebannt blickte Martin auf die Straße. Eingangs der langen Linkskurve folgten einige Meter bis zu der Stelle, wo rechts der Feldweg auf eine brachliegende Ackerfläche führte. Der Lichtkegel erfasste das hohe Buschwerk davor.
„Jetzt!“, rief Paroso laut und unaufgeregt.
Gerda war weit genug vorgefahren, so dass für den Geldtransporter nach dem Aufleuchten der roten Bremsleuchten am VW der Halteweg ausreichte, um sicher zum Stehen zu kommen. Gleichzeitig flogen die zwei rechten Wagentüren des Golfs auf. Fiete und Martin sprangen heraus. Mit der Panzerfaust schulterhoch im Anschlag stürzte Martin an Fiete vorbei und postierte sich breitbeinig vor der Fahrerkabine des Transporters. Die Augen des Fahrers erstarrten in Schock und Angst. Der Beifahrer reagierte instinktiv und hilflos. Die Arme verschränkte er vor dem Gesicht. Wie ein Kind, das sich ängstlich die Bettdecke über den Kopf zieht im Glauben, so das Böse der Welt auszusperren.
Der Geldtransporter setzte zwei, drei Meter zurück und rollte langsam auf den Feldweg. Fiete schritt zügig mit der Kalaschnikow in der rechten Hand vorweg und blieb nach gut 30 Metern stehen. Er bedeutete dem Fahrer zu stoppen und das Licht abzuschalten. Gerda lenkte den Golf rückwärts in die Feldauffahrt. Das Licht erlosch, der Motor tuckerte im Leerlauf abfahrbereit. Strähter schaute kurz auf seine Armbanduhr. 45 Sekunden blieben. Er riss die Hecktür des Golfs hoch und pochte anschließend heftig an die Ladefront des Transporters. Von innen entriegelte der Beifahrer die Tür. Vorn hielt Martin den Kollegen in Schach, Fiete eilte hinter das Fahrzeug.
„Schnell, schnell“, mahnte Gerda mit einer Handbewegung den Moneten-Trans-Mitarbeiter, die Geldboxen herauszureichen.
„Nicht so lahm, Mann“, trieb Fiete den verstört funktionierenden Sicherheitsmann zusätzlich an und fuchtelte mit der Maschinenpistole. Vier Boxen wuchtete Strähter in den Golf. „Stopp!“ Es war das Signal, sich aus dem Staub zu machen. Martin beorderte den Fahrer nach hinten. Mit Kabelbindern banden sie ihren Opfern die Hände auf den Rücken und sperrten sie im Laderaum ein. Sie würden nicht lange auf Hilfe warten müssen. Die Firmenzentrale von Moneten-Trans geriet spätestens in den Alarmmodus, wenn der Transporter nicht im vorgesehenen Zeitfenster beim Fahrrad- und Motorradshop in Nettelsee vorfuhr.
Der Golf Variant preschte zurück nach Bordesholm. Von dort waren es ohne Umwege etwa 60 Kilometer westwärts bis zum ehemaligen RAF-Lager. Bordesholm verließen die Ex-Terroristen zunächst in Richtung Norden auf der Bundesstraße B4. An der Autobahnauffahrt Blumenthal schlugen sie einen Haken und fuhren auf der A251 und dann weiter auf der A7 gen Süden. An der Abfahrt Neumünster-Mitte ging die Fahrt weiter auf der B430 in Richtung Aukrug, bis diese Ost-West-Achse auf die B77 stieß. Von dort hielten sie nordwärts auf Rendsburg zu. Hinter der Stadt am Nord-Ostsee-Kanal folgten sie westlich der B203 bis zur Abfahrt Fockbek. Von dort hielt Strähter auf ihr Versteck bei Westermühlen zu. Er schonte den Golf nicht. Trotzdem war er unauffällig unterwegs, achtete auf Tempolimits und Blitzer.
An dem holprigen Feldweg kannte Gerda jeden Strauch und jeden Stein. Ohne Beleuchtung tastete sich der Golf unbemerkt im Dunkel des hereingebrochenen Abends zum verwaisten Backsteingebäude vor. In den nächsten zwei Tagen würden Strähter, Paroso und Last in Deckung verharren und in aller Seelenruhe die Geldboxen knacken. Die erste Meldung zu dem Raubüberfall bei Bordesholm hörten sie im Radio in den 20-Uhr-Nachrichten.
„Von den Tätern fehlt bisher jede Spur“, plapperte Martin den Sprecher nach. Alle drei lachten. Sie hatten den Coup gründlich vorbereitet und er ist wieder gründlich gut gegangen.