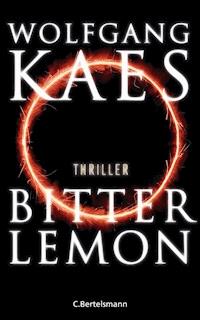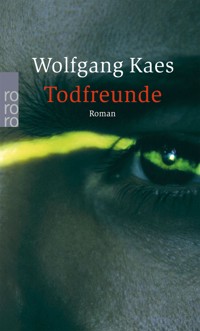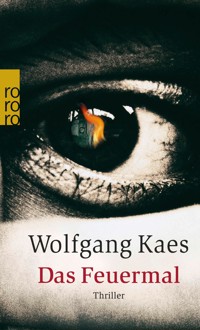
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Morian ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Mann mit dem Feuermal kennt dein tödliches Geheimnis 50 000 Euro Vorauszahlung und das Foto eines gestohlenen Gemäldes stecken in dem Umschlag. Max Maifeld soll das Bild aufspüren und seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückbringen. Er nimmt den Auftrag an und stößt bei seiner Recherche nichts ahnend auf das dunkle Geheimnis seiner eigenen Familie. Maifeld begreift zu spät, dass der Mann mit dem Feuermal ihn als Schachfigur in seinem perfiden Rachefeldzug eingeplant hat. Schon zwei Menschen sind auf grausame Weise umgebracht worden, und das ist erst der Anfang … "Ein neuer deutscher Thriller-Autor der Premium-Klasse." (Kölner Stadt-Anzeiger)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolfgang Kaes
Das Feuermal
Thriller
Über dieses Buch
Der Mann mit dem Feuermal kennt dein tödliches Geheimnis
50000 Euro Vorauszahlung und das Foto eines gestohlenen Gemäldes stecken in dem Umschlag. Max Maifeld soll das Bild aufspüren und seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückbringen. Er nimmt den Auftrag an und stößt bei seiner Recherche nichts ahnend auf das dunkle Geheimnis seiner eigenen Familie. Maifeld begreift zu spät, dass der Mann mit dem Feuermal ihn als Schachfigur in seinem perfiden Rachefeldzug eingeplant hat. Schon zwei Menschen sind auf grausame Weise umgebracht worden, und das ist erst der Anfang …
«Ein neuer deutscher Thriller-Autor der Premium-Klasse.» (Kölner Stadt-Anzeiger)
Vita
Wolfgang Kaes, 1958 in der Eifel geboren, finanzierte sein Studium der Politikwissenschaft und Kulturanthropologie als Waldarbeiter, Hilfsarbeiter im Straßenbau, Lastwagenfahrer, Taxifahrer und schließlich als Polizeireporter. Er schrieb Reportagen für den Stern, die Zeit und andere. 2012 kürte ihn das Medium Magazin zum «Reporter des Jahres», 2013 erhielt er den Henri-Nannen-Preis in der Kategorie «Investigative Recherche». Seit 2003 verarbeitet er seine journalistischen Recherchen auch zu Romanen. Kaes war viele Jahre Chefreporter des Bonner General-Anzeigers, bevor er 2020 entschied, sich künftig ganz dem Bücherschreiben zu widmen.
Mehr zum Autor erfahren sie im Internet unter: www.wolfgang-kaes.de
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2021
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther
Coverabbildung Dave Krieger
ISBN 978-3-644-01308-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Robert, meinen Bruder
Und der Herr sah gnädig auf Abel und seine Opfergabe,
aber Kain und seine Opfergabe sah er nicht gnädig an.
Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick.
Erstes Buch Mose, Genesis 4,4–4,5
Der Abend verhieß nicht die Spur von Abkühlung. Pelzer widerstand dennoch der Versuchung, das Jackett abzulegen, und trat stattdessen hinaus auf den schmalen Balkon. Pelzer atmete schwer. Er zwang sich, jetzt nicht mehr auf die Uhr zu schauen. Er stützte seine Hände auf die Brüstung aus grauem Beton, beugte sich vor und sah hinab, sieben Stockwerke hinab, auf das Ende der Straße. Das Ende der zivilisierten Welt. Er gehörte nicht hierher, so viel stand fest.
Der penetrante Geruch von Gebratenem stieg ihm in die Nase. Er hasste den Geruch, seit dem Magengeschwür. Unten, auf der Wiese neben dem Wendehammer, hatten sie wieder diesen Grill aufgestellt und Feuer gemacht. Als wäre das hier Albanien oder Anatolien oder sonst was. Männer, Frauen, Kinder. Es wurden immer mehr. Von Monat zu Monat mehr. Er hörte jedes Wort, bis hinauf in den siebten Stock, auch wenn er kein Wort verstand von dem, was sie redeten.
Drinnen war die Tagesschau zu Ende. Das Wetter. Das Wetter war seit zwei Wochen unverändert, als stünde die Zeit still. Heiß, nicht zum Aushalten heiß, Tag und Nacht.
Pelzer schaltete den Fernseher aus. Dann starrte er eine Weile die Wohnungstür am Ende der Diele an. Weil niemand klopfte, betrachtete er sich, nur um die Zeit totzuschlagen, zum wiederholten Mal durch die offenstehende Tür des Badezimmers im Spiegel über dem Waschbecken. Er lockerte den Krawattenknoten, nur eine winzige Spur, um besser atmen zu können, und zupfte ein hässliches Haar von der zerknautschten Schulterpolsterung des vom jahrelangen Tragen speckig glänzenden Jacketts.
So weit in Ordnung.
Im Vorbeigehen rückte er den Schnellhefter auf dem Esstisch zurecht, schob die Visitenkarte ein Stück näher an den Schnellhefter heran, sorgsam im rechten Winkel, bevor ihn die Unruhe erneut hinaus auf den Balkon trieb.
Der Schnellhefter war seine Zukunft. Ja, er hatte eine Zukunft, jetzt wieder, endlich. Ihr alle, die ihr ihn schon abgeschrieben habt, ausgemustert habt, totgesagt habt, merkt euch: Klaus-Hinrich Pelzer ist wieder im Geschäft.
Sie waren für acht Uhr verabredet. Jetzt war es zwanzig nach acht. Pelzer steckte sich eine Zigarette an. Das gehörte wohl zum Spiel. Manche Leute brauchten das. König Kunde. Das Spiel der Macht. Na und? Hauptsache, er spielte mit.
Pelzer rauchte so hastig, dass der Filter heiß wurde. Als Erstes würde er sich einen neuen Anzug kaufen. Kleider machen Leute. Er würde die noch ausstehende Miete für das Apartment bezahlen, den Rest vom Juli, und diesmal, pünktlich zum Monatsanfang, den kompletten August. Und endlich die Telefonrechnung.
Und dann?
Mal sehen.
Jemand klopfte an die Tür des Apartments.
Die Klingel war kaputt. Die Haustür stand ohnehin immer offen, im Sommer. Die kaputte Klingel hatte er dem Kunden vorsorglich schon am Telefon gebeichtet. Peinlich, aber nicht zu ändern. Man konnte der Hausverwaltung nicht Beine machen, wenn man mit der Miete im Rückstand war.
Klaus-Hinrich Pelzer ließ die Kippe auf den Beton fallen, trat sie mit der Schuhspitze aus, schloss die Balkontür hinter sich und im Vorbeigehen die Tür zum Badezimmer, atmete tief durch, straffte die Schultern, hob das Kinn, setzte ein Lächeln auf und öffnete.
Den Kunden hatte er sich ganz anders vorgestellt.
Pelzer hatte zwar bisher nur mit ihm telefoniert, das erste Mal vor vier Wochen, als er den Auftrag erhielt, das zweite Mal gestern, als sie den Termin für heute vereinbarten. Aber die Telefonstimme hatte er unbewusst, automatisch, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, einem erfolgreichen Geschäftsmann zugeordnet. Einem Mann, der wusste, was er wollte, und es auch bekam. Einem Mann, der es gewohnt war, Anweisungen zu erteilen. Einem Mann, der kein Wort zu viel verlor und jedes einzelne Wort mit Bedacht wählte. Auf alle Fälle einem Mann, der schicke Anzüge und frischpolierte Schuhe trug.
«Guten Abend. Sind Sie …»
Der Mann nickte nur.
«Bitte kommen Sie doch herein. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nehmen Sie doch Platz.»
Der Mann, der mit einem Kopfschütteln signalisierte, dass er nichts trinken wollte, der nun mitten im Zimmer stand und den angebotenen Sitzplatz ignorierte, trug eine schwarze Maurerhose aus Englisch-Leder, unten mit Schlag und vorne mit doppeltem Reißverschluss, darüber ein verwaschenes Jeanshemd mit abgeschnittenen Ärmeln und unter dem linken Arm eine abgewetzte Schultasche, aus braunem Leder, mit Schnallen und Riemen, die Pelzer an seine Kindheit erinnerte, an die Arbeiter auf dem Heimweg. Außerdem trug der Mann eine Mütze auf dem Kopf, bei der Hitze, eine olivfarbene Mütze, wie sie Soldaten trugen, so eine Art Käppi, mit einem schmalen Schirm aus verknautschtem Baumwollstoff vorne, der fast senkrecht nach unten wies und einen Schatten auf das Gesicht des Mannes warf. Seine Augen waren nur zu sehen, wenn er den Kopf hob. So wie eben, als er binnen Sekunden das Zimmer und die Möbel und den schäbigen Teppichboden taxierte, und so wie jetzt, als er Pelzer in die Augen blickte und sagte:
«Ist das der Ordner?»
Unverkennbar die Stimme vom Telefon. Pelzer atmete auf. Na immerhin. Mehr wollte er gar nicht wissen. Wozu noch Fragen stellen, wenn man am Morgen nach dem ersten Anruf 1000 Euro Spesenvorschuss im Briefkasten findet? Zwanzig Fünfziger in einem unbeschrifteten, unfrankierten Briefumschlag.
«Ja, das ist er.» Pelzer mühte sich, seine Euphorie zu verbergen. «War ein gutes Stück Arbeit. Gar nicht so einfach. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Falls Sie mal wieder meine Dienste in Anspruch nehmen möchten … da liegt meine …»
Während der Mann mit der linken Hand die Schultasche auf Pelzers Esstisch abstellte, zog seine rechte Hand das Käppi vom Kopf, faltete es mit schnellen, geübten Fingern und klemmte es zwischen Gürtel und Hose. Dann nahm der Mann den Schnellhefter vom Tisch, ohne Pelzers Visitenkarte auch nur eines Blickes zu würdigen, und blätterte durch, was Pelzer zusammengetragen hatte, Seite für Seite. Pelzer glaubte, aus den Mundwinkeln des Mannes Zufriedenheit ablesen zu können, bemühte sich aber, den Kunden nicht allzu offensichtlich anzustarren. Wegen des hässlichen weinroten Feuermals, das sich vom Haaransatz des Mannes über die halbe Stirn zog und das linke Auge umrahmte.
Durst. Pelzer hatte Durst.
Der Mann ließ sich Zeit. An einer Stelle hielt er inne, blätterte zurück und runzelte die Stirn. Pelzer hielt das Runzeln und die Stille und die Hitze nicht mehr aus, räusperte sich und sagte:
«Es gibt natürlich die ein oder andere Lücke. Da hätte ich mehr Zeit gebraucht. Und mehr Geld. Aber ansonsten …»
Der Mann hob den Kopf und brachte Pelzer mit einem einzigen Blick zum Schweigen.
Pelzer wischte sich mit dem Handrücken die Schweißperlen von der Stirn und setzte sich auf den nächstbesten der vier Stühle am Tisch. Er spürte, wie sein Hemd unter den Achseln feucht wurde. Jetzt einen ordentlichen Schluck. Der Wodka stand im Kühlschrank. Sollte er einfach aufstehen und sich in der Küche bedienen? Er versuchte, den Gedanken zu verdrängen, und studierte das Gesicht des Mannes in der Hoffnung, darin erneut einen Anflug von Wohlwollen zu entdecken. Das Feuermal war von entstellender Hässlichkeit. Deshalb die Mütze. Ohne das Feuermal hätte er den Mann als attraktiv beschrieben. Das dichte silbergraue Haar war extrem kurz geschoren, das Gesicht wie aus Granit gemeißelt. Der Mann war mittelgroß und schlank, fast hager, dennoch beherrschte und füllte er den Raum. Sehniger Hals, muskulöse Unterarme. Vermutlich hatte er stets viel Sport getrieben. Pelzer zog den Bauch ein.
Wie alt? Ende vierzig vielleicht. Schwer zu schätzen. Die silbergrauen Haare. Der durchtrainierte Körper. Der Mann hatte etwas seltsam Zeitloses an sich, so wie die Männer in den Hochglanzprospekten der Herrenausstatter der Innenstadt, bei denen sich Pelzer gleich morgen mal umschauen wollte. Wenn nicht dieses hässliche Feuermal …
Der Mann hob den Kopf und fing Pelzers Blick ein.
«Ist was?»
«Nein … was soll sein? Heiß hier, finden Sie nicht auch? Das Haus ist leider miserabel isoliert. Im Sommer ist es zu heiß und im Winter zu kalt. Kein Wunder, dass hier nur noch Ausländer einziehen. Und? Sind Sie zufrieden?»
Der Mann nickte wortlos, öffnete seine Tasche und steckte den Schnellhefter kopfüber hinein.
«Das freut mich. Dann bekomme ich also jetzt noch meine restlichen Dreitausend von Ihnen.»
Der Mann entgegnete nichts, sondern zog eine zylinderförmige Thermoskanne aus mattgebürstetem Metall aus der Ledertasche und schraubte sie auf.
«Soll ich Ihnen eine Tasse aus der Küche holen?»
Der Mann antwortete nicht.
«Aber Sie werden sicher nichts dagegen haben, wenn ich mir zum Anstoßen auf unser erstes erfolgreiches Geschäft jetzt auch schnell mal was aus der Küche hole …»
«Bleiben Sie sitzen! Gibt es Kopien von dem Dossier? In Ihrem Computer vielleicht?»
Pelzer schüttelte energisch den Kopf und setzte ein unschuldiges Gesicht auf. «Natürlich nicht. Es gibt nur dieses eine Exemplar. Ich mache keine Mehrfachgeschäfte. Ich verkaufe meine Recherchen immer nur exklusiv an den Auftraggeber. Ich lösche grundsätzlich alles im Computer und …»
Der Röntgenblick ließ Pelzer augenblicklich verstummen und ahnen, dass der Kunde ihm kein Wort glaubte. Aus der offenen Thermoskanne stieg ein Geruch, der Pelzer an Krankenhausflure erinnerte. Jedenfalls roch das nicht nach Kaffee. Der Mann ging zu der Fensterbank neben der Balkontür und schüttete den Inhalt der Thermoskanne über die beiden Yuccapalmen und die Birkenfeige. Pelzer sprang vom Stuhl auf und starrte den Mann ungläubig an. Die glasklare Flüssigkeit tropfte von den Blättern in die Blumentöpfe, und auf der verstaubten Fensterbank aus Kunstmarmor bildeten sich unzählige kleine Pfützen.
«Was machen Sie da? Sind Sie verrückt geworden?»
Der Mann antwortete nicht, sondern schraubte schweigend die Thermoskanne wieder zu und verstaute sie in seiner Schultasche. Dann öffnete er die Balkontür sperrangelweit, nahm ein Streichholz aus der Schachtel, die er in seiner Hosentasche aufbewahrt hatte, zündete es an, trat einen Schritt zurück und schnippte das brennende Streichholz in die Birkenfeige.
Augenblicklich stand die gesamte Fensterfront in Flammen. Pelzer starrte in das Feuer, unfähig, sich auch nur einen Schritt zu bewegen. Seine Unterlippe zitterte.
«Was ist, Herr Pelzer? Wollen Sie das Feuer nicht löschen? Wollen Sie nicht Wasser aus der Küche holen und …»
«Ich … ich kann nicht …»
«Ich weiß, Herr Pelzer. Ich weiß alles. Das können Sie nicht. Dann rufen Sie doch wenigstens die Feuerwehr.»
«Das Telefon … ist …»
Pelzer stand da wie in Trance. Der Schweiß rann ihm von der Stirn, während er in die Flammen starrte.
«Ach richtig, wie dumm von mir. Sie können momentan nur Anrufe empfangen, aber nicht selbst anrufen, weil Sie wieder mal Ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Die Notrufnummer ist aber davon ausgenommen, wussten Sie das nicht?»
«Bitte … helfen Sie mir. Ich …»
«Ich habe eine viel bessere Idee, Herr Pelzer. Gehen Sie schnell auf den Balkon, bevor das Feuer nach Ihnen greift. Gehen Sie hinaus und rufen Sie ganz laut um Hilfe.»
Pelzer spürte, wie der Mann ihn an dem Feuer vorbei durch die offene Balkontür schob.
«Los, machen Sie schon!»
Pelzer beugte sich über die Brüstung. Er krallte seine Hände in den Beton und versuchte zu schreien. Aber da war nichts als ein atemloses Krächzen. Er versuchte es erneut und presste die Luft aus seinen Lungen.
«Feuer …»
Mitten unter den Frauen mit den schwarzen Kopftüchern, die sich um den Grill scharten, stand ein junges Mädchen und schaute auf, unsicher, ob sie sich vielleicht verhört hatte. Ihr Blick glitt über die siebenstöckige Hausfassade, von Balkon zu Balkon.
«Feeeueeer!»
Jetzt hatte sie ihn entdeckt, ihn und die Flammen, die hinter ihm an der Fensterscheibe emporzüngelten. Sie schubste die alte Frau an, die neben ihr stand, sie redete ganz aufgeregt, während ihre kleine, schmale Hand hektisch nach oben deutete. Die alte Frau sah jetzt ebenfalls nach oben, schließlich starrten sie alle zu ihm hoch, etwa ein Dutzend von Pelzers 86 Hausnachbarn, mit denen er bis zu dieser Sekunde noch nie ein Wort gewechselt hatte. Drei, vier, fünf Männer lösten sich aus der Gruppe und rannten von der Wiese über den Wendehammer und verschwanden im Schatten des Hauseingangs. Die Frauen riefen ihm zu und ruderten mit den Armen, bis Pelzer begriff, was sie meinten: Er solle über die gemauerte schulterhohe Abtrennung links neben ihm hinüber auf den Balkon der Nachbarwohnung klettern.
Pelzer streckte die zitternden Hände aus, stützte die Unterarme auf die scharfkantige Blende aus verzinktem Blech und stemmte sich hoch. Seine Schuhsohlen kratzten über den Putz, ohne Halt zu finden. Pelzer strengte sich an. Schließlich schaffte er es, ein Bein auf das Blech zu schwingen. Er kniete hilflos auf der schmalen Trennmauer, unschlüssig, wie er sich nun drehen und auf der anderen Seite herablassen sollte. Ihm wurde schwindlig. Pelzer vermied es, in die Tiefe zu sehen, und starrte stattdessen in das lodernde Feuer jenseits der Scheibe.
In der offenen Balkontür erschien der Mann und lächelte. Pelzer konnte seine Augen nicht sehen, weil er wieder die Mütze trug. Der Mann hob den Kopf und wie in Zeitlupe den ausgestreckten Arm. Jetzt konnte Pelzer die Augen des Mannes sehen. Eines hatte er geschlossen. Der Mann krümmte den Zeigefinger. Das Projektil durchbohrte exakt zwischen Pelzers Augen die Schädeldecke und katapultierte seinen Kopf nach hinten.
Klaus-Hinrich Pelzer war tot, noch bevor sein Körper sieben Stockwerke tiefer auf den Asphalt klatschte.
Der Mini Cooper S heulte beim Zurückschalten auf, schoss aus der Kurve der Autobahnauffahrt, scherte erst auf den letzten Metern der Beschleunigungsspur haarscharf vor einem wild hupenden Sattelzug auf die rechte Fahrbahn, quetschte sich durch eine Lücke in der Karawane, die sich auf der mittleren Fahrbahn in Richtung Norden wälzte, und jagte über die linke Spur seinem Ziel und seiner Höchstgeschwindigkeit entgegen.
«Ganz schön viel Verkehr um diese Uhrzeit. Aber keine Sorge, Josef. Wir schaffen das noch.»
Antonia Dix ließ die Lichthupe aufflammen. Der Mercedes gab sich geschlagen und wechselte zurück auf die mittlere Fahrbahn. Antonia Dix schaltete in den sechsten Gang. Josef Morian rutschte noch tiefer in den engen schalenförmigen Beifahrersitz, der ihm das Gefühl vermittelte, mit seinem Hintern über den rauen, heißen Asphalt zu rutschen. Er rieb sich die schweißnassen Hände auf den Knien trocken und starrte auf den Tacho in der Mittelkonsole.
«Antonia, ich rechne jeden verdammten Tag damit, dass du deinen Führerschein loswirst. Hier ist Tempo 100. Wer kommt nur auf die Idee, in ein so winziges Auto so viel PS zu packen?»
«Josef, du hast die Wahl: Willst du dein Flugzeug noch kriegen, oder willst du, dass ich mich an die Verkehrsregeln halte?»
Morian schwieg. Schließlich war er selbst schuld, dass sie viel zu spät losgefahren waren. Er hatte seine Sonnenbrille nicht gefunden, die er zum letzten Mal vor vier Jahren benutzt hatte. Er war nicht sonderlich darin geübt, Urlaub zu machen. Er hatte das Hotel an der Costa de la Luz erst vor zwei Wochen gebucht. Nachdem ihn der Präsident unmissverständlich dazu aufgefordert hatte, endlich seinen Resturlaub aus dem Vorjahr zu nehmen. Er hatte bis zum heutigen Tag, bis zur zweiten Tasse Kaffee nach dem Frühstück, keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, wo sich seine alte Sporttasche befand, die er als Ersatzkoffer benutzen musste, geschweige denn, womit er sie denn sinnvoll füllen sollte.
Jetzt fiel ihm siedend heiß ein, was er vergessen hatte. Auf dem Küchentisch. Sein Handy. Auch das noch.
«Josef, ich versuche gerade, mir vorzustellen, wie du in Bermudashorts und Hawaiihemd aussiehst.»
«Ich besitze weder Bermudashorts noch Hawaiihemden.»
«Du wirst doch wohl nicht die ganze Zeit in deinem ollen Trenchcoat am Strand rumlaufen, oder?»
«Doch! Aber ich werde nichts daruntertragen.»
Antonia Dix lachte. Morian liebte ihr Lachen. Deshalb brachte er sie so gern zum Lachen. Sie arbeiteten zwar erst vier Jahre zusammen, aber Antonias ständige Nähe war ihm längst zur angenehm wärmenden Gewohnheit geworden. Wie bei einem alten Ehepaar. Abgesehen von dem Altersunterschied. Josef Morian war 49 und fühlte sich manchmal ganz schön alt. Antonia Dix war 31. Wie alt oder wie jung sie sich fühlte, wusste Morian allerdings nicht. Aber vielleicht gehörte auch diese Unwissenheit zu einem ordentlich gealterten Ehepaar.
Antonia setzte den Blinker, verließ die Autobahn und bog auf den vierspurigen Flughafenzubringer ein. Morian glättete den Stoff des gefalteten Regenmantels auf seinem Schoß. Vielleicht war das wirklich eine Schnapsidee. Er hatte gar nicht darüber nachgedacht, welches Wetter ihn in Andalusien erwartete. Noch schwüler als hier würde es am Atlantik hoffentlich nicht sein. Morian hatte den Trenchcoat nur mitgenommen, weil er ihn immer trug. Im Sommer wie im Winter. Auch so eine Gewohnheit. Er packte das Bündel auf seinem Schoß, quetschte es durch die Lücke zwischen den beiden Sitzen und warf es auf die schmale Rückbank des Cooper.
«Du hast recht. Ich nehme ihn doch nicht mit.»
«Gute Entscheidung. Wie wirst du dir denn zwei Wochen lang die Langeweile vertreiben?»
«Ich werde keine Langeweile haben, Antonia. Keine Sorge. Ich werde mich am Hafen ins Café setzen und den Menschen bei der Arbeit zuschauen, ich werde stundenlang den Strand entlangspazieren, ich werde zwei Wochen lang das Nichtstun genießen. Ich habe nicht mal mein Handy eingepackt, was sagst du dazu? Aber wenn irgendwas ist, rufst du mich im Hotel an, ja?»
«Nein! Du hast Urlaub. Da wären wir.»
Antonia Dix parkte den Cooper unmittelbar vor der ersten Drehtür zum Terminal 2 und sprang aus dem Wagen. Während Morian sich noch aus dem engen Sitz zwängte, hatte sie bereits die Sporttasche auf den Bordstein gewuchtet und die Heckklappe des Cooper wieder geschlossen.
«Du meine Güte. Wie alt ist das Teil?»
«Diese Tasche hat meine Karriere als Amateurboxer überlebt. Dann wird sie auch diese Urlaubsreise überleben.»
Die Hitze traf Morian wie eine Keule, nach der Fahrt in dem klimatisierten Auto. Er streckte Antonia die Hand entgegen. «Meine Güte, es kühlt abends gar nicht mehr ab. Danke fürs Bringen. Pass gut auf dich auf. Bis in zwei Wochen.»
«Bist du verrückt? Ich komme noch mit zum Schalter. Oder meinst du, ich riskiere es, dass du dich noch auf den letzten Metern verläufst? Hast du dein Ticket?»
«Gut, dass du es sagst.» Morian öffnete die Beifahrertür, beugte sich in den Wagen, kniete sich umständlich auf die Sitzfläche, lehnte sich über die Kopfstütze und kramte das Ticket aus dem Trenchcoat auf der Rückbank. Als er zum zweiten Mal aus dem Cooper kletterte, fiel sein Blick auf das vor dem rechten Vorderreifen in den Beton gerammte Straßenschild.
«Antonia, hier darfst du nicht parken.»
«Nerv mich nicht, Josef. Los jetzt.»
Als Antonia Dix zwanzig Minuten später wieder auf den Bürgersteig trat, geschahen zwei Dinge gleichzeitig: Ihr Handy klingelte, und ihr Auto wurde von einem Abschleppwagen an den Haken genommen. Antonia Dix sprintete los, baute sich vor dem Kühlergrill des Abschleppwagens auf, hob ihren Dienstausweis über den Kopf und das Handy ans Ohr.
«Beyer hier. Wo zum Teufel steckt Morian? Wieso geht er nicht an sein verdammtes Handy?»
«Er hat Urlaub. Wieso weiß die Kriminalwache das nicht? Steht doch genau vor deiner Nase am Schwarzen Brett.»
Schweigen. Pause. Antonia sah vor ihrem geistigen Auge, wie Oberkommissar Ludger Beyer von der Drogenfahndung, der heute Abend Schichtdienst in der Kriminalwache hatte, das Schwarze Brett studierte. Und sie wusste ganz genau, was er dort in den nächsten zwei Sekunden entdecken würde.
«Oh. Was sehe ich denn da? Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung, Frau Oberkommissarin. Darauf müssen wir aber unbedingt anstoßen. Wie wär’s denn kommendes Wochenende? Ich kenne da ein ganz reizendes …»
«Mit Sicherheit nicht, Herr Kollege. Also? Was ist los?»
«Wir haben eine Leiche. Bonn-Auerberg, Londoner Straße 34–44. Die Strehle ist übrigens längst draußen. Viel Spaß auch.»
Sie saßen zu dritt um den winzigen Tisch des Straßencafés und schwiegen. Theo rührte seit Minuten in seinem Milchkaffee, ohne auch nur ein einziges Mal aufzuschauen. Hurl war klar, was das bedeutete: Theo überließ die Sache ihm. Hurl strich sich mit der Hand über seinen riesigen schwarzen Schädel und ließ den Blick über den Wallrafplatz schweifen, als fände er in dem Gewimmel die Lösung. Zwanzig nach acht, und die Kölner Innenstadt war immer noch voller Menschen, die mit Einkaufstüten durch die Gegend hetzten. Schließlich brach Max das Schweigen:
«Was ist los mit euch?»
Theo sah nur kurz auf, senkte sofort wieder den Blick, rührte emsig weiter und überließ Hurl das Reden.
«Max, wir sollten das Ganze abblasen.»
«Warum?»
«Weil wir unsere Prinzipien verletzen.»
«Wieso?»
«Wir arbeiten nicht für anonyme Auftraggeber.»
«Hurl, er ist noch nicht unser Auftraggeber. Der Mann wollte seinen Namen nicht gleich am Telefon nennen, bevor klar ist, ob wir überhaupt miteinander ins Geschäft kommen. Wenn wir uns morgen bei dem Treffen mit ihm einig werden, dann wissen wir auch, wer er ist. Okay?»
Max gab der Kellnerin ein Zeichen. Die nickte, verschwand im Inneren des «Campi», parkte ihr Tablett auf dem Tresen neben der Kasse und hackte mit ihren lackierten Fingernägeln auf den durchsichtigen, gummiartigen Schonbezug der Tastatur ein.
«Außerdem … was soll schon passieren? Am helllichten Tag. An einem öffentlichen Ort. Mit euch beiden als Rückendeckung. Und außerdem mit Gottes Hilfe von oben …»
Die Kellnerin kam mit dem Kassenbon zurück und legte ihn auf den Tisch. Max griff blitzschnell danach, bevor ihn der plötzliche Windstoß vom Tisch fegen konnte. Als er die Hand wieder öffnete, starrte er ungläubig auf die fettgedruckten Ziffern am Ende der Zahlenkolonne auf dem zerknitterten Zettel: 13,40 Euro. Sie hatten gerade mal zwanzig Minuten an dem Tisch vor dem Café im Erdgeschoss des WDR-Funkhauses verbracht, etwas getrunken und nichts gegessen. Während er einen Zehner und einen Fünfer aus seiner Geldbörse zupfte, starrte die junge Frau unentwegt Hurl an, der das ignorierte und stattdessen durch den schmalen Spalt zwischen den Nachkriegshäusern den Dom betrachtete, der sich schwarz und bedrohlich und 157 Meter hoch dem tiefblauen Himmel entgegenreckte. Max wartete geduldig, bis die Kellnerin sich für das Trinkgeld bedankt, die 15 Euro eingesteckt, sich an Hurl sattgesehen und ihnen noch einen schönen Abend gewünscht hatte, doch Theo kam ihm zuvor:
«Max, ich bin übrigens derselben Meinung wie Hurl. Ist nur so ein Bauchgefühl. Was soll diese dämliche Nummer mit dem Dom als Treffpunkt? Was hat der Typ vor? Man kann den Dom nicht observieren. Unmöglich!»
«Du wirst mich verdrahten, Bruderherz. Und wenn uns die Sache zu brenzlig wird, dann brechen wir sie eben ab. Einverstanden, Theo? Ich muss mal aufs Klo.»
Theo und Hurl sahen Max nach, wie er im Inneren des «Campi» verschwand. Theo schüttelte resigniert den Kopf, beugte sich über den Tisch und rührte wieder in seinem Milchkaffee.
«Theo, ich weiß genau, was das Kopfschütteln bedeutet.»
«So?»
«Ja. Dein Kopfschütteln bedeutet: Er ist stur wie ein Maulesel, aber er ist schließlich dein Bruder, also bist du morgen dabei.»
«So ist es, Hurl. Und du?»
Sie quetschte den Cooper vor dem Wendehammer am Ende der Sackgasse zwischen zwei verlassene Streifenwagen, deren Blaulichter in den blassgrauen Abendhimmel zuckten. Links und rechts von den beiden Streifenwagen hatten die Leute vom Erkennungsdienst Flutlichtmasten aufgebaut. Der gigantische Wohnkomplex am Kopf des Wendehammers wirkte in dem gleißenden Licht wie eine Filmkulisse. Mitten auf der kreisrunden Fläche aus Asphalt knieten drei Kriminaltechniker. Sie trugen schneeweiße Synthetik-Overalls, die das Flutlicht reflektierten, und Handschuhe aus hauchdünnem Latex. Antonia Dix umrundete das rot-weiße Absperrband, nahm den Weg über die verdorrte Wiese, vorbei an einem Grill, dessen Holzkohle ungenutzt vor sich hin glühte.
Sechs Haustüren. Vor dem Eingang mit der Nummer 38 hatte sich ein uniformierter Polizeibeamter aufgebaut. Antonia Dix steuerte auf ihn zu. Er war noch jung. Sehr jung. Er straffte die Schultern und versuchte, seiner Stimme durch Lautstärke Autorität zu verleihen, als er sie anraunzte:
«Wohnen Sie hier?»
«Nein», entgegnete sie, während sie das Ledermäppchen mit dem Dienstausweis aufschnappen ließ. «Ich arbeite hier.»
«Oh. Entschuldigen Sie bitte.»
«Wo?»
«Siebter Stock. Wenn Sie aus dem Aufzug kommen, nach rechts, und dann ist es gleich die erste Wohnungstür links. Quasi der oberste Balkon gleich hier über uns.»
«Danke.»
Sie wusste, dass er ihr nachstarren würde, bis sich die Aufzugtür hinter ihr schloss. Der Aufzug rumpelte mit ihr nach oben, als hätte er alle Zeit der Welt.
Der Flur im siebten Stock war genauso schäbig wie die Eingangshalle. Ihre Augen suchten nach dem Namensschild an der offenstehenden Wohnungstür, aber das wurde von dem breiten Rücken eines älteren Uniformierten verdeckt, der sie kannte und grüßte. Noch bevor sie durch die Tür trat, roch sie Feuer. Nein, das war keine Sinnestäuschung. Das kam auch nicht von dem Grill unten auf der Wiese, dessen Geruch ihr Gehirn erst vor wenigen Minuten abgespeichert hatte.
Eine kurze, schmale Diele, von der rechts zwei Türen abgingen. Ein enges Duschbad, nicht besonders sauber. Eine winzige Küche, in der schon lange nicht mehr aufgeräumt worden war. Der Rest des Apartments bestand aus einem einzigen Zimmer.
Ein kreisrunder Esstisch aus billigem schwarzlasiertem Kiefernholz, vier wacklige Holzstühle, die Sitzflächen aus Bast-Imitat. Ein aufklappbares Schlafsofa aus schwarzem Kunstleder. Ein Bücherregal, zur Hälfte gefüllt. Ein winziger Schreibtisch ohne Schubladen, wie aus der Kinderabteilung bei Ikea. Darauf ein Computer, ein Röhrenmonitor, Tastatur und Maus. Neben dem Schreibtisch, auf dem Fußboden, ein Fernseher. Kein einziges Bild an den Wänden.
Wie ein weiteres Möbelstück stand mittendrin Erwin Keusen im weißen Overall, der bedenklich über seinem Bauch spannte, schob die Kapuze vom verschwitzten Kopf, als er Antonia sah, drehte die Handflächen nach außen und zuckte mit den Schultern, was hieß: Ich habe bisher so gut wie nichts, was ich dir anbieten kann. Seine vier Mitarbeiter waren schon dabei, ihr Werkzeug in den Alukoffern zu verstauen. Antonia hob die Augenbrauen, was Erwin Keusen dazu veranlasste, seinen Kopf in Richtung der Balkontür am Kopfende des Zimmers zu bewegen.
Staatsanwältin Ulrike Strehle stand an der Brüstung und blickte hinunter auf die Straße. Elegantes sandfarbenes Kostüm. Der Rock war gerade lang genug, um nicht unseriös zu wirken, aber kurz genug, um ihre schönen Beine hinreichend zur Geltung zu bringen. Das galt ebenso für die Höhe der Absätze ihrer schwarzen Pumps. Das blondgesträhnte Haar war mit einer scheinbaren Nachlässigkeit zu einer Hochsteckfrisur arrangiert, wie das gewöhnlich nur sehr gute und sehr teure Friseure hinkriegen. Sie trug ein Klemmbrett aus Plexiglas unter dem Arm. Das oberste Blatt des eingespannten Papiers war noch jungfräulich weiß. Antonia Dix hatte noch nicht ganz die Schwelle überschritten, da fragte sie, ohne sich umzudrehen:
«Wo ist Morian?»
«In Urlaub.»
Antonia Dix stellte sich ebenfalls an die Brüstung, neben sie, mit mehr Abstand als nötig, und folgte ihrem Blick hinunter auf den grellerleuchteten Wendehammer. Sie wusste genau, was jetzt hinter ihrem Rücken vor sich ging: Keusens Männer würden eine Pause einlegen, die beiden Frauen durch die Fensterscheibe beobachten und sich dabei angrinsen und zunicken. Das hatte zum einen mit der unsäglichen Geschichte zu tun, die vor zwei Wochen in der Rheinland-Ausgabe der Bild-Zeitung erschienen war:
Den Text hatten zwei Fotos garniert. Eines zeigte Staatsanwältin Ulrike Strehle von der Abteilung für Kapitalverbrechen während einer Pressekonferenz. Wie aus dem Ei gepellt. Das andere Foto zeigte Oberkommissarin Antonia Dix, als sie noch Kommissarin war und gerade das Präsidium verließ:
… Bauarbeiter-Schuhe mit Stahlkappen. Schwarze Military-Hosen. Hautenges schwarzes T-Shirt. Das Schulterholster
mit der großkalibrigen Pistole verborgen unter einer alten schwarzen Kradmelder-Lederjacke, so steif und so schwer wie eine Bleiweste. Und so zäh wie ihre Besitzerin: Antonia Dix. Als zöge sie in den Krieg. In den täglichen Krieg gegen das Verbrechen. Aber selbst ihre typische Arbeitskluft und das raspelkurz gestutzte pechschwarze Haar können ihre Schönheit und das Blut Brasiliens, das in ihren Adern pocht, nicht verbergen …
«Und Sie? Weshalb kommen Sie erst so spät?» Ulrike Strehle warf Antonia Dix einen Blick von oben herab zu, eine leichte Übung für sie, bei 1,80 Metern Körpergröße.
«Ich hatte Morian zum Flughafen gefahren. Danach musste ich meinen Wagen erst einmal aus den Krallen eines geldgeilen Abschleppunternehmers befreien.»
Ulrike Strehle starrte sie verständnislos an, als läge das Parken im Parkverbot außerhalb ihrer Vorstellungskraft.
«So, nachdem auch dieser wichtige Punkt geklärt wäre, könnten Sie mich vielleicht kurz ins Bild setzen, Frau Staatsanwältin.»
«Normalerweise verhält sich das umgekehrt, Frau Dix: Die ermittelnde Polizei setzt die Staatsanwaltschaft ins Bild. Aber gut. Alles spricht bisher für einen Suizid.»
Alles.
Ulrike Strehle widmete sich wieder dem Wendehammer sieben Stockwerke unter ihr. Der zweite Grund, warum Keusens Männer feixend und erwartungsfroh durch die Fensterscheibe starrten, war die allseits bekannte Tatsache, dass sich die Staatsanwältin und die Oberkommissarin nicht besonders gut leiden mochten.
Stutenbissigkeit nannten das die Männer beider Behörden in völliger Selbstüberschätzung. Stuten bissen sich in Konkurrenz um den Hengst. Antonia Dix war noch kein einziger Hengst in den beiden Behörden begegnet, der es nur annähernd wert gewesen wäre, deshalb mit einer Frau in Dauerfeindschaft zu treten. Antonia Dix war einfach nur der Meinung, dass die Einser-Juristin Ulrike Strehle nicht den geringsten Schimmer von polizeilicher Ermittlungsarbeit hatte, in den zwei Jahren ihrer Amtszeit auch nichts dazugelernt hatte und diese erhebliche Schwäche mit maßloser Arroganz tarnte.
«Aha. Suizid also. Na, dann ist ja alles klar, nicht wahr? Haben Sie die Leiche gesehen?»
«Natürlich. Sie lag ja lange genug da unten. Man hat sie erst vor fünf Minuten abtransportiert.»
«Und? Ist Ihnen an der Leiche etwas aufgefallen?»
Ulrike Strehle stockte. Mehr hatte Antonia Dix nicht gewollt. Weil sie geahnt hatte, dass die Staatsanwältin der Leiche garantiert nicht näher als fünf Meter gekommen war. Die Strehle war im ganzen Präsidium dafür bekannt, dass sie gerne einen großen Bogen um Leichen machte und sich mit der späteren aseptischen Papierversion begnügte.
«Morgen früh haben wir von der Rechtsmedizin das Ergebnis der Obduktion. Dann wissen wir sicherlich mehr, Frau Dix.»
«Zeugen?»
«Jede Menge. Da unten wurde wohl ein Grillfest gefeiert, als der Mann sprang. Ich habe sie alle ins Präsidium bringen lassen. Ihr Kollege Beyer vernimmt sie gerade auf der Kriminalwache mit Hilfe eines irakischen Dolmetschers.»
Fehler. Großer Fehler. Zeugenaussagen mussten frisch sein. Schon alleine die Fahrt ins Präsidium konnte die Erinnerungen verwischen, die Unterhaltung im Polizeibus individuelle Eindrücke auslöschen, zugunsten eines kollektiven Einheitsbreis. Antonia Dix seufzte und schwieg.
«Eigenartig ist nur die Sache mit dem Feuer.»
«Feuer?»
Antonia Dix wurde hellhörig.
«Ja, Feuer. Alle Zeugen schwören, hier oben habe es gebrannt. Die Wohnung habe in Flammen gestanden, als der Mann sprang. Aber wie Sie selbst sehen, ist die Wohnung völlig unversehrt, Frau Oberkommissarin. Wenn es hier oben lichterloh gebrannt hätte, stünden wir jetzt unten auf der Straße und würden der Feuerwehr beim Löschen des gesamten Gebäudes zusehen. Das bedeutet also leider: Die Aussagen der Teilnehmer dieses Grillfestes sind insgesamt wohl nur von höchst eingeschränktem Wert.»
«Kaltes Feuer.»
«Wie bitte?»
«Riechen Sie denn nicht, dass es hier gebrannt hat? Kaltes Feuer. Erwin? Kannst du mal kommen?»
Als hätte der Leiter des Erkennungsdienstes nur auf sein Stichwort gewartet, erschien Erwin Keusen auf dem Balkon und hob in rheinischem Singsang zu einem seiner ebenso brillanten wie berüchtigten Monologe an:
«Ganz einfach. Du nimmst Alkohol, aber nicht irgendeinen, sondern einen, der sich gut mit Wasser vermischen lässt und sich nicht anschließend im Ruhezustand wieder vom Wasser absondert. Ethanol zum Beispiel. Oder Isopropanol. Den verdünnst du also stark mit Wasser, grob gesagt im Verhältnis eins zu eins. Wasser hat eine hohe Wärmekapazität. Das bedeutet, dass sehr viel Energie verbraucht wird, um das Wasser zu erwärmen. Das geht der Verbrennungsenergie verloren. Zum anderen liegt der Siedepunkt von Wasser ideal, und die Verdampfungsenthalpie ist extrem hoch, ungefähr 2,2 Kilojoule pro Gramm.»
«Erwin, erkläre der Staatsanwältin doch bitte mal in einfachen Worten, was das bedeutet.»
«Das bedeutet, dass bei der Verbrennung des Gemischs das dabei verdampfende Wasser automatisch die dabei kontaktete feste Materie kühlt, weil die Energie, die zum Verdunsten des Wassers aufgebracht werden muss, eben nicht zur Temperatursteigerung der Umgebung zur Verfügung steht. Das Wasser hat ja selbst keinen Brennwert, es wirkt also nicht energieliefernd, sondern quasi kontraproduktiv für den Verbrennungsvorgang.»
«Herr Keusen, ich verstehe noch nicht ganz.»
Juristen, dachte Erwin Keusen. Fachidioten.
«Kaltes Feuer. Das Zeug wird auf Theaterbühnen benutzt. Oder beim Zirkus. Der Begriff ist etwas irreführend, weil auch dieses Feuer ganz schön heiß ist. Aber es richtet keinen Schaden an. Es kann sich nicht ausweiten. Weil das verdampfende Wasser den scheinbar brennenden Gegenstand abschirmt. So verbrennt nicht der Gegenstand, sondern nur der Alkoholdunst. Frau Strehle, Sie könnten also jetzt getrost einen der 100-Euro-Scheine aus Ihrem Portemonnaie zücken, mit diesem Gemisch tränken und anzünden. Es gäbe zwar ein hübsch ansehnliches Feuerchen. Doch sobald der Anteil des verdunstenden Alkohols unter einen bestimmten Grenzwert sinkt, erlischt die Flamme. Und der Geldschein ist unversehrt, abgesehen vielleicht von ein paar schwach bräunlichen Verfärbungen. Solche Verfärbungen haben wir an den Pflanzen gefunden. Wir nehmen die Pflanzen jetzt mit und untersuchen sie im Labor. Das ist nur eine Vermutung, und es wird wohl auch eine Vermutung bleiben, weil das Gemisch leider ohne Rückstände verbrennt. Aber ich glaube, dass die Zeugen sich nichts eingebildet haben: Auf dieser Fensterbank hat es ein ordentliches und weithin leuchtendes Feuerchen gegeben.»
Erwin Keusen drehte sich grußlos um und zog mit seinen Männern ab. Ulrike Strehle klapperte eine Weile mit ihren Fingernägeln auf dem Klemmbrett herum.
«Halten Sie mich auf dem Laufenden, Frau Dix.»
Dann verschwand auch sie.
Endlich allein. Antonia Dix atmete erleichtert auf. Sie musste sich zunächst ein Bild machen von dem Menschen, der hier gewohnt hatte. Wie hieß er noch gleich? Ihr Blick fiel auf die Visitenkarte, die auf dem Esstisch lag:
Klaus-Hinrich Pelzer
Investigativer Journalismus
Wenn die Visitenkarte dem Toten gehört hatte, dann musste sich Antonia Dix kein Bild mehr von ihm machen. Denn sie wusste, wer Klaus-Hinrich Pelzer war. Sie durchquerte die Diele und sah auf dem Messingschild außen an der Wohnungstür nach. Er war es. Klaus-Hinrich Pelzer. Sein Name war ihr zuletzt vor zwei Wochen begegnet: in der Autorenzeile des Bild-Artikels über die schönen Bonner Verbrecher-Jägerinnen.
Wenn man Geld in die winzige Schale zu ihren schönen, nackten Füßen warf, erwachte sie schlagartig zum Leben. Dann machte sie zuerst ein erstauntes Gesicht und dann ein paar ungelenke Schritte, als müsste sie sich erst an das Leben gewöhnen. Schließlich drehte sie anmutig Pirouetten, schneller und immer schneller, bis sich ihr feuerrotes Hexenkleid aufblähte und den Blick auf ihre schlanken Beine freigab. Dabei klapperte sie in kindlicher Freude mit ihren Kastagnetten, bis ihr Puppenlächeln plötzlich erstarb und sie wieder erstarrte, als sei sie kein Mensch, sondern ein Exponat aus dem benachbarten Museum Ludwig für zeitgenössische Kunst. Entnervte Eltern zerrten ihre um weitere Münzen bettelnden Kinder weiter, und die Chinesen hörten auf, sie zu knipsen, nahmen sich wieder den Dom vor und versuchten verzweifelt, das 157 Meter hohe Motiv hochkant in die Displays ihrer Digitalkameras zu quetschen.
Max Maifeld sah dem Spektakel auf der Domplatte eine Weile zu, bis er entdeckte, wonach er suchte: eine Reisegruppe, die auf das Petersportal im Südturm zustrebte. Ideal, um sich vor der Zeit unerkannt und in Ruhe umzusehen. Max warf der erstarrten Tänzerin zwei Euromünzen in die Schale, ignorierte ihre sofortige Wiederauferstehung und mischte sich unter die verschwitzten Senioren, die in der sengenden Mittagssonne quer über den Platz trotteten, brav ihrer Stadtführerin folgten, ängstlich darauf bedacht, den Anschluss nicht zu verlieren, sichtlich erschöpft vom schier endlos langen Fußmarsch durch die große, fremde, brütend heiße Stadt, aber dennoch wild entschlossen, sich die wichtigste Sehenswürdigkeit Kölns unter keinen Umständen entgehen zu lassen, bevor der unten am Rheinufer wartende Omnibus sie wieder abtransportieren würde.
Im Inneren des Doms herrschte eine angenehme Kühle. Kollektives, geräuschvolles Aufatmen, gefolgt von maßlosem Staunen über eines der größten sakralen Bauwerke der Welt. Stumme Blicke nach oben, in schier endlose Höhen, die jeden Menschen auf der Stelle zur Bedeutungslosigkeit schrumpfen ließen und doch zugleich dem Himmel näher brachten. Eben das, was die Architektur der Gotik bezweckt hatte und den rheinischen Katholizismus perfekt beschrieb: die harmonische, nur scheinbar paradoxe Allianz aus Demut und Größenwahn.
«Meine Damen und Herren, Sie befinden sich mitten in der ältesten Baustelle der Welt.»
Dankbares Nicken. Besuchergruppen liebten Superlative. Sie folgten der Stadtführerin durch den Mittelgang des Hauptschiffes. Gedränge, Geschiebe, als in der Vierung eine zweite Gruppe kreuzte: Jugendliche, die lachten und respektlos laut miteinander redeten. Die Domschweizer in den roten Talaren waren ihnen bereits auf den Fersen, um ihnen klarzumachen, dass man im Gotteshaus die Baseballkappe vom Kopf nimmt. Verständnisloses Achselzucken, weil die Jugendlichen kein Deutsch verstanden und ohnehin nichts hören konnten, wegen der MP3-Player-Stöpsel in ihren Ohren.
Die resolute Stadtführerin stoppte ihre Senioren, indem sie kurz und energisch die Hand hob, und ließ die Baseballkappenträger sowie die sie verfolgenden Domschweizer passieren. Die Stadtführerin war eine kleine, zerbrechlich wirkende ältere Dame in einem dunkelblauen Kostüm, das an die Uniformen von Lufthansa-Stewardessen aus der Propeller-Zeit erinnerte, und sie verfügte über die seltene Gabe, langsam und leise zu sprechen und dennoch alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
«Als Erzbischof Reinald von Dassel am 23. Juli 1164 mit den Gebeinen der Heiligen Drei Könige in Köln eintraf, war bald entschieden, dass die sterblichen Überreste von Kaspar, Melchior und Balthasar, der drei Weisen aus dem Morgenland, eine angemessene Unterkunft bekommen sollten. Eine Kathedrale, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte.»
Alle nickten und starrten den goldenen Schrein im inneren Chor an. Scheinwerfer ließen die bunten Edelsteine funkeln. Max brauchte eine Weile, bis er Theo entdeckte: Im nördlichen Querhaus, hinter einem Meer brennender Kerzen, kniete er zwischen den betenden Frauen in der Kirchenbank; die gefalteten Hände ruhten auf dem abgegriffenen Holz.
Wo war Hurl?
«… drei Jahrhunderte lang wurde gebaut und gebaut. Bis das Geld ausging. Da stand also nun der fertige Chor, und am anderen Ende der halbfertige Glockenturm mit dem hölzernen Arbeitskran obendrauf. Ein Fragment, das Napoleons Revolutionstruppen nach der Invasion im Jahr 1794 als Waffenlager benutzten.»
Entsetztes Kopfschütteln und empörtes Raunen. Diese Franzosen. Diese Gottlosen. Wo steckte Hurl?
«… erst 1842 wurde weitergebaut, und am 15. Oktober 1880 wurde in Anwesenheit Seiner Majestät des Kaisers Wilhelm I. feierlich der letzte Stein auf die Kreuzblume des Südturms gesetzt. Die Hohe Domkirche zu Köln war nach 632 Jahren Bauzeit vollendet. Aber schon 1905 wurde die Dombauhütte wieder geöffnet, um erste Schäden zu beheben und marode Bauteile zu ersetzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Dom bleibt wohl eine Baustelle bis in alle Ewigkeit. Der ätzende Taubenkot, der saure Regen, die Abgase der Autos und der Industrie: Niemand von Ihnen wird den Dom jemals ohne Gerüst sehen.»
«Max? Hörst du mich?»
Theos Flüstern drang aus dem Stöpsel im linken Ohr. Max nickte unmerklich in Richtung seines Bruders.
«Weißt du noch? Ferrari-Hein hat immer gesagt: Wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter.»
Max nickte erneut. Natürlich wusste er noch, was der Altgeselle ihres Vaters gesagt hatte. Das und alles andere, was Ferrari-Hein ihnen gesagt hatte, als sie noch Kinder waren.
Die Senioren applaudierten. Die Führung war beendet. Max sah auf die Uhr. Höchste Zeit.
Hauptschiff, rechte Bankreihe, die vierte Bank, von vorne gezählt, der Platz ganz außen am Mittelgang, so wie vereinbart. Max setzte sich und wartete. Hier wollte sich der Auftraggeber mit Max treffen. In genau zweieinhalb Minuten.
Seine Augen hielten weiter diskret Ausschau nach Hurl. Sein Blick wanderte schließlich die filigranen Pfeiler empor, bis zu der Klais-Orgel, die wie ein Schwalbennest an der Nordwand unter der 43 Meter hohen Decke des Langhauses klebte. Max atmete erleichtert auf. Nur der gewaltige polierte Schädel war zu sehen. Und das Fernglas vor Hurls Augen. Das Fernglas schwenkte wieder nach oben, wanderte entlang der Galerie in der Südwand des Langhauses, hielt plötzlich inne. Blitzschnell verschwand das Fernglas mitsamt Hurls Kopf.
«Sind Sie Max Maifeld?»
Neben ihm, im Mittelgang, standen zwei Mädchen. Max schätzte sie auf vierzehn, vielleicht auch jünger. Die beiden Mädchen trugen Jeans, Turnschuhe und knappe T-Shirts, deren Saum weit über dem Bauchnabel endete. Sie wirkten verlegen, sie tauschten Blicke und kicherten albern, während sie auf eine Antwort warteten.
«Ja. Warum?»
«Sie sollen mal auf Seite 584 nachschauen.»
Sie rannten davon, als sei der Teufel hinter ihnen her, auf das Seitenportal im nördlichen Querhaus zu.
«Theo? Siehst du die beiden? Schnapp sie dir.»
Theo rührte sich nicht, bis die Mädchen an ihm vorbei zum Ausgang rannten. Dann bekreuzigte er sich, erhob sich aus der Bank und schlenderte hinaus.
Vielleicht ein Arbeiter. Hurl konnte sein Gesicht nicht erkennen. Der Mann trug einen Schutzhelm und blickte angestrengt in die Tiefe. Kein Irrtum: Der Mann im Schatten der Pfeiler der jenseitigen Galerie hatte Max im Visier. Jetzt hob der Mann den Kopf, als ahnte er, dass er von der gegenüberliegenden Galerie beobachtet wurde. Ihre Blicke kreuzten sich. Eine Sekunde später hatte sich der Mann mit dem Helm in Luft aufgelöst.
Hurl stopfte das Fernglas in seinen Rucksack, kletterte die Leiter hinauf zum Zwischendach, stieß die Luke auf, zwängte sich durch die enge Öffnung, balancierte über den schmalen Außensteg zwischen Himmel und Erde, kletterte durch das Strebewerk, trat die provisorische Tür zur elektronischen Steuerungszentrale des Uhrwerks auf, öffnete lautlos die nächste Tür zu dem gigantischen Hohlraum zwischen Gewölbe und Spitzdach und sprintete los, über Gänge und Treppen, vorbei an den Aufenthaltsräumen und Toiletten und Werkstätten und kreischenden Maschinen und dem Lager mit den tausend Gipskopien der wasserspeienden, fratzenschneidenden Höllengeschöpfe, vorbei an den verdutzten Gesichtern der Steinmetze, Dachdecker, Tischler, Zimmerer, Schmiede, Maler und Glaser, für sich und vor allem für sie hoffend, dass sich ihm niemand in den Weg stellen und den Helden markieren würde, auch nicht der Falkner, der in diesem Moment um die Ecke bog und den er fast umgerannt hätte, mitsamt dem hysterisch aufschreienden, flügelschlagenden Taubenjäger auf der behandschuhten Faust.
Nur der Mann mit dem Helm begegnete ihm nicht. Zwei Minuten später stellte Hurl fest, dass er sich verlaufen hatte. Er kehrte um, hastete zurück, bis er schließlich die richtige Treppe hinunter zu der Galerie fand, wo er den Mann mit dem Helm gesehen hatte.
Nichts. Niemand.
Hurl beugte sich vor und sah in die Tiefe.
Der Platz in der vierten Reihe.
Max war verschwunden.
Seite 584. Auf jedem Platz in der Kirchenbank lag ein rotes Buch. Max Maifeld griff nach dem Exemplar auf seinem Platz. GOTTESLOB stand darauf, in goldenen Buchstaben. Max schlug das Buch auf. Kirchenlieder. Hauchdünnes Papier, stockig und fleckig von unzähligen mit der Zunge befeuchteten Zeigefingern.
Seite 584.
Christi Mutter stand mit Schmerzen / bei dem Kreuz und weint von Herzen / als ihr lieber Sohn da hing …
Darunter hatte jemand mit Kugelschreiber in blauer, kantiger Schrift vier Ziffern und ein Ausrufezeichen notiert: 1266!
Und jetzt?
Max schaute auf die Uhr. So viel war klar: Der Auftraggeber würde nicht mehr erscheinen. 1266! Max riss die Seite aus dem Gesangbuch und verließ die Bank.
«Max? Ich hab die Mädels. Aber die wissen nix. Die schlottern zwar jetzt vor Angst, weil ich …»
Der Empfang wurde schlechter. Max schirmte das winzige Mikro in seinem Ohr mit der hohlen Hand ab.
«… sie sagen, ein fremder Mann hat sie angesprochen und ihnen fünfzig Euro gegeben, damit sie dir zwei Sätze sagen und dann abhauen. Sie erinnern sich nur, dass der Mann wie ein Bauarbeiter aussah. Was soll ich machen, Max? Ihr Bus mit der ganzen Klasse wartet schon und hupt hier wild rum, und die Lehrerin wird langsam hysterisch. Soll ich …»
«Lass sie laufen, Theo. Lass sie einfach laufen.»
«Mach ich. Alles in Ordnung bei dir?»
«Alles in Ordnung. Bis später.»
Max Maifeld versuchte sich vorzustellen, wie sein Bruder zwei halbwüchsigen Mädchen Angst einjagte, damit sie mit der Wahrheit herausrückten. Theo war zwar fast 1,90 Meter groß und ein beeindruckendes Muskelpaket, wenn auch lange nicht so groß und breit wie Hurl, aber Theo konnte man die grenzenlose Gutmütigkeit schon von der Nasenspitze ablesen.
Im Souvenir-Shop gleich neben der Treppe zur Schatzkammer durchkämmte Max die Broschüren und Bildbände über den Dom. 1266. Was war das? Eine Entfernungsangabe? Länge, Höhe, Breite. Das Gewicht der Glocken. Nichts von dem, was er in den Büchern fand, passte. Eine Jahreszahl?
«Kann ich Ihnen helfen?» Der ältere Herr hinter dem Tresen beobachtete ihn über den Rand seiner Brille hinweg.
«Nein, danke.» Oder vielleicht doch?
«Sagt Ihnen die Zahl 1266 etwas?»
«Eintausendzweihundertsechsundsechzig?» Der Mann zuckte ratlos mit den Schultern.
«Oder vielleicht Zwölfhundertsechsundsechzig?»
«Warum sagen Sie das nicht gleich? Das Judenprivileg.»
«Das was?»
Der Mann kam hinter der Theke hervor, nahm Max die Broschüre aus der Hand und blätterte darin, bis er fand, was er suchte.
«Hier!» Energisch tippte er mit dem Zeigefinger auf die Seite. «Hier steht’s doch: 1266. Das Judenprivileg. Aber da können Sie jetzt nicht hin. Wegen der Beichte.»
Nach mehreren gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Kölner Juden erließ Erzbischof Engelbert von Falkenburg im Jahr 1266 ein Privileg, das die Juden der Stadt fortan unter seinen persönlichen Schutz stellte und ihnen das Recht zur ungestörten und zollfreien Bestattung ihrer Toten gewährte. Das geschah weniger aus christlicher Nächstenliebe als vielmehr aus dem Kalkül, dass die Steuern der Juden eine nicht unbeträchtliche Einnahmequelle für den Erzbischof darstellten.
Das Judenprivileg von 1266 wurde in Stein gemeißelt und später mit Hilfe eines Sockels und eines abschließenden Zinnenkranzes an der südlichen Wand des Chorumgangs platziert …
Ein Domschweizer mit breitem Kreuz stand vor dem schmiedeeisernen Gitter und versperrte den Weg.
«Können Sie nicht lesen? Da! Das Schild! Da steht’s doch groß und breit: Kein Durchgang für Touristen …»
«Ich bin kein Tourist. Ich will zur Beichte.»
Der Domschweizer, dessen fleckig-rote Gesichtsfarbe eine ungesunde Neigung zu Bluthochdruck und cholerischen Wutausbrüchen erahnen ließ, musterte Max, als habe ihm soeben erst ein Anruf aus dem Vatikan bestätigt, dass ausschließlich Großmütterchen mit gramgebeugtem Rücken das heilige Sakrament der Versöhnung per Ohrenbeichte zuteil werden dürfe. Doch dann ließ er Max passieren und starrte ihm misstrauisch nach, bis ihn die Krümmung des Chors verschluckte.
Das perfekte Versteck. Max sah sich nach allen Seiten um, bis er sicher war, dass er nicht beobachtet wurde. Dann stellte er sich auf die Zehenspitzen. In der tiefen Mulde hinter dem Zinnenkranz ertasteten die Finger seines ausgestreckten Arms, wonach er suchte: einen großen braunen Umschlag.
Klaus-Hinrich Pelzer. Geboren 1946 im Ost-Berliner Bezirk Treptow. Erlernter Beruf: Schriftsetzer. Zuletzt ausgeübter Beruf: Journalist. Zuletzt wohnhaft in Bonn-Nord, Retorten-Stadtteil Auerberg, Londoner Straße 34–44. Geschieden. Kinderlos. Alkoholiker. Zwei von der Kasse finanzierte, aber erfolglose Entziehungskuren. Anfang des Jahres hatte sich Klaus-Hinrich Pelzer einen langen, demütigenden, am Ende aber vergeblichen Briefwechsel mit seiner Krankenkasse geliefert, in der Hoffnung, auch noch eine dritte Kur bezahlt zu bekommen.
Antonia Dix legte den Briefwechsel auf den linken Stapel, stützte die Ellbogen auf ihren Schreibtisch, unterdrückte ein Gähnen und sah auf die Uhr. Erwin Keusens Leute hatten in der Wohnung alles für sie eingesammelt, was sie an Papier finden konnten, außerdem Pelzers Computer gefilzt und ihr die komplette Festplatte ausgedruckt. Seit zwei Stunden schon robbte sie sich auf der Suche nach dem Grund für Pelzers Tod durch Pelzers Leben, sofern es schriftlich fixiert war. Den linken Stapel hatte sie hinter sich, den rechten noch vor sich.
Der linke Stapel war auch nach zwei Stunden immer noch deprimierend mickrig, so deprimierend und so mickrig wie Pelzers verpfuschtes Leben. Der rechte Stapel schien unterdessen noch keinen Millimeter geschrumpft zu sein. Zwischen den beiden ungleichen Stapeln lag ihr Schreibblock, auf dem sie sich Notizen machte. Viel stand da noch nicht. Stichworte, manche wieder durchgestrichen, manche mit Ausrufezeichen oder inzwischen mit einem Häkchen für «erledigt» versehen, wie etwa:
Bild Köln anrufen!
Die letzten Jahre seines Lebens hatte ihm die Kölner Redaktion der Bild-Zeitung ein Gnadenbrot verschafft; solange er Geschichten lieferte, konnte er seine Miete bezahlen. Besser gesagt: solange sie seine gelieferten Geschichten druckten. Offenbar war Pelzers Mitarbeit aber nicht mehr sonderlich gefragt, wie Antonia Dix bei der Durchsicht der aus Pelzers Computer gefischten Honorarabrechnungen feststellte. Die letzte Geschichte, die sie ihm vergütet hatten, war ausgerechnet die von den schönen Bonner Verbrecher-Jägerinnen. Davor klaffte ein Loch von dreieinhalb Monaten. Und davor eines von fast fünf Monaten.
Wovon hatte der Mann nur gelebt?
Zuletzt hatte er seine Telekom-Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Die Telekom hatte ihm die Leitung für Telefon und Internet gesperrt. Also ließen sich auch keine aktuellen E-Mails in seinem Computer finden. Pelzer war finanziell am Ende, als er starb. Das hatte ihr vor zwanzig Minuten der stellvertretende Leiter des Kölner Bild-Büros am Telefon bestätigt:
«Im Grunde war er ein armes Schwein.»
«Im Grunde?»
«Na, wie soll ich sagen? Sein Privatleben. Seine Spielsucht. Der Alkohol. Außerdem … man soll ja über Tote nicht schlecht reden, aber … um ehrlich zu sein: Seine Storys waren Schrott. Seit Jahren nur noch Müll. Dabei war Pelzer gar kein übler Rechercheur. Im Gegenteil. Er konnte sich festbeißen. Aber er konnte sein recherchiertes Material nicht adäquat umsetzen. Seine Schreibe war eine einzige Katastrophe. Hölzern. Furchtbar gedrechselt. Vor dreißig Jahren war das vielleicht mal angesagt. Wissen Sie, irgendwie hat er mich immer an eine dieser Figuren aus den klassischen griechischen Tragödien der Antike erinnert. Geboren, um zu verlieren. Sie verstehen sicher, was ich meine.»
Antonia Dix verstand zunächst einmal nur, dass der Mann von Bild Köln keine Ahnung von antiken Tragödien hatte.
«Nein. Wie meinen Sie das?»
«Nun ja, viel weiß ich nicht über sein Leben. Niemand hier weiß viel über ihn. Aufgewachsen im Osten Berlins. Also in der DDR. Einzelkind. Eltern früh verstorben, bei einem Brand. Heimkind. Schriftsetzerlehre bei einer der SED-Zeitungen. Später hat er sich rübergemacht in den Westen. Aber mehr …»
Antonia war plötzlich elektrisiert. «Moment mal. Was haben Sie da eben gesagt? Die Eltern sind …»
«Ja. Bei einem Wohnungsbrand. Da war er wohl noch ein kleiner Junge. Hat als Einziger überlebt, weil ihn die Mutter rechtzeitig aus dem Fenster warf, aus dem vierten Stock, direkt ins Sprungtuch der Feuerwehr. Seine Eltern aber sind jämmerlich verbrannt. Das hat er wohl nie verwunden. Jedenfalls: Feuer versetzte ihn augenblicklich in Panik. Manche Kollegen hier haben sich schon mal einen Scherz daraus gemacht. War aber nie böse gemeint. Wissen Sie, der Pelzer zuckte schon zusammen und wurde panisch, wenn man nur ein Streichholz in seiner Nähe anzündete.»
«Ich dachte, Pelzer war selbst Raucher?»
«War er auch. Kettenraucher. Allerdings benutzte er immer nur diese billigen Wegwerffeuerzeuge und stellte sie auf ganz kleine Flamme. Er sah auch nie hin, wenn er sich eine Zigarette anzündete. Aber auf Streichhölzer reagierte er geradezu hysterisch. Wieso ist das für Sie so wichtig?»
«Ist es nicht. Vielen Dank für die Auskunft.»
Antonia Dix realisierte plötzlich, mit wem sie sprach. Sie hatte keine Lust, dass die Strehle oder der Präsident die Unterhaltung morgen in der Bild-Zeitung nachlesen konnte.
«Keine Ursache. Eine Hand wäscht die andere. Sagen Sie mal … Dix … Antonia Dix … Hatten wir nicht kürzlich mal was über Sie im Blatt? Natürlich! Sie und diese Staatsanwältin. Wie hieß sie noch gleich? Sehr fotogen jedenfalls. War die Geschichte nicht sogar von Pelzer?»
«Keine Ahnung. Wiederhören.»
Sie legte auf.
Was für ein Leben.
Was für ein Tod.
Die Hitze war schon am Vormittag nicht mehr zum Aushalten. Sie öffnete das Fenster. Die Klimaanlage streikte seit Tagen. Und die Lamellen vor den Fenstern, die sich angeblich automatisch dem Sonnenstand anpassen sollten, passten sich wem auch immer an, nur nicht dem Sonnenstand. Dafür hatte im vergangenen Winter, kurz nach dem Umzug über den Rhein vom alten ins neue Polizeipräsidium die Heizung gestreikt. War das vor oder nach dem Wasserrohrbruch gewesen?
Offiziell hatten sie in den Neubau nach Ramersdorf umziehen müssen, weil das alte Gebäude inzwischen viel zu groß geworden war. Seit dem Hauptstadt-Umzug nach Berlin hatte man das Bonner Präsidium von einst 2500 auf jetzt 1400 Beamte schrumpfen lassen. In Wahrheit hatten sie umziehen müssen, um dem rasanten Wachstum von Telekom-City im ehemaligen Regierungsviertel nicht länger im Weg zu stehen. Das Grundstück mit dem grauen Betonbunker an der einstigen Diplomaten-Rennbahn ließ sich nun mühelos in Gold aufwiegen, und deshalb hatte die Düsseldorfer Landesregierung der Bonner Polizei in Windeseile für 55 Millionen Euro einen Neubau ans jenseitige Rheinufer gesetzt. «Das modernste Präsidium in Nordrhein-Westfalen, wenn nicht gar der gesamten Republik», hatte Antonia Dix in der Zeitung gelesen. Der Innenminister hatte das bei der Einweihung gesagt. Nichts gesagt hatte der Innenminister zu dem Umstand, dass in dem hinter dem neuen Präsidium gebauten Parkhaus mal eben Platz für 391 Dienstfahrzeuge und Privatwagen war, ein Großteil der Beamten also zum Ärger der Nachbarschaft die angrenzenden Wohnstraßen zuparkte. Eine Fußgängerbrücke verband das Parkhaus mit dem Dienstgebäude. Weil die Gitterroste nicht ordentlich befestigt worden waren, waren dort vergangenen Herbst zwei Beamte fünf Meter in die Tiefe gestürzt und schwerverletzt im Krankenhaus gelandet. Vier Wochen später war der Besucherparkplatz vor dem Gebäude einen halben Meter tief im Erdreich versunken, weil die Drainage unter dem Verbundpflaster falsch berechnet worden war. Kurz darauf wurde ein Beamter der Fahrradstreife vom Rolltor eingeklemmt. Das Rolltor hatte sich einfach selbständig gemacht und war lautlos und hinterhältig, wie in einem Roman von Stephen King, auf den Beamten zugerollt. Drei gebrochene Rippen. Die Kollegen fanden mittags in der Kantine fast täglich ein neues Gesprächsthema. Vielleicht sollte sich das Kommissariat Wirtschaftskriminalität mal mit dem Neubau des Bonner Präsidiums befassen.
Das Läuten des Telefons schreckte sie aus ihren Gedanken.
«Friedrich hier. Wo ist Morian?»
«Guten Tag, Doktor. Morian ist in Urlaub.»
«In Urlaub?»
«In Urlaub.»
Langsam ging ihr die ständige Fragerei nach Morians Verbleib auf die Nerven. Aber das behielt sie für sich. Denn die Fledermaus verärgerte man besser nicht. Alle nannten Dr. Ernst Friedrich nur die Fledermaus. Solange er nicht in der Nähe war. Denn die Fledermaus hatte nicht einen Funken Humor.
«Was macht die Obduktion, Doktor?»
Dr. Ernst Friedrich schnappte hörbar nach Luft. «Was meinen Sie wohl, weswegen ich anrufe?»
Die Fledermaus war schnell beleidigt. Also schaltete Antonia Dix einen Gang zurück.
«Sie sind ein Genie, Doktor.»
«Behalten Sie Ihre Komplimente für sich. Denn sie sind ebenso plump wie durchschaubar. Das ist jetzt zunächst nur eine kurze Vorabinformation. Ohne Gewähr. Wir warten auf das Ergebnis der feingeweblichen sowie der toxikologischen Untersuchung, bevor das abschließende rechtsmedizinische Gutachten in Schriftform Ihnen und natürlich auch Frau Strehle zugeht. Also: Der Tote … wie hieß er noch gleich …»
«Klaus-Hinrich Pelzer.»
«Klaus-Hinrich Pelzer, genau. Alkoholiker. Seine Leber war am Ende. Lange hätte der ohnehin nicht mehr gelebt, so viel ist sicher. Vielleicht noch drei, vier Jahre. Wahrscheinlich hat er das nicht gewusst. Die Leber erzeugt keine Schmerzen, und Alkoholiker sind Meister der Verdrängung. Solange sie nicht zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen, sind sie auch nicht krank.»
«Woran ist er gestorben, Doktor?»
«Jedenfalls nicht an dem Sturz vom Balkon. Er wurde erschossen. Aus etwa zwei Metern Entfernung, schätze ich. Er war schon tot, als er unten aufschlug. Eintrittsöffnung Stirn, Austrittsöffnung Hinterkopf. Erwin Keusen steht übrigens gerade neben mir. Er sagt, er hat keine Hülse gefunden. Er sagt, der Täter hätte sich vermutlich bewusst so hingestellt, dass die Hülse beim automatischen Auswurf in die Wohnung flog statt vom Balkon. Damit er sie anschließend einsammeln und mitnehmen konnte. Das Geschoss ging übrigens durch den Schädel wie Butter. Ein richtiger Kunstschütze, unser Unbekannter: Das Loch in der Stirn befindet sich exakt zwischen den Augen. Was? … Ach so! … Verstehe! … Hören Sie, Frau Dix? Erwin Keusen unterbrach mich gerade und meinte, aus dem siebten Stock und bei zunächst waagerechter oder vermutlich sogar leicht ansteigender Schussbahn, das Opfer turnte ja auf der Brüstung rum, also da fliege so ein Projektil trotz der Bremswirkung des Schädels wohl noch gut und gerne 800 Meter weit. Und da das Gebäude ja am Kopfende einer Sackgasse steht, wurde das Projektil so schnell auch nicht durch eine Mauer oder irgendwas gestoppt. Und solange er weder Hülse noch Projektil hat, kann er natürlich auch nichts zur Waffe sagen. Da haben Sie aber jetzt ganz schön was zu knabbern, nicht wahr, Frau Dix?»
«Ja. Danke, Doktor.»
Antonia Dix legte auf.
Keine Spuren, keine brauchbaren Zeugen, kein Motiv.
Ludger Beyer und drei Kollegen von der Kriminalwache hatten bis in die Nacht mit Hilfe des Dolmetschers sämtliche Teilnehmer des Grillfestes vernommen. Sie hätten sich auch nur einen einzigen beliebigen Teilnehmer herauspicken können, denn die Antwort war immer dieselbe: Ein Mann schrie, weil seine Wohnung brannte, und dann fiel er vom Balkon.
Niemand hatte eine zweite Person auf dem Balkon gesehen, niemand hatte einen Schuss gehört.
Das konnte bedeuten, dass der Täter einen Schalldämpfer benutzt hatte. Andererseits kannte Antonia Dix das Problem mit Zeugenaussagen nach dramatischen Ereignissen:
Feuer im siebten Stock, ein Mensch schreit um Hilfe, ohnmächtig müssen die Zeugen miterleben, wie er vom Balkon stürzt und vor ihren Füßen auf den Asphalt klatscht, wie sich ein verzweifelter, um Hilfe schreiender Mensch binnen Sekunden in eine leblose, blutende Masse verwandelt.
Wer erinnert sich da noch an einen Schuss?
Pelzer hatte also seit seiner frühen Kindheit, seit dem Brand in der elterlichen Wohnung, eine Feuerphobie. Warum quälte ihn der Täter erst mit dieser Zirkusnummer, bevor er ihn tötete? Um ihn leiden zu sehen? Warum schoss der Täter nicht vorher in der Wohnung, sondern wartete damit, bis Pelzer auf der Brüstung des Balkons herumturnte? Weil Pelzer ihn überrumpeln und auf den Balkon fliehen konnte? Sehr unwahrscheinlich. Denn dieser Mörder wusste offenbar alles über sein Opfer. Er war bestens vorbereitet, und er war ein erfahrener, treffsicherer Schütze.
Dieser Mörder war ein Profi.
Ein Profi, der ein völlig unnötiges Risiko einging?
Wenn er Pelzer in der Wohnung statt auf dem Balkon getötet hätte, einen Schalldämpfer oder Pelzers Brotmesser benutzt hätte, wäre die Leiche vermutlich erst nach Wochen entdeckt worden.
Was also bezweckte er mit dem ganzen Zauber?
Er?
Sie?
Mehrere Täter?
Niemand der Bewohner hatte an diesem Abend einen fremden Menschen im Haus gesehen. Was allerdings ebenfalls nichts bedeuten musste, nach dem ganzen Durcheinander. Das Kurzzeitgedächtnis von Zeugen in überraschenden, stressenden Ausnahmesituationen ähnelte gewöhnlich einem Sieb.
War der Mörder vielleicht gar kein Fremder? Lebte er womöglich sogar im Haus? Antonia Dix machte sich eine weitere Notiz. Aber sie glaubte nicht an diese Variante. Um sie jedoch auszuschließen, würden sie sämtliche Hausbewohner unter die Lupe nehmen müssen. Berufe, Waffenscheine, Vorstrafen.
Die Wohnungstür war unbeschädigt. Pelzer hatte also seinem Mörder bereitwillig die Tür geöffnet. Trotz der Hitze hatte Pelzer einen vollständigen Anzug mit Krawatte getragen. Als erwarte er wichtigen Besuch. Offiziellen Besuch.
Ebenso wie in der gesamten Wohnung wurden auf der Visitenkarte, die einsam auf dem Esstisch gelegen hatte, ausschließlich Pelzers Fingerabdrücke gefunden. War sie für seinen Mörder bestimmt gewesen?
Klaus-Hinrich Pelzer – Investigativer Journalismus. Hatte Pelzer seine Recherche-Künste neuerdings nicht nur der Bild-Zeitung angeboten? War der Mörder ein Opfer seiner Bespitzelungen?
Oder hatte der Auftraggeber den lästigen Mitwisser Pelzer nach getaner Arbeit aus dem Weg geräumt?
Woran hatte Klaus-Hinrich Pelzer zuletzt gearbeitet?
Vielleicht fand sich die Antwort in dem rechten Stapel auf ihrem Schreibtisch. Antonia Dix atmete einmal tief durch und nahm sich den nächsten Ausdruck vor.
In dem großen braunen Umschlag befanden sich ein kleinerer weißer Umschlag und außerdem 50000 Euro in bar. 500-Euro-Scheine, fünf Bündel zu je zwanzig Scheinen. Während Hurl das Geld auf der Drehbank in Theos Werkstatt ausbreitete und zählte, öffnete Max den weißen Umschlag. Er enthielt ein Farbfoto in DIN