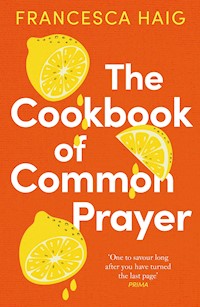9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Als Zwillinge geboren, zu Feinden erzogen
Vierhundert Jahre in der Zukunft: Durch eine nukleare Katastrophe wurde die Menschheit zurück ins Mittelalter katapultiert. Es ist eine Welt, in der nur noch Zwillinge geboren werden. Zwillinge, die so eng miteinander verbunden sind, dass sie ohne einander nicht überleben können. Allerdings hat immer einer von beiden einen Makel. Diese sogenannten Omegas werden gebrandmarkt und verstoßen.
Es ist die Welt der jungen Cass, die selbst eine Omega ist, weil sie das zweite Gesicht besitzt. Während sie Verbannung, Armut und Demütigung erdulden muss, macht ihr Zwillingsbruder Zach Karriere in der Politik. Cass kann und will diese Ungerechtigkeit nicht länger ertragen und beschließt zu kämpfen. Für Freiheit. Für Gerechtigkeit. Für eine Welt, in der niemand mehr ausgegrenzt wird. Doch die Rebellion hat ihren Preis, denn sollte Zach dabei sterben, kostet das auch Cass das Leben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Ähnliche
DAS BUCH
Cass ist jung, hübsch und klug. Dass sie eine Omega, eine Makelbehaftete ist, weiß bei ihr im Dorf niemand. Doch Cass besitzt die Gabe des zweiten Gesichts, und nachts wird sie von schrecklichen Albträumen und Visionen heimgesucht. Als Cass’ Zwillingsbruder Zach, ein Alpha, ihrem Geheimnis auf die Spur kommt und sie an den Dorfältesten verrät, wird das Mädchen mit dem Omega-Zeichen gebrandmarkt und aus dem Dorf vertrieben. Während Cass von nun an arm und rechtlos in einer eigenen Omega-Siedlung leben muss, steigt Zach im Ältestenrat der Alphas immer weiter auf. Doch auch er hat Feinde, und Cass ist seine einzige Schwachstelle, denn die einfachste Möglichkeit, Zach aus dem Weg zu räumen, ist der Tod seiner Zwillingsschwester. Deshalb lässt Zach sie entführen und an einem sicheren Ort einsperren. Doch Cass hat genug von der Unterdrückung und der Demütigung, die den Omegas widerfährt. Obwohl sie ihren Bruder immer noch liebt, flieht Cass aus ihrem Gefängnis und beschließt zu kämpfen. Für Freiheit. Für Gerechtigkeit. Für eine bessere Welt. Doch die Rebellion hat ihren Preis, denn wenn Zach stirbt, stirbt auch Cass …
DIEAUTORIN
Francesca Haig wuchs in Tasmanien auf und promovierte in Literaturwissenschaften an der Universität Melbourne. Wenn sie nicht gerade an ihren eigenen Texten arbeitet, unterrichtet sie Kreatives Schreiben an der Universität von Chester. Für ihre Gedichtsammlungen wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit Das Feuerzeichen legt sie nun ihre erste Romantrilogie vor. Francesca Haig lebt mit ihrer Familie in London.
FRANCESCA
HAIG
DAS FEUER
ZEICHEN
ROMAN
Aus dem Englischen
von Kathrin Wolf
und Sonja Rebernik-Heidegger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel The Fire Sermon
bei Harper Voyager, an imprint of HarperCollins Publishers, London
Jacket Design by HarperCollins Publishers, Uk
Jacket Photograph by Shutterstock (Hefr, Bluekat)
Author Photograph by Andrew North
Copyright © 2015 Simon & Schuster
Copyright © 2015 by De Tores Ltd 2015
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Melike Karamustafa
Covergestaltung: DAS ILLUSTRAT, München
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock (bezikus, nenetus)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-16465-2V004
www.heyne-fliegt.de
Dieses Buch ist meinem Bruder Peter
und meiner Schwester Clara gewidmet –
in aufrichtiger Liebe und Bewunderung.
Wenn man bedenkt, wie viel sie mir bedeuten,
dürfte es keine Überraschung sein,
dass mein erster Roman von Geschwistern handelt.
1
ICH HATTE IMMER gedacht, sie würden nachts kommen, stattdessen ritten die sechs Männer zur heißesten Zeit des Tages über das Flachland. Ernte. Die ganze Siedlung war früh aufgestanden und würde noch bis spät arbeiten. Das verbrannte Land der Omegas bot beileibe keine Garantie für guten Ertrag. Letztes Jahr hatten schwere Regenfälle tief in den Boden gesickerte Asche an die Oberfläche gespült. Das Wurzelgemüse war nur spärlich oder gar nicht aufgegangen und ein ganzes Kartoffelfeld nach unten gewachsen. Als wir die Knollen in der Erde aufspürten, sahen sie runzlig und geschrumpft aus. Der Junge, der nach ihnen gegraben hatte, wurde vom Untergrund verschluckt. Die Grube war nur wenige Meter tief, doch als das Erdreich unter seinen Füßen einbrach, gab es für ihn keinen Weg mehr zurück nach oben. Ich dachte darüber nach weiterzuziehen, aber über den Tälern hingen schwere Regenwolken und in Zeiten des Hungers hieß keine Siedlung Fremde willkommen. Also blieb ich – das ganze trostlose Jahr über. Die anderen erzählten sich Geschichten von der großen Dürre, als es drei Jahre hintereinander nur Missernten gegeben hatte. Ich war damals noch ein Kind gewesen, doch selbst ich erinnerte mich an die Kadaver verhungerten Viehs, welche die staubigen Felder wie knochige Flöße gesprenkelt hatten. Das alles lag inzwischen mehr als ein Jahrzehnt zurück. Diesmal wird es nicht so schlimm wie in den Jahren der Dürre, beschworen wir einander, als würde es durch die ständige Wiederholung wahr.
Im darauffolgenden Frühling ließen wir die Weizenhalme nicht aus den Augen. Die frühen Feldfrüchte erwiesen sich als widerstandsfähig und die langen, dicken Karotten, die wir aus der Erde zogen, brachten die jüngeren Teenager zum Lachen. Auf meinem eigenen Fleckchen Land erntete ich einen Sack Knoblauch, den ich umsichtig, als hielte ich ein Baby in den Armen, zum Markt trug. Den ganzen Frühling hindurch sah ich dem Weizen auf unseren Feldern beim Wachsen zu, wie er hoch und robust gedieh. Bienen summten um den Lavendel hinter meinem Cottage, und drinnen stapelten sich Lebensmittel in den Regalen.
Sie kamen mitten in der Erntezeit. Zunächst hatte ich ihre Ankunft nur gefühlt. Seit Monaten schon, wenn ich ehrlich war. Doch jetzt spürte ich sie mit einer Klarheit und plötzlich aufbrandenden Wachsamkeit, die ich niemandem erklären konnte, der kein Seher war. Es war, als würde sich etwas verlagern. Als würde sich eine Wolke vor die Sonne schieben oder der Wind seine Richtung ändern. Mit der Sense in der Hand richtete ich mich auf und wandte den Blick Richtung Süden. Als am anderen Ende der Siedlung Schreie ertönten, rannte ich schon. Als sie lauter wurden und sechs berittene Männer in unser Sichtfeld galoppierten, flohen auch die anderen. Es war nicht ungewöhnlich, dass Alphas unsere Omega-Siedlungen überfielen und alles plünderten, was ihnen irgendwie wertvoll erschien. Doch ich wusste, was sie wirklich im Sinn hatten. Und natürlich wusste ich auch, dass es keinen Sinn hatte wegzulaufen. Ich war sechs Monate zu spät dran, um den Rat meiner Mutter zu beherzigen. Ich duckte mich unter einen Zaun durch und sprintete auf den Rand der von Gesteinstrümmern übersäten Siedlung zu. Doch selbst in diesem Moment war mir klar – sie würden mich kriegen.
Sie mussten ihr Tempo kaum drosseln, um mich einzufangen. Einer von ihnen packte meine Füße und riss mich auf sein Pferd. Mit einem gezielten Hieb schlug er mir die Sense aus der Hand und warf mich mit dem Gesicht nach unten seitlich über den Sattel. Ich trat wild um mich, was das Pferd nur noch weiter anzutreiben schien. Immer wieder stießen meine Rippen gegen den Rücken des Tiers. Das Rütteln war noch schmerzhafter als der Hieb vorhin. Eine starke Hand ruhte in meinem Kreuz. Ich spürte den Körper des Mannes, der sich über mich beugte und sein Pferd unbarmherzig antrieb. Ich öffnete die Augen, doch angesichts der hufgepeitschten, auf dem Kopf stehenden Welt, die an mir vorbeiraste, schloss ich sie rasch wieder.
Als wir langsamer wurden und ich mich endlich wieder traute, die Augen zu öffnen, bohrte sich eine Schwertspitze in meinen Rücken. »Wir haben Anweisung, dich nicht zu töten«, sagte der Mann über mir. »Dein Zwilling meinte, wir dürften dich nicht mal bewusstlos schlagen. Aber vor allem anderen werden wir nicht zurückschrecken. Wenn du Ärger machst, schneide ich dir als Erstes den kleinen Finger ab, und glaub mir, ich werde mir nicht die Mühe machen, mein Pferd dabei anzuhalten. Verstanden, Cassandra?«
Ich versuchte ein Ja herauszupressen, brachte jedoch nichts als ein atemloses Ächzen zustande.
Wir ritten weiter. Ich hing immer noch kopfüber auf dem Pferd, und als das Ruckeln kein Ende nehmen wollte, musste ich mich übergeben – das zweite Mal auf den Lederstiefel des Mannes wie ich mit einiger Genugtuung feststellte. Fluchend brachte er sein Pferd zum Stehen, wuchtete mich in eine aufrechte Position und schlang ein Seil um mich, sodass meine Arme an meinen Oberkörper gefesselt waren. Langsam ließ der Druck auf meinen Kopf nach und das Blut floss in meinen Körper zurück. Das Seil schnitt mir in die Haut, stabilisierte mich aber wenigstens einigermaßen, weil der Mann in meinem Rücken es so entschlossen festhielt. So ritten wir für den Rest des Tages weiter. Bei Einbruch der Nacht, als die Dunkelheit wie ein Galgen über den Horizont ragte, machten wir kurz Rast, um etwas zu essen. Einer der Männer bot mir ein Stück Brot an, doch ich bekam nicht mehr als einen kleinen Schluck Wasser aus seiner Feldflasche herunter. Es schmeckte warm und modrig. Wieder wurde ich auf ein Pferd gehoben, von einem anderen Kerl diesmal, dessen schwarzer Bart mich im Nacken kratzte. Er stülpte mir einen Sack über den Kopf, was in der Dunkelheit aber kaum einen Unterschied machte.
Lange bevor das Hufgeklapper auf gepflasterte Straßen schließen ließ, spürte ich die Stadt in der Ferne. Auch mit dem Sack vor dem Gesicht drangen einzelne Lichtflecke zu mir durch. Überall um mich herum fühlte ich die Anwesenheit von Menschen, die sich noch dichter zu drängen schienen als in Haven an einem Markttag. Wahrscheinlich waren es mehrere Tausend. Die Straße wurde steiler, und wir verlangsamten das Tempo. Laut klapperten die Hufe unserer Pferde über die Pflastersteine. Als wir anhielten, wurde ich an einen anderen Mann weitergereicht – oder, besser gesagt, geworfen. Minutenlang zerrte er mich weiter und ließ mich blind hinter sich herstolpern. Wenn eine Tür aufgesperrt wurde, blieb er immer kurz stehen. Sobald wir uns in Bewegung setzten, hörte ich, wie sie hinter uns wieder abgeschlossen wurde, jeder einschnappende Bolzen wie ein Hieb in meine Magengrube. Irgendwann stieß er mich auf etwas Weiches. Ich vernahm ein metallisches Klirren, ein gezogenes Messer. Bevor ich noch aufschreien konnte, fiel das durchtrennte Seil von mir ab. Hände machten sich an meinem Nacken zu schaffen und rissen mir den Sack vom Kopf. Raues Leinen streifte meine Nase. Ich befand mich in einem kleinen Raum auf einem niedrigen Bett. Eine Zelle. Fenster gab es nicht. Der Mann, der mich von meinen Fesseln befreit hatte, schloss die Metalltür hinter sich ab.
In mich zusammengesunken, den Geschmack nach Schlamm und Erbrochenem im Mund, gestattete ich mir endlich zu weinen. Zum Teil um mich, zum Teil aber auch um meinen Zwilling. Und um das, was aus ihm geworden war.
2
AM NÄCHSTEN MORGEN weckten mich wie gewöhnlich die Feuerträume.
Als die Monate ins Land gingen, waren dies die einzigen Momente, in denen ich froh war, in der Enge meiner Zelle zu erwachen. Das Grau des Raums und die vertrauten unversöhnlichen Wände standen in einem harten Gegensatz zum erbarmungslosen Exzess der Flammen, der mich jede Nacht heimsuchte.
Von der Explosion gab es weder schriftliche Zeugnisse noch Bilder. Und was hätte das auch für einen Sinn gehabt, wo sie sich doch sowieso unauslöschbar in jede Oberfläche geätzt hatte? Sogar jetzt, ganze vierhundert Jahre nachdem sie alles zerstört hatte, sah man sie noch in jeder gesprengten Klippe, auf jedem versengten Feld und in jedem ascheverstopften Fluss. In jedem Gesicht. Die Explosion war die einzige Geschichte, die unsere Erde zu erzählen hatte – wer also hätte sie noch festhalten sollen? Eine in Asche und Knochen geschriebene Geschichte. Es hieß, vor der Explosion seien Predigten über das Ende der Welt gehalten worden. Die letzte stammte vom Feuer selbst. Danach nichts mehr.
Die meisten Überlebendenden waren damals ertaubt und erblindet, andere allein zurückgeblieben. Wenn sie ihre Geschichten weitererzählt hatten, dann nur noch dem Wind. Und selbst wenn sie noch einen Gefährten hatten – kein Überlebender hätte den Moment, in dem es passierte, in Worte fassen können. Diese neue, unbekannte Färbung des Himmels. Das Tosen, das allem ein Ende bereitete. Sobald jemand versuchte, den Vorfall zu beschreiben, strandete er genau wie ich heute in einem Raum, in dem Worte fehlten und Geräusche vorherrschten.
Die Explosion hatte die Zeit zerspringen lassen und sie in Sekundenschnelle unwiederbringlich in ein Vorher und ein Nachher gepalten. Jetzt, Hunderte Jahre später, im Nachher, gab es keine Überlebenden und keine Zeugen mehr. Nur Seher wie ich erhaschten hin und wieder einen flüchtigen Blick auf das Ereignis, in dem kurzen Moment vor dem Aufwachen oder wenn er uns in der halben Sekunde eines Wimpernschlags aus dem Hinterhalt überfiel: der Blitz, der wie Papier brennende Horizont.
Die einzigen Geschichten, die von der Explosion erzählten, stammten von den Barden. Als ich noch ein Kind war, hatte der Barde, der jeden Herbst durch unser Dorf zog, von Ländern auf der anderen Seite des Meeres gesungen, die das Feuer vom Himmel hatten stürzen lassen. Von der Strahlung und vom darauffolgenden Langen Winter. Ich muss acht oder neun gewesen sein, als Zach und ich eine ältere Bardin mit frostgrauem Haar dieselbe Melodie hatten singen hören, begleitet von anderen Worten. Der Refrain über den Langen Winter war gleich geblieben, doch andere Länder wurden keine erwähnt. Die Verse beschrieben lediglich die Flammen und wie sie alles verzehrten. Als ich meinen Vater bei der Hand nahm und mich nach dem Grund dafür erkundigte, zuckte er bloß mit den Schultern. Es gäbe viele Versionen dieses Lieds, antwortete er. Was mache das schon für einen Unterschied? Wenn es auf der gegenüberliegenden Seite des Meeres einst andere Länder gegeben habe, würden sie längst nicht mehr existieren. Die gelegentlich aufkeimenden Gerüchte eines Anderorts seien eben nur Gerüchte, denen man genauso wenig glauben dürfe wie der Mär von einer Insel, auf der Omegas frei lebten, ohne von Alphas unterdrückt zu werden. Wenn man dabei belauscht wurde, wie man über solche Fragen spekulierte, kam das einer Aufforderung zur öffentlichen Auspeitschung gleich, einer Zurschaustellung am Pranger. So wie bei dem Omega, den wir außerhalb von Haven gesehen hatten. Der so lange unter der sengenden Sonne ausharren musste, bis seine Zunge nur noch als schuppige blaue Eidechse aus seinem Mund hing. Zwei Soldaten des Rats wachten neben ihm und traten ihn von Zeit zu Zeit, um sicherzugehen, dass er noch lebte.
»Stellt keine Fragen«, sagte unser Vater. »Nicht über das Vorher, nicht über das Anderswo, nicht über die Insel. Die Menschen im Vorher haben zu viele Fragen gestellt, zu viel geforscht. Und seht nur, was es ihnen gebracht hat. Dies ist unsere Welt oder eben das, was wir von ihr wissen. Begrenzt durch das Ödland im Osten und Norden, im Westen und Süden durch das Meer.«
Es machte tatsächlich keinen Unterschied, was die Explosion verursacht hatte. Sie lag lange zurück und war genauso unbegreiflich wie das Vorher, das alles zerstört hatte und von dem nur Gerüchte und Ruinen geblieben waren.
In meinen ersten Monaten in der Zelle wurde mir ab und an das Geschenk gewährt, den Himmel zu sehen. Alle paar Wochen führte man mich zusammen mit anderen Omega-Gefangenen zu den Befestigungsmauern, wo wir ein bisschen Bewegung bekommen und frische Luft schnappen sollten. Wir liefen in Dreiergruppen und wurden dabei von mindestens ebenso vielen Wachen begleitet. Sie ließen uns nicht aus den Augen und hielten uns nicht nur voneinander, sondern auch von den Zinnen fern, die den Blick auf die Stadt unter uns freigaben. Schon bei meinem ersten Freigang lernte ich, dass ich mich den anderen nicht nähern durfte, geschweige denn mit ihnen sprechen. Damals hatte sich einer der Wachmänner über das Schneckentempo einer blonden, auf einem Bein hüpfenden Gefangenen beschwert. »Ich wäre schneller, wenn ihr mir nicht meinen Stock weggenommen hättet«, gab sie zurück. Die Männer antworteten nicht. Sie sah mich an und verdrehte die Augen. Es war kein Lächeln, aber das erste Anzeichen menschlicher Wärme überhaupt, seit ich meinen Fuß in die Verwahrungsräume gesetzt hatte. Als wir bei den Mauern angekommen waren, versuchte ich mich näher an sie heranzuschleichen, um ihr etwas zuzuflüstern. Ich war noch gut drei Meter von ihr entfernt, als mich die Wachen so fest gegen die Wand drückten, dass ich mir die Schulterblätter an dem Stein aufschürfte. Dann schleiften sie mich zurück in meine Zelle. Einer spuckte mich an. »Sprich nicht mit den anderen!«, bellte er. »Du darfst sie nicht mal ansehen, verstanden?« Da er mir die Arme auf den Rücken gedreht hatte, konnte ich mir die Spucke nicht von der Wange wischen, ihre Wärme eine einzige widerliche faulige Intimität. Die Frau sah ich nie wieder.
Einen Monat nach dem Vorfall war es Zeit für meinen dritten Freigang zu den Mauern – es sollte der letzte für uns alle sein. Ich stand neben der Tür und wartete darauf, dass sich meine Augen an das helle Sonnenlicht gewöhnten, das auf dem glatten Stein schimmerte. Zu meiner Rechten standen zwei Wachen, die leise miteinander sprachen. Ungefähr sechs Meter links von mir lehnte ein weiterer Wachmann an der Mauer und beobachtete einen männlichen Omega, der sich wohl schon länger im Verlies befand als ich. Seine Haut, die früher einmal dunkel gewesen sein musste, war von einem schmutzigen Grau. Auch seine fahrigen Hände und die Art, wie er ununterbrochen die Lippen bewegte, sprachen Bände. Er war schon die ganze Zeit auf demselben gepflasterten Fleck vor- und zurückgegangen und hatte dabei sein rechtes verdrehtes Bein hinter sich hergezogen. Ich hörte, wie er trotz des Redeverbots Zahlen vor sich hinmurmelte: »Zweihundertsiebenundvierzig. Zweihundertachtundvierzig.« Jeder wusste, dass die meisten Seher irgendwann verrückt wurden. Dass uns die Visionen über die Jahre den Verstand verbrannten. Wenn die Visionen die Flamme waren, waren wir ihr Docht. Dieser Mann hier verfügte zwar nicht über die Gabe, aber es überraschte mich nicht, dass jemand, der zu lange in diesen Verliesen gefangen gehalten wurde, irgendwann dem Irrsinn anheimfiel. Und wenn dem so war, was für eine Chance hatte dann ich, die ich nicht nur gegen die unerbittlichen Mauern meiner Zelle kämpfte, sondern auch noch mit meinen inneren Bildern? Das könnte ich sein, dachte ich, in ein oder zwei Jahren. Auch ich werde meine Schritte zählen, als könnte die Eindeutigkeit der Zahlen Ordnung in meinen zerstörten Verstand bringen.
Zwischen mir und dem auf und ab hinkenden Mann stand noch eine Gefangene, eine einarmige Frau mit dunklem Haar und einem fröhlichen Gesicht, vielleicht ein paar Jahre älter als ich. Man hatte mich zum zweiten Mal mit ihr zusammen nach draußen gebracht. Ich hielt mich so dicht bei den Mauern, wie die Wachen es zuließen, fixierte einen Punkt jenseits der Sandsteinzinnen und überlegte, wie ich mit ihr in Kontakt treten oder ihr irgendein Zeichen geben konnte. Ich kam nicht nah genug an den Steinwall heran, um einen Blick auf die Stadt zu werfen, die sich unterhalb des Berghangs erstreckte. Die Mauern beschnitten den Horizont. Dahinter nur Hügel, grau gepinselt in der Ferne.
Das Zählen hatte aufgehört. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, weshalb, war der ältere Omega schon auf die Frau zugestürzt und hatte sie mit beiden Händen am Hals gepackt. Da sie nur einen Arm hatte, konnte sie sich nicht wehren, und rechtzeitig geschrien hatte sie auch nicht. Ich war immer noch meterweit von den beiden entfernt, als die Wachen den Mann in Sekundenschnelle von ihr herunterzerrten. Aber es war bereits zu spät.
Ich schloss die Augen, um den Anblick ihres Körpers auszublenden, um nicht sehen zu müssen, wie sie mit dem Gesicht nach unten auf den Steinplatten lag, den Kopf in einem seltsamen Winkel zur Seite gedreht. Leider findet ein Seher keine Zuflucht hinter geschlossenen Lidern, stattdessen zeigte mir meine bebende unheilvolle Gedankenwelt, was parallel zum Moment ihres Todes geschah: Dreißig Meter über uns, im Inneren der Festung, kippte ein Glas Wein um. Die rot gefärbten Scherben verteilten sich über den Marmorboden. Ein Mann in einem Samtjackett fiel nach hinten um und rappelte sich, bevor er starb, noch einmal auf die Knie hoch, eine Hand in den Nacken gelegt.
Danach gab es keine Ausflüge mehr zu den Mauern. Manchmal glaubte ich, den verrückten Omega schreien und gegen Wände hämmern zu hören, doch es waren nur dumpfe Schläge, ein Pochen in der Nacht, von dem ich nie wusste, ob ich es wirklich vernahm oder bloß fühlte.
In meiner Zelle war es fast nie dunkel. Eine von der Decke hängende Glaskugel verströmte fahles Licht. Sie war immer eingeschaltet und summte, so leise allerdings, dass ich mich manchmal fragte, ob das Geräusch lediglich in meinen Ohren existierte. Die ersten paar Tage beobachtete ich sie nervös, immer darauf gefasst, dass sie ausbrennen und mich in totaler Finsternis zurücklassen würde. Doch das hier war keine Kerze, ja nicht mal eine Öllampe, und das Licht, das von ihr ausging, ein ganz anderes: kühl und unerschütterlich. Nur alle paar Wochen flackerte der sterile Schein für einige Sekunden, um dann zu verschwinden und mich in einer formlosen schwarzen Welt zurückzulassen. Es dauerte nie länger als ein oder zwei Minuten, bis das Licht blinkend wieder zum Leben erwachte, wie jemand, der aus einem Schlaf hochschreckte, um erneut die Nachtwache aufzunehmen. Inzwischen freute ich mich über diese unregelmäßigen Störungen, die einzigen Unterbrechungen einer ansonsten unablässigen Helligkeit. Das musste die Elektrik sein. Ich kannte die Geschichten: Dahinter steckte eine Art Magie, der Schlüssel zu fast allen technischen Errungenschaften des Vorher. Was auch immer es war – es sollte nicht mehr existieren. Man hatte jede Maschine, die nicht schon während der Explosion zerstört worden war, in der darauffolgenden Säuberung beseitigt. Alle Spuren von Technik, wegen der die Welt zu Asche zerfallen war, hatten ausgelöscht werden sollen. Jedes Überbleibsel aus dem Vorher war ein Tabu, aber keins so sehr wie die Maschinen. Und obwohl ein Tabubruch mit brutalen Sanktionen einherging, wachte schon allein die Angst über das Gesetz. Die Gefahr war in jede Oberfläche unserer verdorrten Welt und in die bizarr verrenkten Körper der Omega gemeißelt. Wir brauchten keine Drohungen, um uns davon fernzuhalten.
Und doch existierte diese Maschine, ein Stück Elektrik, und sie hing von der Decke meiner Zelle. Es war nichts Erschreckendes oder Mächtiges wie die Leute immer raunten. Keine Waffe, Bombe oder Kutsche, die sich ohne Pferde in Bewegung setzte. Nur eine Glasknolle von der Größe meiner Faust, die dort oben von der Decke ihr Licht verströmte. Ich konnte nicht aufhören, sie anzustarren, ihren gleißenden Kern, der so weiß strahlte, als wäre die Explosion selbst darin gefangen. Ich starrte sie an, bis sich ihre hellen Umrisse in das Dunkel meiner Augenlider ätzten. Sie faszinierte und entsetzte mich gleichzeitig. In den ersten Tagen war ich vor dem Licht zurückgezuckt, als könne es jeden Moment explodieren. Wenn ich es betrachtete, jagte mir nicht nur das Verbot Angst ein, sondern vor allem die Frage, was es für mich bedeutete, Zeugin eines solchen Phänomens geworden zu sein. Wenn bekannt wurde, dass der Rat einen Tabubruch beging, würde es zu einer erneuten Säuberung kommen. Der Schrecken der Explosion war noch zu real und zu tief in den Menschen verankert, als dass sie die dafür verantwortlichen Maschinen hätten tolerieren können. Das Licht da oben bedeutete lebenslänglich, das wusste ich. Jetzt, da ich es gesehen hatte, würde ich nie wieder freigelassen werden.
Mehr als alles andere vermisste ich den Himmel. Eine enge Öffnung direkt unterhalb der Decke ließ von irgendwoher frische Luft zu mir hereinströmen, aber niemals auch nur einen einzigen Sonnenstrahl. Dank des Essens, das mir zweimal am Tag unter der Tür durchgeschoben wurde, wusste ich immer ungefähr, wie viel Zeit vergangen war. Als die Monate verstrichen und mein letzter Ausflug zu den Mauern immer weiter zurücklag, merkte ich, dass ich nur noch eine abstrakte Vorstellung vom Himmel hatte. Richtig vorstellen konnte ich ihn mir nicht mehr. Ich dachte an die Geschichten vom Langen Winter nach der Explosion, als die Luft von so viel Asche erfüllt gewesen war, dass jahrelang niemand den Himmel hatte sehen können. Es heißt, in dieser Zeit seien Kinder geboren worden, die ihn nie zu Gesicht bekommen hätten. Ich fragte mich, ob sie dennoch auf seine Existenz vertraut hatten. Ob die Vorstellung vom Himmel auch für sie zu einem Akt des Glaubens geworden war.
Die Tage zu zählen war die einzige Möglichkeit, an so etwas wie einem Zeitgefühl festzuhalten, doch als die Strichliste immer länger wurde, verwandelte es sich in Folter, denn ich hatte keine Aussicht darauf, meiner eigenen Entlassung entgegenzuzählen. Die Zahlen kletterten in immer schwindelerregendere Höhen und mit ihnen das Gefühl der Vereinsamung und der Eindruck, in einer Welt aus Dunkelheit und Isolation dahinzutreiben.
Nachdem unsere Ausflüge zu den Mauern eingestellt wurden, waren die Besuche der Beichtmutter meine einzige Wegmarke. Sie kam alle zwei Wochen, um mich über meine Visionen auszufragen. Von ihr hatte ich erfahren, dass die anderen Omegas überhaupt niemanden mehr zu Gesicht bekamen. Ich wusste nicht, ob ich sie beneiden oder bemitleiden sollte.
Es hieß, die Zwillinge seien in der zweiten oder dritten Generation des Nachher aufgetaucht. Während des Langen Winters waren keine Geschwisterpaare und generell kaum Kinder zur Welt gekommen. Es waren die Jahre der geschmolzenen Körper und des missgebildeten, unkenntlichen Nachwuchses. Nur die wenigsten überlebten und noch weniger konnten sich fortpflanzen, sodass der Fortbestand der Menschheit eine Zeit lang nicht wahrscheinlich schien.
Im Kampf um die Neubevölkerung unserer Welt hatte man die Flut an Zwillingsgeburten, die darauf folgte, wohl zunächst begrüßt. So viele Babys und so viele von ihnen normal! Es wurden immer ein Junge und ein Mädchen geboren, und jeweils ein Teil des Pärchens war perfekt. Nicht nur wohlgeformt, sondern auch stark, robust und gesund. Doch bald schon trat das Fatale dieser Symmetrie zutage, denn der Preis für jedes perfekte Baby war sein Zwilling. Es gab sie in den verschiedensten Ausprägungen: mit fehlenden, verkümmerten und manchmal sogar vervielfachten Gliedmaßen. Ohne, mit zusätzlichen oder fest verschlossenen Augen. Das waren die Omegas, schattenhafte Gegenstücke der Alphas. Die Alphas nannten sie Freaks und Mutanten, behaupteten sie seien das Gift, das sie selbst im Mutterleib aus ihren Körpern vertrieben hätten. Doch wenn der Makel der Explosion schon nicht beseitigt werden konnte, so hatte er sich wenigstens auf den minderwertigen Zwilling verlagert. Omegas trugen die Bürde der Mutation, Alphas hingegen blieben unbelastet und frei. Nein, nicht ganz frei. Denn auch wenn die Verbindung zwischen den Zwillingen nicht so deutlich sichtbar war wie ihre Unterschiede, machte sie sich doch auf eine geradezu existenzielle Weise bemerkbar. Dabei tat es nichts zur Sache, dass niemand wusste, wie diese Verbindung funktionierte. Anfangs hatte man sie noch als zufällig abgetan, doch bald schon wurde der Unglaube von Tatsachen übertrumpft. Denn die Menschen kamen nicht nur im Doppelpack zur Welt, sie starben auch gleichzeitig. Wo auch immer sie sich aufhielten – wenn einer sein Leben lassen musste, galt das auch für den anderen, ganz unabhängig von der zwischen ihnen liegenden Entfernung. Auch heftige Schmerzen oder ernste Krankheiten befielen stets beide Geschwister. Wenn der eine hohes Fieber bekam, traf es bald darauf auch den anderen. Wurde ein Zwilling ohnmächtig verlor auch der andere das Bewusstsein, ganz egal, wo er oder sie sich gerade aufhielt. Harmlose Verletzungen oder Krankheiten schienen die körperliche Entfernung nicht zu überwinden. Erst, wenn sich einer eine tiefe Wunde zuzog, konnte man den anderen vor Schmerz schreien hören.
Als die Unfruchtbarkeit der Omegas bekannt wurde, nahm man eine Weile an, dass sie aussterben würden, dass sie lediglich ein vorübergehender Schandfleck seien, eine Neuausrichtung nach der Explosion. Doch seitdem verhielt es sich in jeder Generation gleich: Es kamen nur Zwillinge zur Welt, einer als Alpha, der andere als Omega.
Als Zach und ich geboren wurden und uns keinen Deut voneinander unterschieden, hatten unsere Eltern wahrscheinlich wieder und wieder nachgezählt: Gliedmaße, Finger, Zehen. Alles da. Und ganz bestimmt hatten sie es kaum glauben können. Niemand entging der Aufsplittung in Alpha und Omega. Niemand. Allerdings hatte man durchaus von Fehlbildungen gehört, die sich erst im Laufe der Zeit manifestierten: ein Bein, das nicht wie das andere wachsen wollte, Taubheit, die in der Kindheit unbemerkt geblieben war, ein Arm, der sich erst spät als verkrüppelt oder schwach herausgestellt hatte. Und dann gab es da noch das Gerücht über einige wenige Zwillingspärchen, bei denen sich kein körperlicher Unterschied manifestierte. Der Junge, der vollkommen normal schien, bis er eines Tages wie am Spieß schrie und schon Minuten, bevor der Dachbalken brach, aus dem Cottage flüchtete. Das Mädchen, das eine Woche lang um den Hund des Schäfers weinte, bis dieser schließlich von einem Karren aus dem Nachbardorf überfahren wurde. Sie alle waren Omegas, deren Mutation unsichtbar blieb – sie waren Seher.
Es gab nur wenige von ihnen. Einen unter ein paar Tausend, wenn überhaupt. Den Seher, der einmal im Monat auf den Markt nach Haven kam, in die große Stadt flussabwärts, kannte jeder. Obwohl Omegas nicht zugelassen waren, hatte man jahrelang toleriert, dass er hinter gestapelten Kisten und verdorbenem Gemüse herumlungerte. Als ich den Markt zum ersten Mal besucht hatte, war er schon alt, aber sein Gewerbe betrieb er trotzdem noch, indem er den Bauern eine Bronzemünze dafür abknüpfte, dass er ihnen das Wetter der nächsten Saison vorhersagte. Oder dafür, dass er einer Kaufmannstochter verriet, wen sie später mal heiraten würde. Dabei hatte ihm immer etwas Seltsames angehaftet. Er hatte ununterbrochen vor sich hingemurmelt, eine nicht enden wollende Beschwörungsformel. Einmal, als Zach, ich und Dad an ihm vorbeigegangen waren, hatte er gerufen: Feuer!Feuer für immer! Keiner der Marktleute hatte auch nur mit der Wimper gezuckt. Offensichtlich waren seine Ausbrüche an der Tagesordnung, ein Geschick, das die meisten Seher teilten. Während sie die Explosion wieder und wieder durchleben mussten, arbeiteten sich die Flammen unaufhaltsam zu ihrem Verstand vor, brannten sich dort ein und hinterließen eine sengende Spur.
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich merkte, dass auch ich anders war. Früher war es mir ebenso wenig klar gewesen wie meinen Eltern. Denn welches Kind erwachte nicht hin und wieder schreiend aus einem Albtraum? Ich brauchte lange, um das Besondere an meinen Träumen zu verstehen. Die Beständigkeit, mit der die Bilder von der Explosion wiederkehrten. Oder dass ich einen Sturm sah, der in der darauffolgenden Nacht tatsächlich aufkam. Dass die Details und Szenerien meinen dörflichen Erfahrungshorizont bei Weitem überstiegen, seinen steinernen Brunnen und die ungefähr vierzig um Rasenflächen gescharten Häuschen. Alles, was ich je gekannt hatte, waren das flache Tal sowie die Gebäude und Holzscheunen, die ungefähr dreißig Meter vom Fluss entfernt in Grüppchen angeordnet und gerade so hoch waren, dass sie dem Schlick entgingen, der jeden Winter mit dem Hochwasser auf die Felder geschwemmt wurde. Meine Träume hingegen waren voller unbekannter Landschaften und seltsamer Gesichter. Voller Festungen, zehnmal so hoch wie unser eigenes kleines Haus mit dem grob verputzten Boden und den niedrigen Balkendecken. Städte, deren Straßen breiter waren als jeder Fluss, Städte, in denen sich Menschenmassen drängten. Als ich alt genug war, um mir darüber Gedanken zu machen, war ich auch alt genug, um zu wissen, dass Zach jede Nacht ungestört durchschlief. Auf der Pritsche, die wir uns teilten, brachte ich mir bei, meinen hastigen Atem in aller Stille zu beruhigen. Und wenn mich während des Tages Visionen überfielen, allen voran das Dröhnen der Explosion, lernte ich, nicht laut aufzuschreien. Als Dad uns zum ersten Mal flussabwärts nach Haven mitnahm, kannte ich das Gedränge auf dem Markt schon aus meinen Träumen. Trotzdem imitierte ich Zachs verblüfftes Starren und wie er zögernd nach Dads Hand griff.
Also warteten unsere Eltern. Wie alle hatten sie nur eine Pritsche für uns angefertigt, denn sie waren davon ausgegangen, ein Kind wegschicken zu müssen, sobald sich der Unterschied zwischen uns manifestierte und wir abgestillt waren. Als wir mit drei Jahren immer noch vollkommen gleich aussahen, baute Vater zwei breitere Betten. Obwohl unser Nachbar Mick im ganzen Tal für sein Schreinerhandwerk bekannt war, bat Dad ihn in diesem speziellen Fall nicht um Hilfe, sondern erledigte alles allein, verstohlen beinahe, in unserem kleinen, von Mauern umgrenzten Hof vor dem Küchenfenster. Wann immer mein windschiefes, schlecht zusammengezimmertes Bett in den folgenden Jahren unter mir knarzte, fiel mir sein Gesichtsausdruck ein, als er die Pritsche in unser Zimmer gezerrt und sie so weit weg von der anderen positioniert hatte wie es in dem engen Raum nur irgend ging.
Mum und Dad sprachen kaum noch mit uns. Es waren die Jahre der Dürre, als alles rationiert wurde und ich das Gefühl hatte, auch Worte seien Mangelware geworden. In unserem Tal, wo die niedrig liegenden Felder im Winter sonst immer geflutet wurden, verwandelte sich der Fluss in ein teilnahmsloses Rinnsal, dessen ungeschütztes Bett wie eine alte Keramik zu beiden Seiten von Rissen durchzogen war. Selbst in unserem wohlhabenden Dorf gab es nichts mehr, was man hätte sparen können. In den ersten beiden Jahren waren die Ernten schon wenig ertragreich und im dritten blieben die Feldfrüchte ganz aus, sodass wir keine andere Wahl hatten, als von den gesparten Münzen zu leben. Unsere vertrockneten Felder wurden vom staubigen Wind abgetragen. Da sich nicht mal Leute mit Münzen Futter leisten konnten, starb ein Großteil des Viehs. Es kursierten Geschichten von Menschen, die weiter östlich verhungerten. Der Rat schickte Patrouillen durch alle Dörfer, um sie vor möglichen Übergriffen der Omegas zu schützen. Es war auch der Sommer, in dem Mauern um Haven und viele andere größere Alpha-Städte errichtet wurden. Dabei sahen die meisten Omegas, die ich in jener Zeit zu Gesicht bekam, viel zu ausgemergelt und erschöpft aus, um irgendjemanden zu bedrohen.
Als die Dürre endlich vorüber war, sandte der Rat weiter Patrouillen aus. Auch Mum und Dads Wachsamkeit ließ nicht nach. Es schien, als würden sie auf jeden noch so kleinen Unterschied zwischen mir und Zach achten, ihn aufgreifen und bis ins kleinste Detail analysieren. Als wir gleichzeitig an einer Wintergrippe erkrankten, hörte ich, wie sich eine lange Diskussion zwischen ihnen entspann, wer von uns als Erster die Symptome gezeigt hätte. Ich muss sechs oder sieben gewesen sein. Durch unsere Zimmertür hörte ich, wie mein Vater unten in der Küche beharrlich behauptete, ich sei schon am Vorabend erhitzt gewesen, gute zehn Stunden, bevor Zach und ich beide mit Fieber aufgewacht seien. In diesem Moment begriff ich, dass die Skepsis, die Dad uns gegenüber an den Tag legte, nichts mit seiner üblichen Derbheit zu tun hatte, sondern mit Misstrauen. Dass sich hinter Mums Achtsamkeit etwas anderes verbarg als mütterliche Zuneigung. Früher war Zach unserem Vater überallhin gefolgt, den ganzen Tag lang, vom Brunnen zum Feld zur Scheune. Je älter wir wurden, desto ungehaltener und argwöhnischer reagierte Dad darauf. Er begann, Zach zu verscheuchen und ihn anzuschreien, er solle ins Haus zurückgehen. Doch meinem Bruder fiel immer wieder eine neue Ausrede ein, um sich so oft wie möglich an seine Fersen zu heften. Wenn Dad flussaufwärts in einem Hain herabgefallene Äste sammelte, schleifte mich Zach ebenfalls dorthin, um nach Pilzen zu suchen. Wenn Dad das Maisfeld aberntete, wollte Zach plötzlich unbedingt das Gatter der nahe gelegenen Koppel reparieren. Dabei hielt er stets eine Art Sicherheitsabstand zu unserem Vater, folgte ihm wie ein seltsam verrutschter Schatten.
Nachts, wenn Mum und Dad über uns sprachen, presste ich die Augen fest zusammen, als könnte ich so die durch die Dielen dringenden Stimmen ausblenden. Ich hörte, wie sich Zach in seinem Bett an der anderen Wand regte. Seinen gleichmäßigen Atem. Ich hatte keine Ahnung, ob er wirklich schlief oder bloß so tat.
»Du hast etwas Neues gesehen.«
Ich starrte an die graue Decke, um den Blicken der Beichtmutter zu entgehen. Ihre Fragen waren immer gleich formuliert: geradeheraus, als Feststellungen, so als wüsste sie bereits über alles Bescheid. Und ob das tatsächlich der Wahrheit entsprach … dessen konnte ich mir nie sicher sein. Ich wusste, wie es war, die Gedanken der anderen zu lesen oder mit Erinnerungen aufzuwachen, die einem nicht gehörten. Aber die Beichtmutter war nicht nur eine Seherin. Sie setzte ihre Kraft gezielt ein. Jedes Mal, wenn sie zu mir in die Zelle kam, spürte ich, wie ihre Gedanken meine umkreisten. Ich hatte mich stets geweigert, mit ihr zu sprechen, aber wie gut ich meine inneren Bilder vor ihr verbergen konnte, wusste ich nicht.
»Nur die Explosion. Wie immer.«
Sie verschränkte die Finger und löste sie wieder voneinander. »Erzähl mir doch bitte mal was anderes als die letzten zwanzig Mal.«
»Da gibt’s nichts zu erzählen. Ich sehe nur die Explosion.«
Forschend blickte ich ihr ins Gesicht, das keinerlei Wissen preisgab. Ich bin aus der Übung, dachte ich. Ich war zu lang in dieser Zelle, abgeschnitten vom Rest der Welt. Aber die Seherin hatte auch etwas Undurchschaubares. Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Sie war fast so bleich wie ich nach den langen Monaten im Verlies. Das Brandmal auf ihrem Gesicht stach deutlicher hervor als bei anderen. Wahrscheinlich, weil sonst alles an ihr so unerschütterlich wirkte. Bis auf das satte rote Mal, das auf ihrer Stirn prangte, war ihre Haut so glatt und makellos wie ein Flusskiesel. Ihr Alter ließ sich schwer schätzen. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, sie sei so alt wie ich und Zach, aber auf mich machte sie einen Jahrzehnte älteren Eindruck. Das musste an der Intensität ihres Blicks liegen. An den dahinterliegenden Kräften, die er kaum zu verbergen vermochte.
»Zach will, dass du mir hilfst.«
»Dann sagen Sie ihm, er soll selbst herkommen. Sagen Sie ihm, er soll mich besuchen.«
Die Beichtmutter lachte. »Die Wachen meinten, in den ersten Wochen hättest du ununterbrochen seinen Namen geschrien. Glaubst du auch jetzt noch, dass er kommen wird? Nach den drei Monaten, die du hier drin verbracht hast?«
»Er wird kommen«, erwiderte ich. »Irgendwann.«
»Du scheinst dir deiner Sache ziemlich sicher zu sein«, sagte sie und neigte den Kopf. »Aber bist du auch sicher, dass du das wirklich willst?«
Nie würde ich ihr anvertrauen, dass die Beziehung mit meinem Bruder genauso wenig eine Frage des Willens war wie die Bewegungsrichtung eines Flusses. Und wie hätte ich ihr auch erklären sollen, dass er mich brauchte, selbst wenn ich diejenige war, die in einer Zelle saß?
Ich versuchte, das Thema zu wechseln. »Ich habe keinen Schimmer, was Sie von mir wollen«, sagte ich. »Und zu was ich Ihrer Ansicht nach fähig bin.«
Sie verdrehte die Augen. »Du bist wie ich, Cass. Dementsprechend weiß ich sehr genau, zu was du fähig bist, selbst wenn du es nicht zugibst.«
Ich versuchte es mit einem strategischen Zugeständnis: »Ich habe sie in letzter Zeit öfter gesehen. Die Explosion.«
»Tja … Leider bezweifle ich, dass du uns brauchbare Informationen zu einem vierhundert Jahre zurückliegenden Ereignis liefern kannst.«
Ich spürte, wie sich ihre Gedanken in mich hineinbohrten, unangenehm wie fremde Hände auf meinem Körper. Ich versuchte, die Undurchdringlichkeit der Beichtmutter zu imitieren, mich abzuschotten.
Sie lehnte sich zurück. »Erzähl mir von der Insel.«
Sie hatte ganz ruhig gesprochen, doch es bereitete mir einige Mühe, den Schock zu überspielen, dass ich so leicht infiltriert worden war. Ich sah die Insel erst seit wenigen Wochen, seit meinem letzten Ausflug zu den Mauern. Zuerst hatte ich noch an mir gezweifelt und mich gefragt, ob das Meer und der Himmel darüber nicht eher eine Fantasie als eine Vision gewesen waren. Ein Tagtraum von einem weiten, offenen Land, der die Begrenztheit meiner täglichen Realität aufbrach, die Begrenzung durch die vier grauen Wände, das schmale Bett, den einsamen Stuhl. Doch dafür kamen die Bilder zu regelmäßig, zu detailliert, zu beständig. Ich wusste um ihre Echtheit, und mir war klar, dass ich nie über sie würde sprechen dürfen. In der erdrückenden Stille der Zelle hallte mein Atem laut in meinen Ohren wider.
»Ich habe sie auch gesehen«, sagte die Beichtmutter. »Du wirst mir alles sagen.«
Erneut bahnte sie sich einen Weg in meine Gedanken. Ich fühlte mich bloßgestellt, als würde ich Dad dabei zusehen, wie er einen Hasen häutete und sein Innerstes offenlegte. Ich versuchte, meinen Verstand abzudichten, die Bildfetzen von der Insel einzuschließen: die in einen vulkanischen Krater gebettete Stadt, Häuser, die auf steilen Abhängen übereinander standen, Wasser, unbarmherzig grau, das sich in alle Richtungen ausdehnte und von scharfkantigen Felsen durchsetzt war. All das sah ich so klar vor mir wie schon in vielen vorangegangenen Nächten. Ich versuchte mir vorzustellen, ich würde das Geheimnis in meinem Mund verschließen, so wie die Insel ihre geheime, in den Krater geschmiegte Stadt hütete.
Ich stand auf. »Es gibt keine Insel.«
Die Beichtmutter erhob sich ebenfalls. »Das wäre tatsächlich besser für dich.«
Umso älter wir wurden, desto prüfender musterte mich auch Zach wie sonst nur unsere Eltern. Für ihn war jeder Tag, an dem sich kein Unterschied zwischen uns manifestierte, ein weiterer Tag, an dem er von dem Verdacht, ein Omega sein zu können, gebrandmarkt war. Ein weiterer Tag, an dem er seinen rechtmäßigen Platz in der Alpha-Gesellschaft nicht einnehmen konnte. Und so verweilten wir – immer noch ohne sichtbare Aufsplittung – am Rande des Dorflebens. Während andere Kinder zur Schule gingen, lernten wir am Küchentisch. Während sie zusammen am Fluss spielten, hatten wir nur einander oder wir folgten ihnen in einigem Abstand, um ihre Spiele zu imitieren. Da wir uns gerade so weit von ihnen entfernt hielten, dass sie uns weder beschimpfen noch mit Steinen bewerfen konnten, erhaschte ich nur einzelne Wortfetzen. Zu Hause versuchten wir dann, ihre Liedverse nachzusingen. Die Lücken füllten wir mit eigenen Worten und Zeilen. Wir existierten in unserem ganz eigenen Kosmos, in den der Argwohn um uns herum uns gedrängt hatte. Für den Rest des Dorfes waren wir Objekte der Neugier und, später, auch Objekte unverblümter Feindseligkeit. Nach einer Weile war das Flüstern unserer Nachbarn kein Flüstern mehr, sondern ein Schreien, eine einzige bösartige Verunglimpfung: Gift. Freak. Blender. Mutanten. Verunstaltete. Da sie keine Ahnung hatten, wer von uns der gefährliche Part war, verachteten sie uns kurzerhand beide. Und jedes Mal, wenn ein neues Zwillingspaar geboren und aufgeteilt wurde, stach unser vereinter Zustand noch mehr hervor. Oscar, der Sohn unserer Nachbarn, dessen linkes Bein am Knie endete, wurde mit neun Monaten zu seinen Omega-Verwandten geschickt. Danach kamen wir oft an der kleinen Meg vorbei, seiner übrig gebliebenen Zwillingsschwester, die allein in dem umzäunten Hof ihres Hauses spielte.
»Bestimmt vermisst sie ihren Bruder«, sagte ich, als wir ihr zusahen, wie sie ohne Unterlass auf dem Kopf eines Miniaturholzpferds herumkaute.
»Na klar«, entgegnete Zach. »Ich wette, sie ist am Boden zerstört, dass sie ihr Leben nicht mehr mit einem Freak teilen muss.«
»Und er vermisst seine Familie bestimmt auch.«
»Omegas haben keine Familie.« Die vertrauten Worte von den Plakaten des Rats. »Abgesehen davon weißt du doch, was passiert, wenn man zu sehr an seinen Omega-Kindern hängt.«
Ja, ich hatte die Geschichten gehört. Es gab immer wieder Eltern, die gegen die Aufteilung rebellierten und versuchten, ihre Zwillinge zu behalten. Der Rat kannte kein Erbarmen mit ihnen. Das Gleiche galt für die wenigen Alphas, die eine Beziehung mit einem Omega eingingen. Es kursierten Gerüchte über öffentliche Auspeitschungen und Schlimmeres. Doch die meisten Eltern waren nur allzu gerne bereit, ihre Omega-Babys abzugeben, schienen geradezu erpicht darauf, ihren deformierten Nachwuchs loszuwerden. Gemäß den Lehren des Rats konnte es gefährlich werden, Omegas über einen längeren Zeitraum um sich zu haben. Die »Gift«-Rufe unserer Nachbarn waren nicht nur ein Zeichen von Abscheu, sondern auch von Angst. Omegas mussten aus der Alpha-Gesellschaft vertrieben werden, so wie dem Alpha-Zwilling im Mutterleib das Gift durch den Omega-Zwilling entzogen wurde. Aber da wir uns nicht fortpflanzen konnten, würden wir wenigstens nie ein Kind wegschicken müssen. Ob dies das Einzige war, von dem wir Omegas verschont blieben?
Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis auch ich vertrieben würde. Meine Geheimniskrämerei zögerte das Unvermeidliche bloß hinaus. Manchmal fragte ich mich sogar, ob mein gegenwärtiges Dasein – das ewige Misstrauen von Seiten des Dorfes und meiner Eltern – besser war als das unweigerlich folgende Exil. Zach war der Einzige, der mein seltsames Schwellenleben verstand, denn er führte es genauso wie ich. Und doch fühlte ich den aufmerksamen Blick aus seinen dunklen ruhigen Augen in einem fort auf mir ruhen.
Auf der Suche nach weniger wachsamer Gesellschaft fing ich eines Tages drei rote Käfer aus den Scharen, die jeden Tag zu unserem Brunnen strömten, und bewahrte sie in einem Glas auf meinem Fenstersims auf. Es gefiel mir, ihrem bewegten Treiben zuzusehen und wie ihre Flügel stumm gegen das Glas flirrten. Eine Woche später entdeckte ich zu meinem Entsetzen, dass mein größter Käfer an den hölzernen Sims genagelt worden war. Aufgespießt und mit nur einem Flügel drehte er sich wieder und wieder um die Achse seiner Gedärme.
»Es war ein Experiment«, sagte Zach. »Ich wollte testen, wie lange er überlebt.«
Ich erzählte es unseren Eltern. »Ihm ist nur langweilig«, erwiderte meine Mutter. »Es macht ihn verrückt, dass ihr nicht wie vorgesehen in die Schule gehen könnt.« Die unausgesprochene Wahrheit – nämlich dass nur einer von uns je eine Schule besuchen würde – schwebte zwischen uns im Raum, Kreise ziehend wie der gepfählte Käfer.
Um seinem qualvollen Rotieren ein Ende zu bereiten, zertrat ich ihn mit dem Absatz meines Schuhs. An jenem Abend brachte ich das Glas und die beiden verbliebenen Käfer zum Brunnen zurück. Als ich den Deckel öffnete und den Behälter etwas zur Seite neigte, wollten sie sich nicht ins Freie wagen. Behutsam beförderte ich sie mithilfe eines Grashalms auf den steinernen Brunnenrand, auf dem ich saß. Einer versuchte einen kurzen Flug und landete gleich darauf auf meinem nackten Bein. Ich ließ ihn verweilen, bis ich ihn schließlich sanft pustend zum Fliegen antrieb.
Später sah Zach das leere Glas neben meinem Bett. Keiner von uns sagte ein Wort.
Ungefähr ein Jahr später – es war ein stiller Nachmittag und wir waren gerade dabei, Feuerholz am Fluss zu sammeln – beging ich den entscheidenden Fehler. Ich marschierte direkt hinter Zach her, als ich plötzlich etwas sah: den flüchtigen Eindruck einer Vision, einen Bildfetzen nur, der sich zwischen mich und die reale Welt schob. Noch bevor der Ast überhaupt zu fallen drohte, warf ich mich auf meinen Bruder und stieß ihn aus dem Weg. Eine instinktive Reaktion, die ich normalerweise unterdrückt hätte. Später würde ich mich fragen, ob meine Angst zu dieser Entgleisung geführt oder ob mich Zachs ständiger Argwohn ausgelaugt hatte. So oder so – er war in Sicherheit. Als sich der massive Ast ächzend vom Stamm löste, andere Zweige mit sich riss und schließlich genau dort landete, wo mein Bruder eben noch gestanden hatte, lag dieser bereits der Länge nach ausgestreckt unter mir auf dem Pfad. Unsere Blicke begegneten sich. Die Erleichterung in seinen Augen erstaunte mich.
»Viel hätte nicht gefehlt«, sagte ich.
»Ich weiß.« Er half mir auf und strich mir ein paar Blätter vom Kleid.
»Ich habe gesehen, dass er fällt.« Ich sprach zu schnell.
»Du musst nichts erklären«, sagte er. »Ich bin dir dankbar, dass du mich weggestoßen hast.« Zum ersten Mal seit Jahren lächelte er mich so breit und unbelastet an wie früher in unserer Kindheit. Doch ich kannte ihn zu gut, um mich zu freuen. Er bestand darauf, mein Feuerholzbündel auf seines zu schnüren und die gesamte Last allein ins Dorf zu schleppen. »Ich bin dir was schuldig«, sagte er.
In den folgenden Wochen verbrachten wir wie immer die meiste Zeit zusammen, doch seine Spiele waren weniger grob. Wenn wir zum Brunnen gingen, wartete er auf mich und wenn wir eine Abkürzung über die Felder nahmen, warnte er mich vor Brennnesselbüscheln. Er zog mich nicht an den Haaren und nahm mir nichts weg. Sein neu erworbenes Wissen gewährte mir eine Atempause von seinen alltäglichen Grausamkeiten, aber noch reichte es nicht, um uns aufzuteilen. Die Jahre voller leidenschaftlicher, nutzloser Beteuerungen hatten Zach gelehrt, dass er Beweise brauchte. Und so wartete er, dass mir ein weiterer Ausrutscher passierte, der mich endgültig verraten würde.
Doch es gelang mir noch über ein Jahr, mein Geheimnis für mich zu behalten. Denn obwohl meine Visionen stärker wurden, unterdrückte ich ein Schreien, wenn Flammen durch meine Nächte zuckten oder Bilder von fernen Orten durch meine Gedanken drifteten. Ich verbrachte zunehmend mehr Zeit allein und wagte mich weiter stromaufwärts, zu einer tiefen Schlucht, die mich vom Fluss wegführte, hin zu einem Ort, an dem verlassene Silos standen. Zach folgte mir nicht mehr, wenn ich alleine loszog. Natürlich betrat ich die Silos nie. Derartige Überbleibsel aus dem Vorher waren tabu. Unsere kaputte Welt war übersät mit Ruinen und sie zu betreten verstieß, genau wie der Besitz von Reliquien, gegen das Gesetz. Ich hatte gehört, dass ein paar verzweifelte Omegas die Trümmerhaufen nach verwertbaren Fragmenten durchsucht hatten, um sie zu plündern. Aber was sollte nach all den Jahrhunderten noch zu bergen sein? Die Explosion hatte die meisten Städte dem Erdboden gleichgemacht. Selbst wenn in den Tabuzonen noch etwas zu holen gewesen wäre – wer hätte sich das angesichts der drohenden Sanktionen getraut? Und noch viel furchteinflößender als das Gesetz waren die Gerüchte über die Ruinen selbst. Über das, was einem dort begegnen konnte. Strahlung, die sich wie ein Wespennest festgesetzt hatte. Eine alles verpestende Vergangenheit. Wenn das Vorher je erwähnt wurde, dann nur hinter vorgehaltener Hand, mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Abscheu.
Früher hatten Zach und ich uns zu Mutproben herausgefordert, um zu sehen, wer sich näher an die Ruinen heranwagte. Eines Tages war er, wie immer der beherztere von uns beiden, zum nächstgelegenen Silo gerannt und hatte seine Hand auf die gewölbte Betonwand gelegt, bevor er, schwindlig vor Stolz und Angst, zu mir zurückgesprintet war.
In letzter Zeit hingegen saß ich nur noch allein unter einem Baum, von dem aus ich die Silos überblicken konnte. Die drei riesigen schlauchförmigen Gebilde waren intakter als so manch anderes altes Gemäuer. Die sie umgebende Schlucht und das vierte Silo, das bis auf sein kreisförmiges Fundament eingestürzt war, hatten einen Großteil der Explosion abgefangen. Aus dem Staub erhoben sich metallene Dachsparren, gierige Finger einer lebendig begrabenen Welt. Obwohl die Silos so hässlich aussahen, war ich dankbar für ihre Existenz. Sie garantierten mir, dass sich niemand hierhertrauen würde und ich wenigstens auf meine Einsamkeit zählen konnte. Anders als in Haven oder anderen größeren Städten hatte der Rat hier keine Plakate an den Mauern befestigt, die im Wind flatterten und auf denen zu lesen stand: Vorsicht vor der Verseuchung der Omegas, und: Alpha-Einheit: Die Steuern für Omegas wurden erhöht.
Seit der Dürre schien es von allem weniger zu geben – nur von den Aushängen des Rats nicht. Manchmal fragte ich mich, ob ich mich zu den Ruinen hingezogen fühlte, weil ich mich selbst in ihnen erkannte. In unserer Gebrochenheit glichen wir Omegas den verbotenen Trümmern. Wir waren gefährlich. Ansteckend. Eine fortwährende Erinnerung an die Explosion und ihr zerstörerisches Werk.
Obwohl Zach mich nicht mehr zu den Silos oder auf andere Ausflüge begleitete, wusste ich, dass er mich aufmerksamer denn je beobachtete. Kam ich müde von meinen langen Spaziergängen zurück, lächelte er mich listig an und fragte, wie mein Tag gewesen sei. Obwohl er wusste, wo ich mich rumtrieb, verlor er unseren Eltern gegenüber kein Wort darüber. Sie wären außer sich gewesen. Doch er ließ mich in Ruhe. Wie eine Schlange, die sich erst zurückzog, um dann vernichtend zuzuschnappen.
Bei seinem ersten Entlarvungsversuch klaute er meine Lieblingspuppe Scarlett. Die mit dem roten, von Mum genähten Kleid. Als Zach und ich plötzlich zwei getrennte Betten bekommen hatten, hatte ich mich nachts trostsuchend an sie geklammert. Selbst jetzt, mit zwölf, schlief ich noch mit Scarlett im Arm ein. Die derb geflochtene Wolle ihres Haars kratzte beruhigend auf meiner Haut. Als ich beim Frühstück nach ihr fragte, antwortete Zach triumphierend, dass sie in einem Versteck außerhalb der Stadt sei. Er habe sie genommen, während ich schlief. Er wandte sich an unsere Eltern: »Wenn sie rausfindet, wo sie vergraben ist, muss sie eine Seherin sein. Dann habt ihr euren Beweis.«
Unsere Mutter tadelte ihn und legte mir beruhigend eine Hand auf die Schulter, aber ich merkte, dass sie mich noch angespannter beobachtete als sonst.
Ich weinte wie geplant. Die hoffnungsvolle Aufmerksamkeit in den Augen meiner Eltern machte es mir leicht. Zu sehen, wie sehr sie danach gierten, das Rätsel zu lösen, zu dem Zach und ich für sie geworden waren, selbst wenn sie mich dafür hergeben mussten. An diesem Abend zog ich eine fremd aussehende Puppe mit seltsam schief geschnittenem Haar und einem schlichten weißen Kittel aus unserer kleinen Spielzeugkiste und entließ Scarlett damit aus ihrem Exil, zu dem ich sie vor einer Woche verdammt hatte. Ich hatte ihr das lange rote Haar abgehackt und das Kleid einer anderen, unwichtigen Puppe übergezogen. Von jetzt an saß Scarlett für jeden sichtbar auf meinem Bett und blieb dennoch ein Geheimnis. Ich machte mir nie die Mühe, flussabwärts zu der vom Blitz versengten Weide zu gehen und die Puppe mit dem roten Kleid auszugraben, die Zach dort versteckt hatte.
3
MUM UND DAD hatten schon wieder einen Streit gehabt. Heimtückisch wie Rauch drang ihr hitziges Wortgefecht aus dem unteren Stockwerk durch die Dielen zu uns.
»Das wird mit jedem Tag ein größeres Problem«, sagte Dad.
Mums Stimme war ruhiger. »Die beiden sind kein ›Problem‹, sondern unsere Kinder.«
»Nur eins davon«, erwiderte er. Ein Glas schepperte laut auf dem Tisch. »Das andere ist gefährlich. Gift. Nur dass wir nicht wissen welches.«
Zach hasste es, wenn ich ihn weinen sah, aber die heruntergebrannte Kerze spendete gerade so viel Licht, dass ich seinen Rücken unter der Decke zucken sehen konnte. Ich schlüpfte unter meinem Quilt hervor. Die Dielen knarzten leise, als ich in zwei Schritten zu ihm hinüberging und mich an den Rand seines Bettes setzte. »Er meint es nicht so«, flüsterte ich und legte eine Hand auf seinen Rücken. »Er will dir nicht wehtun, wenn er solche Sachen sagt.«
Zach setzte sich auf und schüttelte meine Hand ab. Es überraschte mich, dass er nicht mal versuchte, sich die Tränen vom Gesicht zu wischen. »Er tut mir nicht weh«, entgegnete er. »Im Gegenteil, jedes einzelne Wort ist wahr. Und da willst du mir auf die Schulter klopfen, mich trösten und so tun, als wärst du so unglaublich fürsorglich? Unsere Eltern tun mir nicht weh. Und auch die anderen Kinder nicht, die mit Steinen nach uns werfen. Hörst du das?« Er deutete auf den Boden, durch den wir unsere Eltern streiten hörten, und dann auf sein tränenüberströmtes Gesicht. »Das ist alles deine Schuld. Du bist das Problem, Cass, nicht sie. Wegen dir hängen wir in dieser Vorhölle fest.«
Plötzlich spürte ich die Kälte der Dielen unter meinen Füßen und wie eisig sich die Nachtluft auf meinen nackten Armen anfühlte.
»Du willst beweisen, dass ich dir wirklich wichtig bin?«, fragte er. »Dann sag die Wahrheit. Du könntest das Ganze beenden, jetzt und hier.«
»Willst du wirklich, dass man mich wegschickt? Ich bin’s doch, deine Schwester. Und nicht irgendein seltsames Geschöpf. Vergiss den Rat und das ganze Gerede von wegen Ansteckungsgefahr. Ich bin’s. Du kennst mich.«
»Das sagst du schon die ganze Zeit. Aber wie könnte ich glauben, dich zu kennen? Du warst nie ehrlich zu mir. Du hast mir nie die Wahrheit gesagt, sondern mich alles selbst rausfinden lassen.«
»Ich konnte es dir nicht erzählen«, antwortete ich. Selbst dieses Geständnis, hier, in der Einsamkeit unseres Zimmers, war schon riskant.
»Weil du mir nicht vertraut hast. Und jetzt tust du so, als hätten wir ein wahnsinnig enges Verhältnis. Dabei hast du mich die ganze Zeit angelogen. All die Jahre hast du zugelassen, dass ich mir so viele Fragen gestellt habe. Dass ich Angst hatte, ich könnte der Freak sein. Und jetzt meinst du, ich soll dir vertrauen?«
Ich wich zu meinem Bett zurück. Zach starrte mich immer noch an. Hätte es anders zwischen uns sein können, wenn ich ihm die Wahrheit gesagt hätte? Hätten wir einen Weg gefunden, mein Geheimnis zu teilen und uns gemeinsam durchzuschlagen? Stammte sein Misstrauen in Wirklichkeit von mir? Vielleicht war das ja das Gift, das ich in mir trug. Nicht die zerstörerische Kraft der Explosion, die allen Omegas innewohnte … sondern mein Geheimnis. Auf seiner Oberlippe saß eine Träne, die golden im Kerzenschein glänzte. Da ich nicht wollte, dass er das Gegenstück auf meinem Gesicht bemerkte, streckte ich die Hand aus und löschte mit den Fingern die Kerze auf dem Tisch.
»Das muss aufhören«, flüsterte er in die Dunkelheit, halb flehend und halb drohend.
Zachs Ungeduld wuchs, als unser Vater erkrankte. Wir waren gerade dreizehn geworden. Wie auch im Jahr zuvor hatte man unseren Geburtstag mit keinem Wort erwähnt. Unser Alter wurde zu einer zunehmend schmachvollen Mahnung unseres ungesplitteten Daseins. An jenem Abend flüsterte Zach durchs Zimmer: »Du weißt, was heute für ein Tag ist, oder?«
»Natürlich«, erwiderte ich.
»Alles Gute zum Geburtstag«, fügte er hinzu. Es war nur ein Wispern. Ich hätte nicht sagen können, ob es sarkastisch gemeint war.
Zwei Tage später brach Dad zusammen. Unser Vater, der immer so robust und kräftig gewesen war wie der Eichenholzbalken an unserer Küchendecke. Wenn es darum ging, Wassereimer aus dem Brunnen zu ziehen, war er schneller als jeder andere, und als Zach und ich noch kleiner gewesen waren, hatte er uns beide gleichzeitig tragen können. Wahrscheinlich könnte er es immer noch, dachte ich. Nur dass er uns inzwischen kaum mehr berührte. Dann, an jenem heißen Tag, fiel er mitten auf der Koppel auf die Knie. Ich saß an einer Steinmauer im vorderen Teil unseres Gartens und enthülste Erbsen, als ich die Schreie der Feldarbeiter hörte.
Unsere Nachbarn brachten Dad ins Cottage. Mum wollte seine Zwillingsschwester Alice kommen lassen, die oben im Flachland in einer Omega-Siedlung lebte. Zach und Mick schwangen sich auf einen Ochsenkarren, um schon am nächsten Tag mit ihr zurückzukehren. Sie lag auf der Ladefläche im Heu. Wir hatten sie noch nie gesehen, und während ich sie betrachtete, kam es mir so vor, als sei das zehrende Fieber die einzige Ähnlichkeit zwischen ihr und Dad. Sie war dünn und ihr Haar dunkler und länger als seins. Der derbe braune Stoff ihres Kleids war schon einige Male geflickt worden und voller Stroh. Zwischen den Haarsträhnen, die an ihrer verschwitzen Stirn klebten, blitzte das Brandzeichen hervor: Omega.
Wir versorgten sie so gut wir konnten, doch es war von Anfang an klar, dass ihr nicht viel Zeit blieb. Auch wenn wir sie natürlich nicht ins Haus ließen, genügte ihre Anwesenheit im Schuppen, um Zachs Wut zu entfachen. Am zweiten Tag war es am schlimmsten. »Das ist widerlich!«, schrie er. »Die ist widerlich! Wieso kann sie einfach so hierbleiben und warum müssen wir ihr wie die Sklaven nachlaufen? Sie wird ihn umbringen! Und wenn sie ständig in unserer Nähe ist, bringt sie uns auch noch in Gefahr!«
Mum machte sich nicht die Mühe, ihm Einhalt zu gebieten, sondern erwiderte ruhig: »Wenn wir sie in ihrer schmutzigen, alten Hütte gelassen hätten, würde sie ihn noch schneller umbringen.«
Das brachte Zach zum Schweigen. Er wollte Alice loswerden, aber zugeben, was er in der Siedlung gesehen hatte – das kleine saubere Cottage, die weißgewaschenen Wände und die getrockneten Kräuterbündel, die genau wie bei uns über dem Kamin hingen – nein, das wollte er nicht.
»Wenn wir sie retten, retten wir auch ihn«, fügte Mum hinzu.
Erst tief in der Nacht, als unsere Kerze bereits erloschen war und keine Stimmen mehr aus dem Zimmer unserer Eltern drangen, berichtete Zach, was in der Siedlung passiert war. Anscheinend hatten die anderen Omegas versucht, ihn und Mick aufzuhalten, weil sie sich selbst um Alice kümmern wollten. Aber natürlich würde sich kein Omega ernsthaft mit einem Alpha anlegen. Und so waren sie bereitwillig zurückgewichen, als Mick die Peitsche geschwungen hatte.
»Ist es nicht grausam, sie ihrer Familie wegzunehmen?«, flüsterte ich.
»Omegas haben keine Familie«, erwiderte Zach und zitierte einmal mehr den Rat.
»Na ja, keine Kinder, aber es wird doch Menschen geben, die Alice am Herzen liegen. Freunde oder vielleicht ein Ehemann.«
»Ein Ehemann?« Das Wort hing zwischen uns in der Luft. Offiziell durften Omegas nicht heiraten, und der Rat erkannte eine solche Verbindung auch nicht an. Trotzdem taten sie es, das war allgemein bekannt.
»Du weißt, was ich meine.«
»Sie hat da mit niemandem zusammengelebt«, widersprach Zach. »Diese Leute waren einfach nur irgendwelche Freaks aus ihrer Siedlung, die behauptet haben, sie wüssten, was das Beste für sie ist.«
Bislang hatten wir kaum einen Omega zu Gesicht bekommen, geschweige denn, auf so engem Raum Zeit mit ihm verbracht. Den kleinen Oscar von nebenan hatte man weggeschickt, sobald er gebrandmarkt und abgestillt worden war. Und die wenigen Omegas, die es in unsere Gegend verschlug – Vagabunden, die auszogen, um in größeren Siedlungen im Süden ihr Glück zu versuchen –, blieben gerade mal eine Nacht und kampierten flussabwärts außerhalb des Dorfes. In Zeiten magerer Ernte hatten einige von ihnen die Bewirtschaftung ihres halb verödeten Lands eingestellt und sich auf den Weg zu einem Reservat in der Nähe von Wyndham