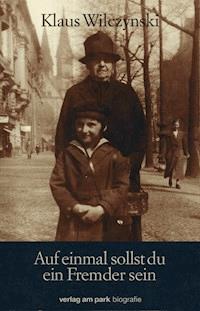Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag am Park
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 2. April 1940 stach in Liverpool die "Dunera" in See. An Bord befanden sich etwa 2.000 Menschen, darunter viele Juden, die von den Briten interniert worden waren und nach Australien abgeschoben werden sollten. Viele dieser Häftlinge hatten bereits Lager in Hitlerdeutschland durchlitten - nun befanden sie sich wieder hinter Stacheldraht und waren üblen Schikanen ausgesetzt. Der Berliner Klaus Wilczynski befand sich unter den Deportierten. In seinem Erlebnisbericht schildert er die Schrecken der 57-tägigen Überfahrt, bei der sie auch von deutschen U-Booten angegriffen wurden. Er erinnert sich an die Internierung in Australien und schließlich an seinen Eintritt in die Streitkräfte des Landes. Denn nachdem sich das britische Parlament mit dem Vorfall befaßt hatte (Churchill: "Ein zu beklagender und bedauernswerter Fehler."), kamen die Männer frei. Einige aber, die mit dem Schiff nach Großbtittanien zurückkehrten, wurden von einem Torpedo getroffen... Der Fall "Dunera" wurde in der Literatur kaum behandelt. Es ist dies der erste Augenzeugenbericht über ein zwar marginales, aber bezeichnendes Kapitel des Krieges und der Judenverfolgung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-89793-312-5
© 2013 verlag am park
Alle Nachdrucke sowie Verwertung in Film, Funk und Fernsehen und auf jeder Art von Bild-, Wort- und Tonträgern sind honorar- und genehmigungspflichtig.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Bücher des Verlags am Park werden
von der Eulenspiegel Verlagsgruppe vertrieben
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Klaus Wilczynski
Das
Gefangenen-
schiff
Mit der »Dunera«
über vier Weltmeere
verlag am park
Am 11. Juli 1940, auf dem Höhepunkt des deutschen U-Boot-Krieges gegen England, verließ um 2 Uhr morgens das Truppenschiff »HMT Dunera« den Hafen von Liverpool. An Bord befanden sich rund 2 000 von der britischen Regierung internierte jüdische und politische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich. 57 Tage später trafen sie im australischen Sydney ein.
Dies ist die frei erzählte Geschichte von einem dieser Flüchtlinge. Sollten die darin vorkommenden Menschen verstorbenen oder noch lebenden Personen ähneln, so ist es gewollt.
»Ich empfinde mit außerordentlicher Stärke, daß die Geschichte dessen, was diesen unglücklichen Ausländern geschah, einer der schimpflichsten Vorfälle in der gesamten Geschichte dieses Landes ist.«
Lord Cecil am 6. August 1940 im britischen Oberhaus
»Ein zu beklagender und bedauernswerter Fehler«
Sir Winston Churchill
1
Ade Europa, nur noch Stunden verbleiben. Mit unseren kümmerlichen Habseligkeiten trotten wir unlustig hinter ein paar Soldaten her zu unserem letzten Nachtquartier vor der großen, unfreiwilligen Reise – ein verlorener Haufen. Fast ein Jahr schon ist Krieg, und es ist mein elfter Tag hinter britischem Stacheldraht. Würde mich jemand fragen, was ich beim Betreten des leergeräumten Saales empfinde, der zu Seebade-Ferienzeiten des zum Internierungslager umgewandelten Kurorts Douglas auf der Insel Man wahrscheinlich eine Tanzhalle gewesen war, so fiele es mir schwer, den Mischmasch von Gefühlen zu definieren. Bedrückung? Etwas davon gewiß. Wer hat schon das Bedürfnis, »eine Seefahrt, die ist lustig« zu singen, wenn er wie eine Sache wider Willen auf eine Fahrt ins Ungewisse verfrachtet wird? Neugier? Sicher auch, denn Ungewißheit fordert die Phantasie heraus. Abenteuer? Ohne Zweifel. Ich bin 18 Jahre alt, jung genug, einer Herausforderung das Abenteuerliche abzugewinnen. Wehmut? Auch davon ein kleiner Schuß, ist sie doch die Gefährtin eines jeden Abschieds.
Aber es fragt mich natürlich keiner nach meinen Gefühlen. Ebensowenig, wie mich ein ziviler oder uniformierter Mister Unbekannt im Londoner Regierungsviertel gefragt hatte, als er meinen Namen auf eine stattliche Liste internierter jüdischer und politischer Flüchtlinge aus Deutschland setzte, denen er allesamt eine Seereise nach weit weg von England verordnete. So weit weg wie möglich mit diesen undurchsichtigen Typen, am besten auf den Mond.
Eng und düster ist es in der Halle. Die dünnen Strohsäcke versprechen auf dem durch Generationen von Lackschuhen blankgewetzten Parkettboden wenig Polster für müde Knochen. Wir richten uns ein, so gut es geht. Lange währt die Nacht ohnehin nicht. Schon im Morgengrauen geht es los. Ohne Frühstück. Ungewaschen. Ein unfreundlicher Tag kündigt sich an. Es nieselt. Blaugrau wie der Himmel zeigt sich auch die Irische See. Aber die Fähre, auf deren Unterdeck wir mit reichlicher Bewachung Liverpool entgegen schaukeln, hat leichtes Fortkommen. Das für seine Tücke berüchtigte Gewässer zwischen England und Irland verhält sich an diesem 10. Juli 1940 relativ ruhig. Gegen Mittag tauchen am Horizont die Kräne des Hafens von Liverpool auf. An den Liegeplätzen haben Frachter aus allen Teilen des britischen Weltreichs festgemacht. Lebensmittel entladen sie und Rohstoffe für die britische Kriegsmaschine. Auf Reede tanzen Respekt gebietend wachsam die grauen Leiber von Kriegsschiffen. Langsam läuft die Fähre im Hafen ein, macht, wie es der Zufall will, an der selben Pier fest, an der ich eine Woche zuvor, aus einem Internierungslager in York kommend, für die Überfahrt nach Douglas unter Bajonetten an Bord eskortiert worden war.
York, das war ein schlimmes Lager gewesen. Mein erstes.
Es machte schon auf seine Präsens mit einem Maschinengewehr auf der Spitze eines imposanten Turms aufmerksam, als wir, eine kleine Gruppe frisch Internierter, in den von Generationen rußender Lokomotiven geschwärzten Bahnhof der Stadt einrollten. Der Turm gehörte zur Schokoladenfabrik »Cadbury«, in deren süßer Nachbarschaft eine so um das Wohl der deutschen Emigranten besorgte Obrigkeit das Camp auf dem Gelände eines Sportplatzes eingerichtet hatte. Rundherum Stacheldraht und Wachposten, vorn ein doppelt gesicherter und mit Bajonetten bewachter Eingang. Das ganze von einer solchen Strenge, daß man beim Passieren des Tores fast glaubte, jeden einzelnen Stachel des damit reichlich bewehrten Zauns zustechen zu fühlen. Der 30. Juni 1940 war es gewesen, dieser erste Tag im Lager, der 48. Geburtstag meiner in irgendeinem Winkel Berlins hängengebliebenen Mutter
Die Unterkünfte standen auf einem Gelände außerhalb der Sportfläche. Ich landete in einer Baracke, in der fast nur Jugendliche untergebracht waren. Der Bretterbau wirkte auf den ersten Blick deprimierend. Auf den zweiten ebenfalls. Kleine Fenster ließen kaum Licht hinein. Bedrückende Enge. Die zweistöckigen Betten in dem Halbdunkel standen so dicht, als wollten sie sich aneinander reiben. Während ich das einzige noch freie in Beschlag nahm, richteten sich neugierige Augen auf mich. Deren Besitzer ließen sich jedoch sonst wenig bei der Tätigkeit stören, der sie gerade mit Inbrunst frönten. Sie aßen ihr Mittag. Gegessen wurde ausnahmslos in der Baracke. Elend wenig gab es, völlig ungenügend für junge Menschen, und es schmeckte ekelhaft. Die Portion, die sie mir zuwiesen, schlang ich schnell hinunter, was bei den Minirationen kein Kunststück war. Ich wollte schnell aus der stickigen Bude herauskommen. Draußen schien die Sonne.
Ehe ich dazu kam, mich für den Rest des Tages an die frische Luft zu verdrücken, hatten alle längst aufgegessen und der Hüttenälteste bekam mich beim Wickel. Knochig und erheblich älter als seine »Jünger«, war er offenkundig nicht nur von Amts wegen der Mittelpunkt des Hüttenlebens. Das Sprechen freilich bereitete ihm physische Mühe, er keuchte. Dies und die ungesund lila-bläuliche Gesichtsfarbe verrieten den Asthmatiker. Er stellte sich mir als Hubert Passauer vor.
Dem Namen zum Trotz stammte er jedoch nicht aus Bayern, sondern aus Berlin, was mein geschultes Berliner Ohr sofort wahrnahm. Passauer, jüdischer und politischer Flüchtling in einer Person, übte auf die jungen Leute um sich herum einen starken Einfluß aus. Nicht, daß er sich aufdrängte. Er besaß einfach eine besondere Ausstrahlung. Und er war ein richtiger Kumpel. Als einen solchen respektierten, akzeptierten die Jungen ihn.
Eine zusammenhaltende, festgefügte Gemeinschaft war das, in die ich da hineinschneite. Daß sie mich ohne viel Getue und Vorbehalte sofort in ihren Kreis aufnahm, machte das Lagerleben schon wesentlich erträglicher. Ein gemeinsames Schicksal hatte diese jüdischen Jugendlichen zusammengebracht. Überwiegend kleinbürgerlich-mittelständischer Herkunft, zwischen 16 und 19 Jahren alt, stammten sie aus allen Teilen Deutschlands. Nach dem 9. November 1938, der schändlichen »Reichspogromnacht« der Nazis, holten jüdische Hilfsorganisationen sie nach England, wo sie in Leeds dank großzügiger Spender aus dem Gastland eine von solchen Körperschaften unterhaltene Schule für angehende Handwerker besuchen konnten. Die etwas anders geartete Vorsorge der Regierung seiner Majestät brachte diese liebenswerte, ruppige Meute Halbwüchsiger nach dem Fall Frankreichs als Gefahr für das Empire hinter Stacheldraht.
Mit einem Bärenhunger im Bauch standen sie mit mir abends vor den Betten in der Baracke zum Zählappell. Ein Soldat rannte unter den Augen eines Leutnants wie ein Schäferhund die Reihen entlang, wobei er statt zu bellen mit Fingern und Lippen eins und eins und eins zusammenzählte, um am Ende seinem ungeduldig auf den Fußspitzen wippenden Vorgesetzten erleichtert das Ergebnis zuzubrüllen: »25, Sir!«. Sir stellte daraufhin sein Wippen ein und begab sich nach draußen, wo er mit Kameraden, die auf gleiche Weise in einem anderen Schuppen Inventur gemacht hatten, das Ergebnis der Viehzählung austauschte. Die Summe stimmte nie. Worauf sich das ganze wiederholte. Ergebnis: » 25, Sir!« Überraschenderweise hatte keiner von uns entbunden, noch war einer entschlafen. Wer wußte aber schon, ob solches sich vielleicht in einer anderen Baracke abgespielt hatte? Jedenfalls kam zu irgendeinem Zeitpunkt die Zahl zusammen, die es sein sollte. Worauf die Baracke trotz des Stacheldrahts um das gesamte Lager, der Posten draußen und des Maschinengewehrs auf dem Turm wie ein Knast abgeschlossen wurde.
Hinter verriegelter Tür, damit uns niemand klaute, saßen wir auf unseren Betten herum und klönten oder spielten Skat. Jung, robust, manche fast noch Kinder, verkrafteten meine Hüttengenossen die ihnen unverständliche, ungerechte Internierung mit einer Mischung aus derbem Humor und Wurschtigkeit. Hubert Passauer, der einzige wirklich Erwachsenen unter ihnen, fügte sich jungenhaft mit unverkennbarem Spaß an der Sache in die Gemeinschaft ein. Wieviel Kraft ihm seine Krankheit dabei abforderte, ließ er sich durch nichts anmerken. Stets war er für die Jungen da, bei jedem Jux mit dabei, mit jedem Problem konnten sie zu ihm kommen.
Unangekündigt beendete in allen Baracken ausgehendes Licht die abendliche Runde. Von zentraler Stelle für die Dauer der Nacht abgeschaltet, signalisierte die erlöschende Beleuchtung Bettzeit. Auch in dieser Hinsicht war die Entmündigung der Internierten von einer Perfektion, die wir von den Nazis Verfolgten und außer Landes Gejagten in jenem durch beschämende Niederlagen gekennzeichneten Jahr 1940 der britischen Kriegsführung gegen Hitler gewünscht hätten. Kaum eingeschlafen in der noch ungewohnten, miefigen Baracke, weckte mich lautes Klopfen auch schon wieder auf. Im Halblicht, das die von draußen hereinleuchtenden Scheinwerfer verbreiteten, sah ich jemanden an der Tür stehen und sie mit beiden Fäusten bearbeiten. Das Trommelkonzert dauerte solange an, bis ein Posten die Tür schimpfend, ob der Trommler verrückt geworden sei, aufschloß. Verrückt war er nicht, er mußte nur auf die Toilette. In der Baracke gab es keine Möglichkeit, nicht einmal einen Eimer fürs kleine Geschäft. Die Gelegenheit, nachts die Blase zu erleichtern, hing, was ich als Gipfel der Schikane empfand, letztlich vom guten Gehör eines wachhabenden Soldaten ab und dessen Gnade, den potentiellen Pinkler zur und von der Latrine zu eskortieren. Jede Nacht mußte einer.
An meinem dritten Tag im Lager York, wo unmittelbare Tuch- oder besser Stacheldrahtfühlung mit der Schokoladenfabrik Üppigkeit vortäuschte, fand die mit regelmäßigen nächtlichen Störungen gekoppelte Schmalkost ein Ende. Das Camp sollte teilweise geräumt, seine Insassen verlegt werden. Ein Gerücht sagte, auf die Insel Man. Doch so genau wußte es keiner von uns. Was kaum einen störte, denn fast jeder war nun schon gelernter Internierter, hatte seine Erfahrungen und kannte die Regeln. Daher wußten wir zumindest eines genau: Andere nehmen dem Internierten die Entscheidungen ab. Am Ende fügt sich alles. Beeinflussen kannst du es sowieso nicht.
In dieser wenig tröstlichen Gewißheit zog morgens ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Männern, Jugendlichen, halben Kindern, Lahmen und Greisen mit Koffern und Taschen beladen unter Bewachung durchs Lagertor zum Bahnhof von York. Wer immer auch den am Straßenrand Maulaffen feilhaltenden Spießbürgern den Ausmarsch angekündigt hatte, er erreichte sein Ziel. Sobald sie uns sahen, bildete sich ein feindseliges Spalier. Die Menge verfolgte unseren kläglichen Zug mit bösen Augen, erging sich in obszönen Verwünschungen, selbst biedere Hausfrauen spukten vor uns vermeintlichen Spionen und Saboteuren aus. Es flogen auch einige Steine. Im ersten Moment fühlte ich mich durch die unverdienten Demütigungen niedergedrückt. Gleich darauf hätte ich mich selbst ob solcher Schlappschwänzigkeit backpfeifen können. Ich drückte das Kreuz durch und marschierte zornig über die Dummheit der aufgehetzten Menschen weiter. Neben mir sang einer meiner Yorker Hüttenkameraden trotzig, »Leckt mir’n Arsch, ich geh ins Kloster, ich geh ins Kloster, leckt mir’n Arsch«. Das verstand zwar keiner in der aufgebrachten Menge, aber es half.
Das Rätselraten, wohin die unter so reger Anteilnahme des unangenehmeren Teils der Yorker Bevölkerung begonnene Reise gehen sollte, endete, als der Eisenbahnzug in den Fährbahnhof von Liverpool rollte. Ausnahmsweise konnten die Gerüchtemacher, deren Biotop jede von Stacheldraht eingezäunte Fläche war, einen Treffer verbuchen. Es ging tatsächlich auf die Insel Man. Das mit abfahrbereiten Maschinen an der Pier wartende Schiff schipperte uns ruhig über die Irische See zu den Ufern jenes Eilands, dessen Weltruhm auf seinen schwanzlosen Katzen und internationalen Motorradrennen beruhte. Zwei große Internierungslager für eine Handvoll echter Nazis und Tausende per plötzlichen Federstrich zu feindlichen Ausländern ernannte Flüchtlinge vor den Kumpanen selbiger Nazis bescherten der bei den Briten zu besseren Zeiten auch als Sommerfrische beliebten Insel eine zweifelhafte neue Attraktion. Der Zauberstab des Kriegsministeriums hatte einfach die durch den Krieg verwaisten Badeorte Onken und Douglas unter Mithilfe einiger Kilometer um sie herum gelegten Stacheldrahts höchst genial in riesige Käfige verwandelt.
Unter solchen Umständen kam ich, ungefragt, wie man verstehen wird, mit meinen neuen Freunden aus der Leedser Schule vom Lager York zu einer vom Innen- oder Kriegsminister – als ob es einen Unterschied machte- verordneten Stacheldrahtkur im Central Camp Douglas an den Ufern der Irischen See.
2
Wie ein Bumerang sind wir also wieder in dem Hafen angekommen, an dem unsere kleine Rundfahrt als Internierte seiner Majestät König Georg VI. begann. Ein Meer, und wenn es auch nur ein kleines ist, liegt zwischen uns, der Insel Man und dem Camp in Douglas, wir sind um einige Erfahrungen reicher, harren der Dinge, die man über uns kommen lassen wird und wissen nur, daß die große, die unbekannte, die Rundfahrt ins Blaue erst vor uns liegt. Neben mir pfeift einer der Handwerkslehrlinge aus Leeds »California here I come, right to where I started from«, Kalifornien, hier komme ich, direkt dorthin zurück wo ich startete. Nur, daß es eben nicht das warme Kalifornien sondern das regnerische Liverpool ist, wo unseres Bleibens abermals keine lange Dauer gegeben sein dürfte.
Wir stehen unten auf dem überfüllten Deck der Fähre und üben uns in der Hauptbeschäftigung der Soldaten und Internierten, dem Warten. Bis irgendwie, irgendwann der Befehl kommt, auf dem Oberdeck anzutreten. Wieder oder immer noch hungrig, beladen mit unseren Koffern und Taschen, steigen wir die eisernen Stufen hinauf. Zusammengedrängt wie die Sardinen geht das Warten oben an Deck weiter. Denn die Büchse, in die man uns für die Überfahrt gepreßt hatte, ist zwar oben offen, doch ihren Inhalt kann sie nicht freigeben, weil keiner die Reeling am Ausstieg öffnet, keine Gangway für den Landgang angelegt wird. Nur warten, stehen und warten. Es gießt indessen in Strömen. Bald sind wir bis auf die Haut durchnäßt. Uns fröstelt. Die Beine werden allmählich steif. Nichts rührt sich. Hinter den großen Scheiben des Salons auf dem Oberdeck sitzen die Herren Offiziere der Bewachung schön warm und trocken in bequeme Plüschsessel zurückgelehnt, sie dinieren in aller Seelen Ruhe. Einen Gang nach dem anderen lassen sie sich schmekken. Suppe, Hauptgericht, Nachspeise, Wein. Draußen regnet und regnet es. Draußen stehen wir, die Menschen zweiter Klasse, die fucking Germans. Stehen, warten, sehen dem Essen zu, aber das macht uns nicht satt. Seit letzten Abend haben wir weder gegessen noch getrunken.
Mein Magen grollt. Ich habe eine Stinkwut im Leib. Endlich kommt sie dann, die Erlösung, denn die Herren Offiziere sind gesättigt. Nach der Verdauungszigarette erheben sie sich, blicken kurz nach draußen, wo wir uns die Beine in den Bauch stehen, ziehen die ledernen Koppel und Schulterriemen zurecht und geruhen, dem Warten der vor Nässe triefenden Masse außerhalb der kuscheligen Messe ein Ende zu bereiten. Wir dürfen, sollen, müssen von Bord gehen.
Nur schwerfällig kommt die Masse Mensch mit Gepäck in Bewegung. Das mißfällt den Soldaten. Jetzt plötzlich geht es ihnen nicht schnell genug, sie treiben zur Eile an. Damit erreichen sie das Gegenteil. Der Abgang gerät zum Chaos, stockt allmählich. Alles drängt in Richtung auf die schmale, zum Trichter gewordene Gangway, der sich nur tröpfelnd landwärts entlädt, wo es sich vor dem Eingang zu einem unfreundlichen Monstrum von Abreisehalle wieder staut. Die abgrundhäßliche Halle stammt noch aus der Zeit, als die Queen Victoria auf der Höhe ihrer Macht stand. Damals zogen von hier zwirbelbärtige Kolonialbeamte, Tropenhelm unter dem Arm, samt Familien hinaus in alle Himmelsrichtungen, um ein Imperium zu verwalten, in dem die Sonne nie unterging. Jetzt gleicht das Relikt einstiger »Glory«, in dessen Kuppel sich Staub und Ruß einer ganzen Epoche festgesetzt haben, einem quirligen mittleren Tollhaus.
Von See her drängen wir hinein, und der Gangway-Trichter speit noch immer den menschlichen Inhalt der Fähre aus Douglas aus. Kaum sind wir drin in dem unfreundlichen Gebäude, stoßen wir auf einen Gegenstrom, den ein kurz zuvor unter der Kuppel eingefahrener Eisenbahnzug entladen hatte. Zur gleichen Zeit läuft auf dem Nebengleis ein weiterer Zug mit Internierten ein. Der Bahnsteig ist aber noch so voll, daß die Leute drinnen die Türen kaum öffnen können. Zwar bläkt ein Lautsprecher, die Insassen des eben aus dem Lager Huyton angekommenen Zuges sollten mit dem Aussteigen warten, bis sie Anweisung dazu erhielten. Doch natürlich zwängen sich einige trotzdem hinaus. Vergeblich bemühen sich Soldaten, dem heillosen Durcheinander Richtung zu geben. Eingezwängt zwischen gegenläufigen Kolonnen feiern durch die Internierung getrennte und in verschiedene Lager verschlagene Bekannte, Freunde und Verwandte seelenruhig Wiedersehensrituale.
Die halbe jüdische Emigration aus Deutschland und Österreich scheint auf dem Fährbahnhof auf der Suche nach Verwandten und nach Nachrichten über den Verbleib von Familien durcheinander zu wirbeln. Und keiner von ihnen allen weiß, wohin die eigene Reise gehen soll.
Schließlich löst sich der Wirrwarr beinahe unmerklich auf, was an ein Wunder grenzt. Vielleicht bewirkt das auch ein Masseninstinkt. Jedenfalls ordnen sich die Gruppen und Grüppchen, die sich behindernden Kolonnen und schiebenden Formationen wie durch einen unsichtbaren Magneten angezogen zu einem breiten, relativ ordentlichen Block von mehr als zweieinhalbtausend Menschen. Der wälzt sich im Trauermarschtempo einem vielen noch unsichtbaren, gemeinsamen Ziel entgegen. Mittendrin nähere ich mich geschubst, geschoben, von Ungeschickten mit Koffern in die Kniekehlen gestoßen, schrittweise dem Hallenausgang, durch den sich der Menschenstrom ins Freie auf eine Anlegestelle ergießt.
Da sehe ich sie liegen – hoch wie ein Haus, abweisend und grau. Aus dem breiten Schornstein kräuselt sich feiner, schmutzigblauer Dunst von Dieselabgasen, steigt träge in den verhangenen Himmel, um in den niedrigen Wolken aufzugehen. Achtern spuckt keuchend eine Öffnung in Stößen Wasser ins ölig schimmernde Hafenbecken. Im Takt damit dringt verhaltenes Motorengeräusch ans Ohr.
Ja, da liegt sie, die »Dunera«! »HMT Dunera«, bitteschön, Seiner Majestät Truppenschiff Dunera. 1937 gebaut für den Transport von 1 600 Soldaten des Königs. Zu welchen Tiefen sie sich doch jetzt im vermeintlichen Sicherheitsinteresse der Britannia herablassen muß! Ihr 12 815 Tonnen tragender Leib, den mächtige Diesel mit 26 Knoten durch alle Meere und an alle Küsten bringen können, an denen britische Soldaten ihre Knochen hinhalten, wartet darauf, eine bunt zusammengewürfelte Ladung internierter Zivilisten an Bord zu nehmen.
Es gibt Segelschiffe, Dampfschiffe, Motorschiffe, Postschiffe, Frachtschiffe, Flußschiffe und Küstenschiffe. Es gibt große und kleine Schiffe, solche, die so etwas wie eine Seele besitzen und seelenlose, die kalt sind wie ein Block Eis. Es gibt Schiffe, deren ganzes Schiffsleben am Tage des Abwrackens eine Null hinterläßt, mit ihnen verbindet sich nichts. Aber es gibt auch Schiffe, die in den Geschichtsbüchern oder im Leben der Menschen prägende, untilgbare Spuren hinterlassen. Zu denen gehören die »Mayflower«, mit der die Pilgerväter in die neue Welt kamen, die »Endeavour« des Kapitäns Cook und gewiß auch das Polarschiff »Fram« von Nansen und Amundsen, das heute noch in Oslo zu bewundern ist. Nicht zu vergessen die Schiffe der letzten Hoffnung, auf denen Tausende europäische Juden noch im letzten Moment ihr nacktes Leben nach Palästina retteten, aus dem später der Staat Israel hervorging.
Auf ihre Art ist auch die »Dunera« eines von den Schiffen, die tief und bestimmend in das Schicksal von Menschen eingreifen. Keiner, der in Liverpool ihre ungastlichen Planken betritt, wird, wenn er sie 57 Tage später verläßt, derselbe geblieben sein. Sie wird Leben verändern, Lebenspläne und Weltbilder zerstören, Anstöße zu neuen geben. Über sie wird man Bücher schreiben und einen Film drehen. Sie wird das britische Unterhaus beschäftigen, einem Oberstleutnant das Kriegsgericht einbringen und einigen hundert entwurzelten Menschen eine neue Heimat. Ein solches Schiff ist sie, nur wissen wir es noch nicht.
»Dunera«. Im steilen Winkel führt die Gangway von den Holzplanken des Liverpooler Piers auf sie hinauf ins Ungewisse. Von allen Seiten umschließen Soldaten in den neuen Kampfanzügen der British Army die im Schleichgang vorrückende und an Bord kletternde Menschenmenge wie eine zähnefletschende Meute Hütehunde. Nur, echte Hütehunde kläffen zwar, aber sie beißen nicht.
Wiederholt kommt der schleppende Zug der die Gangway Ersteigenden an deren Fuß ins Stocken. Den Grund dafür sehe ich, ein Atom im allgemeinen Gedränge, das mich Zentimeter um Zentimeter voranschiebt, erst, als nach endlosen Minuten der riesige Schiffsleib unmittelbar vor mir aufragt. Es spielen sich auf der Brücke zwischen Kai und Schiff so unglaubliche Szenen ab, daß fast jeder aus Selbsterhaltungstrieb zögert, ehe er das mit schlappen Halteseilen versehene Brett betritt. Kräftige Stöße mit Gewehrkolben helfen den Zögernden nach, sich dem auf der Gangway stehenden Spalier von Soldaten auszuliefern, die dort den altpreußischen Brauch des Spießrutenlaufens schöpferisch weiterentwickeln.Unter Kolbenhieben jagen sie die Internierten auf das Deck der »Dunera« in die Arme eines Duos oder Trios, das ihnen als Willkommensgruß an Bord Koffer und Taschen aus den Händen reißt. Ein Teil des Gepäcks fliegt gleich ins Wasser. Was oben bleibt, schlitzen sie mit den Bajonetten auf, greifen hinein und bedienen sich freimütig. Reste fliegen zusammen mit demolierten Gepäckstücken auf einen großen Haufen an Deck. Wer Glück hat, dem nehmen die Exekutoren der Begrüßungszeremonie seine lumpigen Habseligkeiten nur ab, ohne ihre Bereicherungstriebe und Zerstörungswut daran zu befriedigen. Aber seine Sachen ist auch er erst einmal los, denn niemand darf einen Koffer oder selbst das kleinste Stück mit sich nehmen.
Derart von ihrer irdischen Habe fürs erste befreit, dürfen die eingeschüchterten Menschen sich unter den Augen wohlgefällig zuschauender Offiziere weiter auf die ihnen zugedachten Decks jagen lassen. Ich beobachte das Treiben vor mir mit Kribbeln im Bauch und denke, wie gut sie mich doch – im Nachhinein betrachtet – behandelt haben, als sie mich vor noch nicht einmal 14 Tagen abholten.
3
Ich wußte ja, daß ich bald dran sein würde. Nach einem Jahr Krieg hatte es die Katastrophe von Dünkirchen gegeben. Die Wehrmacht hatte das britische Expeditionskorps in Frankreich bis an die Kanalküste zurückgetrieben. Geschlagen die Briten – hinter ihnen deutsche Panzer, über ihnen Görings Luftwaffe, vor ihnen das breite Wasser.
Dann das »Wunder von Dünkirchen«, wie es die Briten nannten. Hunderte Schiffe, Boote, Flußdampfer und Nußschalen eilten, stampften, tuckerten zu dem schmalen Küstenstreifen vor der französischen Hafenstadt. über sich das Heulen der Stukas, neben sich krepierende Fliegerbomben, die haushohe Fontänen aufschießen ließen und die See in einen Höllenstrudel verwandelten, vor sich die Mündungen deutscher Artillerie. Doch die in höchster Not zusammengetrommelte Armada eilte, stampfte, tuckerte, bis der letzte Mann vom Strand an Bord genommen und sicher auf heimatlichem Boden abgesetzt war. Gerettet das Gros des britischen Expeditionskorps. Am Strand von Dünkirchen umspülte die Flut die zurückgelassenen Fahrzeuge und schweren Waffen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!