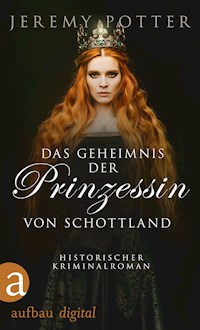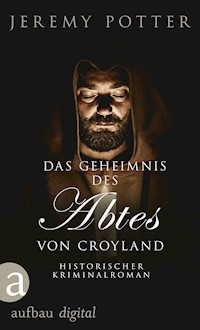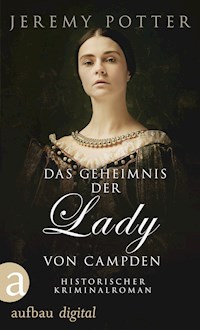
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Thronraub, Morde & Intrigen
- Sprache: Deutsch
1645. In England tobt der Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der Stuartmonarchie und denen des Parlaments. Nachdem das prachtvolle Herrenhaus von Chipping Campden zerstört wurde, zieht es Lady Juliana vor, auf dem Landsitz ihres Gatten zu wohnen. Doch seltsame Dinge geschehen bei den Ruinen des Schlosses. Zuerst verschwindet William Harrison, der Verwalter des Besitzes, ohne jede Spur, dann entdeckt Friedensrichter Sir Thomas Overbury eine Leiche in den unterirdischen Gewölben. Wurde Harrison ermordet? Dessen Adoptivsohn gesteht den Mord und wird gehenkt. Doch nach zwei Jahren taucht der Verwalter plötzlich wieder auf. Weiß Lady Juliana etwa, wo er sich aufgehalten hat?
Ein fesselnder Krimi vor opulenter Kulisse, basierend auf wahren Begebenheiten und realen historischen Persönlichkeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über Jeremy Potter
Jeremy Potter (1922-1997) war Autor zahlreicher Bücher zu verschiedenen Themen der englischen Geschichte sowie Kriminalromanen mit historischem Hintergrund. Zudem war er 18 Jahre lang Vorsitzender der Richard III Society. Privat war er mit der Schriftstellerin Anne Melville verheiratet.
Informationen zum Buch
1645. In England tobt der Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der Stuartmonarchie und denen des Parlaments. Im Herrenhaus von Chipping Campden, das von den Royalisten besetzt ist, entdeckt man im Weinkeller per Zufall mehrere Fässer voller Goldmünzen, die am nächsten Tag verschwunden sind. Fünfzehn Jahre später verschwindet der Verwalter des Anwesens, William Harrison, ebenso spurlos. Ist er ermordet worden? John Perry gesteht den Mord an Harrison, seinem Adoptivvater, und er wird gehenkt. Doch nach zwei Jahren taucht der Verwalter plötzlich wieder auf.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jeremy Potter
Das Geheimnis der Lady von Campden
Historischer Kriminalroman
Aus dem Englischen von Johannes Sabinski
Inhaltsübersicht
Über Jeremy Potter
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Impressum
Vorwort
Dies ist die Geschichte von Sir Thomas Overbury, Landadliger, Friedensrichter und Neffe eines Namensvetters, der als Sekretär einem der Günstlinge König James I. diente und eine Rolle weit über seine Stellung hinaus in der englischen Regierung spielte.
Stolz und Ehrgeiz lagen der Familie Overbury im Blut. Der jüngere Overbury stand dem Onkel weder in seiner Selbstachtung noch im rastlosen Intellekt und dem Dürsten nach Macht und Ruhm nach. Eine Katze hätte nicht wissbegieriger, ein Stachelschwein nicht stachliger sein können, und er war für seine Streitlust berühmt – eine Mischung, die seinem Onkel einen frühen Tod durch Vergiften im Londoner Tower beschert hatte.
Sein von wachsender Ungläubigkeit begleitetes Jahr des Studiums der Theologie in Oxford nahm für den jungen Thomas ein plötzliches Ende, als er sich mit dem Leiter seines Colleges auf einen Disput des Wesens – und gar des wirklichen Seins – der Heiligen Dreifaltigkeit einließ. In Ungnade gefallen, wurde er folglich 1642, im Alter von achtzehn Jahren, ins Ausland geschickt, getröstet durch das Versprechen eines angemessenen Kostgeldes, solange er sich nur in seinem Heimatland nicht mehr blicken ließe.
Wenige Monate darauf brach der Bürgerkrieg aus, und als sein Vater für die Sache der Royalisten eintrat, war der Sohn zur Rückkehr und zum Kampf für das Parlament gesonnen. Bei reiflicher Überlegung jedoch schien die Aussicht auf eine ausgedehnte Fernreise die größere Anziehung zu besitzen. Nach einer gemächlichen Durchquerung Frankreichs und Italiens zog er weiter in den Nahen Osten und erforschte die Levante, bevor er sich in Alexandrien niederließ. Dortselbst als reicher Engländer von Bequemlichkeiten umsorgt, übte er seinen Geist im Studium des Islam und seinen Körper in den Bordellen, während er auf den Tod seines Vaters wartete.
Fünfzehn Jahre im Exil mussten verstreichen, bevor die frohe Kunde von diesem Ereignis ihn nach Hause führte. Er nahm die Güter der Familie in Besitz und wurde bald genauso selbstherrlich wie sein Vater vor ihm. Widerstrebend ließ er die Vergnügungen des Junggesellenlebens hinter sich und tat seine Pflicht, indem er eine Erbin gebärfreudiger Ahnen ehelichte. Als diese jedoch die ihre zu erfüllen versagte und eine Tochter anstelle des Sohnes zur Welt brachte, verbarg er weder seinen Ärger, noch verschonte er sie mit seiner spitzen Zunge.
Die Enttäuschungen nach seiner Heimkehr waren öffentlicher wie privater Natur. Zu seinem Ärger hatte die Regierung des Lordprotektors keinen seiner Talente würdigen Posten zur Hand, den sie einem zurückgekehrten Exilanten, der sich offen über puritanische Sitten verächtlich äußerte, zu überlassen bereit war.
Dann kam die Restauration und mit ihr die Belohnung für die Loyalität seines Vaters und für den glücklichen Zufall, selbst in den Zeiten der Republik nicht durch ein Amt befleckt worden zu sein. Die Ritterwürde und die Ernennung zum Friedensrichter erlaubten es ihm, sich erhobenen Hauptes unter den übrigen Gutsbesitzern im Land zu bewegen. Nunmehr war ein zweiter Sir Thomas Overbury aus Bourton-on-the-Hill, Gloucestershire, imstande, Aufsehen zu erregen und seinen Platz in der großen Welt einzunehmen.
Ereignisse, die fünfzehn Jahre zuvor ihren Ausgang genommen hatten, sollten ihm zu einer Gelegenheit verhelfen.
Kapitel 1
Andrew Fettiplace, Robert Hayward und Daniel Perry waren Einwohner von Chipping Campden und zwangsrekrutierte Pikenträger in der Armee des Königs. Eines Frühlingstags im Jahre 1645 lagen sie auf ihren Bäuchen hinter einer Hecke und wagten kaum zu atmen. Die Straße hinter der Hecke verband die Parlamentshochburgen von Gloucester und Warwick, und sie lauerten feindlichen Kräften auf, die, aus Süden kommend, gemeldet waren.
Alle drei beteten für ihr eigenes Überleben in dem bevorstehenden Gefecht und für den Tod ihres Colonels, Sir Henry Bard, eines einarmigen, bärtigen Monstrums, das dreißig Meter weiter mit seinen Musketieren in Deckung lag. Als Gouverneur der Königlichen Besatzer lebte er im Campden House, dem Herrensitz, stilvoll inmitten wachsenden Elends und war der meistgehasste Mann in drei Grafschaften.
Angst und Abscheu rief er nicht ohne guten Grund hervor. Sir Henrys Söldner, von ihm selbst »Bards Engel« getauft, führten sich wie die Teufel auf. Auf seinen Befehl hin beschlagnahmten sie Vorräte von nah und fern, alles ohne Entschädigung. Freie Quartiernahme wurde erzwungen. Den rechtschaffenen Bürgern stahl man Betten und Bettzeug. Vieh und Getreide eignete man sich ohne viel Federlesens an. Die Bauern mussten sich selbst vor ihre Pflüge spannen, weil Sir Henry ihnen die Pferde weggenommen hatte. Zu alledem verlangte er Steuern von denen, die er bereits bis aufs letzte Hemd ausgezogen hatte. Säumige wurden mit dem Niederbrennen ihrer Häuser und dem Galgen bedroht.
»Ruhe!« Das Geräusch vom Marschierschritten kam näher. Die Warnung wurde von Captain Hill geflüstert, der das Kontingent von Pikenträgern aus Campden House befehligte. Kurze Zeit später erhaschten die geduckten Männer, als sie durch ihre Tarnung spähten, einen Blick auf vorbeiziehende Kniehosen, orangefarbene Mäntel und Monmouthmützen. Ein Moment noch verstrich, und Friede und Herrlichkeit dieses Maienmorgens wurden durch die Musketiere des Colonels zerstört, die das Feuer eröffneten.
Beim völlig überraschten, entsetzten Feind machte sich Verwirrung breit. Einige fielen sofort verwundet, einige hielten inne und standen starr vor Schreck, andere drängten entschlossen voran, und wieder andere wandten sich panisch um und ergriffen die Flucht. Die Offiziere trugen mit widersprüchlichen Befehlen das Ihre zu dem Durcheinander bei.
Captain Hill sprang über die Hecke, das Schwert in der Hand, und brüllte seinen Männern zu: »Mir nach, mir nach!«, um dem Feind den Rückweg abzuschneiden. Für den Fall unzulänglichen Gehorsams sorgte Sergeant Coneybeare, der befehlshabende Zweite, von hinten für Nachdruck: eine weise Vorsichtsmaßnahme, schließlich waren einige der Männer zwangsrekrutiert und andere Kriegsgefangene, die die Seiten gewechselt hatten.
In der Hackordnung der Armee rangierten die Pikenträger auf allerunterster Stufe, und Rüstzeug war im Quartier Mangelware. Alle verfügbaren Helme, Brust- und Rückenpanzer und Kettenschurze waren daher an die Musketiere ausgegeben worden, deren Bedarf bevorzugt gedeckt wurde. Mäntel aus Ochsenleder boten den Pikenträgern ihren einzigen und damit herzlich wenig Schutz. Aber Andrew und Robert waren zäh: sie verfügten über die Kraft, die langschaftigen Piken zu führen, und hatten genug Mumm, einen Feind auf Distanz zu halten und ihm dabei die Stahlspitze in die Brust zu bohren.
Anders Daniel, er war ein kleiner, schüchterner Mann. Von der Hellebardenklinge des Sergeants in die Attacke getrieben, sah er sich einem flüchtenden Puritaner gegenüber, der mit einer Waffe nach seinem Kopf ausholte. Beim Parieren des Hiebs schlug es ihm die Pike aus den Händen, und er stand schutzlos da: Mangel herrschte auch an Schwertern, und keines durfte an solche wie den Pikenträger Perry verschwendet werden. Die Augen des Sergeants nicht länger im Rücken, fiel er zu Boden und stellte sich tot, um dann verstohlen zurück hinter die Hecke zu kriechen.
Das Gefecht war kurz, aber heftig. Die Soldaten beider Seiten hatten nichts gegeneinander, aber vom Schicksal waren sie gegnerischen Lagern zugeteilt worden, und nun hieß es: »Töten oder getötet werden«, bis alle Feinde gefallen oder verwundet am Boden lagen, sich ergeben hatten oder geflüchtet waren. Auf das Konto von Andrew und Robert gingen vier von denen, die blutend auf der Straße hingestreckt waren, bis man sie gnadenlos mit Schwerthieben oder durch Schläge mit dem Musketenkolben erledigte.
Während die Sieger des Scharmützels sich sammelten und darangingen, die Gefangenen zu entwaffnen und die Leichen und die Sterbenden zu fleddern, schlich Pikenträger Perry sich zurück, um seine Waffe wieder an sich zu nehmen und mit klopfendem Herzen dazuzustoßen, in der Hoffnung, dass sein Fehlen unbemerkt geblieben war. Er wählte einen Augenblick, in dem ihm der Sergeant den Rücken zukehrte, aber bei Sergeant Coneybeare war man sich nie sicher. Ihm wurde nachgesagt, ein zweites Gesicht zu haben und ein Gespür für den Delinquenten hinter sich, ohne dass er den Kopf zu wenden brauchte. Seine Strafen mit Spießrute oder Riemen waren ebenso gefürchtet wie jede Feindberührung.
Andrew Fettiplace und Robert Hayward taten, als hätten sie die vorübergehende Desertion ihres Kameraden nicht bemerkt, und die drei vereinten sich wieder, als zum Regimentshauptquartier zurückmarschiert wurde. Sir Henry führte die Kolonne zu Pferde an. Er trug zwar keine Rangabzeichen, doch seine reich bestickte Uniform und die goldene Schärpe um seine Taille verkündeten Befehlsgewalt. Ein leerer Ärmel legte Zeugnis ab von seinem Heldentum für die Sache des Königs in der Schlacht von Cheriton Down.
Gleich dahinter marschierte ein stolzer Träger mit der Schlachtstandarte des Regiments. Diese zeigte eine Krone und eine Faust im Kettenpanzer über dem Motto: Pro Rege et Gloria. Der Hintergrund war weiß, die Farbe des Regiments, gewählt (wie Sir Henry glucksend vor Frohsinn behauptete), um die Reinheit seiner Engel zu symbolisieren.
Hinter dem Standartenträger schob ein Dutzend Männer einen schweren Karren vorwärts, den der Feind eskortiert hatte. Darauf befanden sich zwei große Fässer inmitten Haufen erbeuteter Waffen und Munition. Damit niemand diese Beute übersehen möge, wurde sie vom Regimentstrommler begleitet, der den Takt zum Marschierschritt schlug und Siegesläufe in sein gewohntes Repertoire einstreute.
Der Triumphzug bog von der Hauptstraße ab und schlängelte sich vom Hügelkamm steil abwärts zur Straße des Städtchens, das sich unten in eine Talmulde schmiegte. Kein einziger Freudenruf begrüßte sie dort. Die Ladeninhaber, ihre Kunden, ja selbst die Müßiggänger zogen sich beim ersten Anblick Sir Henrys hastig in die Häuser zurück. Die wenigen Mutigen, die aus Neugier zurückblieben, starrten schweigend.
Draußen vor einer Hütte stand eine Frau mit zwei kleinen Jungen an der Hand. Sie war dunkel wie eine Spanierin oder eine Zigeunerin, und ihr hinreißendes Aussehen zog Pfiffe aus den Reihen auf sich. Ihre Augen schwelten vor Hass, hellten sich aber mit Erleichterung auf, als die Kolonne vorbeizog und sie die drei Männer aus Campden unverletzt ausmachte.
»Der kleine ist ein hübscher Bursche, Daniel!« Andrew machte ihm das Kompliment aus dem Mundwinkel. Dies nämlich war die Familie von Perry. Ein flüchtiger Blick – Perry selbst schenkte ihr kaum Beachtung. In seinem Kopf herrschten Chaos und Schrecken wegen der Frage, ob seine Freunde mit einer Lüge seine Haut retten würden, sollte er der Feigheit vor dem Feind bezichtigt werden.
Robert Haywards Seitenblick galt den »Acht Glocken« auf der anderen Straßenseite. Das Gasthaus wurde von seinem Vater geführt, den man in einem Fenster im Obergeschoss erkennen konnte. Ihre Augen trafen sich für einen kurzen Austausch gegenseitiger Zuneigung.
Im Campden House fiel die Begrüßung überschwenglich aus. Ein Bote hatte die Neuigkeit überbracht. Major Hawkins, den man mit einer Handvoll Männer zurückgelassen hatte, das Hauptquartier zu bewachen, lief voll des Lobes die Stufen hinab, um seinem befehlshabenden Offizier aus dem Sattel zu helfen.
»Der Prinz wird zufrieden mit Euch sein, Sir«, sprudelte er hervor, nachdem Sir Henry sich Helm, Mantel und Stiefel hatte abnehmen lassen und nun im Ballsaal des Herrenhauses thronte, um sich an den ausgesuchtesten Weinen des Kellers zu laben.
Sir Henry grunzte. Der Umfang der ihm von Prinz Rupert zugewiesenen Truppe bröckelte. Ein Lieutenant-Colonel durfte bereits ein Fußregiment befehligen, dessen Sollstärke gut dreizehnhundert Mann ausmachte. Doch Rekruten waren knapp und Waffen ebenso und er – allzeit Soldat – verabscheute es, seine Reihen, wie es andere taten, mit Bauern aufzufüllen, ausgerüstet bloß mit Heugabeln, Sicheln und Dreschflegeln. Um den Feind zu täuschen und den Umstand zu verbergen, dass die Männer unter seinem Kommando beschämend wenige waren, um die Würde eines richtigen Colonels zu wahren, hatte er sie in drei sogenannte Regimenter aufgeteilt. Doch in Wahrheit zählten sie zusammen gerade einmal dreihundert. Zum Ausgleich schund er sie täglich und gründlich, doch an diesem Tag – und sei es auch nie wieder – war er stolz auf sie und zeigte es ihnen, indem er eine kleine Glückwunschrede hielt, bevor er sie entließ, sich an gestohlenem Bier bis zur Besinnungslosigkeit zu besaufen.
Er befand sich hier, weil Chipping Campden, eigentlich unwichtig, eine bedeutende strategische Stellung innehatte, da es von Gebieten unter Parlamentskontrolle umgeben war. Als der Krieg ausbrach, hatte sich jede Seite abwechselnd des verlassenen Hauses als Befestigung bemächtigt. Dann war eine königliche Besatzung aus Oxford von einem parlamentarischen Überfallkommando aus Schloss Warwick überrascht und überwältigt worden. Seit jener Zeit hatte keine Seite mehr versucht, das Haus zu halten, bis wenige Monate zuvor Prinz Rupert beschlossen hatte, dass die Nachrichtenwege des Feindes unsicher zu machen seien. Folglich hatte er Sir Henry abgestellt, den Ort zu besetzten und zu befestigen, und Sir Henry hatte jeden arbeitsfähigen Mann in der Stadt gezwungen, sich mit Spaten, Schaufel und Hacke ans Werk zu machen, um Vicomte Campdens Lustgärten in eine Landschaft aus Verteidigungswällen zu verwandeln.
Seither waren Wochen verstrichen, doch der erwartete Angriff des Feindes blieb aus. Nachdem er seine Basis gesichert wusste, war Sir Henry mit einer Nadelstichtaktik in die Offensive gegangen. Dank der Erkenntnisse eines Spions und der Schlamperei bei den feindlichen Spähern war dieser Tag Zeuge seines bislang größten Erfolgs geworden.
»Ganz besonders wird der Prinz über dies hier zufrieden sein, Sir.« Captain Hill heimste den Glückwunsch des Majors ein, als er mit Papieren in der Hand den Raum betrat. Sie stammten aus einer Mappe, die sich am Leib des feindlichen Anführers fand, nachdem Sir Henry ihn mit einem einzigen Pistolenschuss durchs Auge erledigt hatte.
Er nahm das Anerbotene mit gespielter Gleichgültigkeit entgegen, die sich beim Lesen rasch verflüchtigte. »Oho!« rief er am Schluss voll Verzückung aus. »Dies hier muss geradenwegs an Seine Majestät gehen.«
Der Major vertiefte sich nun seinerseits in die Papiere und kam zu dem Schluss, dass der Colonel sich die Baronswürde verdient habe.
Das erste Dokument war die Kopie eines Erlasses der höchsten Militärobrigkeit des Parlaments und verkündete ihr Wort im Namen des Komitees beider Königreiche. An Colonel Massey, Gouverneur von Gloucester, gerichtet, wies es ihn an, den Feind mit allen Mitteln aus Campden zu vertreiben, um so die schädlichen Folgen der abgerissenen Verbindung mit Warwick zu beheben. Zu diesem Zweck hatte er Vollmacht, sich fünfhundert Mann Fußtruppen und fünfhundert Reiter aus Gloucester, je dreihundert von beidem aus Warwick, zweihundert aus Northampton, und zweihundert Reiter aus Worcester zu beschaffen.
Major Hawkins wurde blass, als er diese Zahlen las, Sir Henrys Brust aber blähte sich vor Stolz darüber, mit seiner kleinen Truppe die Ausdünnung derart vieler feindlicher Garnisonen auslösen zu können.
Das zweite Papier war eine Kopie von Colonel Masseys Antwort und an die übrigen Garnisonskommandanten zu deren Unterrichtung adressiert. Darin teilte der Gouverneur dem Komitee mit, über genügend Arbeitskräfte zur Verteidigung der Stadt zu verfügen, um nicht auch noch die Grafschaft einnehmen zu müssen. Falls er den Feind aus Campden House vertriebe, was dann? Es zu besetzen und seine Rückkehr zu verhindern, hatte er keine Männer. Sein Schreiben schloss mit der förmlichen Bekanntgabe seiner Entscheidung, jegliches Vorgehen gegen das Haus bis zum Erhalt weiterer Instruktionen auszusetzen.
Zur Feier des Tages wurde eine weitere Flasche Wein geöffnet, dann noch eine und noch eine. Als alle geleert waren, lud Sir Henry seine Offiziere ein, sich ihm bei einer Sieges-Gigue anzuschließen. »Der Herr sieht nach den Seinen, den Seinen«, sang er, während sie tanzten. Ausgelassen hüpfend, richtete er seine Augen voll Dankbarkeit zum Deckenfresko, wo eine Galaxie himmlischer Cherubim mit ausgestreckten Armen den Kronleuchter zu halten schien.
»Amen«, stimmte der Major an. »Amen«, kam das Echo des Captains.
Tanz und Gesang wurden durch das Erscheinen von Sergeant Coneybeare unterbrochen, der in Habachtstellung im Türrahmen stand und auf die Erlaubnis zu sprechen wartete.
»Wo hast du deine Zunge, Mann?« dröhnte der Colonel ohne eine Spur von Heiterkeit in der Stimme. Andernfalls hätte es einen Rüffel für die Anmaßung gegeben, ihn unerlaubt anzusprechen. Ein Untergebener Sir Henrys kann nichts richtig machen, jeder unter seinem Kommando wusste das bestens.
Der Sergeant begrub seinen Ärger unter dem lautlosen Schwur, sich irgendwann für alle erlittenen Kränkungen zu rächen. »Die Beute ist sicher verwahrt, Sir«, sagte er. »Sie harrt Eurer Inspizierung, Sir. Und Mr. Harrison sucht um Audienz nach, Sir.«
Dicht auf den Fersen dieser Worte kam Mr. Harrison selbst, von einem betretenen Wächter eskortiert, der ihn an der Außentür nicht aufzuhalten vermocht hatte. Als Verwalter des Hausbesitzers hatte er nicht die Absicht, um Erlaubnis zu betteln. Für ihn war Sir Henry kein Vorgesetzter, sondern ein pestartiger Eindringling. Er wiederum war für Sir Henry ein anmaßendes Faktotum, das notwendige Maßnahmen zu behindern versuchte, und daher ein ebensolcher Feind wie Colonel Massey.
Nunmehr in mittleren Jahren, hatte William Harrison sein Arbeitsleben lang der Familie Campden gedient. Während ihrer Abwesenheit hatte er die alleinige Verfügungsgewalt über ein wertvolles Anwesen, das nicht allein den Herrensitz umfasste, sondern große Teile des Ortes und Hunderte Morgen Land ringsumher. Nicht einmal der Bürgermeister hatte größere Vollmachten als Master Harrison. Doch in Zeiten des Krieges war seine Aufgabe undankbar, und die Kämpfe dauerten nun schon drei Jahre. Trotzdem war er gut über die Runden gekommen, bis dieser arrogante Rüpel mit seinen Günstlingen über Chipping Campden hergefallen war wie ein Wolfsrudel über eine Herde Schafe.
Seither verging kaum ein Tag ohne Grund für Beschwerden über gestohlenes Vieh und Wagen, Scheunen, die als Feuerholz verbrannt wurden, Blei, das man von den Särgen ablöste, um daraus Kugeln zu gießen. Nichts war sicher, nichts heilig. Heute war er gekommen, um den Kommandanten wegen der Not zur Rede zu stellen, in die seine Pachtbauern erniedrigt wurden, Männern und Vieh zur Bestellung der Felder beraubt. Wie immer sprach er geradeheraus, und wie immer war Sir Henry taub für sein Gesuch.
»Habe ich Euch nicht oft genug gesagt, Master Harrison, dass Ihr das Geld bekommen würdet, falls ich etwas hätte, um zu bezahlen, was genommen werden muss? Allein, mir mangelt es sehr an den Mitteln. Seid Ihr mit dieser Antwort nicht zufrieden, so möge sich Seine Lordschaft beim Prinzen beschweren, dessen Diener ich bin in all meinem Tun.«
»Dies hier ist kein Feindesland. Wir sind in dieser Gegend dem König loyal gesonnen, und doch behandelt Ihr uns nicht besser, als es die Rebellen tun würden. Weder der Prinz noch Seine Majestät selbst können für uns den Hungertod wünschen, möchte ich billigerweise unterstellen. Aus Gehorsam Euren Befehlen gegenüber benehmen sich Eure Männer wie Gesetzlose und Wilde.«
»Ich zweifle an der Loyalität eines jeden, der mein Tun hier im Namen des Königs in Frage stellt«, entgegnete Sir Henry mit einem verächtlichen Rülpsen. »Soll ihn der Teufel holen, sage ich. Ich bin Soldat und leiste König Charles große Dienste. Habe ich denn nicht in den Steppen Russlands und den Weiten Polens gekämpft? Habe ich nicht König Christian von Dänemark gedient? Gustav Adolf von Schweden? Dem pfälzischen Kurfürsten? Der König von England hat wenige Kommandanten mit solcher Schlachterfahrung und würde mich nicht bestrafen, wenn es mir gefiele, Euch wie einen Hund zu hängen. Was ich jetzt am liebsten täte.«
Plünderung und Trunksucht, Blasphemie und Unzucht, Mord und Vergewaltigung. Eine kurze Liste dessen, was in Chipping Campden im Namen des Königs geschah. Und jetzt er selbst mit dem Galgen bedroht! Der Verwalter biss die Zähne zusammen und ließ seine Augen für ihn sprechen, die über zerrissene Teppiche, kopflose Statuen und von Kugeln durchsiebte Gemälde wanderten, den stummen Opfern trunkener Orgien.
»Ihr irrt Euch, wenn Ihr von uns glaubt, nicht mehr Wert als faules Pack zu haben.« Sir Henry war seinem Blick gefolgt. Da der Verwalter sich nicht hatte einschüchtern lassen, hub er zu neuerlichem Geprahle an. »Weidet eure Augen heute morgen lieber an den Früchten unserer Mühe. Habt teil an unserer Feier. Seid mein Gast im Haus Eures Herren. Stoßt an auf unseren Erfolg, und Ihr sollt nicht hängen!«
Widerstrebend nahm der Verwalter ein Glas vom Wein seines Herren an und trank in kleinen Schlucken davon. Er verlor den Überblick, wie oft seine Gastgeber sich selbst nachschenkten, während sie ihm die List ihres Hinterhalts auseinandersetzten und sich in ihrer Tapferkeit im anschließenden Gefecht sonnten. Dann, mit dem Colonel in schwankender Führung, stiegen alle in die Kellergewölbe hinab.
Diese waren, wie das Haus darüber, riesig. Unterirdische Gänge, flankiert von Nischen, wo allerlei gelagert wurde, verloren sich in alle Richtungen. Hierhin drang kein Tageslicht. Die Gruppe trug Laternen und war von Düsternis umgeben, bis sie eine von Fackeln erhellte Kammer erreichte. Darin war der Inhalt des erbeuteten Karrens und weitere vom Feind errungene Trophäen auf den Steinfliesen aufgeschichtet und wurde von Posten bewacht.
»Ein schöner Ort für eine Inspektion!« grummelte Sir Henry und stolperte über eine Muskete. »Welcher schwachsinnige Sohn einer syphilitischen Hure hat den Befehl erteilt, das alles hierherzuschaffen, bevor ich es mir draußen ansehen konnte?«
Eine Pause trat ein, bevor Captain Hill antwortete, wobei er sich Mühe gab, die Schuld zu zerstreuen. »Der Sergeant und ich hielten es für das sicherste Vorgehen, Sir«, sagte er, »in den Mannschaften wird ja ständig gestohlen.« Es wäre kaum weise gewesen, Sir Henry daran zu erinnern, dass man ihn eingeladen hatte, die Beute auf dem Vorhof zu begutachten, er aber lieber ins Haus geeilt war, um seinen Durst zu löschen.
»Unteroffiziere werden nicht fürs Denken bezahlt. In meinem Regiment bezahlt man sie dafür, Befehle weiterzugeben. Habt Ihr das verstanden, Captain Hill?«
Der Captain nickte, biss sich auf die Lippe und nährte seinen Groll. Es lag schon drei Monate zurück, dass er überhaupt bezahlt worden war.
»Schön. Also worauf wartet Ihr? Sagt den Männern, sie sollen die Fässer öffnen und zwar schleunigst. Oder wollt Ihr uns hier den lieben langen Tag stehen lassen? Und sorgt dafür, dass sie auf ihre Fackeln aufpassen. Sonst werden wir noch mit einem Knall ins Jenseits befördert.«
Die von Sergeant Coneybeare für den Wachdienst ausgesuchten Soldaten waren die Männer aus dem Ort: die Pikenträger Fettiplace, Hayward und Perry. Letzterer war vor seiner Aushebung Dienstbote im Haus gewesen. Die Fässer waren fest verschlossen, und es bedurfte harter Arbeit, bevor sich die Deckel aufhebeln ließen.
Als der erste aufflog und scheppernd zu Boden fiel, taten alle einen Schritt nach vorne, um hineinzuspähen. Es folgte ein allgemeines Aufkeuchen. Nicht Schießpulver war es, was sie erblickten, sondern funkelndes Gold. Nachdem er den anderen befohlen hatte, zurückzutreten, tauchte Sir Henry seine Hände hinein und ließ sie voller Goldmünzen wieder zum Vorschein kommen. Der Inhalt des zweiten Fasses war von gleicher Art. Die Truppe hatte den Wagen eines Zahlmeisters auf seinem Weg zum Feind im Schloss Warwick aufgebracht!
»Segensreicher Satan!«
Nachdem er diesen gotteslästerlichen Freudenschrei ausgestoßen hatte, verlor Sir Henry sich in seinen Gedanken. Auch William Harrison dachte nach – dass Sir Henry nun in der Lage war, Wiedergutmachung zu leisten. Die Posten dachten ebenfalls – an ihren ausstehenden Sold. Unbemerkt tauschten der Captain und der Sergeant verstohlene Blicke.
Da es seinem Vorgesetzten offenbar die Sprache verschlagen hatte, übernahm Major Hawkins das Kommando und befahl, die Fässer wieder zu verschließen und mit größter Aufmerksamkeit zu bewachen.
»Diebe sind überall«, warnte er.
Kapitel 2
In dieser Nacht trugen vier seiner Männer den Kommandanten ins Bett, wo er bis zum Weckruf herzhaft schnarchte. Als ein Trompeter zum Morgenappell blies, vergrub er seine Ohren im Kissen und lag mit geschlossenen Augen wach, vom großen Bett der Königskammer verwöhnt und von der Vorstellung der Lobpreisungen, mit denen man ihn überschütten würde, sobald seine Depesche in Oxford ankäme. Mit sich und der Welt im reinen, benötigte er Zeit zum Nachdenken, bevor es ans Aufstehen ging. In seiner Abwesenheit konnte Major Hawkins die Inspektion der Truppe vornehmen und später einen Verweis dafür bekommen, diese nicht nach seinen eigenen, strengen Maßstäben durchgeführt zu haben.
Sir Henry war der jüngste Sohn eines Rektors aus Staines: eine Pfarrstelle mit kümmerlichem Einkommen. Obwohl mit den Reichen im nahen Eton zur Schule gegangen, hatte er in der Welt seinen eigenen Weg finden müssen, wo eine Verbindung von Mut, scharfem Verstand und Skrupellosigkeit es ihm ermöglicht hatte, als Söldner den Lebensstil zu pflegen, zu dem er sich berechtigt fühlte.
Sein Stern hatte zwei Jahre zuvor zu strahlen begonnen, als er König Charles in dessen Kriegshauptquartier vorgestellt worden war. Prinz Rupert, Neffe des Königs und Sohn des pfälzischen Kurfürsten, hatte die Begegnung eingefädelt und ihm, mit Blick auf seine Verdienste um den Kurfürsten, das Kommando über eine Brigade gesichert, mit Aussicht auf Erhebung in den Ritterstand, sollte er sich auf dem Schlachtfeld bewähren.
Das Kriegsglück hatte ihm nun das Erforderliche für ein wohlversorgtes Alter in den Schoß fallen lassen. Es war, sagte er sich, der Ausgleich für den verlorenen Arm und nicht mehr, als ein Mann sich verdient hatte für die langjährige Loyalität im Dienste welcher Angelegenheit auch immer. Er würde sich nehmen, was ihm als Pension zustand.
Wie bedauerlich, dass so viele zugegen gewesen waren, als man den Schatz fand: Eine unangenehm große Zahl von Mäulern musste mit Schmiergeld oder anderen Mitteln gestopft werden. Sir Henrys Verstand funktionierte frühmorgens am besten (bevor er zur Frühstückszeit durch großzügigen Umgang mit starken geistigen Getränken benebelt wurde), und bald fand sich eine Lösung des Problems. Das Risiko musste durch einen Kompromiss verringert werden. Beide Fässer waren nach Oxford zu senden, aber nur eines würde ankommen. Dieses, zusammen mit dem eigentlichen Sieg aus dem Hinterhalt, müsste ausreichen, die Dankbarkeit des Königs zu gewinnen und – wer weiß? – die langersehnte Peerswürde.
Wen könnte man mit einem so delikaten Auftrag betrauen? Wieder kam ihm die Antwort schnell in den Sinn. Sergeant Coneybeare war so ein Mann, der seine eigene Großmutter für Geld skalpieren würde. Sein Schweigen könnte man mit einem geringfügigen Anteil an der Beute erkaufen. Mit ihm zusammen müsste man eine Wachmannschaft aussenden, aber Sir Henry würde schon einen Grund finden, um die meisten davon zurückzurufen, bevor sie ihr Ziel erreichten. Angenommen, nur einer bliebe übrig, einer von den Posten im Keller: der Kleine. Der Sergeant könnte ihm phantastische Versprechungen machen, wenn sie eines der Fässer verbergen würden, und ihn dann auf dem Rückweg beseitigen.
Als er den Plan in Gedanken noch einmal überflog, um ihn auf Fehler zu untersuchen, wurde sein Sinnen durch ein Klopfen an der Tür und die Ankündigung eines Boten aus Oxford unterbrochen. Fluchend erhob er sich und stieß noch einige weitere Flüche aus, als er die Depesche las. Sie trug ihm auf, Campden House, dieses Paradies auf Erden, zu räumen, dieses kleine Reich zurückzulassen, das er so zufriedenstellend regiert hatte. Der König war im Anmarsch, um die Rebellenstreitmacht in den Midlands zu fordern und die Belagerung von Chester aufzuheben. Er brauchte jeden Mann, dessen er habhaft werden konnte. Chipping Campden musste aufgegeben werden: die Besatzungstruppe würde man nicht ersetzen. Sir Henrys Regiment sollte am folgenden Tag zur Armee des Königs stoßen und sich mit ihr vereinen.
War sein Plan somit totgeboren? Es schien so. Doch er fuhr fort mit der Überlegung, wieviel leichter sich das Verschwinden eines Teils des Goldes im Durcheinander einer Evakuierung bewerkstelligen ließe. Würde er seine unabhängige Befehlsgewalt einbüßen? Ja; aber dafür gab es die verführerische Aussicht auf Plünderung und Schlachtgemetzel, auf das Tor zur Beförderung. Er rief nach seiner Ordonanz, um sich ankleiden zu lassen, und sang freudig vor sich hin, als die nächste Störung eintrat. Diesmal war es sein Stellvertreter.
Sir Henry teilte ihm die Neuigkeiten aus Oxford mit. »Ist der Appell abgeschlossen?« fragte er. Auf die Entgegnung, dass dem so sei, verlangte er zu erfahren, wie es der Major wagen könne, Derartiges ohne Rücksprache mit seinem befehlshabenden Offizier zu veranlassen. Dann ordnete er an, alle Dienstgrade umgehend wieder antreten zu lassen.
Major Hawkins schien eher zerstreut denn zerknirscht und seltsam träge im Ausführen seines Befehls. »Ich kam, um noch etwas anderes zu melden, Sir«, sagte er zögernd.
»Das kann warten«, gab ihm Sir Henry brüsk zu verstehen. Er war mit der Pflege von Bart und Schnauzer beschäftigt, um beim Appell möglichst grimmig und borstig zu erscheinen. »Habt Ihr verstanden?« grollte er, als der andere sich nicht vom Fleck rührte.
Doch selbst jetzt hielt der Major die Stellung. »Es handelt sich um eine ernste Angelegenheit«, beharrte er.
»Nicht so ernst, wie es um Euch bestellt sein wird, sollten die Männer nicht in den nächsten fünf Minuten zum Appell angetreten sein.« Die Ordonanz hatte Sir Henry in seinen weißen Ausgehrock mit goldenem Spitzenbesatz gezwängt und zupfte gerade an einer scharlachroten Schärpe um seine Taille. Nur der breitkrempige Hut mit seinem weißen Federbüschel fehlte noch auf seinem Haupt, und er würde in voller Pracht und bereit für den Appell sein.
»Das ...« setzte der Major an.
»Schweigt!« brüllte Sir Henry. »Noch ein Wort von Euch, Hawkins, und ich bringe Euch vors Kriegsgericht. In all meinen Dienstjahren ist mir keine derart dreiste Insubordination untergekommen.«
Sir Henry war außer sich, fürwahr ein erschreckender Anblick. Doch auch der Major war ein alter Soldat. Er schluckte, rückte seinen Kiefer zurecht und sprach: »Wie dem auch sei, Sir, ist es meine Pflicht, Euch davon in Kenntnis zu setzen, dass das Gold verschwunden ist.«
Sir Henrys Gesichtsfarbe wechselte von dunkelrot zu purpur. Keines Wortes mehr fähig, griff er nach seinem Schwert und schritt voran, als wollte er die Klinge in seinen Stellvertreter versenken, der sich angstvoll zur Tür zurückzog.
»Hiergeblieben!« bellte er, als sich seine Zunge wieder löste. »Verschwunden, habt Ihr gesagt? Wie, in Teufels Namen, kann das sein? Wurde es nicht bewacht, wie ich befohlen hatte?«
»Es wurde bewacht, wie Ihr befahlt. Alle Posten sind verhaftet worden, aber Captain Hill ließ mich wissen, dass in den Stunden vor dem Morgengrauen nur einer im Dienst war. Seine Ablösung hat ihn bewusstlos am Boden liegend entdeckt.«
»Sterbend?«
»Sturzbetrunken, Sir.« Der Major wappnete sich gegen einen weiteren Sturm, der nicht lange auf sich warten ließ. Die Explosion prasselte nieder wie eine Mörserkannonade. Die folgenden Worte klangen geschmeidig glatt wie das Sirren von Stahl. In dieser Stimmung war Sir Henry am gefährlichsten.
»Hört mir gut zu, Major – solange Ihr diesen Rang noch bekleidet. Diese Fässer sind zu schwer, als dass sie ein Mann heben könnte. Selbst zwei Männer könnten sie nicht weit tragen oder rollen. Es gibt zwei Eingänge zum Keller. Beide sind abgeschlossen. Ergo ist der Schatz noch immer dort. Er kann rasch wiedergefunden werden. Er muss rasch wiedergefunden werden. Captain Hill und Sergeant Coneybeare sollen mir sein Wiederauftauchen binnen einer Stunde melden. Andernfalls werde ich sie beide wegen grober Pflichtvernachlässigung ins Glied zurückstufen und anschließend hängen lassen wegen räuberischer Verschwörung gegen Seine Majestät, der die Kriegsbeute gehört. Denn sie konnte nur mit beider Duldung entfernt werden – oder womöglich mit der Euren.«
Der Major deutete den flüchtigsten Salut an und verließ den Raum im Eilschritt. Beim neuerlich zusammengetrommelten Appell wurde der Marschbefehl ausgegeben. Die für das Wiederauffinden des Schatzes eingeräumte Stunde kam und ging. Alles lief durcheinander. Die Suche im Labyrinth der Kellergewölbe wurde bei Fackellicht fortgesetzt, gleichzeitig wurden Lager geräumt und Ausrüstung für den Abmarsch gepackt. Man untersuchte einen unterirdischen Gang, der mit dem Keller verbunden war. Er verlief unter einer Terrasse und war mit Fässern vollgestapelt, teils leer, teils mit Wein gefüllt. Die Suchmannschaft wurde vom Captain und dem Sergeant angeführt, die persönlich jedes Fass inspizierten. Schließlich meldeten sie ihren Fehlschlag und wurden wie die Pikenträger, die Wache gehabt und die man bei der Suche mitgeschleift hatte, in strenge Haft genommen.
Verzweifelt sandte Sir Henry als letztes Mittel nach Vicomte Campdens Verwalter. »Findet Master Harrison und bringt ihn zu mir«, befahl er. »Mit Gewalt, wenn nötig.«
Der Verwalter war unterwegs im Nachbardorf Paxton, um Pacht einzutreiben, was ihm nicht leichtfiel. Dank Sir Henrys Verwüstungen hatten die Bauern kein Geld, um zu bezahlen. William Harrison war streng, aber menschlich, und fand ihre Schilderungen von Elend und Hungersnot kaum zu ertragen. Mit Erleichterung hatte er vom morgigen Abmarsch der Besatzer erfahren und hoffte, dass der frevelhafte Sir Henry Bard ihm nie wieder unter die Augen treten möge.
Seine Reaktion auf die Aufforderung war, dass er kommen würde, sobald es der Abschluss seiner Geschäfte zuließe. Aber – so wurde ihm grob bedeutet – die Befehle des Colonels vertrügen nicht eine Minute Verzug. »Wollt Ihr mir drohen?« fragte er den Corporal, der ausgesandt war, ihn abzuholen. »Ja«, kam die bärbeißige Antwort.
Sir Henry empfing ihn mit einem Firniss ungewohnter Höflichkeit. Er erläuterte die Wichtigkeit und Dringlichkeit seines Problems und bat um Mithilfe, mehr als das er sie verlangte. Doch der Verwalter, seinen Pflichten in derartiger Weise entzogen, zeigte sich nicht beschwichtigt. Bevor er sich irgendeinem Ansinnen anschließen werde, verlangte er eine uneingeschränkte Entschuldigung, ferner die Zusicherung, dass der Corporal für seine Unverschämtheit dem Diener eines Oberhausmitglieds gegenüber bestraft werde.
Die Zusicherung kam prompt, da Sir Henry nicht die geringste Absicht hatte, ihr Folge zu leisten. Entschuldigungen lagen nicht in seiner Natur, doch er murmelte eine vor sich hin. Das erwies sich als zu halbherzig, um den Verwalter zufriedenzustellen, der daraufhin dem Kommandanten einen Vortrag hielt über das Leid, welches dieser einer unschuldigen Gemeinde zugefügt hätte, und über die mutwillige Zerstörung fremden Eigentums durch seine Männer. Er sah sich um in der verstümmelten Pracht der Eingangshalle des Herrenhauses und versprach, eine Liste beschädigten und fehlenden Inventars anzulegen und seinem Herren einen vollständigen Bericht auszufertigen.
»Ihr müsst tun, was Ihr für richtig haltet, Master Harrison«, entgegnete Sir Henry und schluckte die Wut hinunter, die sich in ihm aufstaute. »Da Ihr doch so vertraut mit dem Haus seid, mögt Ihr in der Zwischenzeit die Freundlichkeit haben, eine Abteilung meiner Männer bei einer gründlichen Erforschung des unterirdischen Teils zu führen. Es muss dort ein Versteck geben, das wir noch nicht entdeckt haben.«
»Die Aufsicht über das Anwesens ist meine Aufgabe«, sagte der Verwalter steif. »Mir untersteht das Gebäude, solange es unbewohnt ist, aber ich bin kein Hausdiener. Für Euch wäre es besser, wenn Ihr Euch der Unterstützung Daniel Perrys versichern würdet.«
»Und für Euch wäre es besser, zu tun, was ich sage«, warnte Sir Henry in schneidendem Tonfall. »Seid daran erinnert, dass ich hier auf Geheiß und im Namen des Königs kommandiere. Ist Gehorsam den Befehlen eines Vertreters Seiner Majestät gegenüber nicht das, was Seine Lordschaft von Euch erwartet? Folgt meiner Anordnung, sonst verspreche ich Euch, wird Euer Bericht nicht der einzige sein, den er erhält.«
Beide wussten bestens, dass die Familie Campden aus glühendsten Royalisten bestand. Der zweite Vicomte (Schwiegersohn des ersten) war während seines aktiven Dienstes in der Garnison von Oxford einem Fieber erlegen, und sein jüngerer Sohn starb als Gefangener in der Hand des Feindes. Sein älterer Sohn, der dritte Vicomte, hatte ein Reiterregiment und ein ganzes Infanteriekorps für die Armee des Königs ausgehoben. Er selbst führte das Regiment an, hatte denselben Dienstgrad wie Sir Henry und machte mit Kampfgeist wett, was ihm an Erfahrung fehlte. Noch kaum dreißig, war er schneidig und draufgängerisch, verschwenderisch und unberechenbar, ein Prahlhans und Aufschneider: nach Meinung der gesetzten Altvorderen in der Familie nicht halb der Mann, den sein Vater abgegeben hatte. Angesichts seiner Vorliebe für das Glücksspiel um hohe Summen war es ganz recht, dass das Anwesen der Campdens noch auf den Namen seiner Mutter lief.
Der Verwalter sah ein, dass er in der Konfrontation den kürzeren gezogen und keine andere Wahl hatte, als zu gehorchen. Mit einem Achselzucken und einer Grimasse nahm er die angebotene Laterne entgegen, durchquerte die Halle und stieg eine Steintreppe hinab in die Dunkelheit. Eine Rotte Soldaten mit Fackeln in Händen kam hinterdrein, und er warnte sie eindringlich vor den Gefahren offenen Feuers.
Zwei Stunden später kehrte die Truppe von unten zurück, staubig, zerzaust und erfolglos.
»Ich habe mich vergewissert, dass jede Ecke, jeder Zentimeter Kellerraum untersucht wurde«, meldete er Sir Henry und dem Major, die beide mit grimmigen Gesichtern warteten. »Nach meiner Schätzung liegen mehr als hundert, vielleicht an die zweihundert Fässer in ziemlichem Durcheinander in den Gewölben unter der Terrasse. Die gehören aber zum Haus. Sie sind schon immer dort gelagert worden, allerdings ordentlich gestapelt. Den Spuren nach sind einige vor kurzem aufgestemmt worden – bei einer Untersuchung früher am heutigen Tage, wie man mir sagte. Der Fußboden hat sich teilweise in einen See aus verschüttetem Wein verwandelt, aber ich habe nochmals zwischen ihnen gesucht und in so viele hineingeschaut, wie ich erreichen konnte.«
»Was also, vermutet Ihr, mag diesem Schatz zugestoßen sein? Ist der Feind nachts gekommen und hat ihn sich zurückgeholt, oder ist er durch Hexerei verpufft? Einer meiner Lieutenants hat mir berichtet, dass Ihr hier einen Hexenzirkel habt, also hatte vielleicht der Teufel selbst die Hand im Spiel?« Sir Henrys Sarkasmus wirkte bedrohlich.
Als das Wort Hexerei fiel, zuckte der Verwalter zusammen und bot eine diesseitigere Erklärung an. »Es gibt einen weiteren Eingang in den Keller für Lieferungen von draußen. Das Tor davor ist geschlossen, aber jemand hat das Schloss aufgebrochen.«
»Dann muss es in den letzten paar Stunden aufgebrochen worden sein!« rief der Major aus. »Es wird regelmäßig überprüft und war heute morgen noch in Ordnung. Oder war es gestern? Eins von beiden kann ich beschwören.«
Sir Henry warf ihm einen vernichtenden Blick zu und eilte nach draußen, um selbst das beschädigte Schloss zu begutachten. Es war ohne Zweifel ein frischer Schaden, und er ordnete auf der Stelle eine eingehende Durchsuchung des Grundstücks an. Doch weder die fehlenden Fässer fanden sich noch irgendwelche Spuren ihrer Verschleppung hin zu den Erdwerken.
Zähneknirschend vor Enttäuschung kehrte er ins Haus zurück, marodierte mit dem unwilligen Verwalter im Kielwasser durch die Kellergewölbe und hielt vergeblich nach übersehenen Fingerzeigen Ausschau. Die Posten hatte man bereits einer nicht allzu zartfühlenden Befragung unterzogen, aber sie hatten geschlafen oder waren betrunken gewesen und wussten nichts Erhellendes zu sagen. Die Hoffnung des Colonels schwand endgültig, und ihm riss der längst ausgefranste Geduldsfaden.
»Das Gold muss wieder her!« zischte er dem Verwalter ins Gesicht und schlug ihm dabei nachdrücklich auf die Brust. Die beiden standen sich Aug’ in Aug’ in der einstigen Pracht des Bankettsaals gegenüber, nunmehr zu einem schmutzigen Regimentsbüro verkommen. Der Major hatte sich entfernen dürfen, und sie waren allein.
Aber der Verwalter war nicht minder entschlossen. »Das gehört nicht zu meinen Aufgaben«, protestierte er energisch. »Ich habe mein Bestes getan, um Euch zu helfen, obwohl es mich nichts angeht. Falls Ihr es wünscht, werde ich die Suche in Ruhe fortsetzen, wenn Ihr und Eure Männer abgezogen sind. Ich verspreche Euch, dass alles, was sich finden lässt, umgehend Oxford überstellt wird. Mehr kann ich weder tun noch sagen.«
»Dafür wird es dann zu spät sein.« In Sir Henry zog sich alles zusammen bei der Vorstellung, seine Pension könnte sich auf der Straße nach Oxford seinem Zugriff entziehen.
»Der König ist vielleicht fort, aber diese Stadt bleibt doch wohl besetzt, oder?«
»Ihr versteht mich nicht, Master Harrison. Dieses Haus ist es, was nicht mehr da sein wird.«
Der Verwalter war erschüttert. In all seinen Dienstjahren hätte er sich nie eine derartige Drohung träumen lassen, niemals geglaubt, dass solche Worte fallen könnten. »Was wollt Ihr damit sagen?« verlangte er zu wissen.
»Mein Befehl lautet, vor unserem Abzug das Haus anzuzünden. Da keine Männer zu seiner weiteren Besetzung verfügbar sind, darf es dem Feind nicht in die Hände fallen. So wollen es die Regeln der Kriegskunst.«
»Der König würde niemals die Vernichtung von Eigentum anordnen, das der Familie des Vicomte gehört. Sie hat mehr für die Sache Seiner Majestät getan, als sonst einer seiner treuen Anhänger.«
»Ich diene unter dem Kommando von Prinz Rupert und nehme meine Befehle von ihm entgegen.«
»Noch weniger würde der Prinz solch mutwilligen Schaden decken. Er ist ein Freund Seiner Lordschaft. Ich muss ohne Umschweife feststellen, dass ich Euren Worten keinen Glauben schenke. Das hier schmeckt nach bloßer Rache für den Verlust Eurer Beute. Wenn Ihr die Wahrheit sagt, so beweist es. Zeigt mir den Befehl und gestattet mir, ihn zu lesen.«
»Nehmt Euch in acht, Master Harrison.« Sir Henry lächelte, während er sprach, aber nicht vor guter Laune. »Seht Euch vor, oder Ihr macht Eure Frau zur Witwe und Eure Kinder zu Waisen. Der letzte, der sich anschickte, mein Wort zu bezweifeln, war tot, bevor es dunkel wurde. Was Euer Ansinnen betrifft, so ist es unverschämt und kann nicht berücksichtigt werden. Euch dürfte bekannt sein, dass militärische Befehle in Kriegszeiten geheim sind. Würde ich das Wissen um sie mit Euch teilen, machte ich mich eines schweren Vergehens schuldig. Wie kann ich sicher sein, dass Ihr kein Spion seid und im Lohn der Rebellen steht? Eure Begierde, einen Blick in meine Befehle zu werfen, bestärkt mich eigentlich nur in diesem Verdacht. Eher, als Euch mit meinem Schwert zu durchbohren, bin ich versucht, Euch einem Erschießungskommando zu übergeben.«