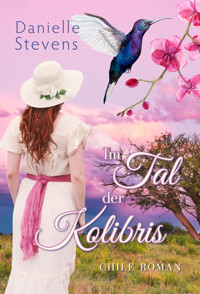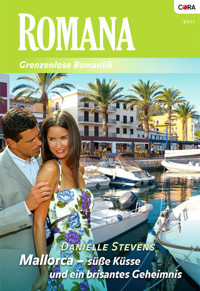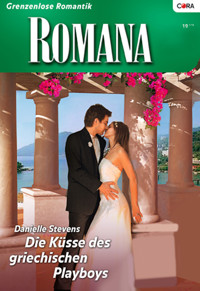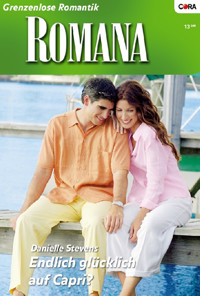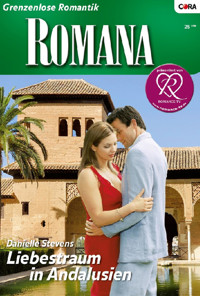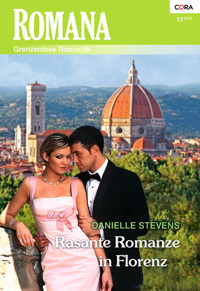0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe und Geheimnis im fernen Neuseeland: Die große Familiensaga von Danielle Stevens!
Auf der Flucht vor der Vergangenheit zieht die Tierärztin Shelly Makepeace mit ihren beiden Kindern nach Neuseeland, um ein neues Leben anzufangen. Doch auch in der neuen Heimat stößt sie auf Ablehnung. Zwischen ihrer Familie und der Nachbarsfamilie scheint ein mysteriöser Streit zu bestehen; die Ursache kennt sie nicht. Einzig der Farmer Josh Wood bleibt ihr zugetan. Eines Tages entdeckt sie auf dem Dachboden ihres neuen Zuhauses ein altes Bild. Das Bild einer wunderschönen jungen Frau. Nach und nach begreift Shelly, dass der Grund für die Feindschaft zwischen den Familien in der Vergangenheit liegt. Wird Josh ihr dabei helfen, das Geheimnis zu lüften …?
Neuseelandroman. Neuauflage. Erstmals erschienen bei Mira Taschenbuch, Hamburg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Danielle Stevens
Das Geheimnis der Maori-Frau
Neuseeland-Roman
Inhalt
Das Geheimnis der Maori-Frau
Inhalt
Impressum
Das Buch
Prolog
ERSTER TEIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ZWEITER TEIL
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DRITTER TEIL
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Wo die Nelkenbäume blühen
Das Haus über den Klippen
Im Tal der Kolibris
Leseprobe „Wo die Nelkenbäume blühen“
Impressum
Copyright © 2023 Danielle Stevens
Copyright Originalausgabe © 2010 Mira Taschenbuch, Hamburg
Covergestaltung: Daniela Krüger
Bildmaterialien: Khoroshunova Olga/Shutterstock;
JenJ Payless2/Shutterstock
Danielle Stevens
c/o Werneburg Internet Marketing und Publikations-Service
Philipp-Kühner-Straße 2
99817 Eisenach
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne Zustimmung der Autoren kopiert, nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden. Sämtliche Übersetzungsrechte vorbehalten. Dieses Buch ist ein fiktives Werk. Namen, Figuren, Unternehmen, Orte werden fiktiv verwendet. Markennamen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum der rechtmäßigen Inhaber. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Das Buch
Liebe und Geheimnis im fernen Neuseeland: Die große Familiensaga von Danielle Stevens!
Auf der Flucht vor der Vergangenheit zieht die Tierärztin Shelly Makepeace mit ihren beiden Kindern nach Neuseeland, um ein neues Leben anzufangen. Doch auch in der neuen Heimat stößt sie auf Ablehnung. Zwischen ihrer Familie und der Nachbarsfamilie scheint ein mysteriöser Streit zu bestehen; die Ursache kennt sie nicht. Einzig der Farmer Josh Wood bleibt ihr zugetan. Eines Tages entdeckt sie auf dem Dachboden ihres neuen Zuhauses ein altes Bild. Das Bild einer wunderschönen jungen Frau. Nach und nach begreift Shelly, dass der Grund für die Feindschaft zwischen den Familien in der Vergangenheit liegt. Wird Josh ihr dabei helfen, das Geheimnis zu lüften …?
Neuauflage. Erstmals erschienen bei Mira Taschenbuch, Hamburg.
Prolog
Reglos hockte der Mann in Schwarz im Schatten des Ratabaumes. Die Luft um ihn herum war erfüllt von den Geräuschen der Nacht – dem sanften Rauschen des Windes und dem Gesang der Grillen –, doch er nahm sie gar nicht wahr. Sein Blick war starr auf das hell erleuchtete Fenster im oberen Stockwerk des Farmhauses gerichtet, hinter dem sich das Elternschlafzimmer befand. Durch den Vorhang konnte er die Bewegungen des Ehepaares verfolgen, das sich anschickte, nach einem langen, anstrengenden Tag zu Bett zu gehen.
Dann – endlich – wurde es dunkel.
Der Mann in Schwarz spürte, wie eine Welle der Erregung ihn durchfuhr. Doch er musste noch ein wenig abwarten. Er schloss die Augen und maß die Zeit, indem er die Schläge seines Herzens zählte.
Eins … zwei … drei … Als er bei neunzig angelangt war, trat er aus seinem Versteck und ging zielstrebig auf das kleinere Gebäude zu, das etwas abseits vom Wohnhaus stand. Die weit über den Kopf gezogene Kapuze seines Sweatshirts verbarg sein Gesicht vor dem Mondlicht. Nur seine Augen glänzten schwach, wie schwarze Murmeln in einem Meer aus Finsternis.
Leise schwappte die Flüssigkeit in dem Kanister, den er bei sich trug, bei jedem Schritt gegen die Wände des Behälters. Er glaubte zu spüren, wie sich die Umrisse des Zippo-Feuerzeugs in seiner Hosentasche durch den Stoff der schwarzen Jeans brannten.
Jetzt war es bald so weit. Er konnte es kaum noch abwarten.
Kurz darauf erreichte er den Schuppen, in dem, wie er wusste, Viehfutter gelagert wurde. Er stellte den Kanister ab und schraubte den Deckel auf. Sofort stieg ihm der beißende Gestank von Reinigungsbenzin in die Nase, der auf ihn eine geradezu berauschende Wirkung ausübte. Einen Augenblick lang genoss er das leichte Schwindelgefühl, das sich in seinem Kopf ausbreitete, dann nahm er den Kanister auf und fing an, die Flüssigkeit rund um das Gebäude zu verteilen.
Als er damit fertig war, stand er einen Moment lang einfach nur andächtig da. Der Nervenkitzel glich dem, was man empfindet, wenn man am Rand eines Hochhausdaches steht und in den gähnenden Abgrund blickt. Denn dabei geht es nicht um Angst, sondern vielmehr um Macht.
Die Macht des freien Willens.
Noch einmal holte der Mann in Schwarz tief Luft, dann zückte er das Zippo, ließ es aufschnappen und drehte das Zündrädchen.
Mit einem leisen Fauchen wurde die Flamme entfacht.
Macht.
Ein freudiges Zittern durchlief seinen Körper. Er holte aus und warf das Feuerzeug weit von sich. Es beschrieb einen hohen Bogen, ehe es mitten in einer Pfütze aus Benzin landete, das mit einem wütenden Brüllen entflammte.
Innerhalb von Sekunden griff das Feuer um sich, und der Schuppen brannte lichterloh. Nur kurz durfte der Mann in Schwarz den Anblick seines Werkes genießen. Das Wiehern der Pferde im benachbarten Stall und das Tosen der Flammen würde die Bewohner des Farmhauses schon bald wecken.
Er wandte sich ab und ging. Kurz darauf war er im Schutz der Nacht verschwunden.
ERSTER TEIL
1.
WELCOME TO AORAKAU VALLEY – HAERE MAI!
Du bist eingeladen, deinen Ärger, deine Unzufriedenheit und deine Fragen mitzubringen. Aber wenn du gehst, nimm Frieden, Gelassenheit und Freundschaft mit.
Shelly Makepeace runzelte die Stirn, als sie den Text im Vorbeifahren las. Dass diese bekannte Maoriweisheit ausgerechnet auf dem Schild stand, das die Besucher von Aorakau Valley begrüßen sollte, erschien ihr wie eine spöttische Fügung des Schicksals. Denn wenn es zwei Worte gab, die ihr Dasein im Augenblick wirklich treffend charakterisierten, dann waren es Ärger und Unzufriedenheit. Und auch an Fragen mangelte es ihr nicht.
Quälende, bohrende Fragen darüber, wie es weitergehen sollte. Ob sie wirklich das Richtige tat und warum ausgerechnet ihr Leben von einem Tag auf den anderen in solche Turbulenzen hatte geraten müssen.
Seufzend strich sie sich eine widerspenstige Strähne ihres rotblonden Haares zurück hinters Ohr. Wenn sie sich bloß nicht so entsetzlich müde und erschöpft fühlen würde …
Während des fast zwanzigstündigen Flugs von Los Angeles nach Christchurch war sie zwar hin und wieder kurz eingenickt, allerdings ohne wirklich erholsamen Schlaf zu finden. Sie hasste einfach die Vorstellung, sich Tausende von Meilen über dem Erdboden zu befinden. Allein der Gedanke daran verhinderte, dass sie sich entspannen konnte, und sie war froh gewesen, nach der Landung endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren.
Doch da hatte der Stress erst richtig begonnen.
Bei der Einreise erschnüffelte ein freundlich schwanzwedelnder Zoll-Spürhund einen Apfel in der Umhängetasche ihrer vierzehnjährigen Tochter Kimberley. Und Will, fünf Jahre jünger als seine Schwester, hatte die Orange, die im Flugzeug als Zwischenmahlzeit gereicht worden war, nicht etwa gegessen, sondern kurzerhand in seinen Rucksack gestopft.
Da schon während des Flugs bei der Ausgabe der Zollformulare darauf hingewiesen worden war, dass die Einfuhr von Lebensmitteln nach Neuseeland streng untersagt war, wurde mit diesen »verbotenen Früchten« ebenso kurzer Prozess gemacht wie mit der Banane einer jungen Französin und dem Sandwich einer Koreanerin. Alles Essbare wurde vom Zoll konfisziert, in Folie verpackt und in einem großen Container deponiert, während die ehemaligen Besitzer gleich an Ort und Stelle eine Strafe von zweihundert Neuseelanddollar pro Verstoß bezahlen durften.
»Sparen Sie sich die Mühe«, hatte ihr eine etwas schadenfroh lächelnde Mitreisende geraten, als Shelly protestieren wollte. »Am Ende hat noch jeder den Paradies-Dollar gezahlt. Vertrauen Sie mir, ich kann ein Lied davon singen.«
Mit einer deutlich zusammengeschrumpften Reisekasse waren Shelly und ihre Kinder nach der Prozedur zum Schalter der Autovermietung gegangen, um ihren reservierten Kleinwagen abzuholen, und nun befanden sie sich bereits seit mehr als sechseinhalb Stunden auf dem Weg nach Aorakau, einem winzig kleinen Fleckchen am südlichen Ende der Landkarte von Neuseeland, etwa auf halber Strecke zwischen Oamaru und Invercargill.
Shelly wischte sich über die Augen, die vor Erschöpfung brannten. Jeder einzelne Knochen, jeder Muskel in ihrem Körper schmerzte, und hinter ihren Schläfen hämmerte es dumpf. Aber jetzt war es ja zum Glück nicht mehr weit. Die letzten Meilen würde sie auch noch durchstehen, und danach … Ihr Mietwagen erklomm auf der einsamen Landstraße die Kuppe des sanft ansteigenden Hügels, und Shelly stockte der Atem.
Für einen Moment fühlte sie sich zurückversetzt in ihre Kindheit. Zu jenen Tagen, in denen sie auf dem Schoß ihres Großvaters gesessen und mit großen Augen staunend den Legenden von Aotearoa – dem Land der langen weißen Wolke, wie die Maori Neuseeland nannten – gelauscht hatte.
Das war es also, das Land ihrer Vorfahren.
Wie von grünem Samt überzogen wirkte der weite Talkessel von Aorakau Valley, der sich wie ein Kelch zur Küste hin öffnete. An den Flanken der schneebedeckten Bergrücken erhoben sich mächtige Kauri- und Ratabäume, deren von roten Blüten gefärbte Kronen schon aus der Entfernung deutlich zu erkennen waren. Und über allem spannte sich der atemberaubend blaue Himmel, an dem sich gewaltige weiße Wolkenberge auftürmten.
Ein Gefühl von Ehrfurcht stieg in Shelly auf, das sie kaum in Worte fassen konnte. Zum ersten Mal, seit sie in Neuseeland angekommen waren, spürte sie so etwas wie eine Verbundenheit mit diesem Land, das sie bislang nur aus Erzählungen gekannt hatte. Für einen Moment vergaß sie all ihre Sorgen und Probleme. Die quälenden Zweifel fielen von ihr ab, und sie fühlte sich einfach nur frei.
»Kim, Will! Schaut nur, wie …« Sie verstummte, als sie in den Rückspiegel blickte und bemerkte, dass ihre Tochter mit ihrem heiß geliebten Handy auf dem Schoß eingenickt war. Ihr rabenschwarz gefärbtes Haar umrahmte das entspannte Gesicht, die mit dunklem Kajal umrandeten Augen waren geschlossen. Hinter den leicht geöffneten, dunkelrot-violett geschminkten Lippen schimmerten perlweiße Zähne.
Erst jetzt fiel ihr auf, wie herrlich still es plötzlich im Wagen war. Kim sah im Schlaf so friedlich aus, dass Shelly für einen Augenblick fast vergaß, wie schwierig sich der Umgang mit ihr in letzter Zeit gestaltete. Vor allem seit die Entscheidung im Raum gestanden hatte, Kalifornien zu verlassen und in Neuseeland noch einmal ganz von vorne anzufangen.
»Auf keinen Fall!«, war Kims wütende Reaktion gewesen. »Ich komme nicht mit, niemals! Und du kannst mich nicht dazu zwingen!«
Am Ende hatte sie sich dann aber doch dem Willen ihrer Mutter beugen müssen. Das bedeutete allerdings nicht, dass sie ihr die Sache einfach machte. Ganz im Gegenteil: Nach zwei Tagen vorwurfsvollen Schweigens war Kim zu einer anderen Strategie übergangen, und die bestand darin, möglichst jedem in ihrer näheren Umgebung das Leben zur Hölle zu machen.
Was sie selbst betraf, so konnte Shelly damit umgehen. Wenn sie eines als Mutter eines Teenagers inzwischen gelernt hatte, dann, dass es am besten war, solche Phasen einfach auszusitzen. Es tat ihr nur leid, dass auch Will unter den Launen seiner Schwester leiden musste.
Ach, Will …
Im Gegensatz zu Kim war der Neunjährige manchmal beinahe schon zu unkompliziert. Er war ruhig und beschwerte sich eigentlich nie. Seit er lesen konnte, sah man ihn meist mit einem Buch in der Hand still in einer Ecke sitzen. Auch jetzt war er, die Stirn leicht gerunzelt, in die Lektüre eines dicken Wälzers versunken.
Shelly war erst ein bisschen erschrocken gewesen, als sie auf dem Flug nach Christchurch feststellte, dass es sich um Die Geschichte der Feuerwehr vom alten Rom bis in die Gegenwart handelte – ein Buch, das Will sich, wie sie wusste, vor einigen Wochen aus der Schulbibliothek ausgeliehen und ganz offensichtlich nicht zurückgebracht hatte.
Noch eine Sache, um die sie sich kümmern musste. Als hätte sie nicht auch so schon genug um die Ohren! Inzwischen verstand sie die Aufregung aber selbst schon gar nicht mehr. Sie würde das Buch einfach mit der Post zurückschicken, sobald sie in Aorakau angekommen waren. Das war nun wirklich das kleinste ihrer Probleme. Nach allem, was in letzter Zeit vorgefallen war …
»Wir sind bald da«, sagte sie leise, um Kim nicht zu wecken.
Will nickte, ohne aufzublicken. Er nahm den ganzen Stress der vergangenen Tage mit bewundernswerter Gelassenheit hin. Und der Abschied von Los Angeles schien ihm keine besonderen Schwierigkeiten zu bereiten. Für ihn war das »Projekt Auswanderung« vermutlich ein einziges großes Abenteuer.
»Mom, pass auf!«, schrie er in diesem Moment.
Wills Warnruf ließ Shelly zusammenschrecken. Sie nahm dem Blick vom Rückspiegel, sah die Schafe, die dösend nur ein paar Meter vor ihr auf der Straße in der Sonne lagen, und riss instinktiv das Lenkrad herum. Es gelang ihr, den Tieren gerade noch auszuweichen, doch als sie die Bremse durchtrat, verlor sie endgültig die Kontrolle über ihren Wagen.
»Festhalten!«, schrie sie, dann schossen sie auch schon rumpelnd über die Straßenbegrenzung hinweg und landeten mit einem heftigen Ruck im Straßengraben.
Shelly ächzte, als ihr der Sicherheitsgurt die Luft aus der Lunge presste. Im nächsten Moment flammten sämtliche Warn- und Hinweisleuchten auf dem Armaturenbrett des Mietwagens auf.
»Verdammt!«, stieß sie mit zittriger Stimme hervor. Dann löste sie hastig ihren Sicherheitsgurt und drehte sich besorgt zu ihren Kindern um.
»Will? Kim? Alles okay bei euch?«
»Verdammt, was war denn das?« Kimberly brauchte ganz offensichtlich einen Moment, um sich vom ersten Schock zu erholen. Ihr Gesicht war kalkweiß, sie rang nach Atem. Doch dann, als Shelly schon anfing, sich ernsthaft Sorgen zu machen, zog sie die Brauen zusammen und fing an zu schimpfen. »Na toll, du hast einen Unfall gebaut, Mom! Das wäre alles nicht passiert, wenn du auf mich gehört hättest und wir in L.A. geblieben wären!«
Shelly atmete erleichtert auf. Dem Tonfall nach zu urteilen, ging es ihrer Tochter gut, und auch Will schien mit dem Schrecken davongekommen zu sein.
Er ließ das Seitenfenster herunter und löste den Sicherheitsgurt. Anschließend kniete er sich auf den Rücksitz und schaute zum Fenster hinaus. »Wow!«, kommentierte er fast begeistert. »Wir stecken mit dem Wagen im Straßengraben fest! Das ist ja so was von cool!«
»Was soll denn daran cool sein, du Vollidiot?«, zischte seine Schwester. »Du bist echt bescheuert!«
»Sofort aufhören!«, beendete Shelly das Wortgefecht zwischen den Geschwistern, noch ehe es richtig beginnen konnte. Das Hämmern in ihrem Kopf nahm wieder zu, und sie massierte sich mit den Fingern die Schläfen. »Streit hilft uns jetzt auch nicht weiter.« Sie stieg aus dem Wagen, kletterte die niedrige Böschung hinauf und schaute sich um. So weit das Auge reichte, nur endlose Hügel, Wiesen und Felder. Die einzigen Lebewesen in ihrer unmittelbaren Umgebung waren Schafe – davon gab es allerdings viele. Nur, dass ihr das leider nicht weiterhalf.
Was für eine Ironie des Schicksals! In Los Angeles war ihr das ständige Verkehrschaos meistens auf die Nerven gegangen; jetzt hätte sie ihr letztes Hemd dafür gegeben, auch nur ein einziges anderes Auto zu sehen.
Sie kehrte zu Will und Kim zurück. »Wir werden uns irgendwie selbst behelfen müssen. Es sieht nicht so aus, als ob hier allzu häufig jemand vorbeikommt.«
Störrisch verschränkte Kim die Arme vor der Brust. »Mir doch egal. Ich war sowieso dagegen, dass wir hierherkommen. Das hast du jetzt davon!«
»Kim, bitte!«
»Ich steige aus und schiebe«, erklärte Will und öffnete die Hintertür. Sie klemmte leicht, sodass er sich mit der Schulter dagegenstemmen musste, um sie ganz aufzubekommen.
»Du?« Kim bedachte ihn mit einem abfälligen Blick. »Das schaffst du nie! Du bist doch noch ein Kind!«
»Wenn Mom den Motor zum Laufen bekommt und du mir beim Schieben hilfst, klappt es vielleicht«, entgegnete Will, ohne auf die Stichelei seiner Schwester einzugehen, die auf Streit aus war.
»Ich?« Sie schüttelte den Kopf. »Mich hat niemand nach meiner Meinung gefragt, als es plötzlich hieß, dass wir nach Neuseeland auswandern. Ich wurde einfach in ein Flugzeug geschleppt und hierher verfrachtet. Jetzt seht auch selbst zu, wie ihr aus dem Schlamassel wieder rauskommt!«
»Kim, es reicht jetzt, okay?« Shelly seufzte. Auf eine Art konnte sie ihre Tochter sogar verstehen. Kim hatte im Grunde überhaupt keine Chance gehabt, sich an den Gedanken zu gewöhnen, Kalifornien zu verlassen. Doch auch Shelly war diese Entscheidung nicht leichtgefallen. Sie hatte ihre geliebte Arbeit als Tierärztin aufgeben und ihre Freunde und Bekannten in L.A. zurücklassen müssen. Sie kannte in Neuseeland doch auch keinen Menschen!
Aber wäre sie geblieben, hätte sie jeden Tag mit der Angst leben müssen, dass ihr zukünftiger Ex-Mann plötzlich vor der Tür stehen und seine Drohungen wahr machen würde. Doch darüber konnte und wollte sie mit ihren Kindern nicht reden. Von daher war es nur natürlich, dass sie nicht verstanden, warum ihre Mutter sie einfach so von einem Tag auf den anderen aus ihrem gewohnten Umfeld riss.
Adrian … Noch immer konnte sie nicht fassen, was der Mann, der einmal ihre große Liebe gewesen war, ihr angetan hatte.
Ihr und ihren gemeinsamen Kindern …
»Jetzt geh und hilf deinem Bruder!«, forderte sie ihre Tochter auf, doch Kim reagierte lediglich mit einem Schulterzucken.
Kopfschüttelnd drehte Shelly den Zündschlüssel herum. Der Motor röchelte kurz, erstarb aber sofort wieder. Ihr brach der kalte Schweiß aus. Hoffentlich war bei dem Aufprall im Straßengraben nichts an der Mechanik des Wagens beschädigt worden. Sie wusste genau, dass sie niemals in der Lage sein würde, auch nur den kleinsten Fehler zu beheben. Um solche Dinge hatte sich Adrian immer gekümmert. Und wenn der mal nicht weiterwusste, war das Auto eben kurzerhand in die Werkstatt gegeben worden.
Bitte spring an! Lass mich jetzt nicht im Stich!
Beim zweiten Versuch gab sie während des Anlassens ein wenig Gas. Der Wagen heulte kurz auf, dann lief der Motor sanft schnurrend wie ein junges Kätzchen.
»Wenn du keine Lust hast, die kommende Nacht hier draußen im Nirgendwo zu verbringen, solltest du jetzt aussteigen und deinem Bruder beim Schieben helfen, junge Dame«, wandte sie sich erneut an Kim.
Die Aussicht auf eine Nacht unter freiem Himmel schien zu wirken. Die Vierzehnjährige zögerte kurz und wog die Alternativen gegeneinander ab. Schlussendlich kam sie dabei anscheinend zu dem Ergebnis, dass es das kleinere Übel war, der Bitte ihrer Mutter Folge zu leisten. Auch wenn das natürlich nicht ohne weiteres Maulen und Nörgeln vonstattenging.
»Seid ihr soweit?«
Kim und Will standen vor dem Wagen, die Hände auf die Motorhaube gestützt.
»Alles klar, Mom«, rief Will. »Versuch mal, ein bisschen Gas zu geben.«
Ein Lächeln huschte über Shellys Gesicht. Obwohl er erst neun Jahre alt war, schien Will ganz automatisch die Männerrolle in der Familie übernommen zu haben. Er redete genauso wie sein Dad früher, damals, in glücklicheren Zeiten …
Rasch verscheuchte sie den Gedanken an Adrian. Er war nicht mehr Teil ihres Lebens, und er würde es nie wieder sein. Sie wäre niemals in der Lage, mit einem Verbrecher zusammenzuleben.
Ja, ein Verbrecher – nichts anderes war er. Als sie die Wahrheit durch einen dummen Zufall aufgedeckt hatte, war es ein schrecklicher Schock für sie gewesen. Sie hatte sich nicht leicht mit der Entscheidung getan, ihren Ehemann – den Vater ihrer Kinder – bei der Polizei anzuzeigen. Doch am Ende war ihr klar geworden, dass ihr gar keine Wahl blieb …
Sie atmete noch einmal tief durch, legte den Rückwärtsgang ein und drückte vorsichtig das Gaspedal herunter, während ihre rechte Hand über der Handbremse schwebte, jederzeit bereit, sie im Notfall anzuziehen.
Doch ihre Befürchtung, der Wagen könnte ins Rutschen geraten und ihre Kinder überrollen, erwies sich als völlig unbegründet. Obwohl Kim und Will mit aller Kraft schoben, rührte sich das Fahrzeug keinen Millimeter. Und je mehr Gas Shelly gab, desto tiefer schienen sich die Räder in den weichen Grasboden zu graben.
Es war zum Verzweifeln.
»Das hat keinen Sinn«, verkündete sie nach dem dritten erfolglosen Versuch schließlich, machte den Motor aus und stieg aus dem Wagen. »Auf diese Weise kommen wir nie hier raus. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen.«
Wütend funkelte Kim sie an. »Wirklich toll, Mom! Ich könnte jetzt mit meinen Freunden im Hancock Park in der Sonne sitzen und …«
»Es reicht, junge Dame!«, fiel Shelly ihr ins Wort. »Ich habe deine ständigen Nörgeleien endgültig satt. Du bist meine Tochter, und deshalb wirst du gefälligst genau das tun, was ich dir sage, verstanden?«
Sprachlos starrte Kim sie an, doch ihre Überraschung währte nicht lange. Schon holte sie Luft, um zu einem wütenden Protest anzusetzen, als Will, der inzwischen die Böschung hinaufgeklettert war, plötzlich rief: »Leute, hört auf zu streiten! Da kommt ein Wagen!«
»Vielen Dank, Mister«, sagte Shelly, als ihr Mietwagen knapp eine halbe Stunde später wieder auf der Straße stand. »Ich wüsste wirklich nicht, was wir ohne Ihre Hilfe gemacht hätten.«
»Ach was, das ist doch nicht der Rede wert.« Der Mann – Shelly schätzte ihn auf Mitte bis Ende fünfzig – löste das Abschleppseil von der Stoßstange seines Pick-ups, mit dem er den Mietwagen aus dem Graben gezogen hatte, und warf es auf die Ladefläche. Mit seinen verwaschenen Jeans, dem karierten Baumwollhemd und seinem grau melierten Bart sah er genau so aus, wie Shelly sich immer einen neuseeländischen Schaffarmer vorgestellt hatte.
Jetzt hakte er den Daumen unter seine Hosenträger und musterte sie neugierig. »Sie sind nicht von hier.«
»Oh Gott, merkt man das so deutlich?«, erwiderte Shelly lächelnd. »Aber Sie haben natürlich recht, wir sind gerade vor ein paar Stunden aus dem Flieger gestiegen. Wir kommen aus den USA.«
»Sind sicher ganz schön kaputt, Ihre beiden.« Er nickte in Richtung ihrer Kinder, die ausnahmsweise einmal still und friedlich neben dem Mietwagen standen.
Shelly war überrascht gewesen, dass ihre Tochter den klaren und direkten Anweisungen eines völlig Fremden ohne jeden Protest gefolgt war. Die ganze Zeit war nicht ein Wort der Klage über ihre Lippen gekommen. Shelly erschien es beinahe wie ein Wunder.
»Ja, wir sind alle ziemlich am Ende, daher sollten wir wohl besser zusehen, dass wir weiterkommen.« Sie zückte ihre Geldbörse. »Was bekommen sie für Ihre Hilfe, Mister?«
Man konnte förmlich mit ansehen, wie sich die Miene ihres Helfers verfinsterte, und Shelly wurde klar, dass sie einen Fehler begangen hatte.
»Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in den Staaten ist«, bemerkte der Mann kühl. »Aber hier bei uns hilft man sich gegenseitig, wenn jemand in Schwierigkeiten ist.«
Shelly spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. »Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen keineswegs zu nahe treten. Vielen Dank noch einmal für Ihre Hilfe. Sie waren wirklich unser rettender Engel.«
»Wohin geht‘s denn von hier aus?«, fragte ihr Helfer, der wieder ein wenig besänftigt wirkte. »Bis nach Invercargill ist es noch ein ganzes Stück, und …«
»Nein, nein, wir sind schon fast am Ziel. Ich habe die Schaffarm meines Großvaters geerbt. Ach, wie unhöflich von mir, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt: Mein Name ist Shelly Makepeace, und das sind meine Tochter Kim und mein Sohn Will.«
»Bob Reardon.« Der Schaffarmer hob eine Braue. »Sagten Sie Makepeace? Wie Ben Makepeace?«
Shelly nickte mit einem traurigen Lächeln. »Ja, Ben Makepeace war mein Großvater. Er hat Neuseeland vor vielen Jahren verlassen, seine Farm aber wohl nie verkauft.« Sie zuckte mit den Schultern. »Tja, und nun gehört sie mir.«
War das Skepsis, die sich in Reardons Miene abzeichnete? Wenn dem so war, dann hatte er sich sehr schnell wieder im Griff.
»Und was ist mit dem Vater der Kinder? Kommt der später nach?«
Rasch schüttelte Shelly den Kopf. »Nein, nein, ich … Wir haben uns getrennt. Er wird nicht hier bei uns leben.«
Nicht zum ersten Mal, seit diese unselige Geschichte ihren Lauf genommen hatte, war Shelly froh darüber, ihren Mädchennamen bei der Hochzeit mit Adrian beibehalten zu haben. Seinen Nachnamen – Shelley – anzunehmen, war für sie aufgrund der Ähnlichkeit zu ihrem Vornamen nie infrage gekommen, daher hatte sich Adrian für einen Doppelnamen – Shelley-Makepeace – entschieden. Kim und Will führten offiziell den Familiennamen ihrer Mutter. Somit würde man sie in Aorakau vermutlich automatisch für eine Alleinerziehende halten und keine allzu neugierigen Fragen nach dem Vater der Kinder stellen.
Auch Mr. Reardon gab sich mit ihrer Antwort zufrieden. »Na, dann wünsche ich Ihnen alles Gute.« Er tippte mit dem Zeigefinger an den Schirm seiner Baseballkappe. »Man sieht sich.«
Er stieg in seinen Wagen, winkte den Kindern noch einmal knapp zu und fuhr dann in Richtung Aorakau weiter.
Shelly blickte ihm noch eine Weile nach und klatschte schließlich in die Hände. »So, Herrschaften, es kann weitergehen. Steigt ein, wenn wir uns beeilen, können wir in zwanzig Minuten am Ziel sein.«
»Und wenn ich nicht will?« Reardon war kaum fort, schon kam Kims rebellische Ader wieder zum Vorschein. Shelly schüttelte den Kopf. »Kim, bitte, ich …« In diesem Moment wurde ihr klar, wo der Unterschied zwischen dem Schaffarmer und ihr lag, und sie korrigierte sich. »Deine Entscheidung«, sagte sie nüchtern. »Aber wer nicht in zwei Minuten im Wagen sitzt, muss den Rest der Strecke wohl zu Fuß zurücklegen.«
Ihre Tochter starrte sie ungläubig an. »Das würdest du nicht tun!«
»Ich würde mein Glück an deiner Stelle nicht herausfordern.«
Keine fünf Minuten später saßen sie alle wieder auf ihren Plätzen, und die Fahrt konnte weitergehen. Kim schmollte zwar, beschwerte sich aber nicht mehr.
Shelly schämte sich fast ein bisschen dafür, aber sie musste zugeben, dass sie das Schweigen ihrer Tochter zur Abwechslung einmal recht erholsam fand.
Das Farmhaus sahvollkommen anders aus, als Shelly es sich vorgestellt hatte. Um das imposante Natursteingebäude eines Schafbarons, wie man es hin und wieder in romantischen Fernsehfilmen gezeigt bekam, handelte es sich definitiv nicht. Aber auch von dem anderen Extrem – einem schäbigen Wellblechverschlag – war es weit entfernt.
Eingebettet in sanfte grüne Hügel und beschattet von der weiten Krone eines Ratabaumes wirkte das zweistöckige Gebäude mit dem hellblauen Anstrich wie eine Oase der Ruhe. Auf der großzügigen Veranda wippte ein Schaukelstuhl im lauen Wind vor und zurück.
Doch der friedliche erste Eindruck ließ sich nicht lange aufrechterhalten.
Sah man nämlich genauer hin, bemerkte man schnell, dass die Farbe der Fassade an vielen Stellen abblätterte. Am Geländer der Veranda fehlten einige Sprossen, was es ein wenig wie ein unvollständiges Gebiss aussehen ließ, das Ziegeldach wies zahlreiche Lücken auf, sodass es vermutlich hineinregnete, und ein zerbrochenes Fenster war nur notdürftig mit einer Plastikfolie abgedichtet worden.
Das war es also. Das Haus, in dem ihr Großvater geboren und aufgewachsen war. Fast rechnete Shelly damit, dass jeden Moment ein junger Ben Makepeace auf die Veranda treten würde. Als die Tür tatsächlich aufgestoßen wurde, atmete sie scharf ein. Doch es war kein schlaksiger blonder Junge mit eisblauen Augen, der da aus dem Haus kam, sondern eine ältere Frau mit grau durchwirktem Haar, die über einem schlichten weißen Baumwollkleid eine dunkelblaue Küchenschürze trug. Als sie den fremden Wagen erblickte, schirmte sie mit einer Hand die Sonne von den Augen ab, sodass sie besser sehen konnte.
»Wer ist das?«, fragte Will. Kim schwieg nach wie vor trotzig – sie hatte sich offenbar entschieden, ihre Mutter mit Nichtachtung zu strafen. Shelly zog es vor, sie vorerst nicht darüber aufzuklären, wie wenig erfolgversprechend diese Strategie war. Sie würde sich auch so noch früh genug mit den Launen ihrer Ältesten herumschlagen müssen.
»Dein Urgroßvater hat die Farm verpachtet, als er Neuseeland verließ«, erklärte sie. »Mrs. Jenkins ist die Witwe des letzten Pächters.« Shelly hatte vor ihrer Abreise kurz mit der älteren Frau telefoniert, um ihre baldige Ankunft anzukündigen. Am Telefon war es ihr nicht gelungen, das Eis zu brechen – umso mehr setzte sie nun auf die erste persönliche Begegnung. Emily Jenkins kannte die Gegend und die Menschen von Aorakau. Sie konnte ihr und den Kindern eine große Hilfe sein – aber nur, wenn es Shelly gelang, ihr Vertrauen zu gewinnen. Von ihrem Großvater wusste sie, dass Emily und ihr verstorbener Mann Jim die Farm über vierzig Jahre lang gemeinsam bewirtschaftet hatten.
Diese Frau hatte den größten Teil ihres Lebens hier verbracht!
»Kommt«, sagte Shelly und parkte den Wagen im Schatten des Rata. »Wir wollen uns vorstellen.«
»Mrs. Jenkins?«, fragte sie, als sie kurz darauf auf die ältere Frau zuging. Die Angesprochene nickte, wirkte aber auf der Hut – auch als Shelly ihr zur Begrüßung die Hand reichte. »Ich bin Shelly Makepeace, wir haben vor ein paar Tagen telefoniert. Das hier sind meine Kinder Will und Kim.«
»Die Urenkel vom alten Ben.« Emily Jenkins Haut war tief von der Sonne gebräunt, ihr Gesicht von Falten überzogen. Wettergegerbt war der Begriff, der Shelly als Erstes einfiel, als sie die ältere Frau sah, die nun fast ein wenig ungläubig den Kopf schüttelte. »Unfassbar, wie schnell die Zeit doch vergeht.« Sie schenkte Will ein vorsichtiges Lächeln. »Du siehst ganz genauso aus wie dein Urgroßvater, als er in deinem Alter war, junger Mann.«
»Sie kannten Gramps, als er ein Junge war?« Überrascht schaute Will Emily Jenkins an.
Die lachte auf. Es war erstaunlich, was für eine Veränderung das auslöste. Sie wirkte plötzlich um viele Jahre jünger. »Nein, natürlich nicht! Ich war damals noch gar nicht geboren. Aber im Haus sind eine Menge alter Gegenstände von eurer Familie zurückgeblieben, als Ben und seine Eltern Neuseeland verließen. Darunter auch eine Hutschachtel mit alten Fotos. Wenn du willst, können wir sie uns gemeinsam ansehen.«
»Ehrlich? Das würde ich furchtbar gern machen!« Will war deutlich anzusehen, dass ihn die Neugier gepackt hatte. Ganz im Gegensatz zu Kim, die ein finsteres Gesicht zog und sich keinerlei Mühe gab, ihre schlechte Laune zu verbergen.
»Wegen dieser Bruchbude sind wir aus L.A. weggegangen? Das ist hoffentlich nicht dein Ernst, Mom!«
Shelly brachte ihre Tochter mit einem strengen Blick zum Schweigen und nahm sich vor, später ein ernstes Wörtchen mit ihr zu reden. Für Emily war diese Bruchbude seit vielen Jahren ihr Zuhause. Und nur weil Kim wütend über ihre eigene Situation war, gab ihr das noch lange nicht das Recht, so unhöflich zu sein.
»Vielleicht sollten wir erst einmal ins Haus gehen«, schlug Emily vor und ging einfach über Kims Bemerkung hinweg, als hätte sie sie nicht gehört. »Sie haben eine anstrengende Reise hinter sich und sind sicher sehr erschöpft. Alles Weitere können wir bei einer schönen Tasse Tee miteinander besprechen. Kommen Sie doch herein.«
Eine halbe Stunde hielten sich die beiden Frauen zusammen in der Küche des Farmhauses auf. Will und Kim waren auf der Couch im Wohnzimmer eingeschlafen. Kims Kopf ruhte auf der Schulter ihres kleinen Bruders. Ein seltenes Bild der Eintracht, das Shelly tief berührte.
Sie seufzte. Warum musste das Leben nur immer so schrecklich kompliziert sein? Sie wollte doch nur das Richtige tun – aber irgendwie schien alles, was sie in letzter Zeit anfasste, komplett schiefzugehen. Es war, als würde ein Fluch auf ihr liegen.
Unwillkürlich musste sie an das denken, was Adrian ihr bei seiner Festnahme im Vorübergehen zugezischt hatte: »Das wirst du noch bereuen, Shelly. Bis dass der Tod uns scheidet – vergiss das niemals! Ich werde dich finden, ganz egal, wo du dich auch verkriechst! Lauf ruhig weg, aber du wirst keine ruhige Minute finden, solange du weißt, ich bin hinter dir her …«
Schockiert hatte Shelly dem Streifenwagen nachgeschaut, in den Adrian verfrachtet worden war. Ihr war ein eisiger Schauer den Rücken hinuntergerieselt. Sie kannte ihren Ehemann gut genug, um zu wissen, dass er keine leeren Versprechungen machte.
In diesen Moment war ihr klar geworden, dass sie auf keinen Fall mit den Kindern in Los Angeles bleiben konnte. Die Entscheidung, nach Aorakau Valley zu gehen, wo sie kurz zuvor die Farm ihres verstorbenen Großvaters geerbt hatte, war da nur naheliegend gewesen. Die knapp 7000 Meilen pazifischer Ozean, die zwischen der Westküste der Vereinigten Staaten und Neuseeland lagen, erschienen ihr als halbwegs ausreichender Sicherheitsabstand zwischen Adrian und ihrer Familie. Doch sie war klug genug, um zu wissen, dass die Entfernung ihren zukünftigen Ex-Mann nicht davon abhalten konnte, Rache zu üben.
Wenn es sein musste, würde er dafür auch bis ans andere Ende der Welt fahren.
»Sie sehen nachdenklich aus, Shelly«, riss Emily Jenkinssie aus ihren düsteren Grübeleien. Die ältere Frau stellte eine Tasse mit dampfendem Earl Grey vor ihr auf den Tisch. Dann öffnete sie einen Schrank und holte ein Kännchen mit Milch heraus. »Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich habe das Gefühl, dass Sie etwas bedrückt, Mrs. Makepeace, und …«
»Ich bin geschieden«, korrigierte Shelly rasch, denn sie konnte es nicht mehr ertragen, irgendwie mit Adrian in Zusammenhang gebracht zu werden. »Und ich würde mich freuen, wenn Sie mich einfach Shelly nennen. Wir werden schließlich demnächst viel Zeit miteinander verbringen, da sind solche Formalitäten doch unangebracht, finden Sie nicht?«
»Also gut, Shelly.« Zum ersten Mal wirkte das Lächeln der Farmerswitwe ihr gegenüber nicht gezwungen. »Ich bin Emily. Und ehrlich gesagt bin ich heilfroh über Ihre offenen Worte. Ich fürchtete schon … nun ja …« Sie zuckte mit den Schultern und stellte das Milchkännchen auf dem Tisch ab. »Möchten Sie Zucker zu Ihrem Tee? Oder vielleicht etwas Milch?«
»Nein, vielen Dank. Was fürchteten Sie?«, hakte Shelly nach.
»Können Sie sich das wirklich nicht vorstellen?« Emily nahm auf dem Stuhl Shelly gegenüber Platz, gab etwas Milch in ihren Earl Grey und rührte sorgfältig um, ehe sie weitersprach. »Ich habe dieses Stück Land mehr als fünfunddreißig Jahre lang mit meinem Mann – Gott hab ihn selig – bearbeitet. Dieses Haus ist in mehr als einer Hinsicht zu meinem Zuhause geworden. Ich hatte vor, hier meinen Lebensabend zu verbringen, und Ben – Ihr Großvater – war so freundlich, mir diese Gelegenheit zu geben, auch wenn ich nach Jims Tod …« Sie atmete tief durch. »Ich will ehrlich sein, ich bin schon seit Jahren nicht mehr in der Lage, die vereinbarte Pacht zu zahlen. Die Schafzucht ist für eine alleinstehende Frau ohne Hilfe nicht zu bewältigen, und Arbeiter kosten Geld. Geld, das ich nicht habe.«
»Sie fürchten also, dass ich Sie von hier vertreiben werde?«
»Nun, dass Sie nach Aorakau gekommen sind, legt den Schluss nahe, dass Sie etwas mit dem Besitz Ihres Großvaters vorhaben. Entweder wollen Sie die Farm selbst betreiben, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, oder Sie suchen nach einem Käufer. Eine alte Frau wie ich dürfte in keinen dieser Pläne passen, daher dachte ich …«
Shelly schüttelte den Kopf. »Keine Angst, Emily. Es stimmt, ich habe nicht vor, die Farm zu behalten. Das Leben hier draußen wäre auf Dauer nichts für die Kinder und mich, wir sind einfach Stadtmenschen. Wer weiß, vielleicht werden wir nach Christchurch gehen oder nach Auckland, mal sehen. Mir ist es eigentlich egal, wo wir uns etwas Neues aufbauen. Hauptsache, ich finde einen Job. Und zwar einen, der genug einbringt, um meine Kinder durchzubringen.«
»Was haben Sie denn gelernt?«, erkundigte Emily sich interessiert.
»Ich bin ich Tierärztin.« Shelly schüttelte den Kopf. »Aber eigentlich möchte ich gar nicht so gern in meinen alten Beruf zurück.«
»Hat Ihnen die Arbeit mit Tieren denn keinen Spaß gemacht?«
»Doch natürlich, ich …« Sie zuckte mit den Schultern. »Es ist nur, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang immer nur ein und dieselbe Sache machen.« Natürlich war das nicht der wahre Grund. Aber wie sollte sie Emily auf die Schnelle erklären, dass die Arbeit als Tierärztin sie einfach zu sehr an ihre Vergangenheit in Los Angeles erinnern würde?
Und vor allem an Adrian …
Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Wie auch immer – wenn ich wirklich einen Käufer für die Farm finden will, der bereit ist, einen angemessenen Preis zu zahlen, muss hier vorher alles auf Vordermann gebracht werden. Und dazu brauche ich jede Unterstützung, die ich bekommen kann. Sie kennen das Land, Sie kennen die Menschen hier. Irgendwie würde es mir wohl auch ohne Sie gelingen, Arbeiter für die Renovierung zu finden – aber es würde mich ganz sicher sehr viel mehr Zeit und Geld kosten als mit Ihrer Hilfe. Und wenn ich erst einmal einen Interessenten gefunden habe, verspreche ich Ihnen, dass ich für Sie tun werde, was immer ich kann. Nun, was sagen Sie?«
Obwohl Shelly ihr keinerlei Garantie hatte geben können, wirkte Emily erleichtert, ja, sie atmete regelrecht auf. »Was ich dazu sage? Nun, ich werde Ihnen natürlich helfen, wo ich kann. Allerdings …«
»Ja?«
»Nun, Sie waren ehrlich zu mir, deshalb will ich auch ganz offen zu Ihnen sein: Es gibt jemanden, der bereit wäre, Ihnen Bens Land auf der Stelle abzukaufen, ohne dass Sie dafür auch nur einen Handschlag rühren müssten.«
»Und wer wäre dieser geheimnisvolle Kaufinteressent?«
»Die Familie Wood«, erwiderte Emily. »Sie sind angesehene …«
»Nein«, fiel Shelly ihr energisch ins Wort. Sie hatte bereits vor ein paar Wochen ein großzügiges Kaufangebot für die Farm erhalten, von einer gewissen Geraldine Wood. Doch darauf einzugehen kam für sie schlichtweg nicht infrage. Sie hatte ihrem Großvater am Sterbebett versprechen müssen, dass sie das Land seiner Familie niemals in die Hände der Woods fallen lassen würde. Und ganz gleich, warum ihm das so wichtig gewesen sein mochte, war ihr dieses Versprechen heilig.
Als sie Emilys erstaunten Blick bemerkte, lächelte sie entschuldigend. »Tut mir leid, meine Reaktion war wohl ein wenig heftig. Aber ich werde keinesfalls an die Woods verkaufen. Mein Großvater hätte das nicht gewollt, und das werde ich respektieren.«
»Ja, ja.« Emily seufzte. »Die alte Fehde …«
Sofort horchte Shelly auf. »Wissen Sie mehr darüber?«
»Nur das, was alle hier wissen.«
»Und das wäre?«, hakte Shelly neugierig nach. Ihr Großvater war zwar keineswegs ein verschlossener Mann gewesen, doch über seine Vergangenheit in Neuseeland hatte er nur selten gesprochen. Und wenn, dann war es in seinen Erzählungen meist um die bezaubernde Schönheit der Natur und die raue Herzlichkeit der Menschen gegangen. Von seiner Kindheit und der Arbeit auf der Farm hatte er sehr wohl erzählt – aber nie über die Zeit, kurz bevor seine Familie in die Vereinigten Staaten ausgewandert war.
»Die Sache liegt schon mehr als sechzig Jahre zurück«, sagte Emily, »doch wie man heute sieht, ist die alte Feindschaft noch so lebendig wie eh und je. Dabei sollen die Woods und die Makepeaces – damals die einflussreichsten Schaffarmer der gesamten Region – einmal eng miteinander befreundet gewesen sein. Aber dann geschah etwas, das zu einem endgültigen Bruch führte. Es hatte irgendwie mit einer Frau zu tun, Genaueres weiß ich auch nicht.«
Shelly war enttäuscht – sie hatte sich mehr von Emily erhofft. Und irgendwie wurde sie das Gefühl nicht los, dass die ältere Frau ihr nicht die ganze Wahrheit sagte. Doch sie spürte auch, dass es keinen Sinn hatte, weiter in sie zu dringen. Emily würde sich ihr erst dann vollkommen öffnen, wenn sie dazu selbst bereit war.
»Ich habe die Nachricht, dass Sie mit Ihren Kindern nach Aorakau kommen, übrigens vorerst für mich behalten«, erklärte die ältere Frau. »Ich wollte nicht, dass Geraldine Wood Sie gleich mit einem Begrüßungskomitee empfängt.«
»Dann glauben Sie, diese Frau könnte mir Schwierigkeiten bereiten?«
»Glauben?« Emily hob eine Braue. »Es würde einem Wunder gleichkommen, wenn sie es nicht zumindest versuchte. Nein, nein, das hat nicht mit Glauben zu tun. Sie können sich darauf verlassen, dass Geraldine Wood Himmel und Hölle in Bewegung setzen wird, um dafür zu sorgen, dass Ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als die Farm an sie zu verkaufen – und dass sie erst dann Ruhe geben wird, wenn sie ihr Ziel erreicht hat.«
Die beiden Hunde – einer schwarz-weiß, der andere lohfarben – jagten mit wehendem Fell über die Ebene. Die klugen, dunkelbraunen Augen der Tiere waren konzentriert auf die kleine Gruppe von Schafen gerichtet, die sich durch ein Loch im Zaun von der Herde entfernt hatte. Wie die Schneiden einer Schere näherten sie sich jetzt von beiden Seiten zugleich und zwangen die Ausreißer, sich genau in die Richtung zu bewegen, in der sie sie haben wollten: zurück durch das Loch im Zaun zur Herde.
»Nemesis! Abraxas!«
Ein lauter Pfiff hallte durch das Tal. Die Hunde brachen ihre Verfolgung auf der Stelle ab und kehrten zu ihrem Herrn zurück, der, sein Pferd am Zügel haltend, oben auf dem Hügel stand. Als sie ihn erreichten, tätschelte er ihnen die Köpfe.
»Gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die schadhafte Stelle im Zaun ausbessern, dann machen wir Schluss für heute.« Josh Wood zog sich den Akubra aus abgenutztem dunkelbraunem Leder, den er zum Schutz vor der Sonne trug, vom Kopf und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Dann saß er auf und trieb Rock, seinen Hengst, mit sanftem Druck an.
Als er das Loch im Zaun erreicht hatte, holte er sein Werkzeug aus der Satteltasche und fing mit der Arbeit an. Es war die Art von Tätigkeit, die auf jeder Schaffarm zum täglichen Brot gehörte. Irgendwo ging immer etwas kaputt und musste repariert werden. Und wer, wie Josh, hier geboren war, der konnte reiten und mit Hammer und Zange umgehen, noch ehe er in der Lage war, seinen Namen zu buchstabieren.
Er trieb gerade den letzten Nagel in das von Sonne und Wind ausgetrocknete Holz des Pfostens, als er das charakteristische Klopfen eines Dieselmotors vernahm. Und das Geräusch kam näher.
Josh strich sein dunkelblondes Haar zurück und beschattete seine Augen mit einer Hand, um besser sehen zu können. Er erkannte den Geländewagen von Thomas O’Leary, dem Chef der Feuerwehr von Aorakau Valley, der direkt auf ihn zuhielt.
Was O’Leary wohl wollte? Hoffentlich kam er nicht, um von einem weiteren Unglück zu berichten.
Mit einem einzigen Hieb versenkte Josh den Nagel, legte den Hammer zurück in die Satteltasche und trat auf den Wagen des Feuerwehrchefs zu, der inzwischen nur ein paar Meter von ihm entfernt angehalten hatte.
»Was gibt’s, Chief? Habt ihr den Brandstifter endlich geschnappt?«
Der ältere Mann stieg aus und schlug die Fahrertür hinter sich zu. Dann seufzte er. »Leider nein. Der Kerl ist ausgefuchster als ein verdammtes Possum, sage ich dir!« Er zuckte mit den Schultern. »Tja, und da sind wir auch schon beim Thema: Ich war gerade auf dem Weg zu der Brandruine bei den Carruthers, als ich dich hier herumwerkeln sah.« Er zog sich die Kappe mit dem aufgestickten Emblem der Feuerwehr von Aorakau vom Kopf und strich sich über den nahezu kahlen Schädel. »Ich weiß beim besten Willen nicht mehr weiter, Josh. Mindestens fünf Feuer in den vergangenen drei Monaten, und dieser Mistkerl hat nicht eine einzige verwertbare Spur hinterlassen. Die Leute vom Stadtrat und der Bürgermeister machen mir die Hölle heiß!«
»Wundert dich das?« Josh zuckte mit den Schultern. »Immerhin hat es, bevor diese Brandserie losging, schon seit einer Ewigkeit kein ernst zu nehmendes Feuer mehr in Aorakau Valley gegeben. Die Leute fürchten um ihre Existenz – und ich kann es ihnen nicht verübeln. Ich würde den Verbrecher auch lieber heute als morgen hinter Gittern sehen.«
»Meinst du denn, ich nicht?« O’Leary stöhnte. »Aber abgesehen von der Tatsache, dass der Typ immer denselben Brandbeschleuniger verwendet, können wir nicht einmal mit absoluter Sicherheit sagen, ob es sich wirklich um ein und denselben Täter handelt. Hast du keine Idee, wie man unserem Feuerteufel das Handwerk legen könnte? Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende, und der Sheriff ist auch keine große Hilfe.«
»Tut mir leid, Tom, aber da weiß ich auch keinen Rat«, sagte Josh und schwang sich mit einer geschmeidigen Bewegung in den Sattel. »Du meldest dich bei mir, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt? Du weißt ja, dass eine der abgebrannten Stallungen meiner Familie gehört und eine weitere einem unserer Pächter. Bisher hat es ja zum Glück bloß Sachschäden gegeben, und es ist noch kein Mensch verletzt worden. Aber wenn du meine Meinung hören willst, dann ist auch das letztendlich nur eine Frage der Zeit …«
Missbilligend runzelte Chief O’Leary die Stirn. Wie viele Menschen in Aorakau war auch er sehr abergläubisch. »Es bringt Unglück, so daherzureden! Wenn jetzt wirklich etwas passiert, dann wirst du dich ewig dafür verantwortlich fühlen.«
»Unsinn!«, entgegnete Josh. »Verantwortlich ist allein die Person, die die Brände legt – sonst niemand.« Er tippte sich an seinen Akubra, trieb sein Pferd an und bedeutete Nemesis und Abraxas mit einem schrillen Pfiff, ihm zu folgen.
Auf dem Weg zurück nach Emerald Downs, dem Farmhaus seiner Familie, dachte er darüber nach, ob Chief O’Leary nicht vielleicht doch recht hatte. Forderte er vielleicht mit seiner Angewohnheit, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen, das Schicksal heraus?
Früher war er nicht so gewesen, ganz im Gegenteil sogar. Er hatte zu den unverbesserlichen Optimisten gehört, jenen Menschen, die selbst der schlimmsten Situation immer noch etwas Positives abgewinnen konnten. Sein Bruder war derjenige von ihnen gewesen, der immer alles eine Ewigkeit weit vorausgeplant und sämtliche Risiken gegen den möglichen Nutzen abgewogen hatte. Doch seit Ronan nicht mehr da war …
Josh zwang sich, den Blick von dem kleinen umzäunten Grundstück fernzuhalten, auf dem sich der Familienfriedhof befand. Hier lagen Generationen von Woods begraben, darunter auch Joshs Groß- und Urgroßeltern.
Die meisten von ihnen waren alt geworden, einige, wie sein Großvater, weit über neunzig. Doch der Mann, der zuletzt hier zu Grabe getragen worden war, hatte das siebenunddreißigste Lebensjahr noch nicht vollendet gehabt, als er zu Tode kam.
Ronan.
Was hatten sie für Pläne gehabt, Ronan und er! Im Gegensatz zu seiner Mutter waren Josh und sein älterer Bruder sich darüber klar geworden, dass das wahre Potenzial Neuseelands nicht in der Schafzucht, sondern im Tourismus lag. Jahr für Jahr kamen mehr und mehr Menschen auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen von überall auf der Welt nach Neuseeland. Ronan und er waren sich einig gewesen, dass es ein schwerwiegender Fehler wäre, diese Chance nicht zu nutzen. Doch ihre Mutter ließ einfach alle Argumente unbeeindruckt von sich abprallen und weigerte sich, den Gedanken an Veränderungen auch nur in Betracht zu ziehen.
Trotzdem hatte Ronan nie aufgehört daran zu glauben, dass es ihnen irgendwann gelingen würde, ihren kühnen Plan in die Tat umzusetzen. Vielleicht war es Josh deshalb so wichtig, den gemeinsamen Traum zu verwirklichen. Er wusste es selbst nicht – fest stand nur, dass er sein Vorhaben, sehr zum Leidwesen seiner Mutter, niemals aufgeben würde.
Josh atmete tief durch. Er war seit dem Tag der Beisetzung nicht mehr auf dem Friedhof gewesen. Es schien fast, als sei dieses gerade einmal fünfzig mal fünfzig Yard große Areal von einer Bannmeile umgeben, die er nicht übertreten konnte.
Rasch schüttelte er den Gedanken an Ronan ab und trieb Rock zu größerer Eile an. Kurz darauf erreichte er sein Elternhaus.
Die Farm, die sich schon seit ewigen Zeiten im Besitz der Familie Wood befand, war im Laufe der Jahrzehnte immer wieder umgebaut worden. Zu einer besonderen Schönheit hatte dieser ständige Wandel allerdings nicht geführt; dem Haus war anzusehen, dass es seinem jeweiligen Besitzer vorrangig um eines gegangen war: zusätzlichen Platz zu schaffen. Ästhetische Gesichtspunkte waren da eher zweitrangig gewesen. Das ursprüngliche Haupthaus bestand aus einem einstöckigen Gebäude aus grauem Naturstein, dessen kleine Fenster nur wenig Sonnenlicht ins Innere fallen ließen. Einige Jahrzehnte später hatte die erste Erweiterung stattgefunden: Auf dem flachen Dach des Steinhauses war eine weitere Etage errichtet worden, dieses Mal in Holzbauweise. Kurz darauf waren noch zwei flache Anbauten hinzugekommen, die sich in ihrer Architektur erneut von den bisherigen Gebäudeteilen unterschieden.
Josh schwang sich vom Sattel und führte Rock zum Stall, wo er von Danny, dem Sohn seines Vorarbeiters, in Empfang genommen wurde. Der Junge war für die Pflege der Pferde und Hunde verantwortlich.
Danny war ungewöhnlich nervös. »Mr. Josh, wo haben Sie so lange gesteckt? Das Abendessen wurde schon vor einer halben Stunde aufgetragen, und Mrs. Geraldine hat schon dreimal nach Ihnen gefragt!«
Ach, daher weht der Wind! Josh unterdrückte ein Schmunzeln. Armer Danny! »Sie ist dir ganz schön auf die Pelle gerückt, wie?« Unbehaglich blickte Danny zu Boden und trat von einem Fuß auf den anderen. Aufmunternd klopfte Josh ihm auf die Schulter. »Mach dir nichts draus, Kumpel. Meine Mutter hat mit ihrer überaus charmanten Natur bisher noch jeden Mann in die Knie gezwungen.« Er zwinkerte ihm verschwörerisch zu. »Ich geh dann mal, bevor der alte Drache noch anfängt, Feuer zu spucken …«
Mit großen Schritten eilte er auf das Farmhaus zu. Absichtlich verzichtete er darauf, zuerst nach oben zu gehen und sich umzuziehen, gerade weil er wusste, wie viel Wert seine Mutter darauf legte, dass sie alle bei Tisch standesgemäß gekleidet waren. Er zog sich also nur den Hut vom Kopf und klopfte sich den Staub von den dunkelblauen Jeans, ehe er ins Esszimmer trat, wo ihm gleich die Stimme seiner Mutter entgegenschlug.
»… ist wirklich eine bodenlose Frechheit! So kann man mit uns doch nicht umgehen!«
»Ist die Rede etwa von mir?«, fragte er mit einem liebenswürdigen Lächeln und blickte in die Runde.
Wie jeden Abend war die ganze Familie einträchtig am Tisch versammelt – wobei von Eintracht im Grunde keine Rede sein konnte. Joshs Mutter Geraldine besetzte den Platz am Kopf der Tafel, der normalerweise für den Hausherrn reserviert war. Doch gewissermaßen war sie das auch. Ihr Mann Nathan – Joshs Vater –, der zu ihrer Linken saß, hatte, was die Angelegenheiten der Farm oder der Familie betraf, kaum etwas zu melden.
Der Stuhl zu ihrer Rechten wurde, wie so oft, von Preston Davies besetzt. Geraldines Anwalt und engster Vertrauter war so etwas wie ein Dauergast im Hause Wood. Insgeheim wurde im Ort gemunkelt, dass die Beziehung zwischen Davies und Geraldine noch viel tiefer ging. Sehr viel tiefer.
Josh glaubte nicht daran. Seine Mutter war keine sehr leidenschaftliche Person – zumindest nicht auf zwischenmenschlicher Ebene. Selbst ihren Ehemann hatte sie, wie Josh vermutete, nach rein praktischen Gesichtspunkten ausgewählt. Nathan Debbenham-Wood war ein einfacher Charakter, leicht zu lenken und zu beeinflussen. Dass zwischen seinen Eltern jemals so etwas wie die große Liebe existiert hatte, wagte Josh zu bezweifeln.
Ein wenig unangenehm fühlte Josh sich daran erinnert, dass auch er keineswegs aufgrund großer Gefühle seit etwas mehr als drei Jahren mit Helen Beauchamp-Smith zusammen war, der Tochter von Bürgermeister Robert Smith.
Es war eine zweckmäßige Verbindung. Sie beide wussten, dass das zwischen ihnen nicht die große Liebe war, doch jeder profitierte auf seine Weise von dieser Beziehung: Seine Mutter ließ ihn mit ihren ständigen Verkupplungsversuchen in Ruhe, hatte sie doch in Helen – attraktiv, gebildet und wohlerzogen – ihre Traumschwiegertochter gefunden. Und auch Helens Vater war zufrieden. Eine bessere Partie als Josh konnte sich der Bürgermeister für seine Tochter kaum wünschen.
Dass sie keineswegs vorhatten, eines Tages miteinander in den Hafen der Ehe einzulaufen, ahnte dabei natürlich außer ihnen niemand.
Alles war also ganz wunderbar – oder? Josh seufzte. Wenn dem doch nur so wäre! Aber aus irgendeinem Grund fühlte er sich, obwohl er eigentlich wusste, dass er das perfekte Arrangement gefunden hatte, schon seit einer geraumen Weile nicht mehr richtig wohl. Etwas fehlte – nur was?
Direkt neben Preston Davies saßen Joshs zwei Jahre ältere Schwester Margaret, die von allen außer Geraldine nur Maggie gerufen wurde, und ihr Mann Rory Bodeyn. Maggie hatte nicht das Glück, die kühlen, aristokratisch wirkenden Züge ihrer Mutter geerbt zu haben. Sie schlug nach der Familie ihres Vaters, mit ihren wässrig-blauen Augen, dem glanzlosen mausbraunen Haar und dem schmalen Gesicht, in dem die prominente Debbenham-Nase nur noch auffälliger wirkte. Doch ihre Klugheit, ihr Sinn für Ironie und schwarzen Humor und nicht zuletzt ihre Liebenswürdigkeit machten ihre äußerliche Reizlosigkeit in Joshs Augen mehr als wett.
Von all den Menschen, die an diesem Tisch zusammen saßen, war Maggie ihm die Liebste.
»Nein, ausnahmsweise dreht sich einmal nicht alles um dich, Joshua«, entgegnete Joshs Mutter kühl, und ihre Miene verfinsterte sich, als sie den unpassenden Aufzug ihres Sohnes bemerkte. »Wir sprachen gerade über die Makepeace-Farm. Wenn du dich auch nur ein Stück weit für die Belange der Familie interessieren würdest, wüsstest du, was dieses Stück Land für uns bedeutet.«
Josh ging, ohne mit der Wimper zu zucken, über den Seitenhieb seiner Mutter hinweg. Ihrer Meinung nach verschwendete er nur seine Zeit, in dem er Tätigkeiten verrichtete, die auch jeder x-beliebige Hilfsarbeiter erledigen konnte. Vor Ronans Tod hatte es sie nicht sonderlich interessiert, doch jetzt, wo Josh ihr einziger Sohn und somit Erbe von Emerald Downs sein würde, war alles anders.
»Es mag dich vielleicht überraschen, Mutter, aber ich bin mir sehr wohl im Klaren darüber, was der Tod von Ben Makepeace für uns bedeuten könnte«, entgegnete er nüchtern. »Seit Jahren nutzen wir nun schon die Wasserstelle auf seinem Grundstück, um unser Vieh zu tränken. Das war kein Problem, solange er am Leben war und die Jenkins als seine Pächter uns keine Schwierigkeiten machten. Aber wenn Bens Erbe sich entschließen sollte zu verkaufen …«
»Erbin«, korrigierte Maggie. »Seine Enkelin hat die Farm und das Land geerbt. Ihr Name ist Shelly Makepeace.«
»Ob Frau oder Mann ist doch vollkommen irrelevant«, ergriff Geraldine erneut das Wort. Ihre gewittergrauen Augen blitzten zornig. Josh konnte sich nicht erinnern, sie je anders gesehen zu haben als jetzt: in einem schmal geschnittenen Kleid aus dunklem Stoff, das ihre schlanke Silhouette betonte, das schwarze, von grauen Strähnen durchzogene Haar, straff am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengefasst. »Preston hat in meinem Auftrag bereits vor Wochen ein überaus großzügiges Kaufangebot nach Kalifornien entsendet. Doch bisher hat diese unverschämte Person auf keine unserer Nachfragen reagiert!«
Josh konnte durchaus nachvollziehen, warum seine Mutter sich so aufregte. Wasser war überlebenswichtig für jeden Schaffarmer. Wer nicht in der Lage war, seine Tiere zu tränken, konnte über noch so viel Land verfügen, es würde ihm nicht viel bringen. Umso wichtiger war das Grundstück des verstorbenen Ben Makepeace, das direkt an die riesigen Wood-Ländereien grenzte und über einen kleinen Süßwassersee verfügte, der vom Silver Creek gespeist wurde.
»Meiner Meinung nach solltet ihr unter diesen Umständen erst recht darüber nachdenken, ob die Zukunft unserer Familie wirklich in der Schafzucht …«
»Genug!« Wütend ließ Geraldine die flache Hand auf den Tisch niedersausen, sodass Teller, Gläser und Besteck klirrten. Im Esszimmer war es jetzt so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. »Ich habe es schon Ronan erklärt, und meine Meinung hat sich in der Zwischenzeit nicht geändert: Wir verdienen unseren Lebensunterhalt seit Generationen mit der Schafzucht, und daran wird sich auch nichts ändern – jedenfalls nicht, solange ich hier etwas zu sagen habe! Es wird keine Ferienhütten geben, Joshua. Nicht auf Wood-Land!«
Zuerst wollte Josh protestieren, doch dann fiel ihm auf, dass sie ihm dieses Mal mit ihren Worten unbeabsichtigt eine goldene Brücke gebaut hatte.
»Du sagst also, dass du nicht damit einverstanden bist, dass Ferienhütten auf unserem Land entstehen, richtig?« Er machte eine kurze, bedeutungsvolle Pause. »Aber was wäre, wenn es mir gelänge, die Farm des alten Ben für uns zu gewinnen? Würdest du mir erlauben, dass ich mein Vorhaben auf Makepeace-Land realisiere?«
»Gut pariert!«, warf Maggie lächelnd ein. Sie hatte schon vor allen anderen begriffen, worauf ihr Bruder hinauswollte.
Auch Geraldine wirkte widerwillig beeindruckt. Schließlich zuckte sie mit den Schultern. »Nun, wenn es dir wirklich gelänge, die Wasserstelle für uns zu sichern …«
»Ja?«
Sie machte eine alles umfassende Handbewegung. »Dann kannst du mit dem Rest des Landes machen, was immer du willst.«
Ja! Josh unterdrückte einen triumphierenden Aufschrei.
»Aber ich warne dich«, fuhr seine Mutter fort und hob drohend den Zeigefinger. »Unsere Abmachung gilt, wenn du es schaffst, mir einen hieb- und stichfesten Kaufvertrag mit einem realistischen Preis für die Makepeace-Farm vorzulegen. Sollten Preston oder ich dir zuvorkommen …«
»… dann ist unsere Vereinbarung hinfällig«, vollendete Josh den Satz für sie. Er rückte seinen Stuhl zurück und erhob sich. »Ihr entschuldigt mich? Ich habe sowieso keinen Hunger und möchte noch eine kurze Kontrollrunde machen. Seit dieser Brandstifter in der Gegend sein Unwesen treibt, kann ich einfach besser schlafen, wenn ich noch einmal nach dem Rechten gesehen habe.«
»Viel Glück bei deinen Plänen«, rief Maggie ihm nach, als er das Esszimmer verließ.
Die scharfe Zurechtweisung ihrer Mutter wurde vom Zufallen der Tür verschluckt.
»Ich schlafe doch nicht mit meinem kleinen Bruder in einem Zimmer!« Energisch schüttelte Kim den Kopf. »Das kannst du vergessen, Mom!«
Es war schon recht spät am Abend, und der Mond tauchte das weite Land rund um die Makepeace-Farm in silbriges Licht. Shelly fühlte sich schrecklich erschöpft. Im Gegensatz zu den Kindern, denen immerhin eine kurze Verschnaufpause auf der Couch vergönnt gewesen war, hatte sie den Nachmittag und frühen Abend damit verbracht, gemeinsam mit Emily einige der unbenutzten Zimmer im Obergeschoss des Hauses herzurichten, sodass sie alle einen Platz zum Schlafen haben würden.
Jetzt saß sie nach dem Abendessen mit Emily und den Kindern an dem riesigen Esstisch in der Küche und fühlte sich so müde und zerschlagen wie selten zuvor in ihrem Leben.
Umso weniger stand ihr der Sinn nach einer erneuten Auseinandersetzung mit Kim. Sie wusste ganz einfach nicht, woher sie die Kraft nehmen sollte, ihrer Tochter in ihrem augenblicklichen Zustand die Stirn zu bieten.
»Bitte, Kim, es ist doch nur für ein paar Nächte, bis …«
»Niemals!«, wetterte Kim, strich sich das schwarz gefärbte Haar aus den Augen und verschränkte die Arme vor der Brust. »Du hast dir das alles hier ausgedacht, Mom! Es war deine Idee, Will und mich aus unserer gewohnten Umgebung zu reißen und uns in dieses gottverlassene Kaff in Neuseeland zu verfrachten! Du hast uns unsere Freunde weggenommen! Und Dad sitzt im Gefängnis, und wir können ihn nicht einmal besuchen! Ich sehe nicht ein, dass wir jetzt noch weiter zurückstecken sollen!«
»Halt mich da raus«, begehrte Will auf. »Ich …«
»Klappe, Vollidiot!«
»Ruhe!« Shelly sprang so abrupt von ihrem Stuhl auf, dass dieser nach hinten umkippte und mit einem lauten Knall auf dem Boden landete. »So, meine Herrschaften«, sagte sie, als Kim und Will sie erschrocken anschauten. »Ich schlage vor, dass ihr jetzt nach oben auf eure Zimmer geht. Kim, wenn du nichts dagegen hast, die Nacht inmitten von Staub und Spinnweben zu verbringen: Der Raum links am Ende des Korridors ist deiner.«
Ohne ein weiteres Wort stand Kim auf und verließ die Küche. Kurz darauf konnte man die Sohlen ihrer lilafarbenen Doc Martens auf der Treppe hören. Dann knallte oben eine Tür.
Will erhob sich ebenfalls. »Nacht, Mom«, sagte er. »Nacht, Emily.«
Als er fort war, setzte Shelly sich wieder, stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und barg das Gesicht in den Händen. Ohne dass sie etwas dagegen tun konnte, schossen ihr Tränen in die Augen.
Sie wollte doch nicht weinen! Sie wollte stark sein! Stark für ihre Kinder und für sich selbst. Doch im Moment fühlte sie sich einfach nur wie ein kleines Häuflein Elend.
»Lassen Sie es ruhig raus.« Emily war aufgestanden und legte Shelly jetzt tröstend eine Hand auf die bebende Schulter. »Ich kann mir vorstellen, dass das alles sehr schwer ist für Sie, Shelly. Aber vergessen Sie nicht: Für Ihre Kinder ist es auch nicht leicht.«
»Ach, das weiß ich doch!«, stieß Shelly schluchzend hervor. »Und ich wünschte wirklich, ich wäre nicht gezwungen gewesen, diesen Schritt zu gehen. Aber ich hatte einfach keine andere Wahl!«
»So ist es im Leben halt manchmal – man kann sich nicht immer aussuchen, wohin einen die Reise führt. Glauben Sie mir: Ihre Familie hätte sich damals auch nie träumen lassen, Neuseeland einmal verlassen zu müssen. Auch sie waren gezwungen, eine schwere Entscheidung treffen, die ihr ganzes Leben beeinflusst hat. Und, was denken Sie? War es, rückblickend betrachtet, falsch, nach Kalifornien zu gehen, um dort ein neues Leben anzufangen?«
Shelly wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. Dabei dachte sie über die Worte der älteren Frau nach und erwiderte schließlich: »Zwei Jahre nach seiner Ankunft in Los Angeles ist mein Großvater meiner Großmutter Rose zum ersten Mal begegnet. Wäre er nicht zusammen mit seiner Familie in die Staaten ausgewandert, dann hätte er sie womöglich niemals kennengelernt. Mein Vater wäre nicht geboren worden und …« Als ihr die Tragweite dieses Gedankens klar wurde, stockte sie.
»Es würde vermutlich weder Sie noch Kim und Will geben«, führte Emily den Satz für sie zu Ende. Sie lächelte. »Verstehen Sie mich nicht falsch, Shelly. Ich kenne Ihre Beweggründe nicht, daher will ich mir nicht anmaßen zu beurteilen, ob Ihre Entscheidung richtig oder falsch gewesen ist. Sie sollen nur eines begreifen: Wenn das Leben eine Tür für Sie zuschlägt, wird es irgendwo anders eine neue für Sie öffnen. Seien Sie mutig und gehen Sie hindurch. Wer weiß, vielleicht erkennen Sie schon bald, dass es das Beste ist, was Ihnen überhaupt passieren konnte.«
Nun lächelte auch Shelly wieder. Sie blinzelte die letzten Tränen weg. »Danke«, sagte sie, und es kam aus tiefstem Herzen. »Vielen Dank, Emily.«
»Das kann sie doch nicht einfach machen!« In einer hilflosen, frustrierten Geste stampfte Kimberly mit dem Fuß auf. »Sie behandelt mich ja wie ein kleines Kind! Aber sie wird schon sehen, was sie davon hat. Ich lasse mir das jedenfalls nicht gefallen! Ich hau von hier ab, sobald sich die erste Gelegenheit bietet, das sag ich dir!«
»Du spinnst!« Will, der auf seinem Bett saß, blickte von seinem Buch über die Geschichte der Feuerwehr auf. »Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Mom dich einfach so gehen lässt. Und selbst wenn … Wo willst du denn hin?«
Lässig zuckte Kim mit den Schultern. Sie hockte mit angezogenen Knien seitlich auf dem Fensterbrett. »Ich könnte bei Dad wohnen«, sagte sie. »Jetzt, wo er im Knast sitzt, braucht er seine Wohnung doch eh nicht.«
»Sei nicht blöd, Kim. Was glaubst du, wie lange er die Miete aus dem Gefängnis heraus zahlen kann?«
»Na, dann werde ich eben bei einem meiner Freunde unterkriechen. Wer weiß, vielleicht lässt mich ja sogar Zack bei sich wohnen.«