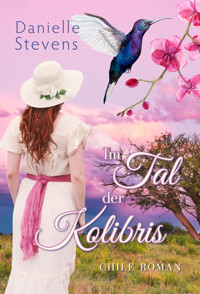4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Abenteuer und Intrigen: Der große Sommerroman von Danielle Stevens!
Trauernd reist Lena nach dem Tod ihres Verlobten nach Sansibar – in das Land, in dem die Nelkenbäume blühen. Auf der Gewürzplantage der Bennetts will sie Andys Werk beenden und dessen Familiengeschichte aufschreiben. Doch dann droht der britische Geschäftsmann Stephen Alistair den Ort, an dem alles begann, mit dem Bau eines Luxushotels zu zerstören. Das darf sie nicht zulassen! Um das Andenken der Bennetts zu bewahren, setzt sie alles daran, die Plantage zu retten, und facht unwissend eine alte Fehde an. Bald stellt Lena fest, dass ausgerechnet in der finsteren Vergangenheit der Schlüssel zu einer glücklichen Zukunft für sie zu liegen scheint …
Neuauflage. Erstmals erschienen bei Mira Taschenbuch, Hamburg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Danielle Stevens
Wo die Nelkenbäume blühen
Sansibar-Roman
Inhaltsverzeichnis
Wo die Nelkenbäume blühen
Impressum
Das Buch
Prolog
ERSTER TEIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ZWEITER TEIL
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DRITTER TEIL
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Epilog
Das Haus über den Klippen
Das Geheimnis der Maori-Frau
Im Tal der Kolibris
Leseprobe »Das Haus über den Klippen«
Leseprobe »Das Geheimnis der Maori-Frau«
Impressum
Copyright © 2020 Danielle Stevens
Copyright Originalausgabe © 2012 Mira Taschenbuch, Hamburg
Covergestaltung: Daniela Krüger
Bildmaterialien: Andy Troy/Shutterstock;
Alexander Lukatskiy/Shutterstock; Astro Ann/Shutterstock
Danielle Stevens
c/o Werneburg Internet Marketing und Publikations-Service
Philipp-Kühner-Straße 2
99817 Eisenach
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne Zustimmung der Autoren kopiert, nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden. Sämtliche Übersetzungsrechte vorbehalten. Dieses Buch ist ein fiktives Werk. Namen, Figuren, Unternehmen, Orte werden fiktiv verwendet. Markennamen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum der rechtmäßigen Inhaber. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Das Buch
Liebe, Abenteuer und Intrigen: Der große Sommerroman von Danielle Stevens!
Trauernd reist Lena nach dem Tod ihres Verlobten nach Sansibar – in das Land, in dem die Nelkenbäume blühen. Auf der Gewürzplantage der Bennetts will sie Andys Werk beenden und dessen Familiengeschichte aufschreiben. Doch dann droht der britische Geschäftsmann Stephen Alistair den Ort, an dem alles begann, mit dem Bau eines Luxushotels zu zerstören. Das darf sie nicht zulassen! Um das Andenken der Bennetts zu bewahren, setzt sie alles daran, die Plantage zu retten, und facht unwissend eine alte Fehde an. Bald stellt Lena fest, dass ausgerechnet in der finsteren Vergangenheit der Schlüssel zu einer glücklichen Zukunft für sie zu liegen scheint …
Neuauflage. Erstmals erschienen bei Mira Taschenbuch, Hamburg.
Prolog
Indischer Ozean, Juli 1887
Wie ein Pfeil schoss der Rumpf des Dampfseglers Fortuna über den Wellenkamm hinweg. Einen Augenblick lang hing er scheinbar schwerelos in der Luft, ehe er sich schließlich absenkte und, von aufspritzender Gischt begleitet, ins Wasser eintauchte. Als der Ruf: »Land in Sicht!« erklang, kamen die meisten Passagiere an Deck und drängten sich an die Reling. Jeder wollte als Erster einen Blick auf die Insel werfen, die für die meisten von ihnen das Land ihrer Träume darstellte. Doch anstatt sie zu sehen, nahmen sie zunächst einmal den charakteristischen Geruch wahr, der Sansibar schon aus vielen Kilometern Entfernung ankündigte – den schweren aromatischen Duft der Gewürznelken.
»Schau nur, Papa!«, rief ein kleines Mädchen, das von seinem Vater auf dem Arm gehalten wurde, sodass es über alle Köpfe hinwegblicken konnte, entzückt. Es deutete auf die Küstenlinie Sansibars, die verschwommen im dunstigen Morgenlicht in Sicht kam. Sein hübsches Gesicht war vor Aufregung gerötet. »Das Paradies!«
Nach und nach schälte sich die Insel aus dem saphirblauen indischen Ozean. Blütenweißer Sandstrand, sanft gewellte Hügel und hoch gewachsene Kokospalmen – ein Bild wie aus einem Traum. Begeisterung und Vorfreude ließ die Augen der Menschen erstrahlen. Die Strapazen der langen Reise waren vergessen. Sie lachten und tuschelten. Frauen umarmten sich, Männer klopften sich gegenseitig auf die Schultern. Ihre Kinder, vom Fieber der Erwartung ergriffen, hielten sich an den Händen und tanzten Ringelreihen. Ein jeder wurde von der ausgelassenen Stimmung an Bord der Fortuna angesteckt. Sogar die Lippen des ersten Maats, dessen Miene üblicherweise mürrisch und verschlossen war, umspielte der Anflug eines Lächelns.
Nur auf eine Person – eine junge Frau, die sich ein wenig abseits des Trubels hielt – schien der Enthusiasmus der Reisenden nicht abzufärben.
Reglos stand sie da. Die graublauen Augen blickten scheinbar ins Leere, doch in Wahrheit nahmen sie alles auf, was sich um sie herum abspielte. Mit einer unbewussten Handbewegung strich sie sich eine Strähne ihres honigblonden Haares, die sich aus ihrem Flechtzopf gelöst hatte, zurück hinters Ohr. Sie schloss die Augen. Was würde die Zukunft ihr bringen? Erwartete sie am Ende ihrer Reise das Land ihrer Träume? Oder würde Sansibar für sie die Insel der Enttäuschungen werden?
Was auch immer zutreffen mochte – die Antwort auf diese Frage lag nur noch wenige Seemeilen entfernt …
ERSTER TEIL
1.
Gegenwart
Lena Bluhm hatte die Augen fest geschlossen, als die winzige Propellermaschine auf die Landebahn aufsetzte. Solange sie zurückdenken konnte, litt sie unter Flugangst. Doch so schlimm wie dieses Mal war es lange nicht mehr gewesen.
Jedes Jahr steigen mehr als vier Milliarden Menschen in ein Flugzeug, Lena! Und die weitaus meisten von ihnen kommen heil ans Ziel.
Sie hielt den Atem an, als der Pilot so scharf bremste, dass Lena in ihren Sicherheitsgurt gepresst wurde. Ihre Finger krallten sich in den Kunstlederbezug der Armlehnen. Ihr stand der kalte Schweiß auf der Stirn. Es beruhigte sie keineswegs, dass der Boden sie nun zurückhatte. Immer und immer wieder gingen ihr die Worte des Selbsthilfebuches durch den Kopf, das sie anlässlich ihres ersten Englandurlaubs von Andy geschenkt bekommen hatte. Diemeisten Flugzeugunglücke geschehen entweder beim Start oder bei der Landung.
Für einen winzigen Augenblick ließ der Gedanke an Andy sie alles andere vergessen – sogar ihre Angst. Doch der Moment währte nur so lange, bis sie die Augen öffnete und durch das Fenster das Flughafengelände an sich vorüberrasen sah. Sofort kniff sie die Lider wieder zu und hielt den Atem an. Und sie entspannte sich erst, als die Maschine ausrollte und schließlich zum Stehen kam.
»Jetzt haben Sie’s geschafft, min Deern«, sagte sie silberhaarige Dame, die neben Lena saß und deren Dialekt sie als alteingesessene Hamburgerin auswies. Sie lächelte aufmunternd. »Wissen Sie, ich reise seit mehr als zwei Jahren quer durch die Weltgeschichte. Mein Heinz-Georg, Gott hab ihn selig, hat mir auf dem Sterbebett das Versprechen abgenommen, all die Orte zu besuchen, die wir uns immer schon gemeinsam ansehen wollten. Inzwischen kann ich kaum noch zählen, in wie vielen Flugzeugen ich gesessen habe – und es ist nie auch nur das Geringste passiert.« Freundlich tätschelte sie Lenas Hand. »Fliegen ist viel ungefährlicher als Autofahren, glauben Sie’s mir ruhig.«
Höflich erwiderte Lena das Lächeln der Frau. »Ich weiß«, sagte sie. »Dummerweise hilft mir dieses Wissen aber nicht dabei, meine Angst in den Griff zu bekommen.«
Echte Erleichterung verspürte sie dann auch erst, als der Pilot über Bordfunk verkündete, dass die Maschine die endgültige Parkposition erreicht habe und man nun bereit für den Ausstieg sei.
Keine fünf Minuten später setzte Lena zum ersten Mal in ihrem Leben einen Fuß auf sansibarischen Boden. Feuchtheiße tropische Luft, der ein schwerer, würziger Duft anhaftete, schlug ihr entgegen.
»Gewürznelken«, erklärte Lenas Sitznachbarin, die gleich hinter ihr das Flugzeug verlassen hatte. »Ihr Anbau mag heutzutage nicht mehr die größte Einnahmequelle der Menschen hier sein, doch der Stellenwert der Gewürzproduktion ist noch immer sehr hoch.«
Lena nickte. Ihr war nicht nach einem Vortrag über die Wirtschaft Sansibars zumute. Ihr gingen ganz andere Dinge im Kopf herum. Allem voran die Frage, ob ihr das, weswegen sie hergekommen war, tatsächlich gelingen konnte.
Ob sie das Buch zu Ende zu bringen vermochte …
Leise seufzend fuhr sie sich mit dem Handrücken über die noch immer feuchte Stirn. Vielleicht hatte Patrick von Anfang an recht gehabt, und sie ließ sich völlig umsonst auf dieses irrwitzige Abenteuer ein. Immerhin war er ihr bester Freund und meinte es sicher nur gut, wenn er sie vor den Gefahren und Enttäuschungen warnte, die diese Reise möglicherweise für sie bereithielt. Doch seltsamerweise hatten seine Worte genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er sich erhofft hatte. Bestärkt in dem Wunsch, sich auf Spurensuche zu begeben, hatte Lena kurzentschlossen sogleich einen Flug nach Sansibar gebucht. Nur hier hatte sie eine Chance, auch die andere Seite von Andy kennenzulernen. Den Teil von ihm, den sie nur aus seinen Erzählungen kannte und der so wichtig war, um zu Ende zu führen, was Andy einst begonnen hatte.
Andy …
Es war das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass er sich in ihre Gedanken schlich, doch der Schmerz traf sie immer wieder vollkommen unvorbereitet. Trotz der tropischen Temperaturen wurde ihr für einen Moment eiskalt. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, und ihr Magen zog sich schmerzhaft zusammen.
Er ist tot, du nicht – lerne endlich, damit zu leben!
Doch wie sollte das gehen? Andy Bennett war ihre große Liebe gewesen. Und nichts und niemand auf der Welt konnte die Lücke schließen, die er in ihrem Herzen hinterlassen hatte.
Nur quälend langsam bewegte sich die Schlange, die sich vor der Einreisekontrolle im Flughafengebäude gebildet hatte, vorwärts. In der vergangenen halben Stunde waren noch zwei weitere Maschinen gelandet, und es gab insgesamt nur vier Schalter, von denen zwei geschlossen waren. Zeit genug für Lena, weiter ihren Gedanken nachzuhängen.
Andy und sie hatten in einer gemütlichen Altbauwohnung im Hinterhaus eines Wohnhauses in Berlin-Mitte gewohnt. Vom Schlafzimmer aus blickte man auf die üppige Krone einer Linde, deren Zweige fast bis zum Fenster reichten. Im Sommer hatte Lena früher gern am offenen Fenster gesessen und den Geräuschen des Lebens, wie sie es nannte, gelauscht. Dem Lachen der Kinder, die unten im Hof miteinander herumtollten, den ersten Fortschritten der jungen Klavierschülerin aus dem dritten Stock, den lautstarken Streits und kaum weniger lautstarken Versöhnungen des Pärchens zwei Etagen unter ihr. Doch seit Andy fort war …
Erneut musste sie ihre Gedanken von ihm weglenken, als sie spürte, wie das inzwischen so bekannte Gefühl von Lähmung von ihr Besitz ergriff. Nein!, rief sie sich innerlich zur Ordnung. Du hast dich jetzt lange genug einfach nur treiben lassen. Fang endlich an, dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen!
Leichter gesagt als getan.
Sie erreichte den Schalter der Passkontrolle und gab ihre Ausweispapiere ab. Der dunkelhäutige Mann warf nur einen flüchtigen Blick darauf, ehe er zu ihr aufblickte und ihr ein strahlendes Lächeln schenkte. »Karibu Zanzibar – Willkommen auf Sansibar!«
Suchend blickte sie sich nach jemandem um, der sich für ihren Impfpass interessierte. In jedem Reiseführer und auch im Internet hatte sie immer wieder den Hinweis gefunden, dass in Tansania und speziell auf Sansibar der Impfpass eines jeden Einreisenden akribisch überprüft wurde. Doch niemand sprach sie darauf an, und so machte sie sich schließlich schulterzuckend auf den Weg zur Gepäckausgabe.
Etwa eine halbe Stunde später bahnte Lena sich, ihren Trolley hinter sich herziehend und die schwere Handtasche über der Schulter, einen Weg durch das Gedränge in der Ankunftshalle des Kisauni Airport. Immer wieder drängten sich dunkelhäutige Männer um sie herum und boten ihr auf Englisch mit melodiösem afrikanischem Akzent ihre Hilfe an – gegen Gebühr, selbstverständlich. Ihr kam es vor wie ein Spießrutenlauf, und so war sie froh, als sie endlich ins Freie trat.
Suchend blickte sie sich nach einem Taxi um. Doch das einzige, das sie entdecken konnte, wurde gerade von der alten Dame aus Hamburg herangewinkt. Lena schluckte einen Fluch herunter und fing an zu laufen. Vielleicht war es ja möglich, sich das Taxi zu teilen.
Sie hatte das Fahrzeug fast erreicht, als es plötzlich Fahrt aufnahm und sich in den fließenden Verkehr einfädelte. Aufstöhnend stellte Lena ihre schwere Tasche auf dem Gehweg ab. Das fing ja wirklich gut an!
Sie zückte ihr Handy und schaltete es ein. Warum, das wusste sie selbst nicht so genau. Nicht, dass sie einen Anruf erwartete. Von wem auch? Patrick hatte sie vor etwas mehr als zehn Stunden zum Flughafen Tegel gebracht, und außer zu ihm pflegte sie seit Andys Tod zu niemandem mehr engeren Kontakt.
Auf dem Display erschien ein Bild von Andy und ihr, wie sie glücklich in die Kamera strahlten. Das Foto war bei ihrem letzten gemeinsamen Urlaub vor zwei Jahren in Irland aufgenommen worden. Wie immer, wenn sie es sah, zog sich ihr schmerzhaft das Herz zusammen. Dennoch brachte sie es nicht über sich, das Hintergrundbild zu ändern. Allein der Gedanke erschien ihr wie ein kleiner Verrat an Andy.
Ein Popup öffnete sich und verkündete, dass irgendjemand insgesamt gut ein Dutzend Mal angerufen hatte, seit sie in Berlin in den Flieger gestiegen war. Gerade als sie nachsehen wollte, wer sie da so hartnäckig zu erreichen versuchte, ging wieder ein Anruf ein.
»Ja?«
»Lena? Alles okay bei dir? Du klingst ein bisschen gestresst.«
Als sie Patricks Stimme hörte, atmete sie tief aus. »Ich habe zehn Stunden Flug hinter mir, es ist furchtbar heiß und stickig, und zu allem Überfluss ist mir soeben das einzige Taxi weit und breit vor der Nase weggefahren – was erwartest du also?« Die Worte waren ihr kaum über die Lippen, als sie ihren Ausbruch auch schon wieder bereute. »Hör zu, es tut mir leid. Ich finde es ja lieb von dir, dass du so besorgt um mich bist, aber das ist wirklich nicht nötig. Ich komme schon zurecht. Wirklich.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung, dann räusperte Patrick sich. »Natürlich«, sagte er, doch sie kannte ihn lange genug, um an seinem Tonfall zu erkennen, dass er eingeschnappt war. »Du musst selbst wissen, was du tust. Aber ich stehe auch dazu, dass ich diese ganze überstürzte Aktion, einfach deine Koffer zu packen und nach Sansibar zu fliegen, für einen Fehler halte. Ich kann deine Beweggründe ja verstehen, aber du hättest dich wenigstens von zu Hause aus vorbereiten können.«
Lena unterdrückte ein Seufzen. Sie hatten diese Diskussion in den vergangenen zehn Tagen immer wieder geführt – stets mit dem Ergebnis, dass sie beide auf ihrem jeweiligen Standpunkt beharrten. Ihr stand wirklich nicht der Sinn danach, ausgerechnet jetzt noch einmal über dieses Thema zu debattieren.
»Patrick, ich weiß, du meinst es nur gut, aber …« Nun entfuhr ihr doch ein Seufzen. »Wir unterhalten uns später, okay? Ich melde mich bei dir. Pass auf dich auf, ja? Bis bald.«
Sie beendete das Gespräch, ohne ihn noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Nicht dass sie Patricks Sorge nicht zu schätzen wusste. Er war Andys Agent und sein bester Freund gewesen, und als sie in Andys Leben getreten war, hatte er sie ohne zu zögern in den Kreis ihrer Freundschaft mit aufgenommen. Zudem war er ihr gerade in den letzten schweren Monaten eine unschätzbare Stütze gewesen. Doch bei dem, was ihr nun bevorstand, konnte er ihr nicht helfen. Sie musste lernen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und auf eigenen Beinen zu stehen.
Sie war so in Gedanken versunken, dass sie das Taxi, das vor ihr am Straßenrand hielt, zuerst gar nicht bemerkte. Als sie es schließlich doch wahrnahm, drängte sich gerade ein Mann an ihr vorbei und öffnete die Tür auf der Beifahrerseite, um einzusteigen.
»Hey!«, rief sie empört. »Hey, Sie da, das ist mein Taxi!«
Der Mann drehte sich zu ihr um, und für einen Moment stockte Lena der Atem. Was für unglaubliche Augen! Graublau mit goldenen Sprenkeln darin, wie der Himmel über Berlin an einem trüben Tag, wenn gerade die Sonne durch die Wolkendecke bricht; umrahmt von einem Kranz erstaunlich dichter dunkler Wimpern.
Lena blinzelte heftig, um das seltsame Gefühl abzuschütteln, das von ihr Besitz ergriffen hatte. Doch sie erreichte lediglich, dass sie auch den Rest ihres Gegenübers bemerkte, der kaum weniger eindrucksvoll war.
Schwarzbraunes, welliges Haar umrahmte ein eher blasses, scharf geschnittenes Gesicht mit ausgeprägten Wangenknochen und kantigem Kinn. Der Mann trug einen leichten, anthrazitfarbenen Anzug, der die Farbe seiner Augen noch betonte und der definitiv nicht von der Stange stammte. Die Hitze schien ihm nicht das Geringste auszumachen, denn Lena konnte auf seiner Stirn nicht die kleinste Schweißperle entdecken.
Er hob eine Braue, was seiner Miene eine gewisse Arroganz verlieh. »Entschuldigung – wie bitte?«, fragte er auf Englisch.
»Oh.« Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie in ihrer Aufregung ganz automatisch Deutsch gesprochen hatte. Sofort wechselte sie ins Englische. »Ich sagte, dass Sie dieses Taxi nicht haben können.«
»Ach, und warum nicht, wenn ich fragen darf?«
»Weil ich vor Ihnen an der Reihe bin«, entgegnete Lena fest und reckte das Kinn. »Ich warte schon viel länger als Sie!«
Schmunzelnd schüttelte er den Kopf. »Sie haben dagestanden und Löcher in die Luft gestarrt«, korrigierte er sie dreist. »Hören Sie, Miss, obwohl es mir ein großes Vergnügen wäre, dieses Thema noch weiter mit Ihnen zu diskutieren, muss ich an dieser Stelle leider abbrechen. Termine, Sie verstehen?«
Er schenkte ihr noch ein letztes strahlendes Lächeln, ehe er in den Wagen stieg und die Tür hinter sich zuzog. Wie paralysiert blieb Lena zurück und schaute tatenlos zu, wie das Taxi – ihr Taxi – mit dem unverschämten Fremden darin davonfuhr.
Lange hatte Lena am Taxistand des Flughafens nicht warten müssen, ehe wieder ein Wagen aufgetaucht war. Die Fahrt zu ihrem Hotel dauerte trotzdem noch einmal eine Stunde, obwohl der Kisauni Airport kaum mehr als einen Katzensprung südöstlich von Sansibar Stadt entfernt lag. Doch je näher sie ins Zentrum der Inselhauptstadt vorrückten, desto dichter wurde das Gewirr von Fahrrädern, Autos und Mopeds, die sich auf den engen Straßen drängten.
Endlich, als sie gerade glaubte, die Hitze im Inneren des Fahrzeugs keine Sekunde länger ertragen zu können, lenkte der Fahrer den Wagen an den Straßenrand. Lena stieg aus und schaute sich um, während sie darauf wartete, dass ihr Gepäck ausgeladen wurde. Ihr Hotel befand sich in einem hohen Gebäude mit fleckiger Steinfassade, das sicher schon bessere Tage gesehen hatte. Sie hätte sich durchaus eine bessere Unterkunft leisten können, immerhin musste sie sich um Geld keine Gedanken machen. Dank Andys Lebensversicherung war sie gut abgesichert. Doch sie brauchte keine luxuriöse Umgebung. Und außerdem fühlte sie sich nach wie vor schlecht dabei, Geld mit vollen Händen auszugeben, das sie nur besaß, weil Andy …
Zwei Stufen führten hinauf zu einer Tür, die jedem Kirchenportal zur Ehre gereicht hätte. Das dunkle Holz war reich mit Schnitzereien und bronzefarbenen Beschlägen verziert.
Lena bezahlte den Taxifahrer und gab ihm ein Trinkgeld, das ihm ein Strahlen aufs Gesicht zauberte. Er bedankte sich überschwänglich und bestand darauf, ihr das Gepäck noch bis ins Hotel zu tragen. Dagegen hatte Lena definitiv nichts einzuwenden, so müde und zerschlagen, wie sie sich fühlte. Sie checkte an der Rezeption ein, die im Grunde genommen nur aus einem Schalter bestand, der in die Wand des Treppenhauses eingelassen war. Und als sie wenig später, nachdem sämtliche Formalitäten erledigt waren, endlich ihr Zimmer betrat, ließ sie sich, ohne sich lange umzusehen, auf das weiche Bett fallen. Nur zwei Minuten die Augen schließen und entspannen, sagte sie zu sich selbst.
Doch sie hatte die Lider kaum geschlossen, als sie auch schon in einen leichten Dämmerschlaf sank.
Es war dunkel. Sterne glitzerten am Himmel, und der fast volle Mond tauchte die Landstraße in seinen silbrigen Schein. Aus den Lautsprechern des Autoradios drang leise ein alter Song von Sade: Smooth Operator. Die Musik verschmolz mit den Geräuschen des Motors und dem Flapp-Flapp der Reifen auf dem Asphalt zu einer beinahe schon hypnotischen Melodie. Mit geschlossenen Augen saß Lena auf dem Beifahrersitz, streichelte mit der Hand über ihren prall gewölbten Bauch und ließ sich einfach treiben.
»Es war nett bei Thomas und Sandra, findest du nicht?«
Lena lächelte, ohne die Augen zu öffnen. »Ja«, sagte sie. »Aber Sandras Lasagne war grauenvoll!«
Andys Lachen, tief und kehlig, erfüllte den Wagen. »Ja«, stimmte er atemlos zu, »sie war tatsächlich ungenießbar – aber nicht halb so schlimm wie die Rote Grütze! Ich habe auf etwas gebissen, das ich für eine Kirsche hielt, sich dann aber als ein Klumpen Gelatine entpuppte!«
Nun konnte auch Lena nicht mehr an sich halten. Sie lachte und lachte, bis ihr die Tränen kamen. Ihr Herz sprudelte über vor lauter Liebe und Zuneigung. Dies war einer dieser Momente, in denen sie sich fragte, womit sie so viel Glück verdient hatte.
Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Augen – in diesem Moment sah sie den Geisterfahrer, der frontal sie zugeschossen kam.
»Andy, pass auf!«
Doch es war zu spät.
Das Kreischen von Metall und das Splittern von Glas war das Letzte, was Lena wahrnahm.
Dann wurde sie von vollkommener Dunkelheit umfangen.
Mit einem erstickten Keuchen schreckte Lena aus dem Schlaf hoch. »Andy …«
Sie setzte sich auf – und ließ sich stöhnend zurücksinken, als ihr klar wurde, wo sie sich befand. Der Unfall lag mehr als ein Jahr zurück, doch die Träume, die sie seit jener Nacht verfolgten, hatten nichts von ihrem Schrecken verloren.
Ihr Herz hämmerte wie wild, und ihr stand der kalte Schweiß auf der Stirn. Mit zitternden Knien stand sie auf und ging ins Badezimmer hinüber. Dort drehte sie das kalte Wasser auf und wusch sich das Gesicht. Seufzend ließ sie sich den Wasserstrahl auch über die Handgelenke laufen. Danach fühlte sie sich ein wenig besser. Doch an Schlaf war nicht mehr zu denken, und das kleine Zimmer, in dem es gerade einmal genug Platz für das schmale Einzelbett, einen Schrank und einen Nachttisch gab, erschien ihr zunehmend beengt und erdrückend.
Was ist los mit dir? Du hast nicht den weiten Weg hierher gemacht, um jetzt im Hotel die Füße hochzulegen! Wolltest du dich nicht auf die Suche nach Andys Wurzeln machen? Jene Orte entdecken, an denen er die schönste und aufregendste Zeit seiner Kindheit verbracht hat? Um das zu Ende zu bringen, was er nicht mehr vollenden konnte?
Ja, genau das war es, was Lena wollte. Andys Worte, wenn er von seiner Jugend auf Sansibar gesprochen hatte, klangen ihr noch in den Ohren nach. Seine Begeisterung, das Glänzen in seinen Augen, sein Enthusiasmus, wenn er von der Freundlichkeit und Offenheit der Menschen schwärmte. Er war nie wieder hierher zurückgekehrt, hatte immer nur davon gesprochen, es irgendwann einmal zu tun – gemeinsam mit ihr. Vielleicht würde auch sie hier endlich wieder etwas anderes empfinden können als Trauer und Verzweiflung.
Worauf wartest du noch? Du hast das Leben lang genug wie einen trägen Strom an dir vorüberziehen lassen – es wird Zeit, dass du endlich wieder darin eintauchst und selbst daran teilnimmst, statt es von außen zu beobachten!
Sie konnte förmlich spüren, wie neuer Tatendrang sie erfüllte, nahm ihre Handtasche auf und verließ das Hotelzimmer.
Es dämmerte bereits, als sie etwas später hinaus auf die Straße trat, doch es war noch immer drückend warm, und die Luft war schwer und feucht, sodass sie sich fast anfühlte wie zäher Sirup. Innerhalb von Sekunden klebte Lena der Stoff ihres T-Shirts auf der Haut. Eine Kakophonie der verschiedensten Geräusche drang auf sie ein. Das Hupen der Autofahrer vermischte sich mit dem Schrillen von Fahrradschellen und dem Geschrei von Straßenhändlern, die lautstark ihre Waren anpriesen.
Und wie geht’s nun weiter, du Genie? In Ermanglung einer Antwort wandte Lena sich einer inneren Eingebung folgend nach rechts. Bald war die Straße gesäumt von kleinen Garküchen, die ihre Speisen direkt von der Theke nach draußen verkauften. Es roch nach gegrilltem Fisch, nach Zimt, Kardamom, Kümmel und Nelken. In den Auslagen standen Schüsseln und Schalen mit gewürztem Reis und weißlich-gelbem Brei.
Eine rundliche dunkelhäutige Frau hielt ihr ein Schälchen von dem Brei entgegen. »Wollen probieren, Miss’us? Ugali very delicious! Yummy, yummy!«
Lena lehnte mit einer knappen Handbewegung ab und eilte hastig weiter. In einer ruhigen Ecke holte sie die Ledermappe mit Andys Aufzeichnungen, die sie immer bei sich trug, aus der Handtasche. In einem der älteren Einträge hatte er einige Kindheitserinnerungen beschrieben. Dabei hatte er auch ein Haus in Stone Town erwähnt, der berühmten Altstadt von Sansibar Stadt, die auf Kiswahili Mji Mkongwe hieß. Dort hatte seine Familie einige Jahre gelebt. Wenn es ihr gelang, dieses Haus zu finden, würde sie vielleicht auch mehr über Andys sansibarische Verwandtschaft erfahren. Womöglich wohnte sogar noch einer von ihnen dort, oder zumindest jemand, der ihr sagen konnte, wo die Familie heute zu finden war.
Leider war nach dem Tod von Andys Mutter sämtlicher Kontakt zu den auf Sansibar lebenden Verwandten abgerissen. Für Andys Vater waren die Erinnerungen an die glückliche gemeinsame Vergangenheit auf der Insel zu schmerzhaft gewesen, und als halbwüchsiger Junge hatte Andy keine andere Wahl gehabt, als diese Entscheidung zu akzeptieren.
Daher hatte Lena kaum einen Anhaltspunkt, wohin sie sich wenden sollte. Sie war nach langen Monaten lähmender Untätigkeit völlig überstürzt aufgebrochen, weil sie es zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten hatte. Deshalb war sie nicht dazu gekommen war, irgendetwas vorzubereiten oder einen Plan zu fassen. Dass sie noch Impfschutz gegen Gelbfieber besaß, war ebenso ein glücklicher Zufall gewesen wie die Tatsache, dass sie bereits über ein gültiges Visum für Tansania verfügte. Andy und sie hatten eigentlich nach Afrika reisen wollen, doch die Nachricht von ihrer Schwangerschaft hatte sie ihre Pläne aufschieben lassen – wie leider so viele andere, was Lena heute zutiefst bereute.
Bei einem Straßenhändler kaufte sie sich eine Stadtkarte in englischer Sprache, und ließ sich anhand des Plans erklären, wo sie hinmusste. Es sah ganz einfach aus, und es war zudem nicht sonderlich weit von ihrem augenblicklichen Standort entfernt.
Mit aufgeregt klopfendem Herzen marschierte sie los, immer tiefer hinein in das Gewirr aus engen Gassen und Straßen. Bald schon drang sie in Regionen vor, in die sich offenbar nur selten ein Tourist verirrte. Leinen, an denen frisch gewaschene Wäsche im Wind flatterte, waren zwischen den Hausfassaden gespannt. Aus den offenen Fenstern drangen Gesprächsfetzen, hier und da lärmte ein vereinzeltes Fernsehgerät. Es wurde zunehmend dunkler. Der Himmel nahm die Farbe von altem, vertrocknetem Papyrus an, und die Schatten in den Gassen wurden länger. Als sie an eine Straßengabelung gelangte, hielt Lena nach einem Hinweis Ausschau, in welche Richtung sie sich wenden musste. Doch es gab weder Straßenschilder noch sonst etwas, das ihr die Orientierung erleichtert hätte.
Im schwachen Dämmerlicht studierte sie noch einmal ihre Karte. Eigentlich konnte es nicht mehr allzu weit sein. Wenn sie den Straßenhändler richtig verstanden hatte, dann musste sich das Haus, in dem Andys Familie gelebt hatte, ganz in der Nähe befinden. Kurzentschlossen wandte sie sich nach rechts.
Es dauerte nicht lange, und die Gegend wurde wieder etwas belebter. Dunkle Gesichter verschmolzen mit den Schatten hinter glaslosen Fensterlöchern, und Lena spürte, wie neugierige Blicke ihr folgten. Wirklich wohl fühlte sie sich nicht. Ihr hellblondes Haar und der blasse Teint wiesen sie eindeutig als Fremde aus, die nicht hierher gehörte.
Die Häuser standen nun weiter auseinander, und ihre Architektur erinnerte Lena an die hässlichen Plattenbauten von Berlin Marzahn und Neukölln – nur dass sie sehr viel heruntergekommener aussahen. Der Straßenbelag wies Schlaglöcher auf, in denen sich brackiges Wasser gesammelt hatte. Dunkelhäutige Kinder in abgerissener Kleidung spielten, indem sie kleine Boote aus geflochtenen Palmwedeln darauf treiben ließen.
Hier sollte Andy einmal gewohnt haben? Lena konnte es sich beim besten Willen nicht vorstellen. Es gab nur eine logische Erklärung: Sie musste sich irgendwo im Gewirr der Gassen verirrt haben.
Ein flaues Gefühl machte sich in ihr breit. Es war verrückt gewesen, einfach so loszuziehen. Was hatte sie sich bloß dabei gedacht? Vielleicht war sie wirklich zu überstürzt von Berlin aus aufgebrochen. Sie hatte am Abend vor ihrer Abreise nur einmal kurz im Internet recherchiert. Und das hatte sie jetzt davon.
Sie atmete tief durch und zwang sich zur Ruhe. Sie durfte nicht die Nerven verlieren, denn damit war niemandem geholfen. Am besten war es wohl, sich auf den Rückweg zum Hotel zu machen. Morgen, bei hellem Tageslicht, sah die Welt sicher schon wieder ganz anders aus.
»Hujambo?«
Lena drehte sich um, als sie eine helle Stimme hinter sich vernahm, und erblickte ein kleines, dunkelhäutiges Mädchen, das mit großen, schwarzbraunen Augen zu ihr aufschaute.
»Hujambo?«, wiederholte es ernst. Die Puppe, die es fest an die Brust gedrückt hielt, schien mit viel Liebe und Geschick aus alten Lumpen gefertigt worden zu sein. Das Haar sah aus wie die Oberfläche eines Scheuerschwamms.
»Was?« Lena beugte sich hinab und schüttelte lächelnd den Kopf. »Tut mir leid, aber ich verstehe dich nicht.« Um die Bedeutung ihrer Worte zu verdeutlichen, zuckte sie die Achseln und machte ein ratloses Gesicht.
Es war nicht wirklich zu erkennen, ob die Kleine begriff. Seufzend blickte Lena sich um. Gab es denn hier niemanden, der ihr helfen oder für sie übersetzen konnte? Sie entdeckte einen Verkaufsstand, der ein bisschen aussah wie Kiosk, wie sie ihn aus Berlin kannte. Kurzentschlossen bedeutete sie dem Mädchen, ihr zu folgen, was dieses auch bereitwillig tat. Seine Augen fingen an zu leuchten, als es die Auslagen mit den Süßigkeiten und den Plastikspielzeugen betrachtete, und Lena wurde es ganz warm ums Herz. Allzu oft konnten es sich die Familien, die hier lebten, sicher nicht leisten, ihren Kindern ein kleines Geschenk zu machen. Und wenn, dann waren es zumeist selbst gebastelte Spielzeuge wie die Puppe der Kleinen.
Der Mann hinter dem Verkaufsstand sprach bedauerlicherweise auch kein Englisch, worauf sein verständnisloser Gesichtsausdruck schließen ließ, als Lena ihn ansprach. Doch sie brauchte kein Kiswahili zu beherrschen, um sich mit ihm zu verständigen. Mit einem fragenden Gesichtsausdruck griff sie nach einem Karton mit Süßigkeiten, der auf dem Tresen stand. Der Mann lächelte verstehend und nickte, und so hielt Lena den Karton dem Mädchen hin.
Artig, fast ein wenig schüchtern, griff die Kleine hinein und nahm sich einen Schokoladenriegel. Sie lächelte strahlend und deutete mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf einen quietschroten Plastikball, der in einem Netz an der Wand hing.
»Ninaweza kupata mpira, tafadhali?«
Erneut benötigte Lena keinen Dolmetscher, um zu begreifen. Mit Händen und Füßen verständigte sie sich mit dem Verkäufer darauf, dass sie den Ball kaufen wollte. Der überreichte ihn ihr mit einem breiten, teilweise zahnlosen Grinsen.
Ob es richtig war, sich so zu verhalten? Lena wusste es nicht. Aber eines wusste sie ganz genau: Sie wollte dem Mädchen unbedingt eine kleine Freude machen. Der Ball und der Schokoriegel kosteten sie zusammen nur ein paar Münzen, und das glückliche Strahlen auf dem Gesicht des Kindes, als Lena ihm das Spielzeug überreichte, war es allemal wert. Was konnte daran falsch sein?
Doch als die Kleine mit ihrem neuen Ball davoneilte, hatten sich bereits drei kleine Jungen bei Lena eingefunden, die sie alle ebenfalls aus großen schokoladenbraunen Augen anschauten. Leise seufzend griff sie erneut nach dem Süßigkeitenkarton und spendierte nun auch ihnen eine Runde Leckereien. Aber schon kamen die nächsten Kinder angerannt, und im Schlepptau hatten sie ein paar Halbwüchsige, die sofort anfingen, die Kleinen zu verscheuchen und Lena nun ihrerseits zu bedrängen.
Und sie hatten es ganz sicher nicht auf buntes Spielzeug abgesehen.
»Tafadhali! Tafadhali!«
»Nicht doch«, keuchte Lena und stolperte zwei, drei Schritte zurück, bis sie sich mit dem Rücken an der Wand der Bretterbude wiederfand. »Lasst mich!«
Doch so leicht ließen die Jugendlichen sich nicht abschütteln. Inzwischen hatten sich auch einige Straßenverkäufer zu ihnen gesellt, die Lena ihre Waren aufdrängen wollten.
Von dieser Seite Sansibars hatte Andy ihr nie erzählt. Wenn er von seinen Jugendjahren auf der Insel berichtete, war stets nur die Rede von blütenweißen Sandstränden und freundlichen, offenen Menschen gewesen.
»Bitte«, stieß sie atemlos hervor und versuchte, die Hände abzuschütteln, die von allen Seiten nach ihr griffen und an ihr zerrten. Sie öffnete ihre Geldbörse, die sie noch immer in der Hand hielt, und schüttete den Inhalt – eine Handvoll Tansania-Schilling-Münzen – achtlos zu ihren Füßen auf den Boden.
Der Effekt trat sofort ein und war umfassend. Die Straßenkinder und Bettler ließen von ihr ab und warfen sich in den Staub, um möglichst viele Münzen zu ergattern. Es war ein Gezeter und Gezerre, und immer mehr Menschen kamen heran, um zu sehen, was hier vor sich ging.
Halb stolpernd, halb laufend eilte Lena davon. Tränen verschleierten ihr den Blick, doch sie blieb nicht stehen. Erst als sie die verwinkelten Gassen der Altstadt wieder erreichte und der Lärm hinter ihr langsam abebbte, wagte sie es, ihre Schritte zu verlangsamen.
Wenige Minuten später trat sie hinaus auf eine deutlich belebtere Straße, auf der auch Autos fuhren. Sie wischte sich den Staub und die Tränen aus dem Gesicht. Als sie ein Taxi sah, winkte sie es sofort heran, kletterte mit noch immer zitternden Knien auf den Rücksitz und nannte den Namen ihres Hotels.
Während die Lichter der Stadt an ihrem Fenster vorüber flogen, wanderten Lenas Gedanken zurück zu Andy und ihrem ungeborenen Kind, das mit ihm gestorben war, und ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Ach, wenn du doch jetzt bei mir sein könntest! Du und unser kleiner Krümel …
Lena hatte gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen war, als der Taxifahrer sich zu ihr umwandte und verkündete: »Miss’us? Wir sind da, Miss’us. Zanzibar Jumba Hotel.«
Sie blinzelte, kramte ein paar Tansania-Schilling hervor, die sie noch in ihrer Geldbörse hatte, und hoffte, dass es ausreichte, um die Taxifahrt zu bezahlen.
Es reichte.
Sie stieg aus und hastete ins Hotel, ohne auf die neugierigen Blicke der Passanten zu achten. Ebenso wenig blieb sie stehen, als der Portier am Empfangsschalter ihr nachrief, dass ein junger Mann aus Deutschland für sie angerufen habe. Nein, Lena blieb erst stehen, nachdem sie die Tür ihres Zimmers hinter sich geschlossen hatte.
Dann sank sie kraftlos am Türrahmen herab, das Gesicht in den Händen geborgen, und ließ ihren Tränen freien Lauf.
Am nächsten Morgen drang helles Sonnenlicht durch die Fensterläden ihres Zimmers. Lena konnte sich nicht daran erinnern, zu Bett gegangen zu sein. Doch als sie erwachte, fand sie sich – noch immer vollständig angezogen – auf der Matratze wieder. Kein Wunder, dass sie sich so verschwitzt fühlte und die Kleidung ihr klamm am Körper klebte.
Als sie sich umdrehte, um aufzustehen, erblickte sie zu ihrer Überraschung einen mageren schwarz-weißen Kater, der leise schnurrend neben ihr auf dem Kissen döste. Er musste in der Nacht auf der Suche nach einem sicheren Schlafplatz über die angrenzenden Dächer und durch das halb geöffnete Fenster hereingekommen sein. Offenbar war das Tier überzeugt, dass von Lena keine Bedrohung ausging, denn als sie sich aufsetzte, hob es nur träge die Lider und schloss sie gleich wieder.
Lächelnd kraulte Lena dem Kater das weiche Fell. Irgendwie war es tröstlich, ihn hier bei sich zu haben. So fühlte sie sich nicht mehr gar so schrecklich allein in diesem fremden Land, in dem sie niemanden kannte und dessen Sitten und Gebräuche ihr fremd waren.
Andy hatte früher immer davon gesprochen, sich eine Katze oder einen Hund anzuschaffen. Lena war dagegen gewesen. Sie beide – Andy als Schriftsteller und sie als Lehrerin der Sekundarstufen I und II – waren beruflich stark eingespannt gewesen. Zu stark, als dass sie die notwendige Zeit hätten aufbringen können, die ein Haustier erforderte.
Schon spürte sie wieder, wie ihr Blick verschwamm. Andy zu verlieren hatte ein Loch in ihr Herz gerissen, das anstatt zu heilen von Tag zu Tag größer zu werden schien. Als ihr ein Schluchzen entfuhr, schlug sie sich erschrocken die Hand vor den Mund.
Nein, sie würde sich nicht wieder ihrem Kummer und ihrer Zukunftsangst ergeben! Sie straffte die Schultern und blinzelte die Tränen fort. Deshalb war sie nach Sansibar gekommen: Sie wollte das Buch zu Ende schreiben, an dem Andy gearbeitet hatte, bevor er starb.
Aber vor allem wollte sie wieder zurück zu sich selbst finden.
In jener schicksalhaften Nacht hatte sie durch den Unfall alles verloren, was ihr im Leben lieb und teuer war: Andy, ihr ungeborenes Kind und bis zu einem gewissen Grad auch sich selbst. Lena wusste, wenn sie es jetzt nicht schaffte, wieder auf die Beine zu kommen, dann würde es ihr wahrscheinlich niemals gelingen.
Der Kater musterte sie aus großen, grüngoldenen Augen. Es fühlte sich an, als könne er hinter die Fassade blicken und erkennen, was wirklich in ihr vorging.
Einmal strich sie dem Tier noch übers Fell, dann stand sie auf und ging ins Bad, um zu duschen. Der kleine Raum war mit türkisblauen Fliesen ausgestattet, und als das Wasser aus dem Duschkopf auf sie niederprasselte, war ihr, als würde sie unter einem tropischen Wasserfall stehen.
Als sie eine halbe Stunde später, in einen flauschigen Bademantel gehüllt, wieder ins Zimmer trat, fühlte sie sich um einiges frischer und ausgeruhter als zuvor. Der Kater war immer noch da. Er saß auf Fensterbrett und ließ sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Lena trat zu ihm und sah eine Weile zu, wie die Stadt unter ihr langsam zum Leben erwachte.
Es hatte geregnet, und ein unwirkliches Leuchten lag über allem. Der Staub war weggewaschen worden und gab den Blick frei auf das, was darunter lag: eine leicht heruntergekommene orientalische Schönheit, die ihr Alter unter bröckelndem Putz zu verstecken suchte und schon viel erlebt und gesehen hatte im Laufe der Jahrhunderte: Perser, Portugiesen, Araber. Großen Prunk auf der einen, das Grauen und die Unmenschlichkeit der Sklaverei auf der anderen Seite.
Von der Regenrinne fiel ein einzelner, funkelnder Wassertropfen herab und landete auf dem Kopf des Katers, der sich schüttelte und mit einem angewiderten Miauen vom Fensterbrett zurück ins Zimmer sprang.
Genau wie er schüttelte nun auch Lena die unschönen Erinnerungen an den vergangenen Abend ab und beschloss, noch einmal ganz von vorn anzufangen. Doch dieses Mal würde sie nicht so blind und planlos vorgehen.
Während ihr neuer Mitbewohner es sich wieder auf dem Bett gemütlich machte, schlüpfte Lena in ein schlichtes, graublaues Baumwollkleid und ging zur Tür. Sie hielt den Knauf schon umfasst, als sie zögerte und schließlich doch noch einmal umkehrte. Nachdem sie eine Kaffeetasse mit leicht gesprungenem Rand zum Trinknapf umfunktioniert und mit frischem Wasser gefüllt hatte, tätschelte sie dem Kater den Kopf. »Wenn du nichts dagegen hast, werde ich dich Krümel nennen.«
Mit einem Lächeln auf den Lippen verließ sie das Zimmer.
»Sie sind also auf der Suche nach Verwandten Ihres Verlobten? Hm …« Nachdenklich kaute der junge Mann hinter der Rezeption auf seiner Unterlippe. »Bennett, sagten Sie? Der Name kommt mir entfernt bekannt vor, aber ich komme nicht darauf, woher. Nun, wie auch immer. Am besten wird es sein, wenn Sie es zuerst bei den hiesigen Behörden versuchen.« Er seufzte. »Allzu viel Hoffnung sollten Sie sich aber nicht machen. Da es auf Sansibar keine gesetzliche Meldepflicht gibt, wäre es schon ein großer Zufall, wenn sich ausgerechnet die Familie Ihres Verlobten hätte registrieren lassen …«
Lena atmete tief durch und zwang sich zu einem Lächeln. »Ich habe nicht damit gerechnet, dass es leicht wird.«
»Wie sieht es mit Ihren Sprachkenntnissen aus? Ich nehme nicht an, dass Sie Kiswahili sprechen?«
»Leider nicht.« Seufzend schüttelte Lena den Kopf. »Kennen Sie vielleicht jemanden, der bereit wäre, mir zu helfen? Ich würde ihn selbstverständlich für seine Mühe entschädigen.«
»Das wird nicht nötig sein.« Er winkte ab. »Ich hatte Nachtschicht und habe in einer halben Stunde Feierabend. Wenn Sie bereit sind, so lange zu warten, werde ich mit Ihnen zur Stadtverwaltung gehen und für Sie übersetzen.«
Lena war überrascht. Und erfreut über so viel Hilfsbereitschaft. »Das würden Sie für mich tun?«
»Es bedeutete für mich keinen großartigen zusätzlichen Aufwand. Meine Wohnung befindet sich in der Nähe der Stadtverwaltung, und schlafen kann ich auch in ein paar Stunden noch.«
»Das ist wirklich ausgesprochen nett von Ihnen, Mister …«
»Suleiman Nwosu«, entgegnete er lächelnd. »Sie können mich ruhig Suleiman nennen. Und ich freue mich, wenn ich helfen kann. Allerdings sieht unser Boss es gar nicht gerne, wenn wir privaten Umgang mit den Gästen pflegen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass wir uns draußen treffen? Sagen wir, in vierzig Minuten vor dem kleinen Café am Ende der Straße?«
Lena nickte. »Sehr gern. Und … wie sagt man Dankeschön auf Kiswahili?«
»Asante«, entgegnete er. »Und darauf sage ich: Si kitu – gern geschehen.«
»Soll das heißen, sie kann mir nicht helfen?«
Suleiman übersetzte Lenas Frage für die bildschöne Einheimische hinter dem Schalter in der Stadtverwaltung. Die schüttelte bedauernd den Kopf und antwortete mit einem Redeschwall, von dem Lena nicht das Geringste verstand. Doch das war auch nicht nötig, um zu begreifen, was die Worte zu bedeuten hatten.
»Es tut ihr leid«, erklärte Suleiman nun auch erwartungsgemäß. »Sie sagt, dass sie leider nichts für Sie tun kann.«
Im Grunde hatte Lena auch nichts anderes erwartet. Seit mehr als vier Stunden wurden Suleiman und sie nun schon von einem Büro zum nächsten geschickt. Aber niemand konnte ihnen wirklich brauchbare Informationen geben. Es war zum Verzweifeln! Entgegen ihrer Behauptung hatte Lena sich das alles doch irgendwie einfacher vorgestellt. Dass es sich so schwierig gestalten würde, etwas über Andys Familie auf Sansibar herauszufinden, damit hatte sie im Traum nicht gerechnet.
Und so langsam fing sie an zu glauben, dass es ihr gar nicht mehr gelingen würde.
»Mir tut es übrigens auch leid«, sprach Suleiman weiter. »Aber wenn ich nicht bald ins Bett komme, bin ich heute Nacht zu nichts zu gebrauchen. Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich Ihnen gern weiter helfen, Miss Lena, aber …«
Sie schüttelte den Kopf. »Ach was, ich bin Ihnen äußerst dankbar für alles, was Sie getan haben. Mehr kann ich nun wirklich nicht von Ihnen verlangen!« Seufzend fuhr sie sich durchs Haar. »Was soll’s, gehen wir. Hier kommen wir ohnehin nicht weiter.«
Sie waren schon fast bei der Tür, als die hübsche Amtsmitarbeiterin sie noch einmal zurückrief. Wieder wechselte Suleiman einige Worte mit ihr, die Lena nicht verstand – doch sie war sicher, dass der Name Bennett mindestens einmal gefallen war.
»Was ist los?«, fragte sie. »Was hat sie gesagt? Ist ihr doch noch etwas eingefallen?«
Suleiman nickte. »Ja«, sagte er. »Es könnte wichtig sein oder auch nicht. Aber sie erinnert sich daran, einmal von einer Gewürzfarm auf der anderen Seite der Insel bei Jambiani gehört zu haben, die einem Mann namens Bennett gehört.«
»Wirklich?« Aufgeregt umklammerte Lena seinen Arm. »Bitte, fragen Sie sie, ob sie noch weiß, wo genau diese Farm zu finden ist. Das könnte unsere erste heiße Spur sein!«
Ungeduldig wartete sie, während Suleiman sich mit der Stadtangestellten unterhielt. Die nahm eine Karte, wie sie vom Tourismusbüro an Touristen ausgeteilt wurde, und zeichnete darauf einen Lageplan. Diesen überreichte sie dann Suleiman, der ihn an Lena weitergab.
»Hier«, sagte er. »Sie ist beinahe sicher, dass der Name Bennett’s Clove and Spice Farm lautet, aber natürlich kann sie nicht sagen, ob das Anwesen inzwischen den Besitzer gewechselt hat.«
Doch Lena wollte keine Einwände hören. Sie fühlte sich wie elektrisiert. Endlich eine Spur! Am liebsten hätte sie Suleiman die Karte einfach aus der Hand gerissen und draußen das erstbeste Taxi herangewinkt, um gleich hinaus zu dieser Gewürzfarm zu fahren. Doch sie zügelte sich mühsam und wartete, bis Suleiman sich von ihrer freundlichen Helferin verabschiedet hatte.
»Wenn Sie möchten, fahre ich morgen nach meiner Schicht mit Ihnen raus nach Jambiani und …«
»Das ist wirklich lieb von Ihnen, Suleiman«, fiel Lena ihm aufgeregt ins Wort. »Aber ich kann beim besten Willen nicht bis morgen warten, das verstehen Sie doch sicher.«
»Aber natürlich.« Er lächelte. »Viel Erfolg – ich hoffe, Sie finden die Antworten, nach denen Sie suchen.«
Lena blinzelte überrascht. Die Antworten, nach denen Sie suchen … Wie hatte er das bloß gemeint? Erstaunlicherweise passten die Worte genau zu ihrer momentanen Situation. Denn war sie nicht genau das: auf der Suche nach Antworten? Antworten auf die Frage, wie es mit ihrem Leben weitergehen sollte? Und ob das alles ohne Andy überhaupt noch einen Sinn hatte?
Mühsam schüttelte sie diesen letzten Gedanken ab. Andy hätte nicht gewollt, dass sie so dachte. Aber es war so verdammt schwer, sich vorzustellen, ohne ihn weiterzumachen.
Sie blinzelte die Tränen weg, die ihr wie von selbst in die Augen gestiegen waren; dann trat nach draußen und winkte sich ein Taxi heran.
2.
Die Fahrt von Stone Town nach Jambiani entführte Lena erneut in eine völlig neue, fremde Welt.
Sobald sie den Trubel der Stadt hinter sich gelassen hatten, ließ der stetige Verkehrsstrom nach, bis er nur noch ein tröpfelndes Rinnsal war und schließlich vollends versiegte. Dafür wurde es zunehmend grüner. Bäume wuchsen nun bis dicht an die Straße heran, und hin und wieder flitzte ein kleiner Affe, schnell wie ein Blitz, über den Asphalt.
Für die Strecke, die einmal quer über die Insel zu führen schien, brauchten sie gut eine Stunde. Als sie Jambiani erreichten, fuhr der Taxifahrer, der glücklicherweise gebrochen Englisch sprach, an den Straßenrand und drehte sich zu ihr um.
»Geben viele Spice Farms hier in der Gegend. Wie sagte Miss’us war der Name?«
»Bennett’s Clove and Spice Farm«, erwiderte Lena. »Haben Sie nicht vielleicht doch schon einmal davon gehört?«
Nachdenklich runzelte der dunkelhäutige Mann die faltige Stirn; dann erhellte sich seine Miene plötzlich, und sein breiter Mund verzog sich zu einem Grinsen, das den Blick auf gleich mehrere Zahnlücken freigab. »Aber natürlich!«, rief er aus und klopfte sich mit der flachen Hand auf die Stirn. »Ich denke, ich jetzt weiß, welche Farm Miss’us meint!« Er wandte sich wieder nach vorn und ließ den Motor an. »Ist nicht weit. Hakuna matata – kein Problem!«
Sie fuhren noch einmal knapp fünfzehn Minuten, und die Umgebung wurde noch grüner. Lenas Herz machte einen aufgeregten Hüpfer, als sie ein Schild passierten, auf dem in fetten Lettern »Bennett’s Clove and Spice Farm« stand.
Das war es also! In ihrem Bauch flatterten tausend Schmetterlinge auf. Zugleich kamen ihr aber auch Zweifel. Was, wenn diese Spur ins Leere führte? Wenn Andys Verwandte die Farm zwischenzeitlich verkauft hatten? Oder wenn – schlimmer noch –überhaupt niemand dort etwas von Andy wusste? Wie sollte es dann weitergehen?
Ruhig Blut, Lena. Das sehen wir alles, wenn es soweit ist.
Dann erblickte sie zum ersten Mal das Farmhaus.
Es handelte sich um ein zweigeschossiges Gebäude. Eine breite Außentreppe führte hinauf zum oberen Stockwerk, das von einer überdachten Veranda umgeben war, die sich auf hohe Pfähle stützte. Ebenfalls auf Pfeilern ruhte auf der Vorderseite das Dach, welches mit getrockneten Palmblättern gedeckt war. Hohe Kokospalmen wuchsen bis dicht an das Haus heran, und die Zufahrt, in der bereits zwei Fahrzeuge standen – ein ziemlich altersschwach aussehender Pick-up mit deutlichen Roststellen und ein ziemlich neu aussehender Jeep –, war gesäumt von Sträuchern, an denen Blüten in sattem Gelb und feurigem Rot leuchteten. Auf den ersten Blick wirkte das Haus sehr einladend auf Lena, fast ein wenig herrschaftlich, doch als sie nun aus dem Taxi stieg, offenbarte sich ihr, dass es schon bessere Tage erlebt hatte.
Die weiße Fassade war fleckig, überall blätterte der Putz ab. Die Holzbalustrade der Veranda wies Schäden auf, die, wenn überhaupt,nur notdürftig repariert worden waren. Und es gab noch weitere Anzeichen des Verfalls. Schwarze Stellen und Löcher in der Dachkonstruktion deuteten darauf hin, dass es einen Brand gegeben haben musste. Um ein Hineinregnen zu verhindern, hatte man die Lücken behelfsmäßig von unten mit Planen abgedeckt.
Das war es also? Das Haus, in dem Andy die schönste Zeit seiner Kindheit erlebt hatte? Der Gedanke ließ ihr den Atem stocken. Fast rechnete sie damit, dass sich die Tür öffnete und ein hübscher blonder Junge hinaustrat und ihr dieses warme Lächeln schenkte, das sie am erwachsenen Andy so geliebt hatte.
Als die Tür dann tatsächlich aufschwang, war es jedoch kein kleiner Junge, der auf die Veranda kam, sondern eine schlanke dunkelhäutige Frau, die zu einem schwarzen Kostüm einen auffälligen schwarzen Hut mit breiter Krempe trug. Sie bemerkte Lena nicht – ihre volle Aufmerksamkeit galt jemandem, der noch im Halbdunkeln des Hausflurs stand. Ihre ganze Haltung drückte Protest aus.
»Was bilden Sie sich eigentlich ein, hier aufzutauchen?«, schrie sie – dann folgte ein wütender Schwall auf Kiswahili, den Lena nicht verstand. Mit ausgestreckter Hand deutete die Frau zur Treppe. »Verschwinden Sie, ehe ich mich vergesse!«
Inzwischen waren noch weitere Menschen hinaus auf die Veranda getreten. Zwei ebenfalls aufgebracht aussehende halbwüchsige Jungs und ein älterer Mann. Dann noch eine ältere Frau, die offenbar versuchte, die aufgeheizte Stimmung zu beschwichtigen – vergeblich.
»Soll ich auf Miss’us warten?«
Lena hatte den Taxifahrer ganz vergessen. »Nein, nein«, erwiderte sie, holte hastig ihre Geldbörse hervor und beglich die Rechnung für die Fahrt. »Ich bleibe erst einmal hier.«
Der Mann zuckte die Achseln und überreichte ihr zusammen mit ihrem Wechselgeld eine Visitenkarte. »Einfach anrufen, wenn ich Miss’us wieder abholen soll«, sagte er, ehe er sich mit einem raschen kwa heri – auf Wiedersehen – verabschiedete, Gas gab und die Auffahrt hinunterbrauste.
Einen kurzen Moment lang blickte Lena ihm nach, dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Geschehen am Haus zu, wo die Auseinandersetzung noch immer im vollen Gange war. Sie fragte sich, wer wohl der Verursacher von alldem sein mochte. Und als hätte eine höhere Macht sie gehört, trat die Person, der all die Aufregung galt, genau in diesem Moment hinaus ins Tageslicht.
Lena riss die Augen auf. Das konnte doch nicht wahr sein! Nein, unmöglich!
Doch selbst aus der Entfernung war ein Irrtum kaum wahrscheinlich. Das wellige schwarzbraune Haar, das blasse, markant geschnittene Gesicht und die hellen Augen …
Lena blinzelte überrascht, doch das Bild, das sich ihr darbot, änderte sich nicht. Keine Frage, bei dem Mann handelte es sich um den unverschämten Schönling vom Flughafen. Was für ein erstaunlicher Zufall! Sie hatte nicht damit gerechnet, ihn jemals wiederzusehen, schon gar nicht hier draußen, auf einer kleinen Gewürzfarm mitten im Nirgendwo.
Doch er war da – und machte nicht weniger Eindruck auf sie als bei ihrer ersten Begegnung. Anstelle eines Maßanzugs trug er heute eine schwarze Hose zu einem figurnah geschnittenen weißen Hemd und einem schlichten schwarzen Sakko. Obwohl sie es nicht wollte, konnte Lena nicht umhin festzustellen, dass er verdammt gut aussah.
Vergiss den Kerl und konzentriere dich darauf, weshalb du eigentlich hier bist!
Aber das war leichter gesagt als getan. Denn seine Verärgerung, die ihm förmlich ins Gesicht geschrieben stand, machte ihn nur noch attraktiver.
»Sparen Sie sich Ihre Anfeindungen, Aaliyah«, knurrte er jetzt. »Sie wissen genau, dass ich am Ende doch gewinnen werde. Der alte Sturkopf hat mir viel zu lange Steine in den Weg gelegt mit seiner lächerlichen Weigerung, in einen Verkauf einzuwilligen.«
Die Lippen der Frau fingen an zu zittern. »Sie … Sie …« Im nächsten Moment prasselte ein weiterer aufgebrachter Hagel auf Kiswahili auf den Schönling herab, den dieser ebenso energisch in derselben Sprache erwiderte.
Schließlich brüllten alle wild durcheinander, und Lena fürchtete schon, dass sie bald mit den Fäusten aufeinander losgehen würden.
Doch dazu kam es nicht.
Der Schönling stieß etwas hervor, das wie ein wütender Fluch klang, drängte sich zur Treppe und eilte mit wenigen ausgreifenden Schritten nach unten. Auf dem Weg zu seinem Wagen kam er an Lena vorbei, ohne sie jedoch eines Blickes zu würdigen. Kurz darauf heulte der Motor des Jeeps auf, und der Wagen schoss in einer gewaltigen Staubwolke die Zufahrt hinunter.
Verwirrt schaute Lena ihm einen Augenblick nach, ehe sie sich wieder daran erinnerte, warum sie hergekommen war. Inzwischen hatten auch die Menschen oben auf der Veranda ihr Eintreffen bemerkt.
Die Frau in dem schwarzen Kleid, die ihren Hut inzwischen abgenommen hatte, eilte die Treppe hinunter und auf sie zu. »Verzeihung«, sagte sie höflich auf Englisch. Es war offensichtlich, dass sie sich nicht recht erklären konnte, was Lena wollte. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Das hoffe ich, ja«, entgegnete Lena und zwang ein Lächeln auf ihre Lippen. Für ein paar Minuten hatte sie ihre Nervosität beinahe vergessen, doch jetzt kehrte sie mit einem Schlag zurück. Ihr Herz hämmerte, und ihr zitterten die Knie. »Ich bin auf der Suche nach jemandem namens Bennett.«
»Dann können Sie nur Rafe Bennett, den Besitzer dieser Farm, meinen. Einen anderen Bennett gibt’s in der Gegend nicht. Aber …« Misstrauisch kniff sie die Augen zusammen. »Was wollen Sie von ihm? Wenn es um Geld geht, muss ich Sie enttäuschen: Rafe Bennett ist tot. Wir haben ihn heute zu Grabe getragen – und außer einem Berg Schulden hat er nichts hinterlassen.«
»Tot?« Lena schluckte. Die Worte der Frau machten all ihre Hoffnungen mit einem Schlag zunichte. Ihr war, als hätte ihr jemand den Boden unter den Füßen weggerissen. »Oh nein …«
Offenbar stand der Schock Lena ins Gesicht geschrieben. Die zuvor verschlossene Miene der Frau nahm einen besorgten Ausdruck an. »Was ist denn los, Kindchen? Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Sie sind ja weiß wie die Wand!« Sie nahm Lena beim Arm und führte sie vorsichtig die Treppe hoch, hinauf auf die Veranda.
Sofort eilten weitere Helfer herbei, und gemeinsam bugsierte man sie auf einen bereits reichlich abgewetzten, aber sehr bequemen Lehnsessel. Ein hübsches junges Mädchen mit einer Hautfarbe wie Milchkaffee, das sein Haar unter einem locker gebundenen Turban verbarg, fächelte Lena mit einem Palmwedel Luft zu, während jemand anders einen Becher Wasser brachte und ihr in die Hand drückte.
Obwohl Lena der ganze Wirbel um ihre Person ein wenig unangenehm war, empfand sie zugleich auch eine tiefe Dankbarkeit. Das alles – die lange Reise, all die fremden Eindrücke und nun auch noch die Nachricht, dass ihre einzige Spur womöglich im Sande verlaufen würde – war zu viel für sie. Sie verdankte es nur der Freundlichkeit dieser Menschen, die sie nicht einmal kannte, dass sie nicht einfach zusammengeklappt war.
»Geht es wieder?« Die Frau im schwarzen Kleid war wieder da, ging vor ihr in die Hocke und musterte sie forschend. Lena schätzte sie auf etwa Mitte bis Ende vierzig. In ihr krauses schwarzes Haar, das sie zu einem Knoten im Nacken zusammengefasst trug, mischten sich bereits grauweiße Strähnen, doch ihr rundliches Gesicht war bemerkenswert faltenlos, sah man einmal von ein paar Lachfältchen um den Mund herum ab. Sie hatte volle Lippen und warmherzige Augen, deren Farbe an geschmolzene Schokolade erinnerte. Ein nettes, freundliches Gesicht. Attraktiv, wenn auch nicht im klassischen Sinne schön.
Lena nickte und brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Ja, es geht schon besser. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt haben sollte. Ich war einfach … nun, geschockt trifft es wohl am ehesten. Als Sie vorhin sagten, dass Rafe Bennett gestorben ist …« Lena atmete tief durch. »Ich habe die ganze Reise von Deutschland hierher auf mich genommen, um nach der Familie meines Verlobten zu suchen. Aber wie es scheint, bin ich zu spät gekommen. Kannten Sie Rafe Bennett gut? Aber, Entschuldigung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt.« Sie streckte der Frau die Hand entgegen. »Mein Name ist Lena. Lena Bluhm.«
»Freut mich sehr, Lena Bluhm«, entgegnete die Frau, und ihre Lippen teilten sich zu einem strahlenden Lächeln. »Ich heiße Aaliyah Maalouf.« Sie deutete auf einen Mann und einen Jungen, die ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet waren. »Und dies sind mein Mann Fadhil und mein Sohn Hashim. Ich habe den Haushalt für Mr. Bennett geführt, und mein Mann war seine rechte Hand bei der Leitung der Gewürzfarm. Daher würde ich sagen, dass wir ihn ziemlich gut gekannt haben.« Sie seufzte. »Er war kein ganz einfacher Mann, stur und verstockt, und dazu, was Fremde betraf, äußerst kontaktscheu. Aber wir haben gelernt, mit ihm zurechtzukommen. Immerhin hat er uns Arbeit und ein Dach über dem Kopf gegeben.« Sie machte eine weitgreifende Handbewegung in die Runde. »Wir alle hier haben für Mr. Bennett gearbeitet. Und mit seinem Tod brechen für uns sehr unsichere Zeiten an.« Sie schüttelte den Kopf. »Aber ich rede immerzu nur von mir. Sie sagten, Sie sind extra aus Deutschland gekommen, um Mr. Bennett zu treffen. Warum?«
»Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte«, antwortete Lena seufzend. »Mein Verlobter hat in seiner Jugend einige Zeit hier auf der Insel verbracht. Er hat mir immer von seinem Onkel und dessen Gewürzfarm erzählt, und wie glücklich er hier gewesen ist.«
»Mr. Bennetts Neffe? Sie meinen doch nicht etwa den kleinen Andy, oder?«
Ein trauriges Lächeln umspielte Lenas Lippen. Sie befand sich also tatsächlich am richtigen Ort – nur leider ein paar Tage zu spät. »Doch, genau der. Andy Bennett und ich waren verlobt.«
Aaliyahs erfreuter Gesichtsausdruck verdunkelte sich. »Waren? Was ist geschehen? Haben Sie sich getrennt?«
»Nein. Andy ist …« Tränen stiegen ihr in die Augen, und ein Kloß bildete sich in ihrer Kehle, der sich auch durch heftiges Schlucken nicht vertreiben ließ. »Es gab einen Autounfall. Das Ganze liegt jetzt fast genau ein Jahr zurück. Andy und ich wurden schwer verletzt. Er fiel ins Koma und …« Sie schüttelte den Kopf.
Ein paar Minuten lang weinte sie stumm. Ihre Schultern bebten, doch kein Laut verließ ihre Lippen. Dann ebbte die Woge der Trauer langsam ab, und sie wischte sich mit dem Handrücken über die Wangen. »Tut mir leid, ich wollte nicht …«
»Unsinn, es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen«, widersprach Aaliyah sanft. »Es tut mir leid zu hören, was mit Andy geschehen ist. Ich erinnere mich noch gut an ihn, obwohl ich selbst noch jung war, als er mit seiner Familie hier auf Sansibar lebte. Damals führte meine Mutter noch den Haushalt für die Bennetts. Andy war ein netter Junge. Wirklich eine schlimme Geschichte, das mit dem Unfall. Es tut mir sehr leid für Sie. Aber offen gestanden verstehe ich noch immer nicht, was Sie von Mr. Bennett wollten.«
»Er war, soweit ich es nachvollziehen kann, Andys einziger noch lebender Verwandter. Er hat mir oft von einem Onkel erzählt, dem auf Sansibar eine Gewürzfarm gehörte. Seine Eltern sind schon vor vielen Jahren verstorben, und Geschwister hatte er keine. Kurz vor dem Unfall war Andy gerade dabei, ein Buch über seine Jugend auf Sansibar und die Geschichte seiner Familie hier zu schreiben. Doch er kam nicht mehr dazu, es zu vollenden.«
»Und jetzt wollen Sie das Buch für ihn zu Ende bringen«, mutmaßte Aaliyah.
Lena nickte. »Ja. Das Problem ist nur, dass ich Sansibar nur aus Andys Erzählungen kenne. Daher hatte ich gehofft, dass sein Onkel mir dabei helfen könnte, die Lücken in seinen Aufzeichnungen zu schließen.« Bedauernd zuckte sie die Achseln. »Aber das hat sich ja jetzt wohl erledigt.«
»Einen Augenblick, ja?« Aaliyah stemmte sich hoch und wandte sich auf Kiswahili an die anderen. Ganz sicher war Lena sich nicht, doch sie glaubte, irgendwo in dem Redeschwall immer wieder den Namen Andy herauszuhören. Als Aaliyah sich schließlich wieder zu Lena umdrehte, lag ein Strahlen auf ihrem Gesicht. »Wir werden Ihnen helfen, Lena.«
Sie blinzelte überrascht. »Sie? Aber wie?«
»Die meisten von uns Älteren haben Andy gekannt. Wir könnten seine Notizen mit Ihnen durchgehen und Dinge ergänzen. Und was die Geschichte der Familie betrifft – meine Urgroßmutter Fathiya kann Ihnen mit Sicherheit einiges über die Bennetts erzählen.«
Lena konnte es kaum glauben. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Würde sie so endlich mehr über Andys Vergangenheit erfahren? »Wollen Sie das wirklich für mich tun?«
Aaliyah nickte eifrig. »Aber natürlich – das heißt, wenn uns dieser Engländer bis dahin nicht von der Farm verjagt hat.«Bei den letzten Worten war ihre Miene hart geworden.
Lena hob eine Braue. »Wer ist das? Und warum sollte er Sie von hier vertreiben?«
»Ein Hotelier«, ergriff zum ersten Mal Aaliyahs Mann Fadhil das Wort. »Er hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, Mr. Bennett zu einem Verkauf der Farm zu bewegen, um hier ein Luxushotel zu errichten.«
»Zum Glück war Mr. Bennett ein sturer Hund«, sagte ein älterer Mann und lachte heiser. »Der hätte die Farm nie hergegeben. Für kein Geld der Welt!«
»Tja, damit ist uns jetzt aber auch nicht geholfen«, erklärte Aaliyah. »Und es bringt auch nichts, wenn wir uns immerzu verrückt machen. Heute haben wir Andys Verlobte zu Besuch und damit erst einmal einen Grund zu Feiern.« Lächelnd wandte sie sich an Lena. »Sie tun uns doch den Gefallen und bleiben zum Abendessen?«
»Nichts lieber als das«, erwiderte Lena wahrheitsgemäß. Sie war so erleichtert, weil es nun tatsächlich voranzugehen schien, dass ihr schier ein Stein vom Herzen fiel.
Einen Tag nachdem sie zum ersten Mal einen Fuß auf sansibarischen Boden gesetzt hatte, war sie tatsächlich hier angekommen und gespannt darauf, was die Zukunft ihr bringen würde.
Es dämmerte bereits, als Lena mit Aaliyah, ihrer Familie und den anderen Arbeitern der Gewürzfarm am Lagerfeuer saß.
Das Knistern der Glut vermischte sich mit dem Zirpen der Grillen und dem Rascheln des Windes, der durch die Baumkronen strich. Eine Frau namens Ngabile war inzwischen zu ihnen gestoßen. Aaliyah und sie hatten ein leises, wehmütig klingendes Lied auf Kiswahili angestimmt, und ein paar Männer klatschten und stampften im Takt dazu. Die Melodie nahm Lena gefangen, und ihre Gedanken trieben einfach davon in die Nacht. Noch nie hatte sie so viele Sterne gesehen wie an dem rasch dunkler werdenden Himmel, der sich über ihnen spannte.
»Ich erinnere mich noch gut an Andy«, sagte Ngabile, nachdem der Gesang verklungen war. »Wir haben oft zusammen am Strand gespielt. Ich war sehr traurig, als seine Eltern mit ihm zurück nach England gegangen sind, weil seine Mutter krank wurde. Er muss damals so um die zwölf oder dreizehn gewesen sein.«
»Weißt du noch, das eine Mal, als er und Said diesen entlaufenen Hund von einem