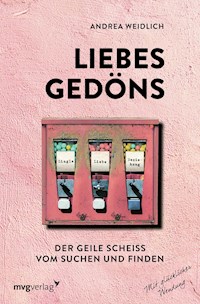15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte über die Antworten des Lebens – ein Buch wie eine Umarmung von innen
Josefine ist unzufrieden mit sich und der Welt. Sie hatte früher einmal Pläne, doch aus denen wurde nichts. Nun steht sie an einem Wendepunkt und vor der großen Frage: Was will ich eigentlich vom Leben? Warum verschiebe ich mein Glück immer auf später? Und wie erkenne ich den Sinn? Mit diesen großen Lebensfragen im Gepäck kehrt sie in ihr Heimatdorf zurück und fängt an, Briefe ans Leben zu schreiben. Und plötzlich antwortet ihr jemand. Dabei erinnert sie sich auch an eine längst vergangene Begegnung in ihrer Kindheit …
Jeden Tag nach der Schule sitzt die zehnjährige Josefine auf einer Parkbank und beobachtet eine rote Tür. Sie stellt fest: Die Menschen kommen ganz anders aus der Tür heraus, als sie hineingegangen sind. Und so drückt sie eines Tages ihre neugierige Nase so lange gegen die Fensterscheibe, bis Eduard Goldbach das Mädchen entdeckt und ihm eine völlig neue Welt öffnet. Josefine stellt dem einfühlsamen alten Therapeuten mit dem weisen Herzen Fragen, die zuvor noch nie ein Mensch gestellt hat. Goldbachs Antworten verändern etwas in ihrer Welt. Was jedoch niemand ahnt, ist, dass das Mädchen ein dunkles Geheimnis wie eine Last durchs Leben trägt.
Ein Buch über die großen Fragen des Lebens von der Autorin der Spiegel-Bestseller „Wie du Menschen loswirst, die dir nicht guttun, ohne sie umzubringen“, „Wo ein Fuck it, da ein Weg“ und „Ich denke, also bin ich … mir im Weg“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine herzerwärmende Geschichte über die großen Lebensfragen und Antworten, die alles verändern.
Josefine ist unzufrieden mit sich und der Welt. Sie hatte früher einmal Pläne, doch aus denen wurde nichts. Während einer Reise in ihr Heimatdorf, beginnt sie, Briefe ans Leben zu schreiben – und plötzlich antwortet ihr jemand. Statt weiter an sich und am Leben zu zweifeln, stellt sich Josefine dadurch neue Fragen: Was will ich vom Leben? Wie will ich dieses Leben verbringen? Und: Wer möchte ich gewesen sein? Dabei erinnert sie sich auch an eine längst vergangene Begegnung in ihrer Kindheit …
Jeden Tag nach der Schule sitzt die zehnjährige Josefine auf einer Parkbank und beobachtet ein altes Haus. Sie stellt fest: Die Menschen kommen ganz anders aus der roten Tür heraus, als sie hineingegangen sind. Und so drückt sie eines Tages ihre neugierige Nase so lange gegen die Fensterscheibe, bis Eduard Goldbach das Mädchen entdeckt und ihm eine völlig neue Welt öffnet. Josefine stellt dem einfühlsamen alten Therapeuten mit dem weisen Herzen Fragen, die zuvor noch nie ein Mensch gestellt hat – und Goldbachs Antworten verändern etwas in ihrer Welt.
Über die Autorin:
Andrea Weidlich ist Autorin und lebt in Wien. Mit Wo ein Fuck it, da ein Weg, Ich denke, also bin ich ... mir im Weg und Wie du Menschen loswirst, die dir nicht guttun, ohne sie umzubringen stand sie wochenlang auf den Bestsellerlisten. Bereits seit ihrer Kindheit schreibt sie Bücher, Geschichten, Theaterstücke und Musik und beschäftigt sich mit der Frage, was Menschen antreibt, glücklich macht und wie sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Nach ihrem Wirtschaftsstudium arbeitete sie zunächst im Management großer internationaler Konzerne – bis sie von einem Tag auf den anderen alles hinwarf, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Bereits ihr erstes Buch Der geile Scheiß vom Glücklichsein wurde zu einem großen Erfolg. Mit ihren psychologischen Themen trifft sie sowohl in ihren Büchern als auch in ihrem Podcast und auf Instagram einen besonderen Nerv und berührt unzählige Menschen.
Andrea Weidlich
Das Geheimnis eines fucking guten Lebens
Wie du bekommst, was du wirklich willst
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Ebook-Ausgabe 10/2025
Copyright © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Silvia Kinkel
Umschlaggestaltung: Philipp Radon unter Verwendung von Abbildungen von Envato (Mograph Motions) und Shutterstock.com (Proonty, detchana wangkheeree)
Satz: inpunkt[w]o, Wilnsdorf (www.inpunktwo.de)
ISBN 978-3-641-34164-0V001
ISBN 978-3-641-34164-0V001
Für meinen Großvater Eduard, Josefine und alle, die sich in ihr wiederfinden.
Und natürlich für Paul, mit dem alles begann.
Inhalt
Eine wahre Geschichte
Eine, meine, die andere Welt
Wenn das Leben leise mitliest
Schuster der Wut
Beschwerde ans Leben
In einem Dorf namens Öd
Ein ganz besonderer Dienstag
Die Formel des Lebens
Im Haus der Antworten
Königin der Pläne
Pension Sattmann
Liebes Leben, ...
Anders als die Anderen
Die Geografie der Liebe
Himmel im Bauch
Die alte Baracke
Ein fucking gutes Leben
Wandelnde Suchmaschine
Nur auf eine kurze Frage
Im Zauberwald
Der alte Lehrmeister
Sonntagstatort
Der Pfau und der stille Garten
Müde von der Welt
Der rote Faden
Eine Erfindung der Leute
Elefant im Wohnzimmer
Vom Leben geghostet
Ein grösserer Plan
Die Tür zur Verbindung
Das Geheimnis über den Sinn
Fragezeichen im Kopf
Die ganze Magie
Wo warst du dein ganzes Leben?
Der Ruf deiner Bestimmung
Newsletter-Anmeldung
Navigationspunkte
Table of Contents
Das Leben erzählt dir keine Geschichte,das Leben zeigt sie dir.
Eine wahre Geschichte
Mein Name ist Josefine Morgenstern, und ich möchte euch eine Geschichte erzählen – eine wahre Geschichte, die so unglaublich ist, dass man sie sich gar nicht ausdenken könnte. Denn würde man sie sich ausdenken, müsste man sich am Ende eingestehen, wie absurd sie klingt, und niemand, wirklich niemand, würde ihr Glauben schenken. So verhält es sich nun einmal, wenn unser Verstand sich einmischt: Er stellt Fragen, wo keine nötig sind, und lässt gerade jene unbeachtet, die dringend gestellt werden sollten. Absurd, so meinte Eduard Goldbach damals aber bereits zu mir, sei etwas Gutes wie ein Ereignis, das sich zunächst als Unglück verkleidet, sich allerdings später, wenn es den Mantel des Missverständnisses abgelegt hat, als wahrer Segen erweist. Das würde ich jedoch wie die meisten Menschen erst viele Jahre später verstehen. Absurd, sagte er mit sonorer Stimme, sei alles, was uns nicht begreiflich ist, und davon gab es ohne Zweifel jede Menge auf der Welt.
Er versuchte, mir schon sehr früh begreiflich zu machen, dass uns gerade die unbegreiflichen Dinge im Leben am Ende näher an die Wahrheit führen. Eine Wahrheit, die ich damals noch nicht umfassend verstand, aber die ich, irgendwo tief in mir, bereits erahnte. Da, wo mein kleines, unbeflecktes Herz noch voller Aufregung und gebannter Neugierde schlug, konnte ich sie immer dann ganz deutlich spüren, wenn er mir wieder einmal von ihr erzählte.
Woche für Woche saß ich Eduard Goldbach gegenüber – tief eingesunken in meinem großen dunkelgrünen Ohrensessel, der mich wie ein weiches Moosbett im Schatten alter Bäume umhüllte. Und obwohl ich noch zu klein für das riesige Möbelstück war, fühlte ich mich schon groß genug, um die Antworten zu begreifen, die er während des Erzählens wie eine sanfte Decke um mich legte. Meine Ohren reichten zwar kaum an die gepolsterten »Ohren« des Sessels heran, und meine kleinen Füße baumelten weit über dem dunklen Eichenboden, ohne ihn je zu berühren – aber dennoch spürte ich jedes Mal eine tiefe Erdung, wenn ich Eduard Goldbachs Worten lauschte, die aus seinem Mund direkt in meine Seele strömten und nicht nur dort, sondern auch generell etwas in der Welt veränderten.
Eine wohlige Wärme breitete sich in meinem Innersten aus – ein Gefühl, nach dem ich mich später so sehr sehnte, das mir aber lange Zeit abhandengekommen war und von dem ich schließlich fürchtete, es für immer verloren zu haben. Es brauchte unzählige Jahre, bis ich wieder zu dem Gefühl zurückfand, und es hätte diese Jahre nicht gebraucht, hätte ich mich früher an die folgende Geschichte erinnert. Deshalb möchte ich sie euch erzählen, damit ihr nicht wie ich unzählige Jahre mit dem Suchen von Antworten zubringen müsst.
Vielleicht erscheint euch meine Geschichte also anfangs ein wenig absurd oder so verrückt wie das Leben selbst – doch dann seid ihr der Wahrheit schon erstaunlich nah. Das Leben steckt nun mal voller verrückter Wendungen, und so ist es nicht verwunderlich, dass auch meine Geschichte davon nicht unberührt bleibt. Wir denken immer, die Welt – oder all das, was uns das Leben gerade erzählt – sei das Verrückteste, das uns je passiert ist. Wir reden uns ein, dass noch niemals zuvor und unter gar keinen Umständen etwas je so verrückt gewesen sein konnte wie das, was wir gerade erleben. Aber wenn ich mich heute zurückerinnere, dann war die Welt schon damals verrückt. Vielleicht liegt es also gar nicht so sehr an der Welt, sondern an uns Menschen. Vielleicht haben wir Menschen die Welt verrückt gemacht.
Kommen wir aber wieder zurück zu Eduard Goldbach, dem großen Ohrensessel und den großen Antworten, die letztlich so viel für mich verändert haben. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ereignete sich exakt vor (sehr verrückten) zwanzig Jahren. Ich war damals gerade einmal zehn Jahre alt. Nun ist es keineswegs so, dass ich euch die Geschichte nicht von Anfang an erzählen möchte – der Grund, warum ich erst später damit beginne, ist schlicht und einfach jener, dass mir an alles Vorherige jede Erinnerung fehlt. Es ist beinahe so, als hätte ich zuvor nicht existiert und jemand hätte in meinem Kopf versehentlich die Löschtaste gedrückt oder wäre mit dem Radierer über die feinen ersten Linien der Anfänge meines Lebens gefahren und hätte irrtümlich ganze zehn Jahre ausradiert. Als ich Eduard Goldbach davon erzählte, meinte er, dass ich mich dahingehend vermutlich täuschte, weil nichts im Leben irrtümlich geschehe, und es wahrscheinlich vielmehr daran lag, dass sich vor langer Zeit etwas in mir dafür entschieden hatte, selbst der Radierer zu sein. Die Striche waren vermutlich viel schwärzer gewesen, als mir lieb gewesen war, und etwas in mir hatte daraufhin beschlossen, sie am besten für immer loszuwerden. Wenn ich heute zurückblicke, dann hatte er wohl – wie auch mit allem anderen – recht, und das, obwohl Eduard Goldbach zu den wenigen Menschen zählte, dem gar nichts daran lag, immer recht zu haben. Bis heute kenne ich kaum jemanden, der besser zuhören und an den richtigen Stellen schweigen kann. Sogar Jahre später, als sich die Zeit wie ein schwerer Rucksack an jeden Wirbel meines schmerzenden Rückens hängte, saßen seine Worte immer noch tief in meiner Seele, und ich hörte nicht auf, mich zu fragen, was wohl der Grund dafür war, dass ich mich an so vieles in meinem Leben nicht mehr erinnern konnte. Vielleicht, so gingen mir Eduard Goldbachs Worte immer wieder durch den Kopf, lag es daran, dass sich etwas in mir nicht damit einverstanden erklären wollte, wie mein Leben bis dahin verlaufen war. Wahrscheinlich wollte meine Erinnerung mir sagen: Lass uns den ganzen Mist vergessen, denn nichts davon hätte je geschehen dürfen. Ich fragte mich aber auch: Wer bestimmte letztendlich, was geschehen durfte? Denn auch das, was danach kam, erwies sich – wenn man meiner Erinnerung Glauben schenken wollte – als eher löschenswert.
Mein Leben kam mir in den vergangenen Jahren jedenfalls wie ein in die Jahre gekommener Schnellzug vor, der von einer Station zur nächsten raste, abends in dieselbe Haltestelle einfuhr und am nächsten Tag wieder auf denselben Gleisen seine gewohnten Bahnen zog. Das klobige Teil wollte nach all den anstrengenden Jahren eigentlich gar kein Schnellzug mehr sein, sondern lieber eine gemütliche Eisenbahn mit dem süßen kleinen Schornstein am Kopf, der den ganzen Dreck abließ, wenn wieder einmal alles zu viel war. Aber nichts an meinem Leben fühlte sich süß an – ganz im Gegenteil; es war bitter, im Abgang eisig enttäuschend und mit einem metallischen Nachgeschmack auf der Seele, die irgendwo zu bluten schien. Einen Wimpernschlag und ein paar rostige, eingefahrene Schienenfahrten später pfiff ich aus allen Ritzen. Ich fühlte mich ausgebremst. Trotzdem wusste ich, dass es am nächsten Tag mit quietschendem Getriebe weiterging, weil so ein verdammter Zug einfach nie zur Ruhe kommt. Ich fragte mich, was denn die Aufgabe, und überhaupt, was der Sinn einer solchen mühsamen Fahrt sein sollte, wenn man ständig durchs Leben raste, sich aber immerzu auf derselben Strecke bewegte und nichts als dieselbe eintönige Landschaft sah. Denn auch in meinem Inneren war es dunkel und ungemütlich geworden. In der Zwischenzeit waren zwar ein paar Menschen zugestiegen, aber letztendlich wollte kaum jemand bleiben. Auch wenn einige davon ein paar Snacks als Stärkung in meinem Abteil genossen hatten, stiegen sie, nachdem sie satt waren, alle wieder aus. Manche hatten ihren ganzen Mist zurückgelassen, während andere das Abteil völlig verwüsteten. Reparieren durfte ich das Ganze am Ende natürlich selbst. Das galt nicht nur für Freundschaften, sondern auch für Beziehungen. DerEine, von dem ich gehofft hatte, er würde irgendwann schicksalhaft meinen Wagon betreten und es sich für immer an meiner Seite gemütlich machen, hatte sich ganz offensichtlich hartnäckig verlaufen oder meinen Zug immer um ein paar Sekunden, möglicherweise aber auch um einige Jahre, verpasst. Mein Schicksal war wohl gänzlich untalentiert, was das richtige Timing anbelangte. Und das, obwohl es doch die eigentliche Aufgabe des Schicksals sein sollte, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenzuführen. Meines war notorisch zu spät.
Und weil das mit der Liebe bisher insgesamt ein verdammtes Rätsel für mich geblieben war, suchte ich die Erfüllung in der Zwischenzeit woanders. Jahrelang jagte ich im Job einer Beförderung nach der anderen hinterher, von der ich überzeugt war, sie würde mir endlich dieses ersehnte Gefühl von damals oder zumindest irgendeine andere Art der Erfüllung bringen. All das machte mich letztendlich aber nur noch müder und ausgebrannter. Anscheinend stand die Erfüllung seit Jahren direkt neben der Liebe und dem Sinn, und zwar immer exakt an derselben Stelle: irgendwo auf dem Abstellgleis. Es wirkte, als hätten sie sich alle gemeinsam dazu entschlossen, mir erfolgreich aus dem Weg zu gehen oder mich erst gar nicht finden zu wollen, obwohl ich doch so angestrengt nach ihnen suchte. Dazu raste ich durchs Leben, und die ganze Raserei führte … ihr ahnt es wahrscheinlich bereits: nirgendwohin. Ich kam nirgends richtig an.
Ich frage mich rückblickend, ob das Mädchen von damals nicht um einiges weiser gewesen war als die Frau, die mir Jahre später im Spiegel gegenüberstand. Wenn ich diese um ein paar Jahre ältere, aber, wie es schien, weder klügere noch weisere Version von mir betrachtete, musste ich mir eingestehen, dass nicht mehr viel von dem lebendigen Mädchen übrig war. Damals, als der Sinn noch gelbe Cordhosen trug und wir barfuß über die Wiese am Hauptplatz liefen, hatte die Welt noch in meine Hosentasche gepasst, und alles schien in Ordnung zu sein. Als das Leben noch nach Träumen roch und jeder davon zum Erreichen nah war, fühlte sich etwas in mir heil und sicher an. Rückblickend betrachtet waren damals weder die Welt noch das Leben sicher, aber auf eine verrückte Art und Weise war ich es selbst – und das, obwohl mir die Sicherheit an allen Ecken und Enden fehlte. Das kleine Mädchen hütete das Leuchten ihrer Seele wie ihren Augapfel, es braute sich die Abenteuer im Kopf zusammen und trug die Magie wie eine Zauberkugel im Herzen, von der ich später nicht mehr sagen konnte, woher sie gekommen war oder wie ich sie jemals wiederfinden würde. Ich wusste nicht, ob die Menschen um mich herum, die Welt oder ich selbst sie mir genommen hatten. Aber eines war sicher, sie war mir irgendwo auf der Strecke abhandengekommen.
Bis ich sie eines Tages wiederfand.
Wie es dazu kam und was genau geschah – darum geht es in dieser Geschichte. Es ist die Geschichte über eine einzigartige Begegnung, dem Ende der Fragen und der Magie der Antworten, von denen ich niemals geahnt hätte, dass sie mich für immer verändern würden.
Doch genau so war es. Damals, mit zehn Jahren, an diesem einen, vorerst ganz alltäglichen Nachmittag, begegnete ich dem nicht Alltäglichen. Was daraufhin passierte, ist so unglaublich, dass ich es lange selbst nicht glauben konnte.
Eine, meine, die andere Welt
An diesem Tag verließ ich nach der letzten Unterrichtsstunde die Schule, und wie jeden Tag wartete ich erst gar nicht darauf, dass mich jemand abholte, weil ich wusste, dass ohnehin niemand kam. Das war weder etwas Neues, noch überraschte es mich sonderlich. Es lag auch nicht an der Uhrzeit, der Schule, oder dem Ort, sondern vielmehr an meiner Mutter, die keinen Plan von meinem Leben hatte – und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie ihn gar nicht haben wollte. Ich glaube, meine Mutter hatte überhaupt keinen Plan. Da verließ sie sich komplett auf mich. Für sie war es selbstverständlich, dass es als Kind meine verdammte Pflicht war, bis spätabends in – oder wenn es sein musste eben auch vor der Schule zu sitzen, damit ich sie nicht störte. Was ich dabei mit meiner Zeit anstellte, interessierte sie nicht. Hauptsache, ich stahl nicht ihre. Ich möchte damit aber keinesfalls einen falschen Eindruck erwecken; natürlich liebte ich meine Mutter und fand ihr Verhalten nicht weiter schlimm. Das Lieben lag mir, genau wie das Warten, gewissermaßen damals schon im Blut. Schließlich hatte es eine Zeit gegeben, als dieses Blut ganz eng mit dem meiner Mutter verbunden gewesen war (das hatte ich in der Schule gelernt). Damals hatte ich über die Nabelschnur jede Menge von ihr bekommen, und das musste für zwei, vielleicht sogar drei Leben reichen. Das sagte meine Mutter jedenfalls immer, wenn ich etwas von ihr wollte. Es sah also ganz danach aus, als hätte sie zum Zeitpunkt meiner Geburt ihre ganze Kraft, mir irgendwelche Wünsche zu erfüllen, aufgebraucht, und sie fand, dass es nun auch nicht mehr ihre Aufgabe war.
Was meine Mutter mit ihrer Zeit anstellte – dazu komme ich später noch. Aber sagen wir so: Sie war ziemlich kreativ. Man könnte sogar sagen, sie war dermaßen kreativ, dass sie sich generell wenig um mein Leben kümmerte. Es kam mir allerdings so vor, als hätte sie genauso wenig für ihr eigenes oder das Leben an sich übrig. Banalitäten wie Essen, Einkaufen, fließendes Wasser oder Strom interessierten meine Mutter nicht. Stattdessen meinte sie, ich müsse viel dankbarer sein, weil in anderen Teilen der Welt Krieg herrsche und die Kinder dort gar nichts hätten und sehen mussten, wie sie überlebten. Dann fuchtelte sie wild mit ihren Armen vor dem Fernseher herum und zeigte auf die Bilder – schreckliche Bilder –, die mich wie hässliche Monster aus dem Bildschirm ansprangen und mir Angst einjagten. Ganz besonders nachts fielen sie immer wieder über mich her. In dem Fernsehgerät schien eine andere Welt zu stecken: eine Welt, die ständig parallel bei uns im Wohnzimmer lief und mich bis in meine Träume verfolgte. Manchmal liefen aber auch glückliche Menschen über den Bildschirm – Menschen, die sich küssten und schöne Dinge zueinander sagten. Und obwohl meine Mutter immerzu in diese andere Welt starrte, hatte ich nicht den Eindruck, dass sie die Bilder wirklich erreichten. Weder die schönen noch die hässlichen – kein Krieg, kein ungelöster Mordfall, kein Reaktorunfall vermochten, eine Regung in ihr hervorzurufen. Wahrscheinlich hätte sie noch nicht einmal die Sintflut mitgerissen. Ich glaube, dafür war sie einfach zu müde. Vermutlich war meine Mutter schon so müde von ihrer Welt, dass gar kein Platz mehr für eine andere war. Ganz generell schien ihr aber weder die eine noch die andere viel anhaben zu können. »Josefine«, sagte sie immer, während sie in die andere Welt starrte, »du darfst eines nicht vergessen«, dabei hob sie mahnend ihren rechten Zeigefinger wie eine alte Lehrmeisterin, die im Begriff war, etwas sehr Weises zu verkünden. »Die Welt ist verdammt ungerecht. Sie ist dunkel, kalt und voller Bosheit – und die Menschen sind um keinen Deut besser.« Sie beugte sich dann jedes Mal näher zu mir, als wolle sie mir ein uraltes Geheimnis anvertrauen, das mein ganzes Leben verändern könnte. »Ich verrate dir jetzt etwas, das dir vielleicht weiterhilft: Wenn du nach dem Guten suchst …« An dieser Stelle legte sie stets eine lange, dramatische Pause ein und ließ die Worte in der Stille nachhallen: »… dann wirst du vermutlich sehr, sehr lange danach suchen müssen.«
Ich verstand schon früh, dass das wahrscheinlich keine sonderlich rosigen Aussichten waren, doch seltsamerweise störte mich das nicht. Für mich war es lediglich eine von vielen Tatsachen, mit denen das Leben einen eben konfrontiert und mit der man mit der Zeit umzugehen lernte. Nachdem meine Mutter wieder eine ihrer lebensvernichtenden Reden gehalten hatte, erhob sie sich mit einem müden Ächzen und verschwand für eine Weile im Schreibzimmer, das keines war, weil niemand darin schrieb. Sie hasste es zu schreiben, weil sie das Zittern ihrer Hände dann nicht mehr verstecken konnte und es aussah, als spielten sie leise Klavier, ohne dass ein Klavier in der Nähe war. Irgendetwas in ihr fühlte sich dann immer ertappt. Ich wusste also gar nicht, was meine Mutter in dem Schreibzimmer suchte, vielleicht waren es die guten Aussichten, die sie sonst nirgends finden konnte. Jedenfalls machte dieses Zimmer etwas mit ihr. Es veränderte sie – nur leider nicht zum Guten. Ich stellte mir vor, dass das Zimmer sie wie ein Monster tief in sich verschlang und anschließend wieder ausspuckte, denn wenn sie zurückkam, sah sie jedes Mal anders aus, als hätte sie eine große beschwerliche Reise hinter sich und wäre noch müder, als sie es ohnehin schon war. Wenn ich sie fragte, was in dem Zimmer passierte, schimpfte sie mich, ich solle sie gefälligst in Ruhe lassen und mich um meinen eigenen Scheiß kümmern.
Irgendwann hörte ich daher auf, sie zu fragen, weil ich sie nicht verärgern wollte, und so blieb das, was sie darin tat, ein Geheimnis zwischen ihr und dem Zimmer. Meine Mutter hatte viele Geheimnisse, von denen ich spürte, dass es besser war, sie nie zu erfahren.
Wenn sie nach einer Weile wieder aus dem Schreibzimmer zurückkam, setzte sie sich mit demselben Ächzen, mit dem sie aufgestanden war, zurück auf die Couch, zog eine Zigarette aus der Packung, auf der Eve stand (ich dachte deshalb immer, sie hätte sie irgendeiner Eve geklaut), und steckte sie in das untere Ende eines Plastikstils. Danach zündete sie die Zigarette an und zog so lange an der Plastiköffnung, bis sie einen riesigen Schwall Rauch gemischt mit einem riesigen Schwall Seufzen wie eine lang aufgestaute Welle der Erleichterung aus ihren Lungen stieß. »Wenn du etwas Schönes willst, musst du zusehen, dass du dir diese verdammte Scheißwelt selbst schön machst«, sagte sie dann so langsam, als hätte sie das Sprechen verlernt. Kurz darauf schloss sie die Augen, als würde sie sterben, aber sie starb nicht, denn ich konnte sehen, wie sie die Augen unter den Lidern bis weit nach oben rollte. Sie rollte sie weg von ihrem Seufzen, weg von der Welt und weg von dem ganzen Wahnsinn, wie sie es nannte. Damit meinte sie mich und all das, worum sie sich, wenn es nach den Leuten im Dorf ging, hätte kümmern sollen. »Dafür bin ich doch nicht auf die Welt gekommen!«, protestierte sie stets und ärgerte sich darüber, dass die Leute redeten. Auch wenn sie selbst nie mit den Leuten sprach, bekam sie das Getuschel im kleinen Laden von Irmgard Sattmann mit. Dann sah ich, wie ihre Mundwinkel einfroren – wie alles in ihr einfror und eine kalte Stille sie ganz und gar überzog. Doch sie schwieg. Die Antwort schleuderte sie nicht den Leuten, sondern mir scharf und kalt wie einen nassen Lappen ins Gesicht, sobald wir wieder draußen waren. »Als hätte ich nichts anderes zu tun, als mich auch noch um euch zu kümmern!« Mit euch meinte sie mich und meinen Vater, als er noch da war. Später sagte sie aber immer noch euch, wenn sie mit mir sprach. Es gefiel mir, weil es sich anfühlte, als wäre mein Vater immer noch bei uns. Dann stellte ich mir vor, ich wäre eine königliche Durchlaucht, die den Schlüssel zu ihrem prächtigen Schloss gerade verlegt hatte, ihn aber ganz bestimmt schon bald wieder finden würde. Am Ende machte ich einen Knicks, wenn sie die Augen wieder schloss, und es fühlte sich majestätisch an.
Ich hatte keine Ahnung, warum meine Mutter nichts mit mir und der restlichen Welt zu tun haben wollte, aber mir war klar, dass sie etwas ganz Besonderes war – in gewisser Weise beneidete ich sie sogar darum und lernte schnell von ihr, dass mir die Welt immer dann nichts anhaben konnte, wenn ich mir meine eigene erschuf.
Wenn das Leben leise mitliest
Als ich das mit der einen, der anderen und der eigenen Welt begriffen hatte, fing ich an zu bauen. Ich baute mir kleine Inseln des Glücks und lernte, dass ich sie auch erschaffen konnte, ohne meine Hände dafür zu benutzen. Zuerst existierten sie nur in meinem Kopf, bis ich sie am Weg zur Schule entdeckte – wie das Vogelhaus, das jemand an den Ast der alten Eiche gehängt hatte, über das ich mich jeden Tag freute, oder die rote Schultasche, die genau dann am Eingang zum Müllplatz stand, als ich mir am Vorabend vor dem Einschlafen vorgestellt hatte, dass ich dringend eine neue brauchte. Ich hatte nie erwähnt, dass sie rot sein sollte, aber in meinen Gedanken war sie es, und ich lernte schnell, dass das Leben leise mitlas, wenn man nachdachte – selbst wenn man nichts davon laut aussprach. Meine Inseln des Glücks waren wie kleine Wohlfühlorte für die Seele; sie ließen ein gutes Gefühl herein, das schnell so groß wurde, dass es zu einer Insel heranwuchs, auf der man es sich zusammen mit dem Gefühl so lange gemütlich machen konnte, bis es einen ganz von innen ausfüllte. Die Inseln sahen allerdings völlig unterschiedlich aus: Manchmal handelte es sich um ein Stück Wiese, ein andermal um den Wald, dann wieder um einen Gegenstand, ein Tier, einen Menschen, meine Schultasche, fließendes Wasser oder den Strom. Manche Glücksinseln pflanzte ich als Ideen in die Köpfe anderer Menschen und wartete geduldig darauf, dass sie wenig später aus der Erde wuchsen. Bei anderen fragte ich nach, bis sich jemand darum kümmerte, und wieder andere erschuf ich, indem ich andere Menschen in Gedanken so lange daran erinnerte, bis auch sie sich erinnerten, und ganz rasch etwas Gutes geschah. Ich war überrascht, wie schnell das alles funktionierte. Eines Abends überlegte ich mir beispielsweise, wie schön es wäre, einen eigenen kleinen Garten zu besitzen – mit einer saftig grünen Wiese und bunten Blumen –, in dem ich tagsüber Urlaub machen und noch mehr Glücksinseln erschaffen konnte. Ich malte mir diesen Garten mit meinem Pinsel im Kopf, setzte noch eine gelbe Parkbank darauf und staunte nicht wenig, als der Gärtner Ohleberg schon eine Woche später mit dem Bürgermeister redete, dass er direkt auf den Hauptplatz ein kleines Stück Wiese pflanzen wollte, auf dem er später liebevoll ein paar Tulpen wie eigene Kinder heranzog, um die er sich fürsorglich kümmerte. Der Gärtner Ohleberg hatte aber gar nicht wissen können, dass ich die Wiese zuerst in seinen Kopf gesetzt und er sie erst daraufhin auf den Hauptplatz gepflanzt hatte. Ich wollte ihm diese Freude aber auch nicht nehmen. Mein Glück sang jedoch ganze Hymnen in meiner Brust, und am liebsten hätte ich es in die eine, von mir aus auch in die andere Welt hinausgerufen, aber ich wusste, dass meine Mutter es für völligen Humbug gehalten hätte und das Fernsehgerät zu beschäftigt damit war, die ganzen Katastrophen abzuspielen, die sich unterdessen auf der Welt ereigneten. Ich behielt es daher als mein eigenes kleines Geheimnis und erzählte vorerst niemandem davon. Manchmal fragte ich mich, ob es meiner Mutter im Schreibzimmer genauso erging, wenn sie sich diese Scheißwelt schönmachte. Zu Hause lief ich dann zum Spiegel und war froh darüber, dass mich meine Insel nicht als Monster ausspuckte und ich im Gegensatz zu meiner Mutter hinterher immer noch ganz normal aussah. Es war mir von außen betrachtet gar nicht anzusehen, was die Insel im Inneren mit mir anstellte. Sie machte mich auch nicht müde, sie gab mir einfach nur ein schönes Gefühl. Eines, das mir ganz allein gehörte.
Und so kam es, dass ich an den Nachmittagen nach der Schule immer auf dem kleinen Stück Wiese Urlaub machte, das der Gärtner Ohleberg – für andere zufällig, für mich lange im Voraus geplant – wie einen grünen Teppich am Hauptplatz ausgerollt hatte.
An einem sonnigen Frühlingstag, es war etwa Mitte Mai, als die Sonne wie eine gelbe Glücksmaschine am Himmel stand – an diesem zauberhaften Tag setzte ich mich wie jeden Nachmittag auf die gelbe Holzbank, die der Gärtner Ohleberg auf den grünen Teppich vor die grellpinken Tulpen gestellt hatte, weil er wollte, dass die Menschen eine gute Zeit dort hatten. Das hatte er jedenfalls zum Bürgermeister am Hauptplatz gesagt – ich hatte es ganz deutlich von der Parkbank aus mitangehört. Es war schon faszinierend, dass der Kopf des Gärtners und meiner offenbar ganz eng miteinander verbunden gewesen sein mussten, denn so wie er hatte auch ich schon länger den Eindruck, dass die wenigsten Menschen gerade eine gute Zeit hatten. Wahrscheinlich hatte der Gärtner Ohleberg es genau zu jenem Zeitpunkt bemerkt, als ich ihm den Gedanken mit der Insel des Glücks in den Kopf gepflanzt hatte. Seither strahlte er mich jeden Tag an, wenn er nachmittags an mir vorbeispazierte. Denn außer mir saß sonst niemand auf der gelben Parkbank. Ganz im Gegenteil; ein paar Menschen hatten sich sogar darüber aufgeregt, was der mickrige grüne Fleck mitten am Hauptplatz zu suchen hatte – beinahe so, als stünde er ihrem eigenen Glück im Weg. Umso mehr freute sich der Gärtner Ohleberg darüber, dass ich mich jeden Nachmittag auf seine Parkbank setzte und ihm von einem zum anderen Ohr lächelnd zuwinkte, wenn er an mir vorbeiging. Ich vermutete sogar, dass er dafür den längeren Weg zur Gärtnerei in Kauf nahm, weil er sich so sehr darüber freute – und so waren schon zwei Menschen glücklich darüber, dass es die Insel des Glücks von seinem Kopf auf den Hauptplatz geschafft hatte. Das kleine Stück Wiese war schlussendlich zu meinem zweiten Wohnzimmer geworden. Ganz egal, ob die Sonne erbarmungslos vom Himmel brannte oder eisige Kälte die Welt erstarren ließ – völlig unbeeindruckt davon, ob mir der Wind seinen ganzen Zorn ins Gesicht peitschte, der Regen in Strömen auf mich niederprasselte und ich völlig durchnässt nach Hause zurückkehrte –, nichts davon konnte mir etwas anhaben. Im Laufe der Zeit hatte ich zwar erkannt, dass weder auf Menschen noch auf das Wetter Verlass war, aber ich lernte auch, dass man ihr eigenartiges Verhalten aussitzen konnte, wenn man sich warm genug anzog. Denn so, wie das schlimmste Wetter irgendwann vorüberzog, verhielt es sich auch mit den Launen der Menschen oder den Schwierigkeiten, die das Schicksal für uns bereithielt. Nichts war für immer – sie zogen alle irgendwann vorüber. Rücksicht auf die eigenen Wünsche gab es zwar keine, aber man konnte rücksichtsvoll mit sich selbst umgehen, indem man tief einatmete und dann noch tiefer in den Regen, den Wind oder die Launen der Menschen und des Lebens ausatmete, bis sie sich ausgetobt hatten und von ganz allein auflösten. So überstand man alles.
Das kleine Stück Wiese war längst mehr als nur mein zweites Wohnzimmer – es war zu meiner Heimat geworden. Und Heimat, das wusste ich inzwischen, hing nicht vom Wetter ab. Man fühlt sich entweder zu Hause oder nicht. Also beschloss ich, dass dieses kleine Stück Wiese bei jedem Wetter meine Heimat war. Von dort hatte man einen guten Ausblick auf das Leben: sowohl auf das eigene als auch auf das der anderen Leute. Vor allem aber mochte ich das Gefühl. Denn so ist das mit der Heimat; sie ist zu groß, um sie mit bloßem Auge erfassen zu können. Aber sie hinterlässt ein großes Gefühl, das man in sich trägt, bis man spürt, dass man selbst zur Heimat geworden ist.
An diesem schönen Frühlingstag sah ich jedoch weder die grellpinken Tulpen noch den Gärtner Ohleberg, als er gerade an mir vorbeispazierte – denn wie schon an den Tagen zuvor tat ich nichts anderes, als unablässig auf die rote Haustür zu blicken, die mir von gegenüber schweigend entgegenstarrte. Ich konzentrierte mich angestrengt, denn um nichts in der Welt wollte ich verpassen, was sich schon wenige Minuten später vor meinen Augen ereignen würde, als sich plötzlich meine Freundin Marlene mit einem lauten Rums neben mich fallen ließ. Sie erschreckte mich dabei fast zu Tode – denn um ehrlich zu sein, wusste ich nicht einmal, ob Marlene wirklich meine Freundin war. Sie hatte sich zuvor noch nie zu mir gesetzt und sich auch noch nie für mich oder meine Gesellschaft interessiert. Im Grunde war ich überzeugt davon, dass Marlene mich nicht mochte.
»Was machst du denn da schon wieder, Josefine«, fragte sie, als wäre es etwas Verbotenes, und brannte mir dabei mit ihrem eindringlichen Blick förmlich ein Loch in die Seite.
Wenn ich es mir recht überlegte, wusste ich selbst nicht, ob ich Marlene überhaupt mochte. Vielleicht übte sie aber gerade deswegen eine besondere Faszination auf mich aus. »Ich beobachte die rote Tür«, antwortete ich knapp und sah nur kurz zu ihr, weil ich zwar verwundert war, dass sie sich tatsächlich neben mich gesetzt hatte, gleichzeitig aber fürchtete, jenen besonderen Moment zu verpassen, der sich jeden Augenblick am Hauseingang abspielen würde.
»Das sehe ich. Aber was passiert da?«, murrte Marlene, und es interessierte sie nicht im Geringsten, dass ich mich offensichtlich gerade zu konzentrieren versuchte. Marlene war ganz anders als alle Kinder, aber auch anders als alle Erwachsenen – man könnte sagen, sie passte weder zu den einen noch zu den anderen –, und damit hatten wir etwas gemeinsam. Was uns allerdings unterschied: Marlene war es völlig egal, was andere über sie dachten. Sie war forsch und unverblümt und eigentlich fast immer schlecht gelaunt. An den meisten Tagen setzte sie das Gesicht einer dunkelroten Tomate auf, war wütend auf die ganze Welt und fauchte jeden an, der ihr zu nah kam. Dass ausgerechnet sie mir gerade so nah gekommen war, fand ich überraschend und irritierend zugleich. Marlene wäre an meiner Stelle wahrscheinlich fürchterlich wütend geworden, denn letztlich war sie mir weder eine große Hilfe, noch glänzte sie durch Freundlichkeit. Aber ich durfte nicht wütend sein – denn wütende Menschen, das sagte meine Mutter immer, könne niemand leiden und das Leben würde sie irgendwann dafür bestrafen.
Daher hatte ich mir das mit der Wut schnell wieder abgewöhnt, und nun schenkte ich Marlene ein Lächeln, bevor ich gleich wieder zur Tür zurückblickte. »Ich warte darauf, dass die Frau vom Schuster rauskommt.«
Schuster der Wut
Die Frau vom Schuster war im Gegensatz zu mir sehr oft wütend. Manchmal stieß sie sogar mit dem Fuß gegen die rote Tür, wenn sie nicht sofort aufging. Danach sah sie nach links und rechts, ob sie jemand bemerkt hatte. Doch sie hatte Glück: Sie sah mich nie und konnte daher nicht wissen, dass ich sie beobachtet hatte. Ich glaube, sie wollte auch nicht gesehen werden, und vielleicht hatte sie genau aus diesem Grund eine gewisse Kurzsichtigkeit gegenüber kleinen Mädchen entwickelt, die ihr dabei zusahen, wenn sie wütend war. Die Sache mit dem Tritt gegen die Tür konnte aber auch nur sie sich leisten, denn hätte sie den Schuh dabei kaputt gemacht, wäre sie immer noch mit dem Schuster verheiratet gewesen und der hätte ihn jederzeit reparieren können.
Irgendetwas schien jedoch hinter der roten Tür zu passieren. Immer dann, wenn die Frau vom Schuster nach einer, vielleicht auch zwei Stunden wieder aus der Tür trat, war ihre Wut vollkommen verschwunden. Nichts in ihrem Gesicht oder an ihrem Körper vermittelte mehr den geringsten Hinweis auf die Wut, mit der sie eben noch das Haus betreten hatte. Normalerweise lässt sich Wut jedoch ganz leicht erkennen: Sie malt Gesichter tomatenrot oder versteckt einen Stock im Körper, der ihn ganz steif macht. Aber nichts davon war noch übrig, wenn sie wieder aus der Tür spazierte. Manchmal lächelte sie sogar – an anderen Tagen liefen ihr bleierne Tränen über die Wangen –, aber die Wut war jedes Mal wie weggezaubert. Ich fragte mich, ob es hinter der Mauer so etwas wie einen Schuster für die Wut gab, der etwas in den Menschen flickte oder gar reparierte – denn was auch immer in diesem Haus passierte, die Menschen kamen ganz anders aus der Tür heraus, als sie hineingegangen waren.
»Du meinst die Frau vom Schuster, die immer alle Kinder schimpft?«, fragte Marlene mit beißender Schärfe.
Ich nickte, ohne den Blick von der Tür zu wenden. Die Wut bei Erwachsenen war schließlich nichts Verbotenes, man hätte sie daher nicht zwingend reparieren müssen. Ich kannte viele wütende Erwachsene. Einer von ihnen war Lehrer Uhlig, der außer auf die Mathematik auf alles in der Welt wütend war. Ich glaube, er hatte sogar eine eigene Formel dafür entwickelt; so etwas wie Wut hoch Wut war Lehrer Uhlig – potenziert bis in die Ewigkeit. Ganz besonders wütend war er auf das Wetter, denn egal, ob gerade die Sonne schien, es regnete, stürmte oder schneite, er ließ jedes Mal, wenn er das Klassenzimmer betrat, seinen Aktenkoffer – in dem sich lediglich ein sehr kleiner Taschenrechner befand – auf den Tisch knallen und rief: »Was ist das heute nur wieder für ein Scheißwetter!« Er mochte wohl keines davon. Er konnte nicht einmal etwas Gutes daran finden, wenn die gelbe Glücksmaschine am Himmel stand.