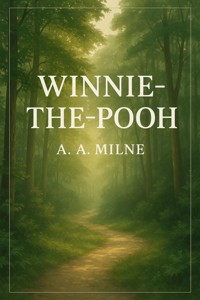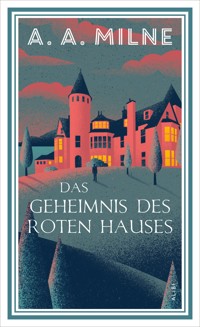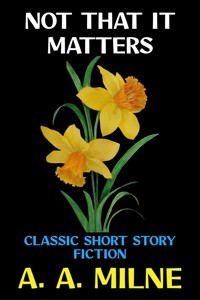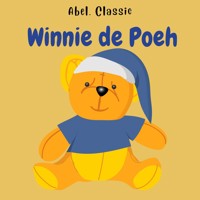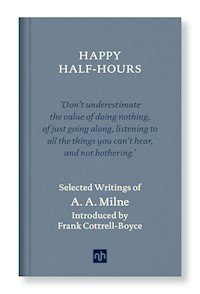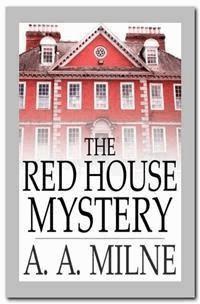3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KI Classics
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Willkommen im Roten Haus – einem beschaulichen englischen Landsitz, der alles bietet: gepflegte Rasenflächen, distinguierte Gäste, ein geheimnisvoller Bruder aus Australien … und plötzlich eine Leiche. Als der wohlhabende Mark Ablett Besuch von seinem lange verschollenen Bruder erhält, endet die Familienzusammenführung nicht gerade harmonisch: Ein Schuss fällt, die Tür ist verschlossen – und der Bruder ist tot. Zum Glück ist Antony Gillingham zur Stelle – zufällig zu Besuch, aber detektivisch begabt. Unterstützt von seinem begeisterten, wenn auch leicht schusseligen Freund Bill Beverley, stürzt er sich mit britischem Elan in die Ermittlungen. Was folgt, ist ein unterhaltsames Katz-und-Maus-Spiel mit verschlossenen Türen, widersprüchlichen Zeugen und einem Krocketspiel, das vielleicht mehr verrät, als es sollte. Das Geheimnis im Roten Haus ist ein Kriminalroman mit augenzwinkerndem Humor, liebevoll gezeichneten Charakteren und dem Charme eines klassischen Whodunits. A. A. Milne, der Schöpfer von Pu der Bär, beweist hier sein Talent für pointierte Dialoge, feinsinnige Ironie und meisterhaftes Erzähltempo. Wer britischen Humor liebt, Detektive mit Eigenheiten schätzt und gerne beim Miträtseln schmunzelt, findet in diesem Roman einen echten Leckerbissen. Keine blutigen Abgründe, sondern ein kultiviertes Verwirrspiel voller Witz und Stil – ein Klassiker der intelligenten Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1. Mrs. Stevens erschrickt
In der schläfrigen Hitze des Sommernachmittags hielt das Rote Haus seine Siesta. Ein träges Summen der Bienen lag über den Blumenrabatten, ein sanftes Gurren der Tauben kam aus den Wipfeln der Ulmen. Von fernen Rasenflächen drang das Surren eines Rasenmähers herüber – das wohl beruhigendste aller Geräusche auf dem Land –, und machte die eigene Ruhe umso süßer, weil andere in dieser Zeit arbeiteten.
Es war die Stunde, in der selbst diejenigen, deren Aufgabe es ist, sich um andere zu kümmern, einen Moment für sich selbst finden. Im Raum der Haushälterin saß Audrey Stevens, das hübsche Stubenmädchen, und verzierte gerade ihren besten Hut neu, während sie sich mit ihrer Tante unterhielt, der Köchin und Haushälterin im Junggesellenhaushalt von Mr. Mark Ablett.
„Für Joe?“, fragte Mrs. Stevens gelassen und mit Blick auf den Hut. Audrey nickte, nahm eine Stecknadel aus dem Mund, fand einen Platz dafür im Hut und sagte: „Er mag ein bisschen Rosa.“
„Ich sag ja nichts gegen ein bisschen Rosa“, meinte ihre Tante. „Joe Turner ist nicht der Einzige.“
„Steht aber nicht jedem“, sagte Audrey, hielt den Hut auf Armeslänge und betrachtete ihn prüfend. „Sieht schick aus, oder?“
„Wird dir schon stehen – hätte mir in deinem Alter auch gestanden. Für mich ist’s jetzt etwas zu auffällig, obwohl ich mich besser halte als manch andere. Ich war nie eine, die sich für was ausgibt, was sie nicht ist. Wenn ich fünfundfünfzig bin, dann bin ich eben fünfundfünfzig – so sag ich das immer.“
„Achtundfünfzig, nicht wahr, Tantchen?“
„Das war jetzt nur ein Beispiel“, sagte Mrs. Stevens mit großer Würde.
Audrey fädelte eine Nadel ein, hielt kurz ihre Hand hoch, um ihre Nägel kritisch zu begutachten, und begann dann zu nähen.
„Schon merkwürdig, das mit Mr. Marks Bruder. Stell dir vor, den eigenen Bruder fünfzehn Jahre nicht zu sehen.“ Sie lachte ein wenig verlegen. „Was ich wohl machen würde, wenn ich Joe fünfzehn Jahre nicht sähe?“
„Wie ich euch heute früh allen gesagt hab“, erwiderte ihre Tante, „ich bin jetzt seit fünf Jahren hier und habe noch nie was von einem Bruder gehört. Das könnt ich vor aller Welt sagen, wenn ich morgen sterben müsste. In der ganzen Zeit war hier kein Bruder.“
„Ich wär fast hintenüber gefallen, als er heute beim Frühstück von ihm sprach. Ich hab das vorher nicht mitbekommen, aber als ich reinkam – wofür war das noch mal? Heiße Milch? Oder Toast? – na ja, auf jeden Fall redeten sie alle über den Bruder, und Mr. Mark sagt zu mir – du kennst ja seine Art –: ‚Stevens‘, sagt er, ‚mein Bruder kommt mich heute Nachmittag besuchen. Ich erwarte ihn so gegen drei.‘ Und dann: ‚Führen Sie ihn ins Arbeitszimmer.‘ Ganz einfach so. ‚Jawohl, Sir‘, sag ich, ganz ruhig, aber ich war völlig verdattert, ich wusste ja nicht mal, dass er einen Bruder hat. ‚Mein Bruder aus Australien‘, sagt er – das hätte ich fast vergessen. Aus Australien.“
„Na ja, möglich, dass er in Australien war“, meinte Mrs. Stevens sachlich. „Davon versteh ich nichts, ich kenn das Land ja nicht. Aber eins weiß ich: Hier im Haus war er nicht. Nicht in den fünf Jahren, die ich hier bin.“
„Aber Tantchen, er war doch fünfzehn Jahre nicht hier. Ich hab gehört, wie Mr. Mark das zu Mr. Cayley gesagt hat. ‚Fünfzehn Jahre‘, sagt er. Weil Mr. Cayley gefragt hatte, wann der Bruder zuletzt in England war. Mr. Cayley kannte ihn vom Hörensagen – hat er Mr. Beverley erzählt –, aber nicht, wann er zuletzt hier war. Deswegen hat er Mr. Mark gefragt.“
„Ich sag ja nichts zu fünfzehn Jahren, Audrey. Ich kann nur sagen, was ich weiß – und das sind Pfingsten fünf Jahre. Ich könnt schwören, dass der keinen Fuß ins Haus gesetzt hat, seit Pfingsten vor fünf Jahren. Und wenn er in Australien war, wie du sagst, dann hat er wohl seine Gründe gehabt.“
„Was für Gründe denn?“, fragte Audrey leicht dahin.
„Das geht dich gar nichts an. Ich bin dir wie eine Mutter, seit deine arme Mutter gestorben ist, also sag ich dir das, Audrey: Wenn ein Gentleman nach Australien geht, hat er seine Gründe. Und wenn er fünfzehn Jahre dort bleibt, wie Mr. Mark sagt – und ich meine es ja selbst für fünf Jahre –, dann hat er seine Gründe. Und ein ordentlich erzogenes Mädchen fragt nicht nach solchen Gründen.“
„Hat wohl was ausgefressen“, meinte Audrey gleichgültig. „Beim Frühstück hieß es, er sei ein Wilder gewesen. Schulden. Ich bin froh, dass Joe nicht so ist. Der hat fünfzehn Pfund auf der Bank – hab ich dir das erzählt?“
Doch über Joe Turner wurde an diesem Nachmittag nicht weiter gesprochen. Eine Glocke ertönte, und Audrey stand auf – nicht mehr Audrey, sondern Stevens. Sie rückte ihre Haube vor dem Spiegel zurecht.
„Da, das ist die Haustür“, sagte sie. „Das ist er. ‚Führen Sie ihn ins Arbeitszimmer‘, hat Mr. Mark gesagt. Wahrscheinlich will er nicht, dass die anderen Damen und Herren ihn sehen. Na ja, die sind eh alle beim Golf... Ob er bleibt? Vielleicht hat er eine Menge Gold aus Australien mitgebracht... Ich könnte was über Australien erfahren – wenn man dort Gold findet, dann sag ich nicht, dass Joe und ich nicht auch...“
„Na, na, geh schon, Audrey.“
„Geh ja schon, Tantchen.“ Sie ging hinaus.
Wer in der Augustsonne gerade die Auffahrt hinunterkam, dem erschien der offene Eingang des Roten Hauses wie eine wohltuende Einladung: allein schon der Anblick der Halle war kühlend. Es war ein großer, niedriggedeckter Raum mit Eichenbalken, cremefarben gestrichenen Wänden und bleiverglasten Fenstern mit blauen Vorhängen. Rechts und links führten Türen in andere Wohnräume, die gegenüberliegende Wand war ebenfalls mit Fenstern versehen, durch die man auf einen kleinen grasbedeckten Innenhof blickte. Von Fenster zu Fenster zog ein leichter Luftzug. Die Treppe stieg auf der rechten Seite mit breiten, flachen Stufen empor, bog nach links ab und führte über eine Galerie entlang der Breite der Halle zu den Schlafzimmern – vorausgesetzt, man blieb über Nacht. Was Mr. Robert Ablett in dieser Hinsicht vorhatte, war noch nicht bekannt.
Als Audrey durch die Halle ging, zuckte sie kurz zusammen: Mr. Cayley saß plötzlich sichtbar auf einem Stuhl unter einem der vorderen Fenster und las. Kein Grund, warum er nicht dort sitzen sollte – bei dieser Hitze war es dort gewiss angenehmer als auf dem Golfplatz. Doch das Haus hatte an diesem Nachmittag etwas Verlassenes an sich, als seien alle Gäste draußen oder – vielleicht am klügsten – oben in ihren Zimmern, schlafend. Mr. Cayley, der Cousin des Hausherrn, war eine Überraschung. Audrey erschrak ein wenig, errötete und sagte: „Oh, entschuldigen Sie, Sir, ich habe Sie zuerst gar nicht gesehen“, worauf er von seinem Buch aufsah und sie anlächelte. Ein anziehendes Lächeln auf diesem großen, wenig schönen Gesicht. „So ein Gentleman“, dachte Audrey bei sich, während sie weiterging, „was würde der Herr bloß ohne ihn machen?“ Wenn dieser Bruder zum Beispiel wieder nach Australien zurückgeschickt werden müsste – dann würde Mr. Cayley das in die Hand nehmen.
„Also das ist Mr. Robert“, sagte Audrey zu sich, als sie den Besucher erblickte.
Später erzählte sie ihrer Tante, sie hätte ihn auf den ersten Blick als Mr. Marks Bruder erkannt – aber das hätte sie so oder so gesagt. In Wahrheit war sie überrascht. Der adrette kleine Mark mit seinem fein gezwirbelten Spitzbart und dem sorgfältig gebogenen Schnurrbart; mit seinen flink umherschnellenden Augen, die in jeder Gesellschaft nach dem nächsten Lächeln suchten – wenn er einen guten Witz gemacht hatte – oder nach einem erwartungsvollen Blick, wenn er gleich an der Reihe war, einen zu machen: er war ein ganz anderer Mensch als dieser grob wirkende, schlecht gekleidete Kolonialtyp, der sie so finster anstarrte.
„Ich will Mr. Mark Ablett sprechen“, knurrte er. Das klang fast wie eine Drohung.
Audrey fasste sich, schenkte ihm ein beruhigendes Lächeln – für jeden hatte sie ein Lächeln.
„Jawohl, Sir. Er erwartet Sie. Wenn Sie bitte hier entlang möchten.“
„Oh! Du weißt also, wer ich bin, was?“
„Mr. Robert Ablett?“
„Aye, stimmt. Er erwartet mich also, was? Wird sich freuen, mich zu sehen, was?“
„Wenn Sie bitte hier entlang möchten, Sir“, sagte Audrey förmlich.
Sie ging zur zweiten Tür auf der linken Seite und öffnete sie.
„Mr. Robert Ab—“, begann sie, brach dann ab. Der Raum war leer. Sie wandte sich an den Mann hinter ihr: „Wenn Sie bitte kurz Platz nehmen möchten, Sir, ich hole den Hausherrn. Ich weiß, dass er da ist, denn er sagte mir, dass Sie heute Nachmittag kommen würden.“
„Oh!“ Er schaute sich im Raum um. „Wie nennt man das hier?“
„Das Arbeitszimmer, Sir.“
„Das Arbeitszimmer?“
„Der Raum, in dem der Herr arbeitet, Sir.“
„Arbeitet, was? Das ist mir neu. Hätte nicht gedacht, dass er je einen Finger krumm gemacht hat.“
„Wo er schreibt, Sir“, sagte Audrey mit Würde. Die Tatsache, dass Mr. Mark „schrieb“, obwohl niemand so genau wusste, was, war im Raum der Haushälterin ein Grund zum Stolz.
„Nicht fein genug fürs Gesellschaftszimmer, was?“
„Ich sage dem Herrn, dass Sie da sind, Sir“, entgegnete Audrey bestimmt.
Sie schloss die Tür und ließ ihn dort.
Na, da hatte sie was zu erzählen! In Gedanken ging sie alles durch, was er zu ihr gesagt hatte, und was sie zu ihm gesagt hatte – ganz ruhig. „Kaum hab ich ihn gesehen, hab ich mir gedacht –“ Ja, man hätte sie mit einer Feder umpusten können. Federn waren überhaupt eine ständige Bedrohung für Audrey.
Aber jetzt ging es erst einmal darum, den Hausherrn zu finden. Sie ging durch die Halle zur Bibliothek, warf einen Blick hinein, kam etwas unentschlossen zurück und blieb vor Cayley stehen.
„Entschuldigen Sie, Sir“, sagte sie leise und respektvoll, „wissen Sie, wo der Herr ist? Mr. Robert ist angekommen.“
„Was?“, sagte Cayley und blickte von seinem Buch auf. „Wer?“
Audrey wiederholte ihre Frage.
„Weiß nicht. Ist er nicht im Arbeitszimmer? Nach dem Mittagessen ist er zum Tempel gegangen. Ich glaube nicht, dass ich ihn seitdem gesehen habe.“
„Danke, Sir. Ich gehe zum Tempel.“
Cayley vertiefte sich wieder in sein Buch.
Der „Tempel“ war ein gemauertes Gartenhäuschen auf dem Grundstück hinter dem Haus, etwa dreihundert Meter entfernt. Hier zog sich Mark gelegentlich zurück, um nachzudenken, ehe er ins „Arbeitszimmer“ ging, um seine Gedanken zu Papier zu bringen. Große Gedanken waren es nicht, zudem wurden sie häufiger beim Abendessen ausgesprochen als aufgeschrieben, und häufiger aufgeschrieben als veröffentlicht. Dennoch war der Hausherr des Roten Hauses stets leicht verletzt, wenn ein Gast den Tempel achtlos behandelte – als wäre er nur für Flirts oder zum Rauchen gedacht. Einmal waren zwei Gäste dabei ertappt worden, wie sie dort Squash spielten. Mark hatte damals nichts weiter gesagt, außer mit leicht spitzem Ton gefragt, ob sie keinen anderen Platz für ihr Spiel gefunden hätten. Eingeladen wurden diese Gäste nie wieder.
Audrey ging langsam zum Tempel, schaute hinein und kam ebenso langsam zurück. Der ganze Weg umsonst. Vielleicht war der Herr oben in seinem Zimmer. „Nicht fein genug fürs Gesellschaftszimmer.“ Na, Tantchen, würdest du jemand mit rotem Halstuch, riesigen staubigen Stiefeln und – Moment! Jemand schießt auf Kaninchen. Tantchen mochte Kaninchen gern, mit Zwiebelsauce. Wie heiß es war; eine Tasse Tee wäre jetzt recht. Nun, eines war sicher: Mr. Robert blieb nicht über Nacht – er hatte kein Gepäck. Natürlich, Mr. Mark konnte ihm etwas leihen; er hatte Kleider für sechs. Sie hätte ihn überall als Mr. Marks Bruder erkannt.
Sie trat ins Haus. Als sie auf dem Weg zur Halle an der Tür zum Raum der Haushälterin vorbeikam, öffnete sich diese plötzlich, und ein erschrockenes Gesicht blickte hinaus.
„Hallo, Aud“, sagte Elsie. „Es ist Audrey“, sagte sie und ließ sie eintreten.
„Komm rein, Audrey“, rief Mrs. Stevens.
„Was ist los?“, fragte Audrey und schaute in den Raum.
„Ach, Kindchen, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Wo warst du?“
„Beim Tempel.“
„Hast du nichts gehört?“
„Was denn gehört?“
„Knalle, Explosionen und fürchterliche Sachen!“
„Ach so“, sagte Audrey, sichtlich erleichtert. „Einer der Männer schießt auf Kaninchen. Ich hab mir gerade gedacht, als ich kam: ‚Tantchen mag ein gutes Kaninchen‘, hab ich gesagt, und ich würd mich nicht wundern, wenn—“
„Kaninchen!“, rief ihre Tante verächtlich. „Das war im Haus, Mädchen.“
„Ganz bestimmt!“, sagte Elsie. Sie war eines der Hausmädchen. „Ich hab’s zu Mrs. Stevens gesagt – nicht wahr, Mrs. Stevens? –: ‚Das war im Haus‘, hab ich gesagt.“
Audrey blickte von ihrer Tante zu Elsie.
„Meint ihr, er hatte einen Revolver dabei?“, flüsterte sie.
„Wer?“, fragte Elsie aufgeregt.
„Der Bruder. Aus Australien. Ich hab’s gleich gesagt, als ich ihn sah: ‚Du bist kein Guter, mein Lieber!‘ Das hab ich gesagt, Elsie. Noch bevor er mit mir gesprochen hat. Unhöflich!“, wandte sie sich an ihre Tante. „Ich geb dir mein Wort.“
„Wie ich immer gesagt habe, Audrey: Man weiß nie, was man von so einem aus Australien zu halten hat.“ Mrs. Stevens lehnte sich zurück, atmete schwer. „Ich geh jetzt nicht mehr raus. Nicht für hunderttausend Pfund.“
„Ach, Mrs. Stevens!“, sagte Elsie, die dringend fünf Schillinge für neue Schuhe brauchte, „so weit würd ich nun auch nicht gehen, aber—“
„Da!“, rief Mrs. Stevens und fuhr erschrocken auf. Alle lauschten, die beiden Mädchen rückten instinktiv näher an den Sessel der Älteren.
Eine Tür wurde gerüttelt, getreten, gerappelt.
„Hört!“
Audrey und Elsie sahen sich erschrocken an.
Sie hörten eine Männerstimme, laut, wütend.
„Mach auf – die Tür!“, brüllte sie. „Mach auf! Ich sag, aufmachen!“
„Macht die Tür nicht auf!“, kreischte Mrs. Stevens panisch, als ginge es um ihre Tür. „Audrey! Elsie! Lasst ihn nicht rein!“
„Verdammt, macht die Tür auf!“, brüllte die Stimme erneut.
„Wir werden alle im Schlaf ermordet!“, wimmerte sie. Entsetzt drängten sich die beiden Mädchen enger an sie, und mit einem Arm um jede von ihnen saß Mrs. Stevens da – und wartete.
2. Mr. Gillingham steigt falsch aus
Ob Mark Ablett ein Langweiler war oder nicht, hing vom Standpunkt ab. Sicher aber war: Er langweilte seine Gäste nie mit Erzählungen aus seiner Jugend. Trotzdem machen Geschichten die Runde. Irgendjemand weiß immer etwas. Es galt als bekannt – zumindest laut Marks eigener Aussage –, dass sein Vater Landpfarrer gewesen sei. Man sagte, Mark habe als Junge die Aufmerksamkeit und Förderung einer wohlhabenden alten Jungfer aus der Nachbarschaft erregt, die seine Schul- und Universitätsausbildung finanzierte. Etwa zu der Zeit, als er Cambridge verließ, starb sein Vater; er hinterließ ein paar Schulden – als Warnung für die Familie – und den Ruf besonders kurzer Predigten – als Vorbild für seinen Nachfolger. Weder Warnung noch Vorbild zeigten große Wirkung. Mark ging nach London, bezog Unterhalt von seiner Gönnerin und machte – so ist man sich allgemein einig – Bekanntschaft mit den Geldverleihern. Für seine Förderin und alle, die fragten, hieß es, er „schreibe“; doch was genau er schrieb, außer Briefen mit der Bitte um Zahlungsaufschub, blieb im Dunkeln. Immerhin besuchte er regelmäßig Theater und Varietés – vermutlich im Hinblick auf ernsthafte Beiträge im Spectator über den Verfall der englischen Bühne.
Zum Glück – aus Marks Sicht – starb seine Gönnerin im dritten Jahr seines Londoner Aufenthalts und vermachte ihm alles Geld, das er brauchte. Von diesem Moment an verließ seine Lebensgeschichte das Reich der Legenden und wurde geschichtlicher. Er bezahlte die Geldverleiher, überließ die wilden Jahre anderen und wurde selbst ein Gönner. Er förderte die Künste. Nicht nur Wucherer erfuhren nun, dass Mark Ablett nicht mehr für Geld schrieb; auch Herausgeber bekamen Gratisbeiträge – samt Gratislunch. Verleger schlossen Verträge über gelegentliche, schmale Bändchen, deren Druckkosten der Autor übernahm und auf Tantiemen verzichtete. Vielversprechende junge Maler und Dichter speisten an seinem Tisch. Sogar eine Theatertruppe nahm er mit auf Tournee – als Gastgeber und Hauptdarsteller gleichermaßen freigiebig.
Er war nicht das, was man gewöhnlich einen Snob nennt. Ein Snob, sagt man leichtfertig, sei jemand, der Adelige liebt – oder, etwas präziser, ein niederträchtiger Verehrer niederträchtiger Dinge. Sollte Letzteres zutreffen, wäre es eine Gemeinheit gegenüber dem Hochadel. Mark hatte zweifellos seine Eitelkeiten, doch er traf lieber einen Theaterdirektor als einen Grafen; hätte er mit Dante befreundet sein können, hätte er diese Freundschaft bereitwilliger erwähnt als eine mit dem Herzog. Nennen Sie ihn also ruhig einen Snob – aber nicht die schlimmste Sorte. Ein Mitläufer, ja, aber einer, der sich an die Schleppe der Kunst hängte, nicht an die der Gesellschaft; ein Emporkömmling, aber am Hang des Parnass, nicht am Hay Hill.
Seine Gönnerschaft machte nicht bei den Künsten halt. Sie umfasste auch Matthew Cayley, einen kleinen Cousin von dreizehn Jahren, dessen Lebensumstände ebenso beschränkt waren wie Marks eigene, ehe seine Gönnerin ihn gefördert hatte. Mark schickte den jungen Cayley auf die Schule und nach Cambridge. Seine Motive waren anfangs sicher uneigennützig – eine Rückzahlung im Buch des Engels der Aufzeichnung, ein Schatz im Himmel. Doch je älter der Junge wurde, desto mehr dürften Marks Pläne auch eigene Interessen verfolgt haben. Ein entsprechend gebildeter Matthew Cayley mit dreiundzwanzig war für ihn ein nützlicher Besitz – für einen Mann, dessen Eitelkeiten ihm kaum Zeit für seine eigenen Angelegenheiten ließen.
Cayley also kümmerte sich mit dreiundzwanzig um die Angelegenheiten seines Cousins. Inzwischen hatte Mark das Rote Haus gekauft – samt einem stattlichen Grundstück. Cayley beaufsichtigte das nötige Personal. Seine Aufgaben waren vielfältig. Nicht ganz Sekretär, nicht ganz Verwalter, nicht ganz Berater, nicht ganz Gesellschafter – sondern von allem ein wenig. Mark verließ sich auf ihn und nannte ihn „Cay“, denn „Matthew“ war ihm, zu Recht, zu steif. Cay war vor allem eines: verlässlich – ein breitschultriger, kantiger Mann, der einen nicht mit unnötigem Gerede belästigte – ein Segen für jemanden wie Mark, der das Reden lieber selbst übernahm.
Cayley war jetzt achtundzwanzig, sah aber aus wie vierzig – genau wie sein Gönner. Von Zeit zu Zeit war das Rote Haus gut besucht, und Marks Vorliebe – nennen wir es Freundlichkeit oder Eitelkeit – galt Gästen, die seine Gastfreundschaft nicht erwidern konnten. Schauen wir uns die Frühstücksrunde an, von der Stevens, das Stubenmädchen, uns bereits einen ersten Eindruck gegeben hat.
Der Erste war Major Rumbold, ein hochgewachsener, grauhaariger, grauschnurrbärtiger Mann im Norfolk-Jackett und grauen Flanellhosen. Er lebte von seiner Pension und schrieb naturkundliche Artikel für Zeitungen. Er musterte die Platten auf dem Buffettisch, entschied sich bedächtig für Kedgeree und machte sich daran. Bei Ankunft des Nächsten war er bereits bei der Wurst. Es war Bill Beverley, ein fröhlicher junger Mann in weißen Flanellhosen und einem Blazer.
„Hallo, Major“, sagte er beim Eintreten. „Wie geht’s dem Gichtfuß?“
„Es ist keine Gicht“, brummte der Major.
„Na, was auch immer es ist.“
Der Major grunzte.
„Ich lege Wert auf Höflichkeit beim Frühstück“, sagte Bill und schöpfte sich großzügig Porridge auf. „Die meisten Leute sind da so ungehobelt. Deshalb hab ich gefragt. Aber verraten Sie’s nicht, wenn’s ein Geheimnis ist. Kaffee?“ fragte er und goss sich eine Tasse ein.
„Nein, danke. Ich trinke nie, bevor ich mit dem Essen fertig bin.“
„Ganz richtig, Major – das gebietet der Anstand.“ Er setzte sich gegenüber. „Na, wir haben einen schönen Tag für unser Spiel. Es wird verdammt heiß, aber das ist unser Vorteil – Betty und ich. Am fünften Grün wird Ihre alte Wunde, die Sie in jenem Grenzgefecht ’43 erlitten haben, sich melden; am achten gibt die Leber den Geist auf – durch zu viel Curry; und am zwölften—“
„Ach, halten Sie die Klappe, Sie Esel!“
„Ich warne Sie ja nur. Hallo – guten Morgen, Miss Norris. Ich habe dem Major gerade erzählt, was ihn und Sie heute erwartet. Brauchen Sie Hilfe oder möchten Sie Ihr Frühstück selbst aussuchen?“
„Bitte bleiben Sie sitzen“, sagte Miss Norris. „Ich nehme mir selbst. Guten Morgen, Major.“ Sie schenkte ihm ein freundliches Lächeln. Der Major nickte.
„Guten Morgen. Wird heiß heute.“
„Wie ich gerade sagte“, begann Bill, „da kommt—Hallo, hier ist Betty. Morgen, Cayley.“
Betty Calladine und Cayley waren gemeinsam hereingekommen. Betty war die achtzehnjährige Tochter von Mrs. John Calladine, Witwe eines Malers, die diesmal für Mark die Gastgeberin spielte. Ruth Norris nahm sich als Schauspielerin ernst – und im Urlaub als ernsthafte Golferin. In beidem war sie durchaus kompetent. Weder die Stage Society noch Sandwich konnten sie schrecken.
„Übrigens, der Wagen kommt um halb elf“, sagte Cayley, den Blick in seine Briefe vertieft. „Ihr esst dort zu Mittag und fahrt danach gleich zurück. Richtig?“
„Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht zwei Runden spielen sollten“, meinte Bill hoffnungsvoll.
„Am Nachmittag ist’s viel zu heiß“, sagte der Major. „Zur Teestunde bequem zurück.“
Mark kam herein. Er war meistens der Letzte. Er grüßte und setzte sich zu Toast und Tee. Frühstück war nicht seine Mahlzeit. Die anderen plauderten leise, während er seine Briefe las.
„Donnerwetter!“, sagte Mark plötzlich.
Alle Köpfe wandten sich instinktiv zu ihm. „Verzeihung, Miss Norris. Tut mir leid, Betty.“
Miss Norris lächelte nachsichtig. Sie hätte das selbst oft sagen mögen – besonders bei Proben.
„Sag mal, Cay!“ Er runzelte die Stirn – verärgert, verwundert. Er hielt einen Brief hoch und schüttelte ihn. „Rate mal, von wem der ist?“
Cayley am anderen Tischende zuckte mit den Schultern. Woher sollte er das wissen?
„Robert“, sagte Mark.
„Robert?“ Es war schwer, Cayley zu überraschen. „Na und?“
„‚Na und‘ ist leicht gesagt“, erwiderte Mark gereizt. „Er kommt heute Nachmittag hierher.“
„Ich dachte, der sei in Australien – oder sonstwo.“
„Natürlich. Ich auch.“ Er blickte zu Rumbold. „Haben Sie Brüder, Major?“
„Nein.“
„Dann mein Rat: Legen Sie sich keine zu.“
„Wird wohl kaum noch passieren“, meinte der Major.
Bill lachte. Miss Norris sagte höflich: „Aber Sie haben doch keine Brüder, Mr. Ablett?“
„Einen“, sagte Mark finster. „Wenn ihr zurück seid, werdet ihr ihn kennenlernen. Wahrscheinlich bittet er euch um fünf Pfund. Gebt sie ihm nicht.“
Ein leichtes Unbehagen machte sich breit.
„Ich hab einen Bruder“, warf Bill aufmunternd ein, „aber ich leihe immer von ihm.“
„Wie Robert“, sagte Mark.
„Wann war er das letzte Mal in England?“, fragte Cayley.
„Vor etwa fünfzehn Jahren, oder? Du warst natürlich noch ein Junge.“
„Ja, ich erinnere mich, ihn damals einmal gesehen zu haben, wusste aber nicht, ob er seither wieder hier war.“
„Nein. Meines Wissens nicht.“ Mark, noch immer sichtlich verstimmt, widmete sich wieder seinem Brief.
„Ich persönlich“, sagte Bill, „finde Verwandtschaft überbewertet.“
„Trotzdem“, sagte Betty etwas gewagt, „es muss doch spannend sein, ein Skelett im Schrank zu haben.“
Mark blickte finster auf.
„Wenn du das spannend findest, kannst du ihn gern haben, Betty. Wenn er auch nur annähernd so ist wie früher – oder wie seine paar Briefe – dann weiß Cay ja Bescheid.“
Cayley grunzte.
„Ich wusste nur, dass man nicht nach ihm fragt.“
Vielleicht sollte das ein Wink an allzu neugierige Gäste sein, nicht weiter zu bohren – oder ein Hinweis an den Gastgeber, vor Fremden nicht zu viel preiszugeben. Doch das Thema erstarb, und man wandte sich erfreut dem Vierer nach dem Frühstück zu. Mrs. Calladine würde die Spieler begleiten und in der Nähe mit einer alten Freundin zu Mittag essen. Mark und Cayley blieben zu Hause – wegen „Geschäften“. Offenbar zählte dazu nun auch der verlorene Bruder. Doch das sollte dem Spielvergnügen keinen Abbruch tun.
Etwa zur gleichen Zeit, als der Major (aus welchen Gründen auch immer) am sechzehnten Loch einen Fehlschlag hinlegte und Mark mit seinem Cousin geschäftlich im Roten Haus beschäftigt war, gab ein gewisser Mr. Antony Gillingham am Bahnhof Woodham seine Fahrkarte ab und fragte nach dem Weg ins Dorf. Nachdem man ihm den Weg erklärt hatte, ließ er seine Tasche beim Stationsvorsteher und ging gemächlich los. Er ist eine zentrale Figur dieser Geschichte, daher wollen wir ihn uns kurz näher anschauen, bevor wir ihn loslassen. Halten wir ihn oben auf dem Hügel mit einem Vorwand an und werfen einen Blick auf ihn.
Das Erste, was auffällt: Er betrachtet uns mehr als wir ihn. Über einem klar geschnittenen, glattrasierten Gesicht – wie man es meist mit der Marine verbindet – sitzen ein Paar grauer Augen, die scheinbar jedes Detail unseres Äußeren aufsaugen. Für Fremde kann dieser Blick im ersten Moment fast beunruhigend wirken, bis man merkt, dass seine Gedanken oft ganz woanders sind. Seine Augen lässt er wie Wächter zurück, während sein Geist einem eigenen Faden folgt. Natürlich tun das viele – wenn man z. B. mit einer Person redet und einer anderen zuhört – aber ihre Augen verraten sie. Antonys taten das nie.
Mit diesen Augen hatte er die Welt gesehen – allerdings nicht als Seemann. Als er mit einundzwanzig das Erbe seiner Mutter antrat – vierhundert Pfund jährlich –, blickte Vater Gillingham von der Stockbreeders’ Gazette auf und fragte, was er nun vorhabe.
„Die Welt sehen“, sagte Antony.
„Na, schick mir ’ne Karte aus Amerika – oder wo auch immer du landest.“
„Mach ich“, sagte Antony.
Der Alte vertiefte sich wieder in seine Zeitung. Antony war der jüngere Sohn und auf väterlicher Seite weit weniger interessant als etwa Champion Birkets Nachwuchs – jener Champion Birket, der übrigens der beste Hereford-Bulle war, den er je gezüchtet hatte.
Antony jedoch hatte nicht vor, weiter zu reisen als bis London. „Die Welt sehen“ bedeutete für ihn: Menschen sehen – und zwar aus möglichst vielen Perspektiven. In London gibt es alle Sorten Menschen – wenn man weiß, wie man hinschaut. Also beobachtete Antony – aus allerlei ungewöhnlichen Blickwinkeln: als Kammerdiener, Zeitungsreporter, Kellner, Verkäufer. Mit einem sicheren Einkommen im Rücken genoss er es in vollen Zügen. Nie blieb er lange in einem Beruf – und schloss meist mit einem Bruch der Etikette, indem er dem Arbeitgeber sagte, was er wirklich von ihm hielt. Neue Stellen fand er ohne Mühe. Statt Zeugnissen bot er Persönlichkeit und Wetteinsatz: keinen Lohn im ersten Monat, doppelten im zweiten – falls zufrieden. Er bekam immer den doppelten Lohn.
Jetzt war er dreißig. Er war für einen Urlaub nach Woodham gekommen – weil ihm der Bahnhof gefiel. Seine Fahrkarte war zwar für eine weitere Strecke gültig, aber er entschied stets nach Laune. Woodham gefiel ihm. Im Abteil hatte er seinen Koffer, im Portemonnaie Geld. Warum also nicht aussteigen?
Die Wirtin des „George“ war nur zu froh, ihm ein Zimmer zu geben. Ihr Mann werde nachmittags das Gepäck holen, versprach sie.
„Und Sie möchten sicher etwas essen, Sir.“
„Ja, aber keine Umstände. Irgendwas Kaltes.“
„Wie wär’s mit Rind, Sir?“ – als stünden ihr hundert Sorten zur Auswahl und sie biete ihm die beste an.
„Klingt perfekt. Und ein Pint Bier.“
Während er sein Mittagessen beendete, kam der Wirt, um nach dem Gepäck zu fragen. Antony bestellte ein weiteres Pint und kam rasch ins Gespräch.
„So ein Gasthaus auf dem Land zu führen – das muss doch Spaß machen“, sagte er und überlegte, ob das sein nächster Beruf werden könnte.
„Spaß? Weiß nicht, Sir. Es bringt uns das Auskommen – und ein bisschen mehr.“
„Sie sollten mal Urlaub machen“, sagte Antony nachdenklich.
„Lustig, dass Sie das sagen“, antwortete der Wirt lächelnd. „Ein anderer Herr – vom Roten Haus – hat das gestern auch gesagt. Hat sogar angeboten, mich zu vertreten.“ Er lachte kehlig.
„Das Rote Haus? Doch nicht das Rote Haus in Stanton?“
„Genau, Sir. Stanton ist der nächste Halt nach Woodham. Das Rote Haus liegt etwa eine Meile von hier – Mr. Abletts.“
Antony zog einen Brief aus der Tasche. Absender: „Das Rote Haus, Stanton“ – unterschrieben: „Bill“.
„Guter alter Bill“, murmelte er. „Der bringt’s.“
Antony hatte Bill Beverley vor zwei Jahren in einem Tabakladen kennengelernt. Antony war auf der einen Seite des Tresens, Bill auf der anderen. Irgendetwas an Bill – vielleicht seine Frische und Jugend – hatte Antony angesprochen. Nachdem Zigaretten bestellt und eine Adresse genannt worden war, erinnerte sich Antony, einmal eine Tante von Bill auf einem Landsitz getroffen zu haben. Später sahen sich beide in einem Restaurant wieder. Beide trugen Abendgarderobe – aber sie machten verschiedene Dinge mit der Serviette, und Antony war der höflichere. Dennoch mochte er Bill. Bei einem seiner Urlaube – in einer beschäftigungslosen Phase – ließ er sich durch einen gemeinsamen Freund vorstellen. Bill war zunächst etwas pikiert, als man ihn an die früheren Begegnungen erinnerte, aber das legte sich schnell. Die beiden wurden bald enge Freunde. Bill schrieb ihm manchmal Briefe mit der Anrede: „Lieber Irrer“.
Nach dem Mittagessen beschloss Antony, zum Roten Haus hinüberzuspazieren und seinen Freund zu besuchen. Das Gasthauszimmer war zwar nicht das fiktive Landhotel mit Lavendelduft, aber sauber und bequem. Er machte sich auf den Weg über die Felder.
Als er die Auffahrt hinabschritt und die alte Backsteinfassade des Hauses näherkam, summten die Bienen über den Blumenbeeten, die Tauben gurrten in den Wipfeln der Ulmen, und von fernen Rasenflächen kam das Surren eines Rasenmähers – das wohl beruhigendste aller Geräusche auf dem Land...
Und in der Halle hämmerte ein Mann gegen eine verschlossene Tür und brüllte: „Mach auf! Ich sage, mach auf!“
„Hallo?“, sagte Antony überrascht.
3. Zwei Männer und ein Toter
Cayley drehte sich abrupt zur Stimme um.
„Kann ich helfen?“, fragte Antony höflich.
„Etwas ist passiert“, sagte Cayley. Er atmete schwer. „Ich habe einen Schuss gehört – es klang wie ein Schuss – ich war in der Bibliothek. Ein lauter Knall – ich wusste nicht, was es war. Und die Tür ist abgeschlossen.“ Er rüttelte wieder am Griff und schüttelte die Tür. „Mach auf!“, rief er. „Mark, was ist los? Mach auf!“
„Aber er muss sie absichtlich abgeschlossen haben“, sagte Antony. „Warum sollte er sie nur deshalb öffnen, weil Sie es verlangen?“
Cayley sah ihn verwirrt an. Dann wandte er sich wieder der Tür zu. „Wir müssen sie aufbrechen“, sagte er und stemmte sich mit der Schulter dagegen. „Helfen Sie mir.“
„Gibt es kein Fenster?“
Cayley starrte ihn verständnislos an.
„Fenster? Fenster?“
„Ein Fenster einzuschlagen ist deutlich einfacher“, sagte Antony mit einem Lächeln. Er stand ganz ruhig da, lehnte sich an seinen Stock, kaum über die Schwelle der Halle getreten, und dachte sich wohl, dass hier viel Lärm um nichts gemacht wurde. Aber er hatte den Schuss nicht gehört.
„Natürlich – ein Fenster! Was bin ich für ein Idiot.“
Er drängte sich an Antony vorbei und rannte in die Auffahrt. Antony folgte ihm. Sie liefen an der Front des Hauses entlang, einen Weg zur Linken hinunter, dann wieder nach links über den Rasen – Cayley vorn, Antony dicht dahinter. Plötzlich warf Cayley einen Blick über die Schulter und blieb abrupt stehen.
„Hier“, sagte er.
Sie waren bei den Fenstern des verschlossenen Raums angekommen – französische Türen, die auf den Rasen hinter dem Haus führten. Doch sie waren geschlossen. Antony konnte nicht verhindern, dass ein Schauer der Spannung ihn durchlief, als er Cayleys Beispiel folgte und sein Gesicht dicht ans Glas presste. Zum ersten Mal fragte er sich, ob es in diesem geheimnisvollen Raum wirklich zu einem Revolverschuss gekommen war. Von der anderen Seite der Tür aus war alles so melodramatisch und übertrieben erschienen. Doch wenn es einen Schuss gegeben hatte – warum nicht auch einen zweiten oder dritten? Auf die beiden unvorsichtigen Narren etwa, die ihre Nasen an die Scheiben drückten und geradezu darum baten?
„Meine Güte, sehen Sie es?“, sagte Cayley mit zitternder Stimme. „Da hinten. Schauen Sie!“
Im nächsten Moment sah auch Antony es. Ein Mann lag am anderen Ende des Raums auf dem Boden, mit dem Rücken zu ihnen. Ein Mann? Oder nur noch ein Körper?
„Wer ist das?“, fragte Antony.
„Ich weiß es nicht“, flüsterte Cayley.
„Na, wir sollten nachsehen.“ Er musterte kurz die Fenster. „Ich denke, wenn Sie ihr Gewicht an der Verbindung der Flügel ansetzt, geben sie nach. Sonst treten wir das Glas ein.“
Ohne ein Wort warf Cayley sich gegen das Fenster. Es gab nach, und sie traten ein. Cayley ging rasch zu dem reglosen Körper hinüber und kniete sich daneben. Einen Moment lang schien er zu zögern, dann fasste er sich ein Herz, legte eine Hand auf die Schulter des Mannes und drehte ihn herum.
„Gott sei Dank!“, murmelte er und ließ den Körper wieder los.
„Wer ist es?“, fragte Antony.
„Robert Ablett.“
„Oh!“ sagte Antony. „Ich dachte, er heißt Mark“, fügte er eher zu sich selbst als zu Cayley hinzu.
„Ja, Mark Ablett wohnt hier. Robert ist sein Bruder.“ Er schauderte. „Ich hatte Angst, es wäre Mark.“
„War Mark auch in dem Raum?“
„Ja“, sagte Cayley abwesend. Dann, als hätte er plötzlich genug von den Fragen eines Fremden: „Wer sind Sie überhaupt?“
Doch Antony war zur verschlossenen Tür gegangen und probierte den Griff. „Ich nehme an, er hat den Schlüssel eingesteckt“, sagte er, als er wieder zu dem Körper zurückkehrte.
„Wer?“
Antony zuckte mit den Schultern.
„Wer auch immer das getan hat“, sagte er und wies auf den Mann auf dem Boden. „Ist er tot?“
„Helfen Sie mir“, sagte Cayley schlicht.