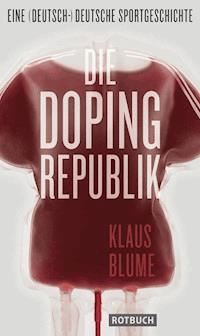Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mörderischer Osten
- Sprache: Deutsch
In ihrer Heimatstadt Halle kreuzen sich nach zwanzig Jahren die Wege der Wissenschaftler Tom Wegelius und Moritz Hirscher. Wegelius will die kriminellen Praktiken bei der Privatisierung der Chemiewerke von Leuna, Schkopau und Bitterfeld-Wolfen aufdecken. Doch seitdem sich ungewöhnliche Todesfälle in seinem Umfeld ereignen, ist er abgetaucht, um nicht selbst zum Opfer zu werden. Hilfe kann er nur von der jungen Staatsanwältin Dörte Stoye aus Freyburg und einem alten Kollegen aus Jena erwarten. Hirscher hingegen betreibt nun nach Jahren im Ausland die ehrwürdige Hallenser Paracelsus-Apotheke. Zumeist aber forscht er in einem Labor in Pößneck – nach süchtig machenden »Cocktails« für einen Arzneimittelkonzern. Als der Mord an einer beliebten Apothekerin der Paracelsus-Apotheke und früheren Topathletin durch die Lokalpresse geht, schaltet sich die Kripo Jena ein, und es entspinnt sich gefährliches Netz aus Gewalt und Betrug … In Das Geheimnis von Leuna verknüpft Klaus Blume kunstvoll das Thema Doping mit dem Ausverkauf ostdeutscher Chemiewerke nach 1989 und schafft einen fesselnden Krimi von großer Brisanz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Blume
Das Geheimnis von Leuna
Ein Saale-Krimi
Bild und Heimat
ISBN 978-3-95958-722-8
1. Auflage
© 2016 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: fotolia / wkbilder
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.bild-und-heimat.de
Prolog
Kolja war tot. Das stand zwar nicht in der Zeitung, doch alle, die mit ihm zu tun gehabt hatten, wussten es. Auch der Ort seines Begräbnisses war allen bekannt, denen Kolja dreißig Jahre lang den Weg geebnet und gesichert hatte. Als er noch unantastbar schien, damals als General in Ostberlin. Nicht in seinem eigenen Ministerium, nicht einmal im Politbüro. Kolja, angreifbar? Ja, wie denn? Kolja hatte es zwar in der DDR bis zum Geheimdienstgeneral gebracht, doch für einen Pass des ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates hatte es nie gereicht. Kolja war, nach seiner Rückkehr 1946 aus Moskau, stets sowjetischer Staatsbürger geblieben – ein Russe, inmitten des ostdeutschen SED-Politbüros.
Und seine Vertrauten? Auf sie konnte er sich sogar noch über den Tod hinaus verlassen. Hatten sie ihm doch ihr Leben zu verdanken. Wie selbstverständlich brach deshalb auch der Apotheker Maurice Hirschinger aus seinem sonnigen französischen Exil ins neblige märkische Altwriezen auf, einem Kaff im kaum noch bewohnten Oderbruch. Irgendwo im pommerschen Niemandsland. Dorthin hatte sich Generaloberst Nikolai »Kolja« Sylbern zu DDR-Zeiten stets dann zurückgezogen, wenn er einmal nicht der Genosse General, sondern einfach nur »Kolja« sein wollte. Auf seinen kleinen Bauernhof, hinter dem stets verschlossenen schmucklosen Tor; kaum erkennbar, obwohl an der Hauptstraße gelegen. Nur einen Steinwurf von der gegenüberliegenden Kirche entfernt. Über sie und ihren Pastor, über die schlitzohrige Haushälterin und den hüftsteifen Küster, über die asthmatische Buchhalterin und den beinamputierten Organisten hatte der überzeugte Atheist Kolja Sylbern stets seine schützende Hand gehalten. Ohne dass es auffiel, wie er jahrzehntelang gehofft hatte.
Dort drüben, gegenüber seinem Bauernhof, wollte Kolja einmal begraben werden, zwischen der Sakristei und dem modrigen Oderufer. So hatte er es dem Pastor anvertraut. Es sollte ein Begräbnis werden ohne die Genossen vom Politbüro, vor allem aber ohne jene aus dem Ministerium für Staatssicherheit. Stattdessen hatte sich Kolja eine Beerdigung inmitten jener »Familie« gewünscht, zu der er zwar keine verwandtschaftlichen Bindungen besaß, zu der aber jene Wissenschaftler gehörten, die er mitsamt ihren vertraulichen Projekten vor seinem eigenen Geheimdienst beschützt hatte. Jahrzehntelang. Und deren blitzschnelles spurloses Abtauchen, gleich in den ersten Tagen nach dem Mauerfall 1989, er umsichtig geplant hatte. Ebenfalls jahrzehntelang. Denen er aber selbst nie nach China oder ins westliche Ausland gefolgt war.
Jetzt war Kolja tot, und nur er hatte gewusst, wer weshalb und mit wem wohin verschwunden war. Was derjenige dort, wo er nun lebte, tat und warum; wie er jetzt hieß, wie er lebte und ob er überhaupt noch am Leben war. Und falls nicht, ob er eines natürlichen Todes gestorben oder ob es ein sogenannter berufsmäßiger Abgang gewesen war.
Maurice Hirschinger überlegte: Kolja, angeblich schon in den 1940er Jahren sowjetischer, aber zu keiner Zeit DDR-Bürger, war nach dem Mauerfall offenbar zwischen seiner russischen Wahlheimat, einem Kloster in Nischni Nowgorod, und seinem Resthof im Oderbruch hin- und hergependelt. Hatte mal hier, mal dort gelebt. Das mussten all jene geduldet haben, die nun das Sagen hatten. Ob in Moskau oder in Berlin. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Vielleicht hatten ihn die neuen Herren sogar hofiert? Alle diese Kriegsgewinnler, wie Kolja sie nannte.
Warum sollte Hirschinger diesen Mann also nicht zu Grabe tragen? Oder jedenfalls zugegen sein, wenn es andere taten. Doch wie sollte er sich auf dieser Stippvisite in die eigene Vergangenheit verhalten? Auf keinen Fall auffallen, sich aber dennoch umschauen; sich merken, welcher der alten Genossen sonst noch in Altwriezen auftauchte. Wer aus den weltumspannenden Pharmakonzernen sich aus seiner sicheren Deckung wagen würde. Wer aus dem südamerikanischen Exil. Wer käme aus seinem Pekinger Labor herbeigeflogen? Oder wer tauchte gar von den sieben Bergen im abgeschotteten Nordkorea im Oderbruch auf?
Hirschinger war mit dem Zug in den Oderbruch gekommen. Nicht einmal einen Leihwagen hatte er sich in Berlin genommen. Nur keine Spuren hinterlassen. Aber vielleicht machte er sich auch unnötige Sorgen, versuchte er sich zu beruhigen. Denn wer sollte ihn schon wiedererkennen? Vor allem auf den ersten Blick? Schon 1989 hatte er sich in den USA ein völlig anderes Gesicht verpassen lassen. Bei einem erstklassigen plastischen Chirurgen. Er habe jetzt ein sehr französisches Aussehen, hatte dieser Amerikaner behauptet. Hirschinger hatte sich deshalb auch eine andere Gestik antrainiert, andere Manieren zugelegt. Sie waren ihm in Fleisch und Blut übergegangen. So als seien es seine eigenen. Trotzdem kamen ihm Zweifel. Reichte das auch, um die früheren MfS-Spezialisten zu täuschen? Sie alle waren schließlich Profis.
Sicher, Gestik, Mimik, Sprachrhythmus – das alles hatte er verändert, das alles war ihm in all den Jahren zur zweiten Natur geworden, doch irgendetwas würde von früher noch übrig geblieben sein. Irgendeine Winzigkeit, die ausreichen könnte, ihn zu enttarnen.
So wie Hirschinger dachten wohl an die hundertfünfzig Trauergäste, die sich zwischen bemoosten Grabsteinen, wuchtigen Ulmen und ausladenden Trauerweiden um Koljas letzte Ruhestätte scharten.
Was Hirschinger ganz und gar irritierte. Er hatte allenfalls eine Handvoll Getreue erwartet, nicht aber diesen Massenauflauf. Doch nun steckte er mittendrin, und da hieß es, die Augen offen halten. Dort, rechts neben dem stählernen Engel am Hauptweg, war das nicht Petzold, genannt das »Riesenarschloch«? Genosse Nationalpreisträger Professor Dr. Dr. Josef-Hermann Petzold? Das Gesicht schien unverändert, nur eben um fünfundzwanzig Jahre gealtert. Aber warum trat er im Habitus eines gottesfürchtigen Juden auf? Ekelhaft, dieser Zynismus, dachte Hirschinger. Hattest du Schwein dein mörderisches Handwerk nicht einst bei den Nazis gelernt? Von der Pike auf, wie du ungeniert vor uns geprahlt hast. Um im ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat medizinische Versuche an ahnungslosen Patienten durchzuführen. Du warst der Skrupelloseste von uns. Ob deine Sponsoren aus der Schweiz oder den USA jemals danach gefragt haben? Dich oder Kolja?
»Es ist Petzold. Er heißt jetzt Moishe Mejir und forscht für den Staat Israel. In Jerusalem hochdekoriert. Und wer alimentiert dich, Moritz?«
Hirschinger drehte sich erschrocken um und blickte in ein blasses pickliges Gesicht, das den DDR-Weinbrand Wilthener Goldkrone ausdünstete.
»Ich«, stammelte Hirschinger, »ich verdiene meinen Unterhalt mit meiner Apotheke in …« Doch da war der Mann mit der Weinbrand-Fahne schon weitergeflogen. Hirschingers Augen suchten ihn, doch sie blieben nur an einem braunen Setter hängen. Der Hund trottete mit gesenktem Kopf auf ihn zu und rieb seine Schnauze an seinem rechten Hosenbein. Das kann aber jetzt wirklich nur ein Zufall sein, schoss es Hirschinger durch den Kopf. Denn dieser Hund erinnerte ihn an seinen Setter Ajax vor dreißig Jahren. Damals, als er offiziell und hochangesehen – für die Leopoldina in Halle forschte und Fachaufsätze in aller Welt veröffentlichte; inoffiziell aber, in Koljas Auftrag, mit seinen Forschungen in den damaligen Leuna-Werken vergeblich versucht hatte, die natürlichen, die angeborenen Leistungsgrenzen des Menschen zu überschreiten. »Der sozialistische Mensch muss allen anderen überlegen sein, das gilt es zu beweisen, Moritz«, hatte Kolja gefordert. Jahraus, jahrein verlangte er Hirschinger dieses aberwitzige Glaubensbekenntnis ab. Dabei wusste doch gerade Hirschinger, der Biochemiker und Krebsforscher, dass die Erfüllung dieser Forderung unmöglich war. Warum sollte gerade er die Quadratur des Kreises beweisen? Er tätschelte dem braunen Setter den Kopf, kraulte ihn – gedankenverloren – hinter dem linken Ohr. So wie er es vor dreißig Jahren bei Ajax getan hatte.
Was war Wirklichkeit, was Inszenierung? Standen an diesem verschlammten Teich – genau ihm gegenüber – nicht zwei vornehme ältere Herren, die so gar nicht auf diesen verwahrlosten Friedhof zu passen schienen? Na klar, erinnerte er sich, sie waren es: der Schweizer Pierre d’Abergues und der Berliner Professor Leopold Habermann. Er hatte sie nicht nur einmal im Hugenotten bewirtet, in Halles »französischem« Haus. Es ging schließlich um Forschungsaufträge für Leuna, dafür musste er immer mal wieder besonders tief in die volkseigene Tasche greifen. Sollte er hinübergehen und beiden deren eigenen Leitsatz zuflüstern: »Der Tugendhafte begnügt sich, von dem zu träumen, was der Böse im Leben verwirklicht.«
»Lass das lieber bleiben, sie erkennen dich sowieso nicht«, hauchte ihn die blubbernde Weinbrand-Stimme von eben an.
An wen nur erinnerte ihn dieser gutturale Bariton?
»Simon?« Hirschingers Gehirn ratterte im Akkord.
»Du hast mich an Ajax erkannt, nicht wahr?« Das käsige Gesicht verrutschte zu einem schiefen Grinsen.
»Wie denn?« Hirschinger schüttelte den Kopf. »Der lebt doch schon lange nicht mehr.«
Doch die Weinbrand-Stimme war schon wieder weitergeflogen. Nur Ajax rieb immer noch den Kopf an seinem rechten Knie.
Woran hatte ihn die Weinbrand-Stimme erkannt? Wieso hatte er ihn mit seinem deutschen Vornamen angeredet, ihn, Docteur Maurice Hirschinger aus dem südfranzösischen Albi? Hirschinger geriet in Panik. Gehörte diese Stimme wirklich zu Simon? Zu jenem Simon Reinhard, der vor niemandem in die Knie gegangen war. Der sich von nichts und niemandem verbiegen ließ. So war er jedenfalls früher aufgetreten. Hirschinger dachte nach: Ja, Simon war ein hochbegabter Biologe, zudem ein fantastischer Arzt und ein leidenschaftlicher Forscher – jedenfalls damals. Er hätte es, unter Koljas Schutzschild und im Dienste der DDR, weit bringen können. Sehr weit! Doch er machte keine Kompromisse.
Selbst Simons Liebe zu Karla Lieberknecht, einem damals ebenso umjubelten wie hochdekorierten Volleyball-Star, vermochte ihn nicht an Koljas Reich zu binden. Auch als Karla, die damals freilich noch anders hieß, kurz vor dem Mauerfall, noch schnell unter Hirschingers Bettdecke gekrochen war, kroch Simon nicht zu Kreuze. Im Gegenteil, Simon feierte drei Tage und vier Nächte lang seine ganz persönliche Freiheit – ganz allein, mit drei Flaschen Wilthener Goldkrone – und machte sich danach aus dem Staub. Forschung ade! Nicht in den Westen, sondern in den menschenleeren Nordosten, um – mal in der einen, mal in der anderen Kirche – Orgel zu spielen. Für ein Bett in irgendeiner Nische und ein warmes Mittagessen.
Woran aber hatte Simon ihn erkannt? Kolja hätte es sofort beantworten können. Kolja hätte auch gewusst, was es mit dem Grauhaarigen auf sich hatte, der im leicht französischen Tonfall auf Pastor Neumann einredete. Was wollte dieser Trauergast denn wissen? Woher kam er überhaupt? Und was hatte es mit jenem eleganten Paar auf sich, das sich auf diesem verlotterten und verschlammten Friedhof nur verirrt zu haben schien, jedoch d’Abergues und Habermann mehr als nur höflich zunickte. So, wie man eigentlich nur lieben alten Bekannten zunickt. Das alles ergibt doch keinen Sinn! Aber noch unsicherer machte es Hirschinger, dass sowohl der Grauhaarige mit dem französischen Akzent als auch das elegante Paar ihn zu beobachten schienen – und zwar so beiläufig, dass es schon wieder professionell wirkte. Jedenfalls auf einen Profi wie ihn. Du siehst Gespenster, wo keine sind, rief sich Hirschinger zur Ordnung. War auch nötig, denn sogar die schlanke, noch sehr junge Frau im dunkelblauen Business-Anzug hatte seinen Pulsschlag schneller schlagen lassen. Was hatte sie hier verloren? Sie konnte doch, schon wegen ihrer Jugend, nie und nimmer zu Koljas innerem Zirkel gehört haben. Woher wusste sie also von dieser Trauerfeier? Er schaute ihr nach: Sah dieses Mädchen nicht Sarah verblüffend ähnlich? Seiner Sarah? Was war wohl aus ihr geworden? Lebte sie immer noch in Berlin, in dieser riesigen zugigen Wohnung, an der ehemaligen Stalinallee?
»Wie sich die Bilder gleichen«, hauchte ihn just in diesem Augenblick die Wilthener Goldkrone an, und Ajax rieb seine feuchte Setter-Schnauze erneut an seinem rechten Knie. Wie aus dem Nichts waren beide auf einmal neben ihm aufgetaucht.
»Was ist aus Sarah geworden?«, flüsterte Hirschinger in Simons aufgedunsenes Gesicht.
»Frag doch Petzold.« Ausgerechnet Petzold? »Vielleicht ist Sarah ihm in Tel Aviv ja mal über den Weg gelaufen. So viele ehemalige DDR-Bürger gibt’s dort doch nicht.«
Hirschinger starrte ihn achselzuckend an, wollte etwas fragen, doch Simon war schon – unter seinen Achselhöhlen hinweg – abgetaucht. Nur Ajax rieb seine feuchte Hundeschnauze an seinem rechten Knie. Erst jetzt bemerkte Hirschinger das rotweiße Palästinensertuch, das er anstelle eines Halsbandes trug.
»Neumann, ich bin Pastor Neumann«, sagte in dem Moment eine feste sonore Stimme, direkt vor ihm.
Hirschinger blickte in ein uraltes Totenkopfgesicht, dessen wässrig schimmernde blaue Augen schon seit langer Zeit erloschen schienen.
»Hirschinger, sehr angenehm«, antwortete er, peinlich darauf bedacht, lothringisch-französisch zu klingen.
Der Totenkopf nickte nachsichtig, als sei ihm dieser Name nur allzu geläufig. Dann fragte er, sich dabei zurücknehmend: »Sie kannten den Verblichenen schon, als er noch unter uns weilte?«
Hirschinger verneinte und murmelte etwas von seiner verstorbenen Frau, deretwegen er hier sei.
»Ja, ja, die Toten.« Neumann nickte. »Sie können in der Kirche mit uns die Messe feiern, das tröstet Sie vielleicht ein wenig. Simon stimmt schon die Orgel an.«
Als der letzte Ton verklungen war, erhob sich Simon hinter seiner schützenden Balustrade: »In unserer Bahnhofsgaststätte haben wir ein pommersches Büfett herrichten lassen. Kolja lädt Sie alle dazu ein – posthum, versteht sich.«
Hirschinger blickte auf seine Uhr. Gott sei Dank blieb ihm nur wenig Zeit, wenn er seinen Zug nach Berlin nicht verpassen wollte. Doch gerade in dem Moment lauerte ihm an der einzigen freien Ecke des Büfetts ausgerechnet jener Mann auf, dem er eigentlich nicht begegnen wollte. Dort, wo Matjesfilets neben knusprigem Bauernbrot, frischer Butter und einigen Flaschen schwedischen Elchschnapses die Trauergäste besonders anlockten. Dort lehnte auch Tom Wegelius am Büfett, der Mann mit dem französischen Singsang.
»Also wirklich wie bei Kolja zu Hause, nicht wahr?«, sagte er redselig zu Hirschinger.
In Hirschinger blitzten alle Signallampen auf einmal auf: Dieser Mann wollte doch etwas von ihm? War er von irgendeinem Geheimdienst auf ihn angesetzt? Oder von irgendeiner Familie, die mit ihm noch eine alte Rechnung zu begleichen hatte? Hirschingers Gehirn funktionierte auf einmal wieder wie ein Computer: Auf keinen Fall ins Deutsche verfallen!
Er könne das leider nicht bestätigen, antwortete Hirschinger bedauernd. Er sei ja nie bei Kolja daheim eingeladen gewesen und nur wegen seiner verstorbenen Frau zu dieser Beerdigung gekommen. Womit er – lässig mit französischem Akzent parlierend – wiederholte, was er zuvor auch schon dem Pfarrer vorgelogen hatte.
Nur weg von hier – und lieber draußen auf dem Bahnsteig im Regen frieren. Doch dort fröstelte schon das elegante Paar, das ihn auf dem Friedhof beobachtet hatte. Damit hatte er nicht gerechnet. Allenfalls mit Simon, doch der ließ sich weit und breit nicht mehr blicken. Dennoch ließ sich Hirschinger seine Überraschung nicht anmerken, sondern nickte den beiden höflich zu. Seinen lothringisch-französischen Tonfall hatte er jetzt wieder voll drauf. Würde ihn jetzt jemand ansprechen, würde sich Docteur Maurice Hirschinger aus Albi auf keinen Fall wieder in Professor Moritz-Maria Hirsch aus Halle an der Saale verwandeln.
Hirschinger nickte dem eleganten Paar noch einmal freundlich zu und stieg in seinen Zug nach Berlin. In knapp fünf Stunden würde er in Toulouse landen, wo Karla auf ihn wartete. Ende gut, alles gut? Karla wartete vergeblich. Als Hirschinger im Zug nach Berlin saß, der weiter über Halle und Leipzig nach Dresden fuhr, beschlich ihn ein angenehmes Gefühl. Spürte er doch, dass er in den letzten Stunden ins Visier einiger Schurken geraten war, doch niemand hatte irgendeine Bemerkung über sein früheres Leben in der DDR gemacht. In Südfrankreich waren sie ihm auf die Spur gekommen. Doch hier, in der Heimat? Als der Zug im Berliner Hauptbahnhof wieder anfuhr, blieb Hirschinger einfach sitzen – bis zum nächsten Halt, in Halle an der Saale.
1
Es war einer jener typischen halleschen Sonntage. Trist und grau. Der Spätsommer schien mit Macht zum Herbst reifen zu wollen. Es regnete seit gefühlten hundert Stunden, und über dem Hallmarkt lastete jene lähmende Stille, die Tom Wegelius noch hinter den hohen Fenstern seines Arbeitszimmers deutlich zu spüren glaubte. Zwar bemühte er sich schon seit Stunden um eiserne Konzentration, doch das meiste über die seit zwanzig Jahren verschüttete Leuna-Affäre las er, ohne deren wirkliche Tragweite zu begreifen: Siebenundvierzig Millionen Euro Schwarzgelder. Addierte er aus den ersten Akten zusammen. Mindestens sechs spurlos verschwundene Aktenbände bei Helmut Kohls Amtsübergabe an Gerhard Schröder. Wie kann so etwas passieren? War der überwiegende Teil geschreddert worden, oder woanders versteckt? In einer anderen Akte stand sogar etwas von achtzig Millionen Euro an Schmiergeldern. Dürfte auch noch zu wenig sein, dachte Tom und blätterte und blätterte. Das Kriminalgericht von Paris hatte am 12. November 2003 sogar von dreihundertfünf Millionen Euro Schmiergeldern gesprochen. Auffällig, dachte er, ist ja wohl vor allem die Unauffälligkeit, mit der diese Akten einst zu den Akten gelegt wurden. Unvollständige Akten? Unwichtige Aufzeichnungen?
Aber Tom Wegelius vermochte nicht, sich zu konzentrieren. Auch nicht auf die wahnwitzig anmutenden Aufzeichnungen der Richterin Eva Joly, die in Paris sechs Jahre lang unter Polizeischutz gestanden hatte, vierundzwanzig Stunden am Tag. Hatte man sie in der Leuna-Affäre wirklich be- oder eigentlich überwacht? Doch Wegelius konnte sich einfach nicht konzentrieren. Irgendetwas in seinem Körper setzte ihm zu. Was hatte er eigentlich am Abend zuvor gegessen? Einen leckeren »Hellas-Teller« beim Griechen in der Nähe des Marktes. Doch jetzt verkrampfte sich sein Magen. Mittlerweile kolikartig. In immer kürzeren Abständen. Tom hielt sich am Schreibtisch fest, was ihm gar nicht so leicht fiel, weil sich dieser plötzlich um ihn zu drehen begann. Tom wählte – sich mit der linken Hand an der Schreibtischkante festkrallend – die Rufnummer des ärztlichen Notdienstes.
Nur zwanzig Minuten später befand er sich in der Notaufnahme des Bergmannstrost, eines Krankenhauses aus dem Jahr 1824.
»Ihre Gallenblase macht Sperenzien«, erklärte ihm ein betagter Arzt, der wohl schon bei Gründung des Bergmannstrost behandelt und geheilt zu haben schien. »Thomas Wegelius, ein komischer Name«, wunderte sich Dr. Henrixdorff, dann studierte er die Unterlagen des neuen Patienten: »Sie kommen also aus Belgien. Seit wann heißt man denn dort so?«
Wegelius’ Lebensgeister schienen langsam wieder zu erwachen: »Weiß ich nicht. Vielleicht seit dem Dreißigjährigen Krieg, als die Schweden womöglich auch Flandern geplündert haben.« Tom spürte, wie er immer besser in Form kam und ging sogar zum Gegenangriff über: »Ihr Name, Herr Doktor, klingt ja auch eher dänisch als deutsch.«
Henrixdorff lächelte.
»In den deutsch-dänischen Kriegen sollen unsere Familien sogar gegeneinander gekämpft haben. Irgendwann hat es einen Familienteil an die Saale getrieben. Doch was treibt einen Belgier ausgerechnet nach Halle?«, fragte der Arzt.
»Leuna«, antwortete Wegelius knapp und bewusst schmallippig.
»Darüber müssen Sie mir unbedingt Näheres berichten«, hakte Henrixdorff nach. »Denn wir Außenstehenden denken ja, die Sache hat sich längst von allein erledigt. Zumindest, nachdem der Hauptangeklagte, wie ich mich zu erinnern glaube, vor etwa zehn Jahren an Herzversagen gestorben sein soll. In welchem Hotel sind Sie eigentlich untergekommen?«
Tom hätte jetzt eigentlich schweigen sollen, doch stattdessen wurde er immer redseliger; vielleicht wirkten jetzt die Beruhigungsmittel, die ihm Henrixdorff verabreicht hatte. »In gar keinem. Ich habe eine Wohnung gemietet. In einem alten Haus am Hallmarkt, mitten in der Altstadt.«
Am nächsten Tag stiefelte Wegelius mit einem langen Rezept von Dr. Henrixdorff in der Jackentasche in die Paracelsus-Apotheke am Markt. Er sah sich in dem uralten Verkaufsraum um. Staunenden Blickes. Wie oft hatte er hier früher, als Junge, Rezepte für seine längst verstorbene Mutter eingelöst. Manchmal Tag für Tag. Tom glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Nichts schien sich verändert zu haben: weder die alten Holzpaneele und erst recht nicht die sicher unermesslich wertvoll gewordenen Delfter Kacheln. Historische Zeugnisse längst vergessener Zeiten. An jenem breiten Tresen, an dem zuvor schon Generationen von Apothekern ihre Kunden beraten hatten, stand jetzt eine hochgewachsene Frau von vielleicht sechzig Jahren. Fülliges schwarzes Haar umrahmte ein ebenmäßiges kluges Gesicht. Ein markantes Gesicht, das sich jedem Kunden einprägte. Beim Hinausgehen blieb Toms Blick an einem kleinen weißen Schild an der Eingangstür hängen. Inhaber: Dr. Moritz Hirschinger. Er stutzte. Warum kommt mir dieser Name bekannt vor? Doch es wollte ihm partout nicht einfallen.
Von dort zog es ihn in den wunderschönen Laden in der Kleinen Klausstraße. Dort, wo es, wie im Schlemmer-Paradies Rob in Brüssel, beinahe alles gab, was der Feinschmecker begehrte. Und Tom suchte ja etwas ganz Besonderes für das Abendessen, zu dem er Dr. Henrixdorff eingeladen hatte. Er freute sich darauf, denn irgendwie kam ihm dieser alte Arzt wie ein wandelndes Lexikon der Saale-Landschaft vor. Er mochte sich täuschen, beruhte sein Eindruck doch nur auf seinen Beobachtungen und dem kurzen Gespräch mit dem Internisten. Doch weil er ohnehin niemanden saaleabwärts – von Halle bis Jena – kannte, schien es ihm nicht verkehrt, endlich jemanden kennenzulernen. Und was eignete sich dafür besser als ein gemeinsames Abendessen? Nicht in einem Restaurant, sondern daheim – ganz privat.
Also los. Tom erstand zuerst roten Friséesalat und ein dunkles Roggenbaguette. Danach, für die Vorspeise, zwei riesige Champignons, eine Packung grüne Tagliatelle, Speck, etwas Crème fraîche und viel frische Petersilie. Für die Hauptspeise hatte er sich beim Fleischer an der Ecke ein Kaninchen in sechs Teile zerlegen lassen. Danach wollte er Camembert mit Friséesalat anbieten. Zum Rotwein und zum guten Gespräch unter Männern. So, nun zum Wein, dachte Tom: zu den Champignons mit der grünen Pasta zog er einen frischen Sauvignon Blanc von der Unstrut aus dem Regal, zum Kaninchen zwei Flaschen eines fruchtigen Barbaresco aus dem Piemont. Voilà, der Abend konnte beginnen. Tom eilte nach Hause und freute sich darauf, Dr. Henrixdorff mit einem Kaninchengericht zu überraschen, das – bis auf die französische Senf-Sauce – zu Weihnachten 1984 in der DDR-Krimiserie »Polizeiruf 110« Furore gemacht und seinerzeit viele Nachkocher gefunden hatte.
Damals hatte der 1994