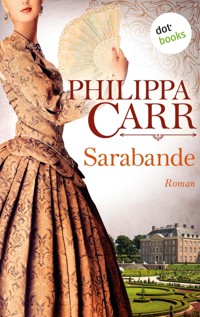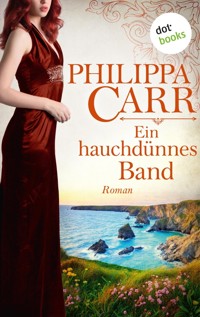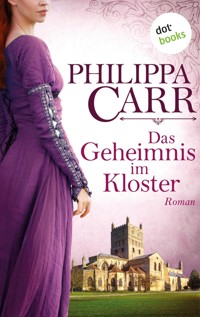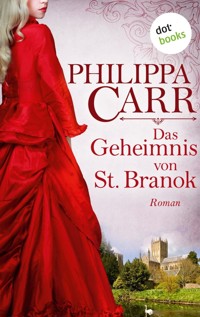
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter Englands
- Sprache: Deutsch
Ein Geheimnis, das zwei Menschen zusammenschweißt: Der historische Liebesroman "Das Geheimnis von St. Branok" von Philippa Carr als eBook bei dotbooks. Wenn ein einziger Moment das Leben verändert … Cornwall, Mitte des 19. Jahrhunderts. Angelet ist noch ein Mädchen, als sie dem älteren Benjamin Lansdon begegnet und mit dem Überschwang jugendlicher Gefühle für ihn zu schwärmen beginnt. Doch dann kommt es zu einem schrecklichen Ereignis, das die beiden von nun an verfolgen wird … Jahre später – Benjamin ist längst in seine australische Heimat zurückgekehrt – ist Angelet zu einer bildschönen jungen Dame herangewachsen, die in London debütiert und dem charmanten Gervaise Mandeville das Ja-Wort gibt. Als ein Schatten auf die Frischvermählten zu fallen droht, beschließt Gervaise, sein Glück dort zu suchen, wo jüngst ein Goldrausch ausgebrochen ist: Australien! Es ist ein großes Land, beruhigt sich Angelet, es besteht keine Gefahr, Benjamin wieder zu begegnen – aber das Schicksal hat andere Pläne … Das glanzvolle Leben auf herrschaftlichen Landsitzen und die Schrecken des Krimkriegs, dunkle Geheimnisse und die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft: ein Roman aus der international erfolgreichen Saga "Die Töchter Englands" von Bestsellerautorin Philippa Carr! Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Das Geheimnis von St. Branok" von Philippa Carr, auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn ein einziger Moment das Leben verändert … Cornwall, Mitte des 19. Jahrhunderts. Angelet ist noch ein Mädchen, als sie dem älteren Benjamin Lansdon begegnet und mit dem Überschwang jugendlicher Gefühle für ihn zu schwärmen beginnt. Doch dann kommt es zu einem schrecklichen Ereignis, das die beiden von nun an verfolgen wird … Jahre später – Benjamin ist längst in seine australische Heimat zurückgekehrt – ist Angelet zu einer bildschönen jungen Dame herangewachsen, die in London debütiert und dem charmanten Gervaise Mandeville das Ja-Wort gibt. Als ein Schatten auf die Frischvermählten zu fallen droht, beschließt Gervaise, sein Glück dort zu suchen, wo jüngst ein Goldrausch ausgebrochen ist: Australien! Es ist ein großes Land, beruhigt sich Angelet, es besteht keine Gefahr, Benjamin wieder zu begegnen – aber das Schicksal hat andere Pläne …
Das glanzvolle Leben auf herrschaftlichen Landsitzen und die Schrecken des Krimkriegs, dunkle Geheimnisse und die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft: ein Roman aus der international erfolgreichen Saga »Die Töchter Englands« von Bestsellerautorin Philippa Carr!
Über die Autorin:
Philippa Carr ist – wie auch Jean Plaidy und Victoria Holt – ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Eine Übersicht über den Romanzyklus »Die Töchter Englands« finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2017
Copyright © der Originalausgabe 1987 by Philippa Carr
Die Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel »The Pool of St. Branok«.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/faestock und Richard Melichar
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-061-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Geheimnis von St. Branok« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philippa Carr
Das Geheimnis von St. Branok
Roman
Aus dem Englischen von Dagmar Roth
dotbooks.
Kapitel 1 Begegnung am Teich
Schon im ersten Augenblick, da Benedict auf dramatische Weise in das Leben unserer Familie trat, spürte ich die besondere Anziehungskraft zwischen uns lange vor dem alptraumhaften Erlebnis am Teich von St. Branok, das uns die folgenden Jahre quälen und unser Dasein völlig verändern sollte.
Im Jahr 1851 fuhren meine Eltern mit mir und meinem kleinen Bruder Jack zur Weltausstellung nach London. Ich war gerade neun Jahre alt, Benedict siebzehn. Eigentlich kein großer Altersunterschied, aber wenn man neun ist, bedeuten acht Jahre fast ein ganzes Leben.
Wir kamen mit dem Zug aus Cornwall – schon die Bahnfahrt erschien mir äußerst abenteuerlich – und wohnten nun im Haus von Onkel Peter und Tante Amaryllis am Westminster Square. Die beiden waren eigentlich gar nicht mein Onkel und meine Tante. Wegen der reichlich komplizierten Verwandtschaftsverhältnisse in unserer Familie nannte ich sie einfach so. Onkel Peter hatte in die Familie eingeheiratet, sich aber schon bald zu ihrem unangefochtenen Oberhaupt aufgeschwungen. Meine Mutter hegte eine fast widerwillige Bewunderung für ihn. Ihre zwiespältigen Gefühle verrieten mir, daß er ein Geheimnis haben müsse, von dem ich nichts wußte. Er besaß ein überschäumendes Temperament, Charme und jene gewisse verruchte Ausstrahlung, die viele Menschen fasziniert. Ich hatte mir oft und vergeblich gewünscht, sein aufregendes Geheimnis aufzudecken. Tante Amaryllis – die Nichte meiner Großmutter, obwohl beide fast im gleichen Alter waren – war eine sanfte, liebenswürdige Frau und erschien selbst einem kleinen Mädchen wie mir rührend naiv. Alle liebten sie zärtlich. Zwiespältigkeiten oder gar Geheimnisse gab es bei ihr bestimmt nicht.
In ihrem Haus wurden häufig Gesellschaften gegeben, an denen bedeutende Persönlichkeiten teilnahmen. Natürlich durfte ich bei solchen Anlässen nicht dabeisein. Trotz meiner Jugend kannte ich aber die Namen vieler Gäste. Meist handelte es sich um bekannte Politiker.
Auch die Kinder der beiden führten ein aufregendes Leben. Ihre Tochter Helena war mit Matthew Hume, einem erfolgreichen Politiker, verheiratet. Er hielt sich häufig bei Onkel Peter auf, auch ohne Helena. Sie verbrachten viel Zeit zusammen, denn Onkel Peter nahm großen Anteil an Matthews politischer Karriere, Einmal hatte ich meine Mutter sagen hören, Onkel Peter sei die graue Eminenz hinter Matthew Hume. Den Sohn Peter nannte die ganze Familie nur Peterkin, damit es nicht zu Verwechslungen zwischen Vater und Sohn kam. Zusammen mit seiner Frau Frances leitete er eine Mission im Londoner East End. Das Ehepaar widmete sein Leben ausschließlich der Wohltätigkeitsarbeit.
Meine Mutter interessierte sich sehr für unsere Familiengeschichte und hat mir viel darüber erzählt. Sie sprach sehr gerne von der Vergangenheit. Sie war auf dem altehrwürdigen Landsitz Cador geboren, der sich seit Hunderten von Jahren im Besitz der Cadorsons befunden hatte. Inzwischen gab es die Cadorsons nicht mehr, denn meine Mutter, die einzige Erbin der Familie, hatte Rolf Hanson geheiratet. Obwohl er erst durch die Heirat mit meiner Mutter Besitzer von Cador würde, liebte er es mehr als alle anderen Familienmitglieder. Ich hatte gehört, wie jemand sagte, der Landsitz samt allen dazugehörigen Gütern sei noch nie zuvor verwaltet worden. Außerdem war der Besitz noch nie so groß gewesen. Mein Vater hatte ein Herrenhaus mit sehr viel Grundbesitz mit in die Ehe gebracht und somit die Ausdehnung der Ländereien von Cador noch beträchtlich vergrößert.
Er stammte nicht aus Cornwall. In diesem abgelegenen Teil der Welt galt er als Ausländer, weil er jenseits des Flusses Tamar in jenem fremden, fernen Land namens England geboren wurde. Diese Einschätzung seiner Person amüsierte ihn ungeheuer. Wir waren eine sehr glückliche Familie. Mein Vater schien der klügste Mann der Welt zu sein. Er hatte auch für das kleinste Problem Verständnis und löste es, ohne Aufhebens davon zu machen. Nie habe ich erlebt, daß er die Beherrschung verlor. Häufig begleitete ich ihn auf seinen Inspektionsritten zu den Farmen. Jack, der drei Jahre jünger war als ich, schloß sich uns erst seit kurzer Zeit an. Meine Eltern hatten geglaubt, ich würde ihr einziges Kind bleiben, und mich bereits als zukünftige Herrin von Cador betrachtet. Doch als sie noch einen Sohn bekommen hatten, sollte selbstverständlich er Cador erben.
Meine Mutter sagte oft zu mir: »Cador ist ein wundervolles Haus – nicht wegen der Türme und der gewaltigen Mauern, sondern wegen der Menschen, die hier gelebt und ein Zuhause daraus gemacht haben.« Meist fügte sie noch hinzu: »Du darfst niemals, niemals glauben, ein Haus an sich habe Bedeutung. Es kommt nur auf die Menschen an, die du liebst und die dich lieben. Ich bin lange davon überzeugt gewesen, deinem Vater läge mehr an Cador als an mir, und habe damit kostbare Zeit verschwendet, die ich in liebevoller Verbundenheit mit ihm hätte verbringen können. Zum Glück habe ich meine Lektion noch rechtzeitig gelernt. Aber da hatten wir leider schon ein paar gemeinsame Jahre vergeudet. Dir kann das, Gott sei Dank, nicht passieren, da Cador eines Tages Jack gehören wird. Wenn du einmal heiratest, kannst du sicher sein, daß dein Mann dich um deiner selbst willen liebt und nicht, weil du Besitzerin eines großen Landsitzes bist.«
Diese Sätze brachte sie stets mit großem Nachdruck vor. Meine Mutter redete gern – ganz im Unterschied zu meinem Vater. Wenn sie auf ihre lebhafte Weise sprach, betrachtete er sie mit einem nachsichtigen, liebevollen Lächeln. Obwohl eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm nicht zu leugnen war, schlug ich mit meinen blonden Haaren, den großen, verträumten grauen Augen und dem breiten Mund äußerlich mehr meiner Mutter nach., Auf den ersten Blick wirkte ich auf die meisten Menschen ernst und nachdenklich, aber meine kecke Nase machte diesen Eindruck schnell zunichte. Meine Stupsnase strafte meine Ernsthaftigkeit Lügen. Meine Vergangenheit stand meiner Nase in nichts nach.
In jenen Tagen wußte ich nicht, wie glücklich ich mich schätzen konnte, solche Eltern zu haben. Was ich ihnen alles zu verdanken hatte, erkannte ich erst sehr viel später.
Ich verbrachte eine herrliche, ungetrübte Kindheit. Bis zu jenem Tag am Teich von St. Branok, als ich auf einen Schlag Gefahr und Todesangst kennenlernte und sich mein Leben von Grund auf veränderte.
An die Zeit vor jenem Tag erinnere ich mich gern. Rückblickend kommt es mir vor, als hätte es nur sonnige, unbeschwerte und ausgefüllte Tage gegeben. Ich hatte eine Gouvernante, Miß Prentiss, die sich verzweifelt und ihrer Meinung nach leider vergeblich bemühte, aus mir eine kleine Lady zu machen. Ihrer Ansicht nach entsprach mein Benehmen nicht meiner gesellschaftlichen Stellung. Doch was konnte eine Gouvernante schon ausrichten, wenn meine Eltern mir meine Freiheit ließen und mich nicht bändigten? Ich bin überzeugt, bei ihren seltenen Besuchen in der Küche hat sie sich bei Mrs. Penlock, unserer Köchin, und Watson, unserem Butler, über ihre schier unlösbare Aufgabe beklagt. Da sie als Gouvernante höher auf der sozialen Leiter stand als das übrige Hauspersonal und sie auf die gesellschaftliche Hierarchie großen Wert legte, ließ sie sich nur gelegentlich dazu herab, in die Küche zu gehen.
Mrs. Penlock dagegen, die schon auf Cador gearbeitet hatte, als meine Mutter noch ein kleines Mädchen war, fühlte sich Miß Prentiss durchaus ebenbürtig. In ihrem vornehmen schwarzen Kleid aus schwerer Seide herrschte sie wie eine Königin über das Hauspersonal. Auch Watson stand Miß Prentiss in nichts nach – er war ein sehr würdevoller Gentleman, sofern er nicht gerade hinter einem der hübscheren Hausmädchen her war. Aber selbst auf Freiersfüßen verhielt er sich noch ein wenig herablassend.
Es waren glückliche Tage. Ich vermute, meine Mutter ließ mir meine Freiheit, weil sie selbst sehr frei erzogen worden war. Weder sie noch mein Vater entsprach der landläufigen Vorstellung von gestrengen Eltern. »Kinder darf man sehen, aber nicht hören«, sagte die alte Mrs. Fenny, die in einem der kleinen Häuser in der Nähe des Hafens in East Poldorey wohnte. Sie gehörte zu den alten Frauen, die ständig nach der Sünde Ausschau halten und anscheinend dauernd mit der Nase darauf stoßen. Stundenlang sah sie aus ihrem winzigen Fenster auf den Kai hinaus, wo die Männer ihre Netze flickten oder die Fische abwogen. Ihren Augen entging nichts. Im Sommer pflegte sie sich einen Stuhl vor die Tür zu stellen und dort den ganzen Tag zu sitzen. So konnte sie noch besser am Geschehen teilhaben. Auch die kleinste Missetat und schon den, leisesten Hauch eines Skandals bekam sie mit.
»Solche Leute hat es immer gegeben und wird es immer geben«, meinte meine Mutter achselzuckend. »Ihre übertriebene Neugier kommt nur daher, daß sie selbst ein schrecklich langweiliges Leben führen. Sie beneiden die anderen, die etwas erleben. Aus Langeweile und Neid suchen sie ständig nach einer Gelegenheit, andere zu verleumden. Hoffen wir, daß wir nie so werden.«
Ich liebte den Hafen und die kleinen Fischerboote, die auf den Wellen schaukelten. Die Boote waren an großen Eisenringen festgemacht. Wenn man am Kai entlangging, mußte man ständig aufpassen, nicht über diese Fußangeln zu stolpern. Besonders gern schaute ich den Männern bei der Arbeit zu.
»Wünschen guten Tag, Miß Angel!« riefen sie mir freundlich zu.
Eigentlich heiße ich Angelet. Meine Mutter kannte unsere Familiengeschichte gut und erzählte mir von einer Vorfahrin, die zur Zeit des Bürgerkriegs, des Kampfes zwischen den englischen Royalisten und dem Parlament, gelebt hatte. Sie hieß Angelet, und nach ihr war ich benannt worden. Ich fürchte, Angel, die Kurzform dieses Namens, paßte nicht unbedingt zu meinem Verhalten. Vielleicht hoffte man, ich würde versuchen, diesem Namen Ehre zu machen, und ein engelhaftes Wesen werden.
Alle in Poldorey kannten mich. »Miß Angel, die Kleine von Cador. Wenn Jack nicht wär', hätt' sie den Landsitz geerbt.« Ich konnte mir vorstellen, was nach seiner Geburt geredet wurde. »So ist es besser. Besser, ein junger Bursche wird später Grundherr. Für ein Mädchen ist das nichts.«
Ich kannte alle diese Menschen gut. Manchmal wußte ich schon im voraus, was sie sagen würden, noch ehe sie die Worte ausgesprochen hatten. Die alte Mrs. Fenny mit den neugierigen Augen und der unfehlbaren Nase für Dinge, die sie nichts angingen; die unverheirateten Schwestern Poldrew, die in einem kleinen Haus am Rande von East Poldorey wohnten und deren größtes Bestreben Sauberkeit und Tugend war. So eifrig waren sie auf die Wahrung ihrer Tugend bedacht, daß sie jeden Abend unter die Betten guckten, ob sich dort nicht ein Mann versteckt hätte. Dabei hatte bisher kein Mann auch nur die geringste Neigung erkennen lassen, ihnen zu nahezutreten. Dann gab es da Tom Fish, der sofort mit seiner Schubkarre zur Stelle war, wenn die Fischer mit ihrem Fang in den Hafen einliefen. Er schob die Karre durch die Straßen der beiden Stadtteile links und rechts vom Fluß und ratterte auch zu den umliegenden Dörfern. Dabei rief er in monotonem Singsang: »Fisch, fangfrischer Fisch! Nur herbei, meine Damen! Tom Fish steht vor Ihrer Tür! Ich bin wieder da, meine Schönen!« Oder Miß Grant, der das Handarbeitsgeschäft gehörte. Solange sie auf Kundschaft wartete, saß sie neben ihrem Ladentisch und häkelte. Da waren die Bäcker, aus deren Backstuben der verführerische Duft nach frischem Brot aufstieg, und »Pengelly's«, wo man alles kaufen konnte, vom Fingerhut bis zu Arbeitsgeräten für die Farm. Nicht zu vergessen »Fisherman's Rest«, wo die Fischer nach dem Verkauf ihres Fangs einkehrten. Auch der Weg der Bergarbeiter führte nach Feierabend meist zuerst ins Wirtshaus. »Werfen alles zum Fenster raus, was sie dem Meer entrissen oder aus dem Boden gewühlt haben«, bemerkte Mrs. Fenny, die von ihrem Fenster aus beobachtete, wie die Männer auf schwankenden Beinen aus dem Wirtshaus torkelten. »Dem alten Pennyleg sollte auch etwas Besseres einfallen, als den Leuten Alkohol auszuschenken«, nörgelte sie. Für sie stand längst fest, daß der alte Pennyleg, der Wirt, einmal im Fegefeuer schmoren würde.
Mrs. Fenny weckte stets meine Neugierde. Ich beobachtete sie, wie sie mit der Bibel auf dem Schoß auf dem Stuhl neben ihrer Tür saß, mit dem Finger jede Zeile entlangfuhr und dabei unentwegt die Lippen bewegte. Erstaunt fragte ich mich, was sie damit bezwecken wollte, denn wie alle anderen wußte auch ich genau, daß sie nicht lesen konnte.
Gerne setzte ich mich auf die zusammengerollten, aufgestapelten Taue, denen ein strenger Geruch nach Seetang entströmte, lauschte dem Rauschen der Wellen und blickte auf das Meer hinaus. Dabei träumte ich oft von den Männern, die dort hinausgefahren waren, um unentdeckte Gebiete zu erforschen – Männer wie Drake und Raleigh. Ich stellte mir vor, wie die Segel der Schiffe sich im Wind blähten und barfüßige Seeleute geschäftig hier‑ hin und dorthin eilten, während ich mit gespreizten Beinen auf dem unruhig schwankenden Deck stand und ihnen meine Befehle zurief. In meiner Phantasie sah ich spanische Galeonen, vollbeladen mit Schätzen. Ich schickte meine Freibeuter auf Kaperfahrt aus, und sie brachten Berge von Schätzen zurück nach England. Immer wieder verlor ich mich in solche Tagträumereien. Am liebsten sah ich mich als Raleigh und Drake. Das war gar nicht so einfach, denn dabei mußte ich mich in einen Mann verwandeln. Deshalb übernahm ich des öfteren die Rolle der Königin Elisabeth und schlug die tapferen Männer zu Rittern. Das fiel mir leichter. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, die große Königin zu sein. Dreitausend Kleider, eine rote Perücke und Macht, uneingeschränkte Macht zu haben, fand ich herrlich.
Für mich waren diese Tagträume zuweilen lebendiger als alles, was sich um mich herum tatsächlich ereignete. Doch so unbeschwert Kind sein konnte ich nur bis zu dem Vorfall am Teich von St. Branok. Danach veränderte ich mich völlig. Ich wagte nicht mehr, mich meinen Tagträumen hinzugeben, denn ich hatte Angst, mit ihnen käme die Erinnerung an den Alptraum zurück.
Cador lag ungefähr eine Viertelmeile von den beiden Poldoreys entfernt auf einem Hügel. Von dort oben hatte man einen herrlichen Blick auf das Meer. Das prächtige Haus mit den Türmen und Zinnen und den mächtigen grauen Steinmauern trotzte seit Hunderten von Jahren Meer und Wetter. Vielleicht war es vor langer Zeit einmal eine Festung gewesen. Wenn ich nachts im Bett lag, hörte ich das Lied des Windes – manchmal klang es wie das schrille Gelächter eines Wahnsinnigen, manchmal winselnd wie ein notleidendes Tier; manchmal fröhlich, manchmal schwermütig. Vor jener schicksalhaften Begegnung hatte mich der Gesang des Windes fasziniert. Danach haßte ich das Geräusch. Mir kam es wie eine unheimliche Warnung vor.
Ich hatte niemals Langeweile. Besonders lebhaft interessierte ich mich für Dinge, die mich nichts angingen. »Miß Angels Nase ist nun wirklich ein wenig klein geraten, aber zum Ausgleich dafür steckt sie sie überall hinein«, bemerkte Mrs. Penlock immer wieder.
Mir gefielen die kleinen Cottages mit ihren weißgetünchten Lehmwänden, die sich am Kai zusammendrängten. Wann immer sich die Gelegenheit ergab, betrat ich eines der Häuschen. An Weihnachten verteilte ich zusammen mit meiner Mutter nach uraltem Brauch Geschenke an die Bewohner der Cottages. Die Behausungen der Armen bestanden aus zwei dunklen Räumen, von einer Trennwand aus Brettern abgeteilt, die nicht bis zur Decke hinaufreichte. Ich nahm an, dies sei mit Absicht so gemacht worden, damit die Luft zirkulieren konnte. In manchen Cottages gab es einen talfat, eine Art Bord oder Sims knapp unterhalb der Decke, auf dem die Kleinen schliefen. Mit Hilfe einer aus Seilen geknüpften Leiter kletterten sie hinauf. Die einzige Lichtquelle bestand aus einer Tonlampe, Stonen Chill genannt, die an einen Kerzenleuchter mit Sockel erinnerte. In den Sockel wurde Petroleum gegossen und anschließend ein Docht, der purvan, eingesetzt.
Solche Besuche verliefen immer nach dem gleichen Muster. Die Hausfrau staubte rasch einen Stuhl für meine Mutter ab, bevor sie ihr Platz anbot. Ich stand daneben, beobachtete alles mit großen Augen und ließ mir kein Wort der Unterhaltung entgehen. Die Frauen erzählten, wie sich Jenny als Dienstmädchen im Pfarrhaus machte oder wann Jim von See zurückerwartet wurde. Diese Besuche gehörten zu den Pflichten der Herrin des Landsitzes, und meine Mutter verstand es, mit den Leuten umzugehen.
In den Cottages roch es immer nach Essen. Die Feuer wurden mit Holz in Gang gehalten, das die Leute am Strand sammelten. Mir gefielen die blauen Flammen. Die Leute behaupteten, das Salz im Holz würde die Flammen färben und verraten, daß es dem Meer entrissen worden sei. Die meisten besaßen offene Öfen, in denen sie buken, während in einem rußgeschwärzten Kessel über den Flammen weitere Speisen zubereitet wurden.
Die Leute sprachen einen ganz eigenen Dialekt. Erst mit der Zeit lernte ich, sie zu verstehen. Sie aßen auch ganz merkwürdige Speisen, zum Beispiel quielett, einen Erbsenbrei, der fast so aussah wie Porridge, oder pillas, ähnlich einer Hafergrütze, die aufgekocht wurde und dann eine Art Eintopf namens gurts ergab. Meine Mutter erzählte mir, die Menschen seien im vorigen Jahrhundert noch sehr viel ärmer gewesen. Damals hätten sie Gras gerupft, das Gras in einen Teig aus Gerstenmehl gerollt und die Teigrollen in der heißen Asche gebacken.
Im Vergleich dazu waren sie fast wohlhabend geworden. Meine Mutter wies mich häufig darauf hin, wie verantwortungsbewußt mein Vater sei. Er hielte es für seine Pflicht, darauf zu achten, daß niemand in seiner Nachbarschaft Hunger leide.
Die armen Fischer waren völlig vom Wetter abhängig. Der Wind an unserer Küste frischte oft zu Sturmstärke auf. Wenn Stürme vorher gesagt wurden und die leeren Boote auf den Wellen schaukelten, legte sich eine schwermütige Stimmung über die beiden Poldoreys. Natürlich kamen manche Stürme ohne jede Vorwarnung, und davor fürchteten sich die Fischer und ihre Familien am meisten. Ich hörte einmal, wie die Frau eines Fischers sagte: »Wenn er hinausfährt, weiß ich nie, ob er wieder zurückkommt.« Diese Worte machten mich sehr traurig. Die ständig drohende Gefahr war die Ursache nicht nur ihres, sondern des Aberglaubens auch all der anderen. Immerzu achteten sie auf Vorzeichen und böse Omen.
Die Bergleute waren nicht weniger abergläubisch. Das Moor fing ungefähr zwei Meilen außerhalb der Stadt an, und dicht beim Moor lag die Zinnmine von Poldorey. Die Leute nannten sie liebevoll »Scat Bal«, das bedeutete soviel wie nutzlos, abgebaut, eben eine ehemalige Mine. Doch das traf bei weitem nicht zu. Die Mine hatte der Gemeinde Wohlstand gebracht. Wir waren gut bekannt mit den Pencarrons, die in einem schönen Haus namens Pencarron Manor in der Nähe des Bergwerks wohnten. Sie hatten vor einigen Jahren den Grund und Boden gekauft und mit dem Zinnabbau begonnen.
Die abergläubischen Bergleute ließen immer etwas von ihrem Lunch in der Mine zurück, um die Geister versöhnlich zu stimmen. Auf keinen Fall wollten sie ihren Unmut erregen, damit kein Unglück im Bergwerk passierte. Es hatte bereits einige schlimme Unfälle gegeben. Etliche Frauen und Kinder hatten den Ernährer in der alten »Scat Bal« verloren. Wie die Fischer achteten auch sie unentwegt auf schlimme Vorzeichen. Nicht die kleinste Kleinigkeit, die etwas bedeuten mochte, entging ihnen.
»Es ist verständlich, daß sie Angst haben«, erklärte meine Mutter. »Und ein wenig von seinem Lunch abzugeben, wenn man davon überzeugt ist, sich damit Sicherheit zu erkaufen, ist schließlich nicht verwerflich.«
Ich konnte nicht genug über die bösen Geister erfahren. Begierig lauschte ich den Geschichten der Leute. Angeblich hatten die Geister die Gestalt von Zwergen. Die Bergleute behaupteten, es handle sich um die Geister der Juden, die Christus gekreuzigt hatten. Meine Mutter hielt das für blanken Unsinn. Aber schließlich mußte sie ja auch nicht hinunter in den Stollen. Trotzdem interessierte sie sich sehr für die vielen Legenden, die in unserer Gegend die Runde machten.
Nachdenklich sagte sie zu mir: »In London würden sie uns auslachen. Aber in Cornwall scheinen sich diese merkwürdigen Legenden zu bewahrheiten. Diese Gegend ist der geeignete Ort für Geister und diese seltsamen Geschichten von Quellen, die über geheimnisvolle Kräfte verfügen, von Gespenstern und unerklärlichen Begebenheiten. Denk doch mal an den Teich von St. Branok.«
»O ja«, bat ich eifrig, »erzähl mir vom Teich.«
»Am Teich mußt du sehr vorsichtig sein. Du darfst nur mit Miß Prentiss oder einem anderen Erwachsenen hingehen. Der Boden ist ein bißchen sumpfig.«
»Erzähl die Geschichte. Bitte.«
»Es handelt sich um eine uralte Legende. Ich vermute, ein paar von den Leuten hier glauben sogar daran.«
»Was glauben sie denn?«
»Daß sie, die Glocken hören.«
»Glocken? Welche Glocken?«
»Die Glocken, die angeblich im See liegen.«
»Was? Im Wasser?«
Sie nickte. »Das Gerede ist einfach lächerlich. Manche behaupten, der Teich sei unergründlich tief. Wenn das der Fall wäre, wo sollten sich dann die Glocken befinden? Schließlich müßten sie auf dem Grund liegen. Entweder hat der Teich einen Grund oder er hat keinen. Beides geht nicht.«
»Erzähl mir die Geschichte von den Glocken, Mama.«
»Vor langer, langer Zeit, so sagt man, stand dort ein Kloster.«
»Das glaub' ich nicht. Im Wasser?«
»Damals gab es dort noch keinen Teich. Als die Mönche das Kloster errichteten, waren sie fromme, sehr gläubige Männer, die ihre Tage mit Beten und guten Taten verbrachten. Das geschah zu der Zeit, als der heilige Augustinus das Christentum nach Großbritannien brachte.«
»Ja, ja«, drängte ich ungeduldig. Ich fürchtete, die Erzählung würde in eine Geschichtsstunde ausarten.
»Von nah und fern kamen die Menschen zum Kloster. Alle brachten Geschenke mit – Gold und Silber, Wein und köstliches Essen. Und plötzlich waren die Mönche nicht mehr arm, wie es ihre Ordensregel vorschrieb, sondern reich. Von da an gaben sie sich verwerflichem Treiben hin.«
»Was haben sie denn gemacht?«
»Sie liebten gutes, reichhaltiges Essen. Sie tranken zuviel, sie feierten ausgelassene Feste, sie tanzten; kurzum, sie taten Dinge, die sie nie zuvor gemacht hatten. Eines Tages erschien ein Fremder im Kloster. Doch er brachte den Mönchen keine Geschenke, sondern ging geradewegs in die Kirche und hielt eine Predigt. Er sagte den Mönchen, Gott sei sehr unzufrieden mit ihnen und sehr zornig. Aus diesem wunderschönen Kloster, das sie Ihm zu Ehren errichtet hatten, hätten sie eine Lasterhöhle gemacht. Sie müßten ihre Untaten bereuen. Aber die Mönche genossen ihr Leben viel zu sehr und hatten nicht die geringste Lust, etwas zu ändern. Sie haßten den Fremden, der ihnen die Botschaft überbracht hatte. Sie befahlen ihm, unverzüglich zu verschwinden. Wenn er nicht freiwillig ginge, würden sie ihm Beine machen. Doch er dachte gar nicht daran. Da holten sie die Peitschen und Stöcke, mit denen sie sich früher kasteit hatten, um wahrhaft Heilige zu werden – ich hab' nie verstanden, wozu das gut sein soll. Damit schlugen sie auf ihn ein, aber die Schläge prallten ohne jede Wirkung von seinem Körper ab. Er trug nicht die kleinste Verletzung davon. Plötzlich umgab ihn ein heller, glänzender Lichtschein. Er hob die Hände und belegte St. Branok mit einem Bannfluch. Seine Worte lauteten: ›Früher war dies ein heiliger Ort, jetzt ist er verflucht. Bald wird nichts mehr von ihm künden. Fluten werden sich über ihn ergießen und ihn vor den Blicken der Menschen verbergen. Die Glocken werden schweigen, es sei denn, sie kündigen eine entsetzliche Katastrophe an.‹ Nach diesen Worten verschwand er.«
»Geradewegs in den Himmel?«
»Vielleicht.«
»Ich wette, das war der heilige Paulus. Ihm traue ich so etwas zu.«
»Wer auch immer es war, er hat die Wahrheit gesprochen. Jedenfalls, wenn man der Legende Glauben schenkt. Die Mönche versuchten, die Glocken zu läuten, aber diese gaben keinen Ton von sich. Da bekamen sie Angst. Sie beteten, aber es half nichts. Die Glocken schwiegen. Eines Nachts begann es zu regnen. Ohne Unterbrechung regnete es vierzig Tage und vierzig Nächte. Die Flüsse traten über die Ufer, das Wasser stieg und stieg, bis über das Dach des Klosters. Und so entstand der Teich von St. Branok.«
»Wie tief im Wasser befindet sich denn das Kloster?«
Lächelnd sah sie mich an. »Es ist doch nur eine Geschichte. Immer wenn eine Katastrophe passiert, behaupten die Leute, sie hätten die Glocken gehört. Aber wenn du mich fragst, bilden sie sich das nur ein, denn alle reden erst hinterher davon. Vor der Katastrophe sagt keiner ein Wort von den Glocken. Es ist halt eine der, alten Legenden, von denen es in Cornwall so viele gibt.«
»Aber der Teich ist da.«
»Es ist einfach ein Tümpel, weiter nichts.«
»Und er ist unendlich tief?«
»Das bezweifle ich.«
»Hat schon einmal jemand versucht, das herauszufinden?«
»Warum, um alles in der Welt, hätte das jemand tun sollen?«
»Um nachzusehen, ob dort unten ein Kloster steht.«
»Ach was, das ist doch nur Aberglaube. Kein Mensch überprüft das. Niemand hat das Wasser der Nun's-Quelle im Altertum auf seine angeblichen Heilkräfte untersucht. Oder die St. Uny's Quelle in Redruth. Von der erzählt man sich, man könne jemanden, der zum Tod durch den Strang verurteilt worden ist, nicht hängen, wenn er daraus getrunken hat. Es gibt Leute, die glauben solche Dinge. Andere wiederum sind skeptisch. Mit St. Branok ist das nicht anders.«
»Trotzdem möchte ich die Glocken hören.«
»Aber es gibt keine Glocken. Ich bezweifle sogar, daß es jemals ein Kloster St. Branok gegeben hat. Wenn die Leute für ein Ereignis keine Erklärung finden, bilden sie sich ein, dies oder jenes gehört oder gesehen zu haben. So entstehen die Legenden. Aber geh bitte nicht zu nahe an den Teich! Es ist zu gefährlich. Stehende Gewässer haben immer so etwas an sich, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Außerdem ist der Boden sumpfig. Das habe ich dir bereits gesagt.«
Ich dachte nach dieser Unterhaltung kaum mehr an den Teich, denn es gab sehr viel interessantere Geschichten als die Legende um St. Branok. Es kursierten alle möglichen Erzählungen über Hexereien. Angeblich besaßen manche Menschen die Macht, andere mit einer Krankheit zu belegen. Wieder andere vollbrachten Böses, indem sie eine kleine Wachsfigur mit dem Aussehen ihrer Feinde anfertigten, in die sie Nadeln hineinsteckten. Als ein Mann ganz überraschend gestorben war, beschuldigte seine Mutter dessen Frau, Salz um seinen Stuhl gestreut zu haben – ein Mord, für den sie kein Gericht der Welt verurteilen konnte. Die Frau hieß Maddy Craig. Wie man behauptete, besaß sie übernatürliche Kräfte, weil einer ihrer Ahnen einer gestrandeten Meerjungfrau zurück ins Wasser geholfen hatte. In Cornwall gab es mehrere Familien, die es auf ähnliche Weise angeblich zu übersinnlichen Kräften gebracht hatten.
Meine Mutter wußte gut Bescheid über die Vorfahren unserer Familie und erzählte gern und oft von ihnen. Die meisten stammten aus Eversleigh. Im Lauf der Zeit heirateten einige in andere Gegenden Englands. So kam es, daß der eine Zweig der Familie in Cador, der andere in Eversleigh lebte. Wir besuchten diese Verwandten sehr selten, denn Eversleigh liegt im Südosten Englands, Cador dagegen im Südwesten.
Meine Mutter besaß einige Familienstammbücher und unterhielt sich mit mir über die Angelet, der ich meinen Namen verdankte. Ich interessierte mich natürlich für sie. Sie hatte eine Zwillingsschwester namens Bersaba, und beide heirateten denselben Mann – zuerst Angelet und dann Bersaba. Bersaba natürlich erst nach dem Tod meiner Namensschwester.
Cador besaß eine Ahnengalerie. Am meisten fühlte ich mich zum Porträt meines Großvaters hingezogen. Er blickte auf mich herab, seine Augen schienen mir zu folgen, wohin ich mich auch wandte. Nach meinem Geschmack handelte es sich um ein gutes Gemälde, denn es vermittelte den Eindruck, als würde er jeden Augenblick aus dem Bild heraussteigen, so lebendig sah er aus. Er war ein dunkler Typ, und sein Gesicht drückte Willenskraft aus. Seine Mundwinkel waren zu einem leichten Lächeln nach oben gezogen, und in seinen Augen lag ein gewisses Zwinkern. Er sah so aus, als hielte er das Leben für einen Riesenspaß.
Meiner Mutter fiel mein besonderes Interesse an diesem Porträt auf.
»Du siehst es dir oft an«, bemerkte sie einmal.
»Er sieht aus, als wäre er lebendig. Die anderen sind so langweilig wie die meisten Gemälde.«
Sie wandte sich ab. Ich wußte, sie wollte mir nicht zeigen, wie tief bewegt sie war.
Nach einer Weile sagte sie leise: »Er war ein wunderbarer Mann. Ich habe ihn geliebt. Sehr geliebt. In meiner Kindheit war er für mich der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. Ach, Angel, ich wünsche mir so sehr, du hättest ihn noch gekannt! Manchmal könnte man meinen, unser Schicksal sei vorbestimmt. Er mußte jung sterben. Ich kann ihn mir beim besten Willen nicht als alten Mann vorstellen. Abenteuer faszinierten ihn, ja, man könnte fast sagen, Gefahren zogen ihn magisch an. Aber schließlich fand er im Kreise seiner Familie Ruhe und Frieden. Er hat seine Familie zärtlich geliebt ... meine Mutter, Jacco und mich.«
Sie verstummte. Ihre Gefühle überwältigten sie.
Ungestüm umarmte ich sie.
»Gehen wir. Die Erinnerungen tun dir zu weh«, bat ich.
Sie schüttelte den Kopf. »Wenn er mich so sehen könnte, würde er mich auslachen. Er würde sagen, ich hätte nicht den geringsten Grund zum Traurigsein. Sie ging mit ihm ... meine Mutter ... und Jacco auch. Alle sind sie fortgegangen und haben mich allein gelassen. Aber in meiner Erinnerung sind sie noch heute lebendig. Ich werde sie nie vergessen. Auch jetzt denke ich an den Tag, an dem sie weggegangen und niemals wiedergekommen sind.«
Sie erzählte mir von Großvater Jack Cadorson. »Cador war seine Heimat. Er hatte einen älteren Bruder, der den Besitz erbte. Die beiden Brüder sind nicht gut miteinander ausgekommen. Jack verließ Cador und lebte bei den Zigeunern.«
»Er sieht fast selbst wie ein Zigeuner aus.«
»Das Zigeunerleben lag ihm im Blut. Er hatte vor nichts und niemandem Angst. Er forderte die Gefahr heraus und nahm jede Herausforderung an. Und am Ende hat er stets gewonnen. Während er bei den Zigeunern lebte, tötete er einen Mann. Dieser Mann, ein Aristokrat, überfiel ein kleines Zigeunermädchen. Jack eilte dem Kind zu Hilfe. Es kam zu einem Kampf, in dessen Verlauf er den Mann tötete. Dafür wurde er zu sieben Jahren Verbannung in Australien verurteilt. Er wäre als Mörder gehängt worden, hätte nicht deine Großmutter Jessica ihren Vater überreden können, alles in seiner Macht Stehende für ihn zu unternehmen. Ihr Vater machte seinen großen Einfluß geltend und konnte die Strafe mildern. Mit der Deportation in ein fremdes Land ist er als Mörder, und so haben sie ihn ja bezeichnet, glimpflich davongekommen.
Während seiner Abwesenheit starb sein Bruder, und nun war er Erbe von Cador. Nach der Verbüßung seiner Strafe kehrte er nach England zurück und heiratete Jessica. Mein Bruder Jacco wurde geboren und später ich. Wir waren eine glückliche Familie. In Australien war er zu Wohlstand gekommen und besaß auch Land dort. Deshalb waren sie an jenem unseligen Tag in Australien. Er wollte mit meiner Mutter und Jacco segeln. Sie sind auf dem Meer geblieben. Sie sind nie zurückgekommen.«
»Sprich nicht weiter!«
»Es erschüttert mich. Selbst heute noch.«
Ich legte meinen Arm um sie. »Sei nicht traurig, Mama. Heute hast du Papa und uns – Jack und mich.«
Sie drückte mich ganz fest an sich. »Ja. Ich habe allen Grund, glücklich zu sein. Aber diesen Tag werde ich niemals vergessen. Wir waren fast immer zusammen. Und dann – nie wieder. Die Wege des Lebens sind unerforschlich. Stets muß man auf das Schlimmste vorbereitet sein.« Sie küßte mich und fügte rasch hinzu: »Eigentlich habe ich keinen Grund zum Traurigsein. Ich habe mit ihnen eine so herrliche Zeit verbracht. Daran sollte ich mich erinnern und dankbar sein. Und jetzt habe ich deinen Vater und dich und Jack.«
Nachdem ich diese Neuigkeit über meinen Großvater erfahren hatte, zog es mich noch häufiger zu seinem Porträt in der Galerie. In meinen Tagträumen versetzte ich mich in die Zeit lange vor meiner Geburt. Ich war eine Zigeunerin, und wir wohnten zusammen in einem Zigeunerwagen. Ich begleitete ihn auf der Schiffsreise nach Australien. Auch an jenem verhängnisvollen Tag war ich beim Segeln dabei. Den Schluß veränderte ich, denn ich rettete sie alle. Mein Großvater beanspruchte von nun an einen bedeutenden Platz in meinen Träumen.
Anfang April lag der erste Hauch des Frühlings in der Luft, und Jack, unser Kindermädchen Amy und ich hielten uns oft im Garten auf. Eines Tages spazierten meine Eltern auf dem Gartenweg zu uns herüber.
Jack lief zu Mutter und klammerte sich an ihren Röcken fest. Zärtlich hob sie ihn hoch. Sie lächelte mir zu. »Wir haben Nachricht von Tante Amaryllis.«
Tante Amaryllis schrieb häufig. Sie hielt es für ihre Pflicht, die Familie zusammenzuhalten. Darüber hinaus hatte sie wohl das Gefühl, sie müsse sich nach dem unglückseligen Unfalltod meiner Großmutter in Australien ganz besonders um meine Mutter kümmern. Amaryllis und Großmutter Jessica waren fast im gleichen Alter gewesen und zusammen aufgewachsen.
»Tante Amaryllis ist schon ganz aufgeregt wegen der Weltausstellung, berichtete meine Mutter. »Die Königin höchstpersönlich wird am ersten Mai die Ausstellung eröffnen. Tante Amaryllis meint, wir dürften uns dieses Ereignis nicht entgehen lassen. Außerdem ist es schon einige Zeit her, seit wir sie zuletzt besucht haben.«
Vor Freude hüpfte ich von einem Bein aufs andere. Ich machte sehr gerne Besuche in London.
»Es spricht nichts dagegen, diese Einladung anzunehmen«, sagte mein Vater.
»Ich komme auch mit«, verkündete Jack.
»Aber natürlich, mein Schatz«, antwortete meine Mutter.
»Wir denken nicht einmal im Traum daran, dich zurückzulassen. Oder glaubst du das etwa?«
»Nein«, erwiderte Jack ein wenig selbstgefällig, wie mir schien.
»Bestimmt wird es sehr aufregend. Die Vorbereitungen für die Weltausstellung laufen schon seit Monaten. Und die Königin scheint besonders davon angetan zu sein, weil die Ausstellung auf eine Idee von Prinz Albert zurückgeht. Er beschäftigt sich nach wie vor damit.«
»Wann reisen wir?« erkundigte ich mich.
»In ein paar Wochen«, antwortete meine Mutter.
»Spätestens«, versicherte Vater. »Wir wollen doch nicht die Eröffnung verpassen.«
»Und die Königin«, warf ich ein. »Oh, ich kann es kaum noch erwarten.«
»Ich schreibe sofort an Tante Amaryllis«, beruhigte mich meine Mutter.
In den nächsten Tagen sprachen wir fast ausschließlich über die bevorstehende Weltausstellung.
In London bereitete uns Tante Amaryllis einen herzlichen Empfang. Das Haus am Square versetzte mich jedesmal aufs neue in Entzücken. Mitten auf dem schönen Platz, den prachtvolle Häuser säumten, befand sich ein abgeschlossener Garten. Nur die Bewohner der umliegenden Häuser durften diesen Garten benutzen. Alle besaßen einen eigenen Schlüssel, damit sie nach Belieben hineingehen konnten. Die Anlagen wurden hervorragend gepflegt. Zwischen den Bäumen und Sträuchern schlängelten sich schmale Wege, hie und da standen Bänke zum Ausruhen. Ich betrachtete diesen Garten als perfekte Miniaturausgabe eines Zauberwaldes. Von den Fenstern im obersten Stock des Hauses aus erhaschte man einen Blick auf die Themse. Ich hätte stundenlang hinaussehen können. Der Anblick versetzte mich zurück in die ruhmreiche Vergangenheit der Großstadt, in die Zeit, als der Fluß noch die Hauptverkehrsader gewesen war. Als Anna Boleyn machte ich mich auf den Weg zur Krönung und wurde später in das trostlose Gefängnis des Londoner Towers geworfen. Oder ich nahm an einem prunkvollen Fest am königlichen Hofe teil und lauschte hingerissen Händels Wassermusik. Stets stand ich im Mittelpunkt großartiger Ereignisse. Ich war die Heldin.
Tante Amaryllis mußte schon fast sechzig Jahre alt sein, sah aber mit ihrem faltenlosen, fast kindlich wirkenden Gesicht um einiges jünger aus. Onkel Peter war noch älter, machte jedoch einen unverwüstlichen Eindruck.
Amaryllis umarmte meine Mutter besonders herzlich. Tränen standen in ihren Augen. Ich wußte, sie dachte an meine Großmutter. Es war immer das gleiche, wenn sie meine Mutter längere Zeit nicht gesehen hatte.
»Es ist so schön, dich wieder einmal bei uns zu haben«, sagte sie. »Mir kommt es vor, als hätte ich dich eine Ewigkeit nichtmehr gesehen. Angelet, wie du gewachsen bist! Und der kleine Jack! Na, klein darf ich wohl nicht mehr sagen, oder?«
»Ich bin schon ziemlich groß«, bestätigte Jack in seiner üblichen Bescheidenheit.
Tante Amaryllis küßte ihn zärtlich.
»Und Rolf ... Schön, dich zu sehen. Jetzt zeige ich euch eure Zimmer. Selbstverständlich dieselben wie immer. Morgen kommen übrigens Helena und Matthew zum Essen. Matthew will am Vormittag irgend etwas Berufliches mit Peter besprechen.«
Freudig erregt bezog ich mein kleines Zimmer im Obergeschoß des Hauses. Tante Amaryllis wußte, wie gerne ich den Fluß betrachtete. Sie merkte sich solche scheinbar unwichtigen Dinge. Ich glaube, sie hat ihr Leben lang versucht, anderen Menschen eine Freude zu bereiten.
Bis zum Schlafengehen unterhielt sich die ganze Familie äußerst angeregt.
»Du mußt mit den Kindern Helena besuchen!« sagte Tante Amaryllis. »Jonnie und Geoffrey freuen sich schon auf Angelet.«
»Wie alt ist Jonnie jetzt eigentlich?«
»Er wird bald dreizehn.«
Ich konnte es kaum erwarten, Jonnie zu besuchen.
Am nächsten Vormittag nahm meine Mutter Jack und mich mit zu den Humes. Matthew war natürlich bei Onkel Peter, aber Tante Helena begrüßte uns überschwenglich. Tante Helena hatte große Ähnlichkeit mit ihrer Mutter, nur fehlte ihr die herausragende Eigenschaft von Amaryllis: der naive Glaube an das Gute im Menschen. Helena liebte ihre Familie über alles und bewunderte ihren Mann wegen seiner beruflichen Erfolge. Sie unterhielt sich mit meiner Mutter über Matthews Karriere im Parlament und betonte ihre große Hoffnung, daß seine Partei bald wieder an die Regierung komme, denn dann würde Matthew bestimmt ins Kabinett berufen werden. Jedenfalls zweifelte ihr Vater nicht im geringsten daran, und der hörte ja bekanntlich das Gras wachsen.
Ich schloß mich Jonnie an, der mir seine Bücher über Archäologie zeigen wollte. Seine ganze Begeisterung galt seiner Bibliothek. Ich machte mir nicht viel aus alten Waffen, Münzen, Tonscherben und Dingen, die irgend jemand irgendwann ausgegraben hatte und anhand derer man die kulturelle Entwicklung von der Steinzeit zum Bronzezeitalter nachvollziehen konnte. Aber ich war gerne mit Jonnie zusammen. Die Weltausstellung interessierte ihn natürlich ebenfalls. Er berichtete mir, er sei häufig in den Hyde Park gegangen und habe sich die Fortschritte beim Aufbau der Ausstellung angesehen. Seiner Meinung nach mußte die Eröffnung einfach großartig werden. Besonders neugierig war er auf den fast schon legendären Kristallpalast.
Geoffrey, obwohl nur zwei Jahr älter als ich, verhielt sich mir gegenüber immer ein wenig gönnerhaft und reserviert. Er benahm sich, als sei es unter seiner Würde, sich mit einem so kleinen Mädchen abzugeben. Jonnie war vier Jahre älter als ich, nahm mich aber im Gegensatz zu seinem Bruder völlig ernst. Ich mochte Jonnie sehr.
Als wir zu Tante Amaryllis und Onkel Peter zurückkehrten, war Matthew immer noch da.
Onkel Peter verhielt sich mir gegenüber ausgesprochen freundlich und zuvorkommend. Ich hatte den Eindruck, er widmete mir besonders viel Aufmerksamkeit. Einmal sagte er zu mir: »Du siehst deiner Großmutter gar nicht ähnlich, trotzdem kommst du ganz nach ihr.« Ich spürte, daß er mir damit ein Kompliment machte. Anscheinend hatte er Jessica sehr gern gehabt.
Obwohl schon recht alt, war er eine Herrschernatur. Sein Haar glänzte fast weiß, aber er wirkte noch immer sehr stattlich. Den besonderen Unterschied zu allen anderen Menschen, die ich kannte, bildete sein geheimnisvolles Lächeln. Wenn er lächelte, sah er aus, als sei das Leben für ihn ein einziges Vergnügen. Ich war überzeugt davon, daß er einen Weg gefunden hatte, das Leben ganz auf seine Weise zu genießen.
Die graue Eminenz ... nun, daran gab es wohl kaum einen Zweifel. Mochte Matthew auch ein guter Politiker sein, so betrachtete er seinen Schwiegervater doch als seinen unentbehrlichen Mentor. Matthew hatte seit seiner Rückkehr aus Australien viel erreicht. Unter anderem hatte er ein Buch über die Deportationen und die Gefangenen in Australien geschrieben, das zu dem Klassiker über dieses Thema aufgestiegen war. Noch immer wurden Verurteilte deportiert, und noch immer gab es diese berüchtigten Aufseher, denen die Gefangenen rechtlos ausgeliefert waren. In den Gefängnissen herrschten entsetzliche Zustände. Aber Matthew war es mit seinem Buch immerhin gelungen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese furchtbaren Zustände zu lenken. Die Deportation war ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Matthew, der für die Abschaffung dieser barbarischen Bestrafung plädierte, hatte inzwischen zahlreiche Anhänger. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis diese sich durchsetzen konnten. Matthew hatte auch ein Buch über Kinderarbeit verfaßt und besonders über das Schicksal der Kinder berichtet, die als Schornsteinfeger und in den Bergwerken schuften mußten. Er setzte sich nachhaltig für Reformen ein. Im Parlament begegnete man ihm mit großem Respekt. Seine Wähler achteten und schätzten ihn. Die Parteiführung hatte große Pläne mit ihm, und er durfte mit Recht auf ein Ministeramt hoffen, sobald seine Partei wieder die Regierung übernehmen würde.
Ich durfte zusammen mit den Erwachsenen essen.
»Angelet, setz dich bitte neben mich!« forderte mich Onkel Peter auf. Mit seinem Charme gelang es ihm spielend, das Herz eines Kindes zu erobern.
Den größten Teil der Unterhaltung bestritt er alleine. Anscheinend hatte er seine Finger wirklich »überall drin«. Jedenfalls hatte ich einmal gehört, wie jemand so über ihn urteilte. Damals wußte ich noch nicht genau, welchen Geschäften er nachging, aber sie mußten sehr einträglich sein, denn er war äußerst vermögend. Später erfuhr ich, daß ihm einige Klubs gehörten, von denen manche einen besonders schlechten Ruf genossen. Aber seiner Ansicht nach leistete er mit seinen Klubs der Gesellschaft einen großen Dienst. In den Klubs verkehrten Leute, die sich manch kleiner Vergehen schuldig gemacht hatten. Ohne diese Treffpunkte hätten sie leicht zu einer Bedrohung für die Gesellschaft werden können. Das behauptete jedenfalls Onkel Peter, und deshalb betrachtete er sich fast als Wohltäter. Auch Amaryllis war von seinen guten Absichten felsenfest überzeugt, obwohl es im Zusammenhang mit seinen geschäftlichen Aktivitäten einmal einen handfesten Skandal gegeben hatte, der ihn seinen Sitz im Parlament kostete. Seitdem mußte er sich damit begnügen, Matthew in seinem Sinne zu beeinflussen. Ich hielt Matthew für eine Marionette und Onkel Peter für den Puppenspieler.
Aber er manipulierte nicht nur Matthew. Ich bin sicher, daß er eine ganze Anzahl von Leuten nach seiner Pfeife tanzen ließ.
Neben ihm sitzen zu dürfen, empfand ich als eine Art Auszeichnung. Ich fühlte mich wichtig.
Die Unterhaltung drehte sich um die Torheiten des Premierministers John Russell, der den Whigs angehörte. Onkel Peter war ein Tory und ließ kein gutes Haar an dem kleinen John, wie er den Premierminister abfällig nannte.
Über die Ausstellung wurde des langen und breiten gesprochen.
»Du freust dich bestimmt schon auf die Eröffnung, nicht wahr, Angelet?« fragte er mich.
Ich nickte aufgeregt.
»An dieses Erlebnis wirst du dich dein Leben lang erinnern. Es ist ein historisches Ereignis.«
»Soweit ich weiß, nimmt die Königin die Eröffnung selbst vor«, warf meine Mutter ein.
»Ja, natürlich. Ihre kleine Majestät gerät über die Ausstellung geradezu ins Schwärmen. Und warum? Weil die Ausstellung ein Geisteskind ihres geliebten Albert ist. Schon aus dem Grund muß in ihren Augen einfach alles großartig sein.«
»Findet ihr es denn nicht auch schön, wie glücklich die beiden sind?« fragte Tante Amaryllis. »Sie gehen ihrem Volk mit gutem Beispiel voran.«
»Glaub mir, auch in dieser Ehe wird es hin und wieder ein Gewitter geben. Davon bin ich überzeugt, meine Liebe«, antwortete Onkel Peter. »Aber ich denke auch, daß sich Albert jedesmal gut aus der Affäre zieht, und das sagt schon einiges über seine Klugheit aus ... oder sollte er seinen Einfluß auf die Königin vielleicht doch nur seinem guten Aussehen verdanken?«
»Aber Peter!« sagte Tante Amaryllis, halb scheltend, halb bewundernd.
»Wie dem auch sei«, mischte sich Matthew ein, »das Projekt steht jedenfalls kurz vor der Vollendung. Es wird schon nichts schiefgehen.«
»Der kleine John wird sich die größte Mühe geben, Schwierigkeiten zu machen«, sagte Onkel Peter. »Was hat er denn diesmal wieder ausgeheckt, Matthew?«
»Er möchte, daß die Salutschüsse im St. James Park abgefeuert werden. Er behauptet, wenn man die Zeremonie im Hyde Park vornähme, könnte die Kristallkuppel zerspringen.«
»Besteht denn diese Gefahr?« wollte meine Mutter wissen.
»Ach was«, entgegnete Onkel Peter scharf. »Er muß nur mal wieder ungefragt dazwischenreden und Ärger machen.«
»Vermutlich wird sich Albert gegen ihn durchsetzen«, meinte Matthew.
»Und was ist, wenn die Kuppel wirklich beschädigt wird?« fragte ich.
»Meine liebe Angelet«, sagte Onkel Peter und schenkte mir ein strahlendes Lächeln, »dann hat Albert unrecht gehabt und der kleine John recht.«
»Ist die Gefahr groß?«
Er zuckte die Achseln. »Ich glaube nicht. Albert wird in dieser Sache kaum einlenken oder sich zu einer. Änderung seiner Pläne überreden lassen. Mach kein so besorgtes Gesicht. Ich bezweifle, daß etwas passiert. Die Kristallkuppel wird die ganze Prozedur unbeschadet überstehen. Und falls nicht ... nun, dann kommen wir zumindest in den Genuß eines gewaltigen Gescheppers.«
»Ich finde es ziemlich leichtsinnig, ein solches Risiko einzugehen«, wagte ich zu widersprechen. »Es wäre doch furchtbar, wenn die Kuppel zerbrechen würde nach all dem Wirbel, den es bereits um sie gegeben hat.«
»Das Leben steckt voller Gefahren,. mein Liebes. Manchmal lohnt es sich, ein Risiko einzugehen. Gibt der Prinz in dieser Angelegenheit nach, dann bringt der kleine John mit Sicherheit neue Einwände vor. Albert kann unmöglich zugeben, daß er sich möglicherweise irrt. Folglich bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als das Risiko in Kauf zu nehmen.«
Mich beunruhigte diese Ansicht außerordentlich, aber ich sagte nichts mehr, denn ich fühlte Onkel Peters amüsierten Blick auf mir.
Er sprach weiter über die Ausstellung. Über die Ansicht des Prinzen, damit ein Fest der Arbeit und des Friedens feiern zu wollen. Und wieviel schöner es wäre, wenn die Nationen auf dem Feld der Technik friedlich miteinander wetteiferten, anstatt sich auf den Schlachtfeldern die Köpfe einzuschlagen. Kunst und Handel sollten in Zukunft eine gleichwertige Stellung einnehmen.
Endlich kam der große Tag. Ich war froh, daß wir zu den Glücklichen gehörten, die zur Eröffnungsfeier gehen konnten. Zum erstenmal sah ich die Königin. In ihrem kostbaren rosasilbernen Kleid fand ich sie sehr schön. Sie hatte den Hosenbandorden angelegt und trug auf dem Kopf eine kleine Krone mit dem funkelnden Kohinoor-Diamanten. Vor Entzücken hielt ich den Atem an. Noch nie hatte ich ein so großartiges Schauspiel gesehen. Stolz stimmte ich in die Hochrufe der Menge ein, als die Königin aus der Kutsche stieg. Zwei Federn, die an der Krone befestigt waren, wippten elegant. Sie sah stolz, glücklich und wahrhaft königlich aus. Genauso, wie ich mir immer eine Königin vorgestellt hatte.
Wir verbrachten einen wundervollen Tag. Meine hochgesteckten Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Die Musik klang herrlich. Ich liebte den Halleluja-Chor. Die Königin und ihr Gemahl nahmen auf dem eigens für sie reservierten Podium Platz und thronten unter einem blaugoldenen Baldachin. Ich konnte meine Augen nicht von dem Paar losreißen. In Gedanken versetzte ich mich an ihre Stelle. Ich war Viktoria – die stolze Ehefrau, die kluge Mutter, die große Königin –, das Vorbild einer ganzen Nation. Diese Vorstellung gefiel mir ausnehmend gut.
Es war ein aufreibender Tag. Es gab unendlich viel zu sehen. Viele Länder hatten weder Kosten noch Mühen gescheut und ihre besten und qualitativ hochwertigsten Produkte nach London gebracht. Die Anwesenheit zahlreicher Berühmtheiten wie des Herzogs von Wellington imponierten mir besonders. Am meisten aber beeindruckte mich unsere kleine Königin. Sie sah so strahlend glücklich, so menschlich und trotzdem königlich aus. Ich mochte sie vom ersten Augenblick an. Sie hinterließ einen unvergeßlichen Eindruck bei mir. Die Königin leibhaftig gesehen zu haben, das war das aufregendste Erlebnis der ganzen Ausstellung.
Am Abend drehten sich unsere Gespräche ausschließlich um die Weltausstellung.
Die begeisterte Tante Amaryllis sagte: »Ihr wollt bestimmt noch einmal hin, bevor ihr nach Cornwall zurückfahrt.«
Meine Mutter nickte nachdrücklich.
»Wird dann die Königin auch wieder dasein?« erkundigte ich mich.
»Das würde mich nicht überraschen« antwortete Onkel Peter schmunzelnd. »Die Ausstellung ist eine Herzensangelegenheit ihres Alberts, und sie unterstützt ihn, wo immer sie kann.«
»Die Salutschüsse wurden im Hyde Park abgefeuert«, sagte ich, »und die Glaskuppel ist nicht zerbrochen.«
»Das hat dir große Sorgen bereitet, nicht wahr?« Onkel Peter sah mich lächelnd an.
»Ja, natürlich.«
»Ein kleines Risiko war schon dabei. Aber ich habe dir ja gesagt, man muß Gefahren ins Auge sehen. Wer sich unerschrocken und mutig einer Gefahr stellt, kann nur gewinnen.« Wir gingen erst sehr spät zu Bett. Kaum lag ich in den Kissen, fiel ich in tiefen Schlaf. In einem wunderschönen Traum sah ich mich in einem rosa- und silberfarbenen Kleid majestätisch die Treppe zur königlichen Tribüne hinaufschreiten. Eine riesige Menschenmenge jubelte mir zu.
Am nächsten Tag geschah etwas Unerwartetes.
Wir saßen gerade beim Essen. Matthew war auch wieder anwesend. Wahrscheinlich holt er sich wieder Ratschläge für seine Parlamentsarbeit, dachte ich ein wenig hochnäsig.
Wir redeten fast ausschließlich über die Weltausstellung. Als wir beim Dessert angelangt waren, klopfte es leise an die Tür. Auf Onkel Peters Aufforderung erschien Janson, der Butler.
Er hüstelte diskret und verkündete: »Ein junger Herr wünscht Sie zu sprechen, Sir.«
»Ein junger Herr? Kann er nicht warten, bis wir mit dem Essen fertig sind, Janson?«
»Er sagte, es sei wichtig, Sir.«
»Wer ist es denn?«
»Ein Mr. Benedict Lansdon, Sir.«
Onkel Peter schien sekundenlang zu überlegen und rührte sich nicht. Dieser Moment der Unsicherheit fiel kaum auf, aber ich beobachtete ihn genau und fand, er wirkte verstört.
Er erhob sich halb von seinem Stuhl, setzte sich aber gleich wieder.
»Oh«, sagte er nur. »Ja, also gut, ich komme sofort, Janson. Bitten Sie ihn zu warten.«
Janson verließ das Zimmer. Onkel Peter warf Tante Amaryllis einen raschen Blick von der Seite zu.
Sie fragte: »Wer ist das, Peter? Der Name ...«
»Es könnte ein verschollen geglaubter Verwandter sein. Ich werde der Sache nachgehen. Wenn ihr mich bitte entschuldigen wollt.«
Kaum war er draußen, begannen die Mutmaßungen.
»Wer könnte das nur sein?« überlegte Matthew laut. »Es muß jemand aus der Familie sein. Dieser Name ...«
»Ich finde es sehr aufregend«, meinte ich.
Meine Mutter lächelte mir zu, sagte aber kein Wort.
Nach dem Essen erhoben wir uns sofort. Bestimmt sprach Onkel Peter noch mit dem geheimnisvollen Besucher.
Es war wirklich nicht schön, ein Kind zu sein. Die wichtigsten Dinge enthielt man mir vor. Ich spürte, es mußte ein Geheimnis um diesen Benedict Lansdon geben. Da war ich ganz sicher. Meine Eltern unterhielten sich im Flüsterton über ihn. Tante Amaryllis sah reichlich verwirrt aus. Ich hörte Matthew zu meinem Vater sagen, er hoffe, »es spreche sich nicht herum«.
Angestrengt überlegte ich, was er damit gemeint haben könnte.
Ich lauschte, ich beobachtete, und schließlich kam ich der Sache auf den Grund.
Benedict war Onkel Peters vor siebzehn Jahren in Australien geborener Enkel. Sein Vater war ein Sohn von Onkel Peter. Onkel Peter hatte zwar nur einmal geheiratet, nämlich Tante Amaryllis, aber vor seiner Ehe zeugte er einen Sohn, von dessen Existenz Amaryllis bis zu diesem Augenblick keine Ahnung gehabt hatte.
Ich hörte, wie meine Mutter zu meinem Vater sagte: »Er hat es auf seine Art erledigt. So, wie man es von ihm erwartete. Eine Jugendsünde ... Damals hat er Amaryllis natürlich noch nicht gekannt.«
Benedict war also das Produkt einer Jugendsünde.
Von Benedict selbst erfuhr ich endlich mehr darüber. Wir fühlten uns sofort zueinander hingezogen. Ich zu ihm, weil er ganz anders war als alle, die ich bisher kannte, und er zu mir, weil ich ihn unverhohlen bewunderte.
Er war groß für sein Alter, hatte strahlendblaue Augen, die in einem merkwürdigen Kontrast zu seiner sonnenverbrannten Haut standen. Sein Haar war sehr hell, von der brennenden australischen Sonne gebleicht. Seine zur Schau getragene Unbekümmertheit erinnerte an Onkel Peter, wirkte aber bei Benedict ein wenig großspurig. Bestimmt war Onkel Peter in Benedicts Alter genauso gewesen. Sein Enkel vermittelte den Eindruck, als sei die Welt nur zu seinem Wohlergehen und Vorteil geschaffen worden. Bei Onkel Peter war mir diese Einstellung auch schon aufgefallen. Es konnte nicht den geringsten Zweifel geben, daß die beiden miteinander verwandt waren.
Das Stadthaus hatte nur einen kleinen eigenen Garten. Er war fast vollständig gepflastert, die kleinen Büsche sahen kümmerlich aus, und der Birnbaum trug nur harte, kleine Früchte. Damit der Garten ein wenig Farbe bekam, hatte Tante Amaryllis blühende Pflanzen in Tontöpfe gepflanzt und eine rustikale Bank aufstellen lassen.
In diesem Garten fand meine erste Begegnung mit Benedict statt.
»Hallo«, sagte er. »Du bist ja ein hübsches kleines Mädchen. Wie heißt du denn?«
»Angelet. Manche Leute nennen mich Angel, aber das paßt gar nicht zu mir.«
»Das möchte ich hoffen«, erwiderte er. »Vor einem Engel wäre mir angst und bange.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, daß du dich vor irgend etwas fürchtest.«
Davon war ich wirklich zutiefst überzeugt, und er hörte das nur allzugern. Seine blauen Augen blitzten vor Vergnügen. »Es gibt wenig, wovor ich Angst habe«, gab er zu. »Aber Engel haben die irritierende Angewohnheit, über die Sünden der Menschen Buch zu führen.«
»Hast du denn viele Sünden begangen?«
Er nickte und sah mich verschwörerisch an. Ich lachte und fragte: »Wie heißt du?«
»Benedict Lansdon. Nenn mich Ben!«
»Ben paßt auch besser zu dir. Benedict klingt so heilig. Das ist ein Name für einen Mönch, einen Heiligen oder dergleichen.«
»Ich fürchte, zu dieser erlauchten Gesellschaft werde ich niemals gehören.«
»Was machst du hier?«
»Meinen Großvater besuchen.«
»Onkel Peter?«
»Ist er wirklich dein Onkel?«
»Nein, eigentlich nicht. Onkel ist eben eine Anrede für Leute, von denen man nicht weiß, wie und ob man überhaupt mit ihnen verwandt ist. Er hat meine Tante Amaryllis geheiratet, aber sie ist auch nicht meine richtige Tante. Dieses Verwandtschaftsverhältnis ist viel zu kompliziert, um es einleuchtend erklären zu können.«
»Bei mir ist das ganz einfach. Er ist mein richtiger Großvater.«
»Merkwürdig. Er scheint erst seit heute zu wissen, daß es dich überhaupt gibt.«
»Das ist ganz und gar nicht merkwürdig. Im Gegenteil, sogar völlig normal. Manche Menschen haben Kinder, die nicht eingeplant waren. Die völlig überraschend kommen, um es mal so auszudrücken. Jedenfalls ist das meiner Großmutter und deinem Onkel Peter passiert.«
»Ich verstehe.«
»Meine Großmutter wanderte nach Australien aus. Er gab ihr Geld und unterstützte sie, solange sie lebte. Mein Vater wurde geboren. Er bekam den Namen Peter Lansdon, nach seinem Vater ... Peter Lansdon Carter. Den Carter hat man dann weggelassen. Meine Großmutter hat nie geheiratet, aber mein Vater schon. Ich bin also Onkel Peters richtiger Enkel. Meine Großmutter sprach oft von England. Sie hat immer betont, was für ein feiner Mensch mein Großvater sei. Einmal stand etwas in den Zeitungen über ihn. Nicht gerade Gutes. Aber sie lachte nur darüber und sagte, er sei unverbesserlich. Nach ihrem Tod verloren wir jeglichen Kontakt zu ihm, aber wir haben nach wie vor oft von ihm gesprochen. Dann starb auch meine Mutter. Mein Vater und ich hatten ein wenig Grundbesitz, führten aber ein karges Leben. Der Boden taugte nichts, denn er war viel zu trocken. Immer wieder gab es lange Dürreperioden. Und jede Menge Schädlinge – Heuschrecken und dergleichen. Als mein Vater wußte, daß er bald sterben müsse, sprach er mit mir über meine Zukunft. Er hatte einen Käufer für unser Land und meinte, ich solle nach England gehen und meinen Großvater aufsuchen. ›Es ist sicher kein Problem, ihn ausfindig zu machen‹, hat er gesagt. ›Er ist ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft.‹ Nach Vaters Tod fand ich es an der Zeit, nach England zu gehen. Ich verkaufte das Land, und jetzt bin ich hier.«
»Ganz schön mutig von dir.«
»Ach, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ich wollte einfach nach England.«
»Was wirst du jetzt machen?«
Er zuckte die Achseln. »Mal sehen, woher der Wind weht.«
»Hoffentlich aus der richtigen Richtung.«
Er schenkte mir ein zuversichtliches Lächeln. »Dafür sorge ich schon.«
»Davon bin ich überzeugt.«
Wir lächelten einander an. Ich empfand große Sympathie für ihn. Ich prahlte: »Mein Großvater ist auch nach Australien gegangen.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Das erste Mal als Sträfling.«
»Das glaube ich nicht!«
»Doch, doch. Er hat einen Mann getötet und wurde zu sieben Jahren Verbannung verurteilt.«
»Du flunkerst.«
»Nein. Aber ich gebe zu, es ist schwer zu glauben. Er hat bei Zigeunern gelebt, obwohl er auf Cador aufgewachsen ist. Du mußt unbedingt einmal nach Cador kommen, ja?« Es ist ganz herrlich dort. Seit Generationen gehört Cador der Familie Cadorson.«
»Also einer dieser alten Herrensitze.«
»Es ist mein Zuhause.«
»Erzähl mir von deinem Großvater.«
»Na gut. Als er bei den Zigeunern lebte, hat er beobachtet, wie ein ehrenwerter Gentleman ein Zigeunermädchen überfiel. Mein Großvater griff ein und tötete ihn im Kampf. Aber vor Gericht nannte man ihn einen Mörder und verurteilte ihn zu sieben Jahren Verbannung in Australien.«
»Ein mildes Urteil für einen Mörder, das muß ich schon sagen.«
»Aber er war doch kein Mörder. Es war Notwehr. Meine Großmutter, die damals noch sehr jung war, rettete ihn, beziehungsweise ihr Vater. Sie hat ihren Vater gebeten, sich für meinen Großvater einzusetzen. Mein Großvater fügte sich in das Unvermeidliche, gelangte in Australien zu Wohlstand und kehrte nach England zurück. Dann heiratete er meine Großmutter.«
»Aha. Ein Happy-End.«
»Nicht ganz. Mein Onkel Jacco und meine Mutter wurden geboren, und sie waren eine sehr glückliche Familie, bis sie wieder nach Australien gingen. Dort sind sie ertrunken, alle bis auf meine Mutter. Sie ist am Leben geblieben, weil sie an jenem Tag nicht mit ihnen segeln ging.«
»Dann hat Australien ihn am Ende doch besiegt.«
Ich nickte. »Ja. Das scheint ein Land zu sein, wo viele schlimme Dinge passieren.«
»Überall passiert etwas.«
»Jedenfalls freue ich mich, daß du nach England gekommen bist, Ben.«
»Ich mich auch.«
Amaryllis kam mit meiner Mutter in den Garten. Bens Gegenwart verunsicherte sie sichtlich. Aber er lächelte sie unbefangen an. Er fühlte sich bereits ganz zu Hause.
Er erzählte von Australien und fand London genauso aufregend, wie er sich die Stadt vorgestellt hatte. Er erkundigte sich, ob man hier reiten könne. Tante Amaryllis meinte, das ließe sich arrangieren.
»Ich gehe jede Wette ein, daß du eine ausgezeichnete Reiterin bist«, sagte er zu mir.
»Nun, ja«, antwortete ich. »In Cador reite ich oft und gern.«
»Vielleicht können wir mal zusammen ausreiten.«
»Ja. Das wäre herrlich.«
Meine Mutter und Tante Amaryllis wechselten besorgte Blicke. Tante Amaryllis verkündete rasch, das Essen werde in einer halben Stunde serviert.
Jonnie, Geoffrey und ich gingen mit Ben zum Reiten in die Rotten Row. Es war ganz anders als in Cornwall. Die vielen eleganten Menschen zu Pferde tauschten beständig Begrüßungen aus. Ich ritt wahrhaftig nicht schlechter als die Jungen aus London, aber Benedict war ein phantastischer Reiter. Ich wünschte mir, ihn einmal in einer Umgebung reiten zu sehen, wo er seine ganze Reitkunst demonstrieren konnte.
Er unterhielt sich fast ausschließlich mit mir. »Du solltest das Outback sehen.« Er schilderte mir das Land in leuchtenden Farben. »Nur Busch und Hügel und Eukalyptusbäume, so weit das Auge reicht.«
»Und Känguruhs?« erkundigte ich mich.
»Natürlich. Känguruhs auch.«