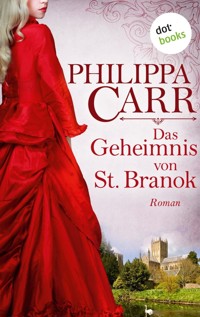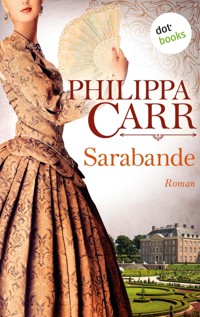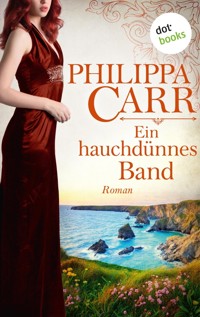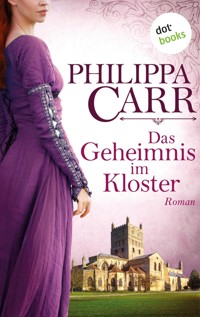Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter Englands
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Frau stellt sich den Schatten der Vergangenheit: Der Schicksalsroman "Die venezianische Tochter" von Philippa Carr als eBook bei dotbooks. Intrigen, Leidenschaft und Ränkespiele … Im Jahre 1678 versetzt ein bösartiges Gerücht ganz England in Aufruhr. Aber gibt es wirklich eine papistische Verschwörung, um Charles II. zu ermorden? Einer der Männer, die zu Unrecht verfolgt werden, rettet sich auf den idyllischen Landsitz der Familie von Priscilla Eversleigh. In einem Moment jugendlicher Unbesonnenheit gibt sie sich ihm hin – und entdeckt kurze Zeit später, dass die Nacht nicht ohne Folgen geblieben ist. Natürlich würde ein in Schande geborenes Kind ihren Ruf für immer zerstören. Also schmiedet Priscilla einen gewagten Plan, der sie nach Italien führt … aber auch in die Hände eines ruchlosen Schurken, der zu allem bereit ist, um seine Pläne in die Tat umzusetzen. Wird es Priscilla gelingen, ihn aufzuhalten, bevor er sie und die gesamte Familie Eversleigh vernichten kann? Ein Roman aus der international erfolgreichen Saga "Die Töchter Englands": Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen! Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die venezianische Tochter" von Philippa Carr, auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Intrigen, Leidenschaft und Ränkespiele … Im Jahre 1678 versetzt ein bösartiges Gerücht ganz England in Aufruhr. Aber gibt es wirklich eine papistische Verschwörung, um Charles II. zu ermorden? Einer der Männer, die zu Unrecht verfolgt werden, rettet sich auf den idyllischen Landsitz der Familie von Priscilla Eversleigh. In einem Moment jugendlicher Unbesonnenheit gibt sie sich ihm hin – und entdeckt kurze Zeit später, dass die Nacht nicht ohne Folgen geblieben ist. Natürlich würde ein in Schande geborenes Kind ihren Ruf für immer zerstören. Also schmiedet Priscilla einen gewagten Plan, der sie nach Italien führt … aber auch in die Hände eines ruchlosen Schurken, der zu allem bereit ist, um seine Pläne in die Tat umzusetzen. Wird es Priscilla gelingen, ihn aufzuhalten, bevor er sie und die gesamte Familie Eversleigh vernichten kann?
Ein Roman aus der international erfolgreichen Saga »Die Töchter Englands«: Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen!
Über die Autorin:
Philippa Carr ist – wie auch Jean Plaidy und Victoria Holt – ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Eine Übersicht über den Romanzyklus »Die Töchter Englands« finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2017
Copyright © der Originalausgabe 1978 by Philippa Carr
Die englische Originalausgabe erschien 1978 unter dem Titel »The Love Child«.
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 1986 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Gemäldes von Giovanni Antonio Canaletto und eines Bildmotivs von shutterstock/Kieselev Andrey Valerevich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-008-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die venezianische Tochter« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philippa Carr
Die venezianische Tochter
Roman
Aus dem Englischen von Hilde Linnert
dotbooks.
Kapitel 1 Das Komplott
Als mein Vater, der bis dahin von meiner Existenz keine Notiz genommen hatte, plötzlich fand, daß Mistress Philpots, die bis zu diesem Zeitpunkt meine Gouvernante gewesen war, nicht mehr über die für diese Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten verfüge und ersetzt werden müsse, war ich verblüfft. Ich hatte nie angenommen, daß er sich über meine Erziehung Gedanken machen würde. Wenn es sich um meinen Bruder Carl gehandelt hätte, der um vier Jahre jünger war als ich, dann wäre es etwas anderes gewesen. Carl war der Mittelpunkt der Familie; er trug den gleichen Namen wie mein Vater – Carl als Abkürzung von Carleton – und wurde zum genauen Ebenbild meines Vaters erzogen. Mein Vater nannte es »einen Mann aus ihm machen«. Carl mußte ein perfekter Reiter sein; er mußte die Jagd anführen; er mußte mit Pfeil und Bogen genauso gut umgehen können wie mit einer Büchse, und er mußte auch ein guter Pall-Mall-Spieler sein. Es war unwichtig, daß er in Latein und Griechisch eher schwach war und daß Reverend George Helling, der ihn unterrichtete, die Hoffnung aufgegeben hatte, aus ihm einen Gelehrten zu machen. Carl mußte vor allem ein Mann werden, das heißt, unserem Vater gleichen. Als Vater seinen Entschluß bekanntgab, war meine erste Reaktion daher nicht »Was wird Mistress Philpots dazu sagen?« oder »Wie wird die neue Gouvernante aussehen?«, sondern Verwunderung darüber, daß er mich überhaupt bemerkt hatte.
Für meine Mutter war es typisch, daß sie daraufhin fragte: »Und was soll aus Emily Philpots werden?«
»Meine liebe Arabella«, antwortete mein Vater, »dir sollte die Erziehung deiner Tochter am Herzen liegen und nicht das Wohlergehen einer dummen alten Frau.«
»Emily Philpots ist keineswegs dumm, und ich lasse meine Diener nicht auf die Straße setzen, nur weil es dir gerade so beliebt.«
So sprachen sie immer miteinander. Manchmal schien es, als haßten sie einander, aber das stimmte nicht. Wenn er abwesend war, wartete sie besorgt auf seine Rückkehr, und wenn er heimkam, suchte er zuerst sie auf – sogar vor Carl; war sie nicht anwesend, blieb er unruhig und besorgt, bis sie wieder eintraf.
»Ich habe nicht gesagt, daß sie hinausgeworfen werden soll«, betonte er.
»Soll sie auf die Weide geschickt werden wie ein altes Pferd?« wollte meine Mutter wissen.
»Ich hänge an meinen Pferden, und meine Zuneigung endet nicht zugleich mit ihrer Nützlichkeit. Die alte Philpots soll sich zur Ruhe setzen und zusammen mit Sally Nullens vor dem Kamin dösen. Sally ist ja glücklich, nicht wahr, soweit ihr das möglich ist, wenn sie nicht ein Baby zu betreuen hat.«
»Sally macht sich nützlich, und die Kinder lieben sie.«
»Ich nehme an, daß die Philpots sich ebenso nützlich machen kann, obwohl ich das mit der Liebe bezweifle. Jedenfalls habe ich beschlossen, Priscillas Erziehung nicht länger zu vernachlässigen. Sie braucht jemanden, der ihr höhere Bildung beibringt und ihr eine Gesellschafterin ist, eine gebildete, selbstsichere, erfahrene Frau.«
»Und wo willst du diesen Ausbund finden?«
»Ich habe sie schon gefunden. Christabel Connalt wird Ende der Woche eintreffen. Somit hast du genügend Zeit, Emily Philpots die Neuigkeit beizubringen.«
Er sprach sehr entschieden, und meine Mutter, die auf ihre unschuldige Art sehr klug und vernünftig war, begriff, daß es keinen Sinn hatte zu protestieren. Sie war offensichtlich ebenfalls der Meinung, daß Emily Philpots mir alles beigebracht hatte, was sie mir beibringen konnte, und daß ich auf eine höhere Bildungsebene vorrücken mußte. Außerdem hatte mein Vater sie vor ein Fait accompli gestellt, das sie akzeptierte.
Sie fragte ihn über diese Christabel Connalt aus. Dabei betonte sie, daß Christabel ihr zusagen müsse, sonst würde sie sie nicht behalten. Sie hoffte, sich klar ausgedrückt zu haben.
»Sie weiß natürlich, daß sie sich nach der Herrin des Hauses zu richten hat«, erklärte mein Vater. »Sie ist eine sympathische junge Frau; Lady Westering hat sie mir empfohlen. Sie ist wohlerzogen und kommt aus einem Pfarrhaus. Jetzt muß sie sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ich fand, daß das eine Gelegenheit ist, ihr und gleichzeitig uns etwas Gutes zu tun.«
Sie debattierten noch eine Weile, und schließlich erklärte sich meine Mutter bereit, sich Christabel Connalt anzusehen. Dann unterzog sie sich der unangenehmen Aufgabe, Mistress Philpots taktvoll beizubringen, daß eine neue Gouvernante ins Haus kam.
Emily Philpots reagierte genauso, wie Mutter und ich es erwartet hatten. Sie fiel, wie Sally Nullens sich ausdrückte, »aus allen Wolken«. Sie war also nicht mehr gut genug, um die Miss zu unterrichten. Die Miss mußte von jemand Gelehrtem unterrichtet werden, so, so. Wir würden schon sehen, was dabei herauskam. Sie beriet sich mit Sally Nullens, der es vor einiger Zeit ähnlich ergangen war. Man hatte ihr Master Carl weggenommen, weil mein Vater auf dem Standpunkt stand, daß es einem Jungen nicht guttat, von einer Schar Frauen verzärtelt zu werden. Außerdem war sie darüber empört gewesen, daß meine Eltern nicht mehr Kinder in die Welt gesetzt hatten – beide waren ja noch in dem Alter, in dem man leicht eine Kinderstube bevölkern konnte.
Emily erklärte, sie würde sofort ihre Sachen packen und das Haus verlassen, und dann würden wir schon sehen. Aber nach dem ersten Schock begann sie darüber nachzudenken, wie schwer es für sie in ihrem Alter sein würde, eine neue Stellung zu finden; gleichzeitig wies meine Mutter darauf hin, daß sie ohne Emily verraten und verkauft war, denn niemand konnte so wunderbare Kreuzstichstickereien anfertigen wie sie oder Flicken aufsetzen, die beinahe nicht zu sehen waren. Schließlich ließ sie sich zum Bleiben überreden, schniefte selbstgerecht, gab in Sally Nullens Zimmer vor dem Feuer mit dem Teekessel düstere Prophezeiungen von sich und bereitete sich auf ihr neues Leben und Christabels Eintreffen vor.
»Sei freundlich zu der armen Emily«, mahnte meine Mutter. »Für sie ist es ein harter Schlag.«
Meine Mutter stand mir viel näher als mein Vater. Wahrscheinlich bemerkte sie seine Gleichgültigkeit mir gegenüber und versuchte mich dafür zu entschädigen. Ich liebte sie innig, hatte aber zu meinem Vater eine viel stärkere Bindung, was unter diesen Umständen beinahe pervers war. Ich bewunderte ihn so sehr. Er war eine starke, dominierende Persönlichkeit, die so gut wie jedermann Ehrfurcht einflößte – sogar Leigh Main, der vom gleichen Schlag war wie er. Ich kannte Leigh, seit ich auf der Welt war, und er hatte immer erklärt, er habe vor nichts auf Erden oder in der Hölle Angst. Das war einer seiner Lieblingssprüche. Aber selbst er hütete sich vor meinem Vater.
Vater herrschte über die Familie – und sogar über meine Mutter, die sicherlich keine willensschwache Frau war. Sie stellte sich ihm auf eine Art, die ihm insgeheim Spaß machte. Anscheinend hatten sie Freude daran, einander in die Haare zu geraten. Das ergab einen nicht gerade sehr friedlichen Haushalt, aber es war nicht zu übersehen, daß sie einander gern hatten.
Wir waren überhaupt ein komplizierter Haushalt – wegen Edwin und Leigh. Als ich vierzehn war, waren sie einundzwanzig; ihre Geburtstage lagen nur wenige Wochen auseinander. Edwin war Lord Eversleigh und der Sohn meiner Mutter aus ihrer ersten Ehe. Sein Vater – der Cousin meines Vaters – war vor Edwins Geburt getötet, auf unserem Besitz ermordet worden, was mir sehr geheimnisvoll und romantisch vorkam. Edwin hatte jedoch nichts Geheimnisvolles oder Romantisches an sich. Er war nur mein Halbbruder, nicht ganz so groß oder so kräftig wie Leigh, in dessen Schatten er stand.
Leigh war eigentlich nicht mit uns verwandt, obwohl er von Geburt an in unserem Haus gelebt hatte. Er war der Sohn einer alten Freundin meiner Mutter, Lady Stevens, die unter dem Namen Harriet Main als Schauspielerin aufgetreten war. Leighs Geburt schien irgendwie anstößig zu sein. Meine Mutter sprach nicht darüber, doch Harriet selbst klärte mich auf.
»Leigh ist ein uneheliches Kind«, erzählte sie mir, »und ich bin jetzt sehr froh, daß ich ihn habe. Damals mußte ich ihn allerdings deiner Mutter anvertrauen, die ihn großzog – natürlich tat sie es viel besser, als ich es gekonnt hätte.«
Ich war nicht davon überzeugt, daß sie damit recht hatte. Ihrem zweiten Sohn, Benjie, ging es sehr gut, und ich stellte mir oft vor, was für eine aufregende Mutter Harriet sein mußte. Ich fand sie sehr anziehend, und sie lud mich oft zu sich ein, denn sie liebte Bewunderung, ganz gleich, von wem sie kam. Ich konnte mit ihr besser reden als mit allen anderen Erwachsenen.
Edwin und Leigh waren Offiziere, das war Familientradition. Edwins Großväter waren beide berühmte Offiziere im Dienst der royalistischen Sache gewesen. Seine Eltern hatten einander in der Zeit kennengelernt, da sich der König im Exil befand. Meine Mutter erzählte mir oft von den Tagen vor der Restauration und dem Leben im baufälligen alten Schloß von Congrève, wo sie darauf gewartet hatte, daß der König auf den Thron zurückkehrte.
An meinem sechzehnten Geburtstag sollte ich die Familien-Tagebücher zu lesen bekommen, dann würde ich alles verstehen, kündigte meine Mutter an. Inzwischen sollte ich damit beginnen, selbst ein Tagebuch zu führen. Zuerst war ich erschrocken, dann machte ich mich an die Arbeit und gewöhnte mich bald daran, alles, was mir widerfuhr, schriftlich festzuhalten.
Das war also unser Haushalt – Edwin, Leigh, ich – um sieben Jahre jünger als die beiden – und Carl, der um vier Jahre jünger war als ich.
Wir hatten eine zahlreiche Dienerschaft, darunter unsere alte Nurse Sally Nullens und Jasper, den Obergärtner, mit seiner Frau Ellen, unserer Wirtschafterin. Jasper war ein eingefleischter Puritaner und darüber unglücklich, daß sich das Commonwealth aufgelöst hatte; sein Vorbild war Oliver Cromwell. Ellen wäre eine hübsche Frau gewesen, wenn sie den Mut dazu gehabt hätte. Sie hatten eine Tochter, Chastity, die einen der Gärtner geheiratet hatte und immer noch für uns arbeitete, wenn sie nicht gerade schwanger war, was alljährlich mit schöner Regelmäßigkeit eintrat.
Menschen unserer Gesinnung führten nach der Restauration ein angenehmes Leben. Ich war zu jung, um zu begreifen, welch ungeheure Erleichterung sich der Bevölkerung anläßlich der Wiedereinführung der Monarchie bemächtigt hatte. Mistress Philpots erzählte mir einmal, daß die Menschen beinahe verrückt vor Freude geworden waren, als endlich alle Einschränkungen der persönlichen Freiheit fielen. Nach dem Übermaß an Religion waren sie beinahe religionslos geworden, und daher herrschte jetzt allgemein Leichtfertigkeit. Es war ja gut und schön, daß man die Theater wieder geöffnet hatte, aber nach Ansicht von Philpots waren einige Stücke ausgesprochen unzüchtig. Auch mit dem Benehmen der Damen war sie nicht einverstanden, die sich nach dem Vorbild des Hofes richteten.
Emily Philpots war Royalistin und wollte die Lebensführung des Königs nicht kritisieren, aber seine zahlreichen Mätressen fand sie skandalös.
Mein Vater hielt sich oft bei Hofe auf, denn er war ein Freund des Königs. Beide interessierten sich für Architektur, und nach dem großen Brand erforderte der Wiederaufbau Londons viel Arbeit. Die Geschichten, die mein Vater erzählte, wenn er vom Hof zurückkam, waren sehr aufregend. Er war mit dem unehelichen Sohn des Königs, dem Herzog von Monmouth, befreundet und meinte einmal, es sei ein Jammer, daß Old Rowley (der Spitzname des Königs) diesen Sohn nicht für ehelich erklärte, denn er wäre ein viel besserer Thronfolger als sein humorloser, griesgrämiger Bruder, der noch dazu Katholik war.
Mein Vater war merkwürdigerweise überzeugter Protestant. Er pflegte zu sagen, daß die Church of England der Religion den ihr zustehenden Platz angewiesen habe. »Laßt die Katholiken herein, und wir haben die Inquisition im Land, und die Menschen leben wieder in Angst und Schrecken, wie zur Zeit Cromwells. Beide sind Extremfälle. Wir ziehen einen Kurs der Mitte vor.«
Wenn er darüber sprach, daß Charles sterben und Jakob seinen Platz einnehmen könnte, wurde er sehr ernst. Die Heftigkeit, mit der er dieses Thema behandelte, überraschte mich.
Wenn mein Vater an den Hof reiste, begleitete ihn meine Mutter. Sally Nullens behauptete, mein Vater habe die Aufsicht seiner Frau nötig, und ich entnahm daraus, daß es vor seiner Heirat in seinem Leben etliche Damen gegeben hatte.
So sah es also bei uns zu jener Zeit aus, als Christabel Connalt kam.
Sie traf an einem nebligen Tag Ende Oktober ein. Mit der neuen Postkutsche war sie bis Dover gereist, von wo sie mein Vater abholte. Ich fand, daß er meiner Erziehung zuliebe sehr viel auf sich nahm. Die Diener hatten das Zimmer für die Erzieherin hergerichtet und erwarteten neugierig ihre Ankunft – eine Abwechslung im sonst einförmigen Dasein der Dienerschaft. Außerdem hatte Emily Philpots viel Aufhebens von der Sache gemacht und war sich in düsteren Prophezeiungen über das Unheil ergangen, das die neue Gouvernante über uns bringen würde. Wahrscheinlich wurde die Ankommende von der Hälfte der Bediensteten daraufhin für eine Hexe gehalten.
Carl übte in seinem Zimmer auf dem Flageolett, und die traurigen Klänge von »Barbary Allen« drangen bis in den letzten Winkel. Um dem Grabgesang zu entgehen, schlenderte ich durch den Garten bis dorthin, wo sich einmal eine Laube befunden hatte und wo der erste Mann meiner Mutter ermordet worden war. An der Stelle wuchsen jetzt rote Blumen. Meine Mutter wollte andere Farben haben, aber ganz gleich, was sie anpflanzen ließ, die Blüten waren immer rot. Ich war überzeugt, daß der alte Jasper dabei seine Hand im Spiel hatte, denn er fand, daß die Menschen bestraft werden müßten und Vergangenes nicht vergessen dürften. Seine Frau behauptete von ihm, er sei so gut, daß er überall Böses sähe. Ich war von seiner Güte nicht so ganz überzeugt, denn ich mißtraute seiner übertriebenen Tugendhaftigkeit; aber es stimmte, daß er in allem das Böse sah. Obwohl meine Mutter sich einredete, daß diese Ereignisse in Vergessenheit geraten waren, hafteten sie im Gedächtnis der Diener, die behaupteten, daß es an dem Ort spuke.
Während ich diesen Gedanken nachging, hörte ich die Kutsche vorfahren. Ich wartete und lauschte. Mein Vater rief nach den Stallknechten, dann herrschte Stille. Wahrscheinlich waren sie ins Haus gegangen.
Ich überlegte, wie sich die Veränderung auswirken würde. Christabel Connalt würde zweifellos sehr streng und sehr gelehrt sein und versuchen, mir Bildung einzutrichtern, was Emily Philpots nie gelungen war. Rückblickend wurde mir bewußt, daß sie nicht sehr tüchtig war und daß Carl und ich diese Tatsache ausgenützt hatten, denn Kinder sind in solchen Dingen durchtrieben. Carl war Emilys Schüler gewesen, bis er der Erziehung des Vikars anvertraut wurde. Die arme Emily hatte sehr unter uns gelitten. Carl hatte ihr einmal eine Spinne auf den Rock gesetzt und dann kreischend auf das Tier gezeigt. Danach hatte er sie heldenhaft von dem Insekt befreit, und ich tadelte ihn später, weil er sich gemein benommen hatte. Carl faltete die Hände, blickte zum Himmel und sagte im Ton Jaspers, daß er das alles nur zu Emilys Besten getan hätte.
Im Geist hatte ich mir ein Bild von Christabel Connalt gemacht. Da sie in einem Pfarrhaus aufgewachsen war, war sie sicherlich sehr religiös und stand wahrscheinlich den herrschenden Sitten noch kritischer gegenüber als Mistress Philpots. Ich stellte sie mir ältlich vor, mit ergrauenden Haaren und harten Augen, denen nichts entging. Ein Schauder überlief mich, weil ich überzeugt war, daß ich mich noch nach Emilys sanftem Regiment zurücksehnen würde. Sie und Sally Nullens sprachen über nichts anderes als über meine Gouvernante. Wenn ich in Sallys Wohnzimmer trat, das Carl »Nullen Salon« nannte, spürte ich sofort die gespannte, geheimnisvolle Atmosphäre. Die beiden Frauen pflegten am Kamin zu sitzen, die Köpfe zusammenzustecken und zu tuscheln. Sally Nullens glaubte felsenfest an Hexerei, und wenn jemand starb oder an einer geheimnisvollen Krankheit litt, suchte sie immer nach der Person, die für das Unheil verantwortlich war. Carl behauptete, sie sehne sich nach den Tagen der Hexenjagd zurück.
»Kannst du dir denn nicht vorstellen, wie die alte Sal herumgeht und die hübschen Mädchen untersucht ... überall, um Spuren zu finden, die ihre Liebhaber hinterlassen haben? Heißen sie bei Mädchen eigentlich Sukkubus oder Inkubus?«
Carl brachte zwar Reverend George Helling beim Latein- und Griechischunterricht zur Verzweiflung, aber bei den Tatsachen des Lebens kannte er sich sehr gut aus. Obwohl er nicht einmal zehn war, begutachtete er die jungen Mädchen, die das Essen auftrugen, sachkundig und versuchte herauszubekommen, wer was mit wem trieb.
Sally Nullens sagte: »Genau wie sein Vater. Steckt noch in den Windeln und denkt schon an Dummheiten.«
Das war natürlich übertrieben, aber es stimmte, daß Carl auf dem besten Weg war, ein Mann zu werden – was meinen Vater natürlich freute.
Meine Gedanken kreisten weiterhin um die Veränderungen, die sich durch Christabel Connalt ergeben würden.
»Der Herr war anscheinend froh darüber, daß er sie hier unterbringen konnte«, hatte Emily zu Sally gesagt, als ich an Sallys Tür stand – Sally flickte, und Emily verzierte ein Unterkleid meiner Mutter mit Kreuzstichen.
Auf die Bemerkung folgte ein Schnüffeln, das andeutete, daß mehr dahintersteckte; daraufhin lauschte ich schamlos. Es ging ja um meinen Vater.
»Es würde mich interessieren, wer sie überhaupt ist«, fuhr Emily fort.
»Ach, er hat es längst aufgegeben, Weiberröcken nachzulaufen. Die Mistress duldet es nicht.«
»Manche geben es nie auf. Ich wäre wirklich nicht überrascht ...«
»Die Wände haben Ohren«, sagte Sally betont. »Auch die Türen. Ist da jemand?«
Ich trat ins Zimmer und sagte, daß ich meinen Reitrock gebracht hätte; ich hatte ihn am Vortag zerrissen – konnte Sally ihn bitte flicken?
Sie warf Emily einen vielsagenden Blick zu und griff nach dem Rock.
»Ganz schön schmutzig ist er obendrein. Ich werde ihn auch reinigen. Sie machen uns schon sehr viel Arbeit, Mistress Priscilla.«
Irgendwie stimmte mich diese Bemerkung traurig. Sie betonte immer, wie nützlich sie war, und wollte hören, daß wir ohne sie verloren wären. Emily Philpots würde von nun an in das gleiche Horn stoßen, und die beiden waren jetzt schon davon überzeugt, daß ihnen die Neue nicht sympathisch sein würde.
Ich sah zum Haus hinüber und betrachtete es, als sehe ich es zum erstenmal. Eversleigh Court, der Wohnsitz der Familie. Eigentlich gehörte es Edwin, obwohl mein Vater den Besitz verwaltete und in Gang hielt. Ich fragte mich, ob er etwas gegen Edwin hatte. Edwin gehörte alles – der Titel und der Besitz, und dabei wäre es gerechter gewesen, wenn sie meinem Vater gehört hätten. Mein Vater hatte sich während des Bürgerkriegs als Anhänger Cromwells ausgegeben und dadurch den Besitz gerettet. Edwin war damals noch nicht auf der Welt gewesen. Meine Mutter nannte ihn das Restaurationsbaby, denn er wurde im Januar 1660 geboren, nur wenige Monate, ehe der König zurückkehrte.
Es war ein schönes altes Haus, das, wie alle diese Häuser, im Laufe der Jahre noch gewonnen hatte. So viele Generationen von Eversleighs hatten an ihm gebaut; hier hatten sich Tragödien und Komödien abgespielt; und Sally behauptete, daß alle, die keine Ruhe finden konnten, zurückkamen und unsichtbar durch das Haus geisterten.
Es gab viele solche Häuser auf dem Land. Unseres war in der Zeit der Königin Elisabeth erbaut worden, und zwar zu Ehren Glorianas mit dem typischen E-Grundriß. Ostflügel, Westflügel, Mitte; die Halle war so hoch wie das ganze Haus und hatte eine gewölbte Decke mit breiten Eichenbalken. Einige Räume waren elegant getäfelt, aber die Halle hatte Steinmauern, an denen Waffen hingen, um die künftigen Generationen an die Rolle zu erinnern, die Eversleigh in der Geschichte des Landes gespielt hatte. Oberhalb des großen Kamins hing der gemalte Familienstammbaum, der sich immer weiter verästelte und sich zweifellos im Lauf der Zeit über die ganze Halle ausbreiten würde. Auch ich schien darin auf – natürlich nicht im Hauptzweig. Der gehörte Edwin, und wenn er heiratete, würden sich seine Kindergenau im Mittelpunkt befinden. Leigh ärgerte sich darüber, daß man ihn nicht auch aufgenommen hatte. Er konnte damals noch nicht verstehen, warum man ihn ausgeschlossen hatte. Wahrscheinlich versuchte er deshalb, Edwin in jeder Beziehung zu übertreffen.
Doch ich befaßte mich nicht wirklich mit diesen Dingen, während ich neben dem von Gespenstern heimgesuchten Blumenbeet stand; ich schob nur den Augenblick hinaus, in dem ich die Frau kennenlernen sollte, die mein bisheriges Leben verändern würde.
Chastity kam in den Garten; sie watschelte leicht, denn sie war schon wieder schwanger.
»Wo stecken Sie denn, Mistress Priscilla? Sie wollen, daß Sie die neue Gouvernante kennenlernen. Ihre Mutter sagt, Sie sollen sofort in den Salon kommen.«
»Schön, Chastity, ich komme. Du solltest nicht laufen, weißt du, sondern an deinen Zustand denken.«
»Ach, es ist alles ganz natürlich, Mistress.«
Es war ihr sechstes Kind, und dabei war sie noch jung. Meiner Berechnung nach war sie für mindestens weitere zehn Kinder gut.
»Du bist wie eine Bienenkönigin, Chastity«, meinte ich vorwurfsvoll.
»Was ist das, Mistress?«
Ich erklärte es ihr nicht. Ich dachte darüber nach, wie ungerecht das Schicksal war: es schenkte Chastity jedes Jahr ein Kind, während meine Eltern nur Carl und mich hatten (Edwin zählte nicht, er gehörte nur meiner Mutter). Wenn sie mehr Kinder gehabt hätten, würde Sally Nullens jetzt nicht überall Hexen sehen, und Emily Philpots wäre für die Kleineren gut genug. Außerdem hätten mich ein paar jüngere Brüder und Schwestern gefreut.
»Hast du sie gesehen, Chastity?«
»Eigentlich nicht, Mistress. Man hat sie in den Salon geführt. Meine Mutter sagte, ich solle Sie suchen, weil Ihre Mutter nach Ihnen gefragt hat.«
Ich ging direkt in den Salon, und meine Mutter sagte: »Ach, da ist Priscilla. Komm, Priscilla, ich will dich Mistress Connalt vorstellen.«
Christabel Connalt stand auf und kam auf mich zu. Sie war groß, schlank und sehr einfach gekleidet; aber sie verfügte über eine gewisse angeborene Eleganz. Sie trug einen Umhang aus blauem Wollstoff, der am Hals von einer Brosche zusammengehalten wurde, die vielleicht aus Silber war. Das Mieder des Kleides war aus dem gleichen blauen Stoff; es war tief ausgeschnitten, aber sie trug ein Leinentuch um den Hals, so daß das Mieder sittsam wirkte; es war mit einer silbernen Kordel verschnürt. Der in Falten gelegte Rock war ebenfalls aus dem gleichen Stoff. Am Umhang war eine Kapuze befestigt, die sie abgestreift hatte, so daß man das dunkle, nicht modisch gekräuselte Haar sah; sie trug es in offenen, aus dem Gesicht gekämmten Locken.
Es war jedoch nicht ihre Kleidung, die mir sofort auffiel – sie war mehr oder weniger so gekleidet, wie man es von der Tochter eines Pfarrers erwartete, dessen Gehalt so bescheiden ist, daß seine Tochter sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen muß. Es war ihr Gesicht. Sie war nicht schön, aber sie besaß Würde. Sie war keineswegs so alt, wie ich angenommen hatte. Ich schätzte sie auf Mitte zwanzig – im Vergleich zu mir natürlich alt, aber eigentlich in der Blüte ihres Lebens. Ihr Gesicht war oval, die Haut glatt und samtig wie ein Blütenblatt, die Augenbrauen dunkel und schön geschwungen, die Nase etwas zu lang, die Augen groß mit kurzen, dichten, dunklen Wimpern, der Mund immer in Bewegung. Ich fand später heraus, daß man an ihrem Mund ihre Gefühle viel besser erkennen konnte als an ihren Augen. Die Augen blickten vollkommen ruhig, die Lider zuckten nicht, aber um den Mund lag eine Spannung, die sie nicht unterdrücken konnte.
Ich war so erstaunt, daß ich nicht sprechen konnte, denn ich hatte sie mir ganz anders vorgestellt.
»Ihre Schülerin, Mistress Connalt«, sagte mein Vater. Während er uns beobachtete, zuckten seine Mundwinkel leicht; das hieß, daß er sich innerlich amüsierte und es nicht zeigen wollte.
»Ich hoffe, daß wir uns gut verstehen werden«, sagte ich.
»Das hoffe ich ebenfalls.«
Ihr Blick ruhte auf mir, und ihre Lippen bewegten sich leicht. Sie preßte den Mund zusammen, als ob ihr etwas an mir nicht ganz gefiele.
»Mistress Connalt hat uns ihren Lehrplan auseinandergesetzt«, sagte meine Mutter. »Er klingt sehr vielversprechend. Du solltest ihr jetzt ihr Zimmer zeigen, Priscilla, und dann anschließend das Schulzimmer. Mistress Connalt möchte so bald wie möglich mit dir zu arbeiten beginnen.«
»Möchten Sie Ihr Zimmer sehen?« fragte ich.
»Ja, gern«, antwortete sie, und ich führte sie hinauf.
Während wir die Treppe hinaufstiegen, meinte sie: »Ein schönes Haus. Ein Glück, daß es während des Krieges nicht zerstört wurde.«
»Mein Vater hat sich sehr bemüht, es zu erhalten.«
»Ach!« Sie holte überrascht Luft.
»Wie ich gehört habe, sind Sie in einem Pfarrhaus aufgewachsen«, bemerkte ich beiläufig.
»Ja, in Westering. Kennst du den Ort?«
»Leider nicht.«
»Er liegt in Sussex.«
»Hoffentlich ist es Ihnen hier nicht zu öde, wie man vielfach meint. Wir sind nahe der Küste, und deshalb bekommen wir auch den Ostwind mit voller Wucht zu spüren.«
»Das klingt wie eine Geographiestunde«, stellte sie fest; in ihrer Stimme schwang Lachen mit.
Das gefiel mir, und ich fühlte mich daraufhin wohler. Ich zeigte ihr ihr Zimmer, das neben dem Schulzimmer lag und nicht sehr groß war. Emily Philpots hatte darin gewohnt, aber sie war jetzt in das nächste Stockwerk, neben Sally Nullens, übersiedelt. Meine Mutter hatte es so haben wollen und die arme Emily damit schwer getroffen.
»Ich hoffe, daß es Ihnen zusagt«, meinte ich.
Sie wandte sich mir zu und antwortete: »Im Vergleich zum Pfarrhaus ist es luxuriös.« Ihr Blick wanderte zum Kamin, in dem auf Anordnung meiner Mutter ein Feuer brannte. »Im Pfarrhaus war es so kalt, daß ich vor dem Winter richtiggehend Angst hatte.«
Ich ließ sie allein, damit sie auspacken und sich waschen konnte. In einer Stunde wollte ich sie abholen, ihr das Schulzimmer und meine Bücher zeigen und ihr erklären, was ich bis jetzt gelernt hatte. Wenn sie wollte, konnte ich sie auch durch Haus und Garten führen.
Sie dankte mir mit einem beinahe scheuen Lächeln. »Ich glaube, daß ich hier sehr glücklich sein werde.«
Danach ging ich zu meinen Eltern hinunter, die, wie nicht anders zu erwarten, von der neuen Gouvernante sprachen.
»Eine Frau mit Selbstbeherrschung«, sagte meine Mutter.
»Sie verfügt zweifellos über Haltung«, antwortete mein Vater.
Meine Mutter lächelte mir zu. »Da ist Priscilla. Nun, meine Liebe, was hältst du von ihr?«
»Es ist noch zu früh, etwas zu sagen.«
»Seit wann bist du so vorsichtig mit deinem Urteil? Ich halte sie für sehr tüchtig.«
»Sie ist offensichtlich gut erzogen«, fügte mein Vater hinzu. »Meiner Meinung nach, Bella, sollte sie die Mahlzeiten mit uns einnehmen.«
»Die Mahlzeiten mit uns einnehmen! Die Gouvernante!«
»Aber du siehst ja, daß sie ganz anders ist als die alte Philpots.«
»Zweifellos. Doch mit uns essen! Und was ist, wenn wir Gäste haben?«
»Sie wird sich anpassen. Sie kann sich sehr klar ausdrücken.«
»Und wenn die Jungen nach Hause kommen?«
»Wieso?«
»Glaubst du nicht ...«
»Ich glaube, daß man eine junge Frau mit ihrer Erziehung nicht dazu verurteilen kann, das Essen allein in ihrem Zimmer einzunehmen. Mit der Dienerschaft kann sie natürlich auch nicht essen.«
»So ist es mit den Gouvernanten immer. Wie ich das hasse!«
»Was meinst du, Priscilla?« wandte sich mein Vater an mich und überraschte mich dadurch sehr, da er mich zum erstenmal in meinem Leben um meine Meinung fragte, so daß ich zu stottern begann und nicht wußte, was ich antworten sollte. »Versuchen wir es«, fuhr er fort, »wir werden ja sehen, was dabei herauskommt.«
Die Diener würden es sicherlich für sehr merkwürdig halten, daß jemand, der auf der sozialen Stufenleiter nur knapp über ihnen stand, die Mahlzeiten am Familientisch einnahm, und es würde Nullens und Philpots wieder neuen Stoff für Klatsch liefern.
Es war ja wirklich sehr merkwürdig, daß mein Vater sich zuerst um meine Erziehung und dann auch noch um das Wohlergehen meiner Gouvernante kümmerte. Natürlich fragte ich mich, was eigentlich dahintersteckte. Christabel Connalt würde Veränderungen mit sich bringen, das lag in der Luft.
In den nächsten Tagen stand sie im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Sally Nullens und Emily Philpots sprachen endlos über sie, und die übrige Dienerschaft stand den beiden in nichts nach. Ich war natürlich mehr mit ihr zusammen als die anderen und versuchte sie kennenzulernen, was gar nicht einfach war. Zeitweise hielt ich sie für vollkommen selbstsicher. Dann wieder glaubte ich eine gewisse Verletzlichkeit an ihr zu entdecken. Es war der verräterische Mund, der alle möglichen Gefühle ausdrückte. Gelegentlich bildete ich mir ein, daß sie einen geheimen Groll hegte.
Ihr Allgemeinwissen und ihre pädagogischen Fähigkeiten standen außer Zweifel. Reverend William Connalt hatte, bevor er sie in die Welt hinausschickte, dafür gesorgt, daß sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen konnte. Sie war gemeinsam mit den Söhnen des dortigen Gutsherrn unterrichtet worden, und ich nahm an, daß sie sich bemüht hatte, nicht nur mit ihnen Schritt zu halten, sondern sie sogar zu übertreffen. Sie wollte nämlich nicht bloß ebenso gut sein wie alle anderen, sondern besser.
Zuerst herrschte zwischen uns eine gewisse Zurückhaltung, aber ich war entschlossen, die Schranken zu überwinden, und es gelang mir auch – vor allem deshalb, weil sie bald herausfand, wie gering mein Wissen war. Mein Vater hatte anscheinend wirklich recht gehabt, denn wenn ich noch lange Emily Philpots überantwortet gewesen wäre, hätte es schlecht mit meiner Bildung ausgesehen.
Das sollte alles anders werden.
Wir nahmen Latein, Griechisch und Mathematik vor, und ich glänzte in keinem dieser Fächer. In englischer Literatur war ich nicht so schlecht. Infolge meiner Besuche bei Tante Harriet (ich nannte sie so, obwohl sie nicht meine richtige Tante war) interessierte ich mich für Theaterstücke und konnte ganze Shakespeareszenen auswendig. Obwohl Tante Harriet vor langer Zeit von der Bühne Abschied genommen hatte, arrangierte sie immer noch kleine Unterhaltungen und setzte uns dabei als Schauspieler ein. Das machte mir Spaß und steigerte mein Interesse für die Literatur.
Während der Literaturstunden wirkte Christabel nicht so zufrieden wie sonst. Ich begriff, daß sie nur dann glücklich war, wenn sie mir zeigen konnte, um wieviel gescheiter sie war als ich. Dabei hatte sie das gar nicht nötig. Sie war ja zu uns gekommen, um mich zu unterrichten. Außerdem war sie um zehn Jahre älter als ich, also verfügte sie zwangsläufig über ein größeres Wissen.
Es war sehr merkwürdig. Wenn ich dumme Fehler machte, sprach sie zwar sehr ernst zu mir, aber ihre Mundwinkel verrieten mir, daß sie sich eigentlich darüber freute; und wenn ich brillierte – zum Beispiel in Literatur –, sagte sie regelmäßig »Das war ausgezeichnet, Priscilla«, preßte aber die Lippen zusammen, und ich wußte, daß sie sich ärgerte.
Ich hatte mich immer schon für Menschen interessiert und mir Aussprüche gemerkt, die Aufschluß über ihren Charakter gaben. Meine Mutter pflegte mich deshalb auszulachen, und Emily Philpots meinte: »Wenn du dir wichtige Dinge genauso gut merken könntest, würde ich mit dir mehr Ehre einlegen.« Aber mich interessierten die längsten Flüsse oder die höchsten Berge nicht, mich interessierte nur, was die Menschen dachten.
Deshalb fand ich bald heraus, daß Christabel einen geheimen Groll hegte; und wenn es nicht so absurd gewesen wäre, hätte ich angenommen, daß er sich gegen mich richtete.
Mein Vater hatte Christabel vorgeschlagen, sich im Stall ein Pferd auszusuchen und mit mir auszureiten. Das machte ihr Freude. Sie erzählte mir, daß sie zu Hause die Pferde der Westerings hatte reiten dürfen, um sie zu bewegen.
Wenn wir ausritten, legten wir oft bei einem Gasthof eine Rast ein, tranken Apfelwein und aßen Käse mit Haferbrot oder mit frisch gebackenem Roggenbrot.
Manchmal ritten wir zum Meer hinunter und galoppierten den Strand entlang. Wenn ich bei solchen Gelegenheiten einen Wettritt vorschlug und sie gewinnen ließ, strahlte sie vor Freude.
Ich nahm an, daß dieses Verhalten die Folge ihrer unglücklichen Kindheit war; wahrscheinlich beneidete sie mich, weil ich stets ein so behütetes, angenehmes Leben geführt hatte.
Carl hatte sie in sein Herz geschlossen. Gelegentlich kam er sogar während der Unterrichtsstunden ins Schulzimmer und lernte mit uns, was mich sehr wunderte, denn in das Pfarrhaus schlich er immer wie eine Schnecke. Er erkundigte sich nach ihrem Lieblingslied und versuchte es zu spielen; allerdings war die Wirkung auf alle in Hörweite Befindlichen verheerend.
Zuerst weigerte sich Christabel, von sich zu erzählen, aber allmählich gewann ich ihr Vertrauen, und als sie erst einmal zu sprechen begonnen hatte, war es, als ob ein Damm geborsten wäre.
Bald sah ich den liebeleeren Haushalt vor mir: das Pfarrhaus war immer kalt und feucht, außerdem lag es direkt neben dem Friedhof, so daß sie nur Grabsteine sah, wenn sie aus dem Fenster blickte. Als sie noch ein Kind war, hatte ihr die Wäscherin erzählt, daß die Toten bei Nacht aus den Gräbern hervorkämen und tanzten, und wenn jemand ihnen dabei zusah, mußte er noch im gleichen Jahr sterben.
»Ich lag schaudernd im Bett«, erinnerte sie sich, »und kämpfte gegen die Versuchung an, aus dem Bett zu steigen und nachzusehen, ob sie wirklich tanzten. Ein paarmal tat ich es, und ich weiß heute noch, wie kalt die Dielen waren und wie der Wind am Fenster rüttelte. Ich fror, aber ich war nicht imstande, wieder ins Bett zurückzugehen.
Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was für eine Kindheit ich gehabt habe. Sie hielten sich für gute Menschen und waren davon überzeugt, daß man nur dann ein guter Mensch ist, wenn man sich elend fühlt. Sie hielten es für tugendhaft zu leiden.«
»Wir haben hier auch jemanden, der so ist, Jasper, den alten Gärtner. Er ist nämlich Puritaner. Er war schon während des Krieges hier, als mein Vater so tat, als wäre er ein Anhänger Cromwells.«
»Erzähl mir davon«, rief sie, und ich erzählte ihr alles, was ich wußte. Sie hörte mir gebannt zu, und um ihre Lippen lag dabei ein leichtes Lächeln, das sie verschönte.
Manchmal hatte ich das Gefühl, daß sie ihre Eltern haßte.
Einmal sagte ich zu ihr: »Ich glaube beinahe, Sie sind froh, daß Sie von zu Hause fortgekommen sind.«
Sie preßte die Lippen zusammen. »Es war nie ein Zuhause ... wie dieses hier. Wie glücklich bist du doch, Priscilla, weil dich deine Mutter hier geboren hat.«
Mir kam diese Feststellung merkwürdig vor.
Ich ließ mir gern vom Pfarrhaus und dem Leben dort erzählen. Wie das Kaninchen-Stew mit Wasser verlängert wurde, bis es nach nichts mehr schmeckte; wie sie Gott für diese Mahlzeit danken mußten; wie sie ihre Leibwäsche stopften und flickten, bis man kaum mehr erkennen konnte, wie sie ursprünglich ausgesehen hatte; wie sie stundenlang bei endlosen Morgengebeten im kalten Wohnzimmer knieten; wie sie Kleider für die Armen nähte, denen es ganz bestimmt besser ging als ihr. Und der Unterricht im Wohnzimmer, das im Winter eiskalt und im Sommer unerträglich heiß war. Sie lernte ohne Unterlaß, denn nur so konnte sie Gott dafür danken, daß er so gut zu ihr war.
Wieviel Bitterkeit ihr Mund ausdrückte! Die arme Christabel! Denn am Leben im Pfarrhaus hatten sie nicht so sehr die Entbehrungen und Strapazen gestört, sondern vielmehr die Lieblosigkeit – das wurde mir sehr bald klar. Die arme Christabel sehnte sich so sehr danach, geliebt zu werden.
Ich konnte sie sehr gut verstehen, denn ich befand mich meinem Vater gegenüber in einer ähnlichen Lage. Meine Mutter umhegte mich liebevoll, und Tante Harriet machte kein Geheimnis daraus, daß sie mich allen anderen vorzog; ich konnte also nicht behaupten, daß ich nicht genug Liebe bekam. Auch mein Vater war nicht unfreundlich zu mir; er war nur gleichgültig und kümmerte sich kaum um mich, weil ich nicht der Sohn war, den Männer seines Schlages sich immer so sehr wünschen. Deshalb war es bei mir zu einer fixen Idee geworden, daß ich irgendwie seine Anerkennung erringen und seine Aufmerksamkeit erregen mußte.
Christabels Verbitterung schwand, wenn sie von Westering erzählte. Ich sah das Dorf in Sussex vor mir – es gibt überall in England solche Orte, und unsere Gemeinde war sehr ähnlich. Die Kirche, das zugige, düstere Pfarrhaus, der Friedhof mit den schiefen Grabsteinen, die kleinen Hütten, das Herrenhaus, das über dem Dorf thronte – das Heim von Sir Edward Westering und Lady Letty, Tochter eines Grafen. Lady Letty tauchte in Christabels Erzählungen häufig auf; sie war offensichtlich eine markante Persönlichkeit. Ich konnte mir vorstellen, wie sie an der Spitze der Familie Westering Einzug in die Kirche hielt – Sir Edward ein paar Schritte hinter ihr und dann die Jungen, die gemeinsam mit Christabel im Pfarrhaus unterrichtet wurden, bevor sie auf die Schule kamen. Ich sah auch Christabel in ihrem blauen Sergekleid vor mir, das an den Ellbogen schon fadenscheinig war, wie sie die Familie scheinbar gleichgültig beobachtete, während ihre Mundwinkel zuckten. Wahrscheinlich wünschte sie sich nichts sehnlicher, als ein Mitglied dieser Familie zu sein und in ihrem Kirchenstuhl zu sitzen.
Gelegentlich sah Lady Letty sie im Vorbeigehen an, und dann pflegte Christabel einen Knicks zu machen. Darauf Lady Letty: »Ach, die Tochter des Pfarrers. Christabel, nicht wahr?« Man konnte von ihr doch nicht erwarten, daß sie sich den Namen einer so unbedeutenden Person merkte. Also nickte Christabel, Lady Letty musterte sie genau und ging dann weiter.
Lady Letty hatte vorgeschlagen, daß die Tochter des Pfarrers reiten lernen sollte, um die Pferde der Westerings zu bewegen. »Wird den Pferden guttun«, hatte sie hinzugefügt. »Damit ich nicht auf die Idee käme«, meinte Christabel, »daß es zu meinem Besten geschah.«
Die Westerings waren überhaupt die Wohltäter des Dorfs. Zu Weihnachten schickten sie Decken und Gänse ins Pfarrhaus, die Mrs. Connalt mit Christabels Hilfe verteilte. Lady Letty gab zu verstehen, daß das Pfarrhaus auch Anspruch auf eine Decke und eine Gans habe – aber natürlich kein Aufhebens davon machen sollte. »Wir nahmen uns die fetteste Gans und die wärmste Decke«, erzählte Christabel mit gequältem Lächeln.
Zu Ostern und zum Erntedankfest suchte Christabel im Küchengarten der Westerings Blumen und Gemüse aus, die die Gärtner dann in die Kirche brachten. Bei dieser Gelegenheit verwickelte Lady Letty sie oft in ein Gespräch und erkundigte sich dabei nach ihren Fortschritten. Christabel wurde jedesmal verlegen und fragte sich, warum Lady Letty sie immer wieder ins Herrenhaus kommen ließ; denn kaum war sie dort, hatte Lady Letty nichts Eiligeres zu tun, als sie wieder fortzuschicken.
Lady Lettys Verhalten gab tatsächlich Rätsel auf. Es war merkwürdig, daß sie sich für das Leben und Treiben im Dorf interessierte, denn sie war sehr häufig bei Hof. Gelegentlich fanden in Westering Manor Feste statt, wenn Adelige aus London zu Besuch kamen. Einmal war sogar der König bei ihnen zu Gast gewesen.
»Ich hatte das Gefühl, daß mein Leben immer in den gleichen Bahnen weitergehen und sich nie ändern würde«, erwähnte Christabel einmal. »Ich sah vor mir, wie ich immer älter und Mrs. Connalt immer ähnlicher wurde ... vertrocknet, verschrumpelt, wie ein lebender Leichnam, freudlos und in jedem unschuldigen Vergnügen schon eine Sünde witternd.«
Ich fand es merkwürdig, daß sie von ihrer Mutter als von Mrs. Connalt sprach – als distanziere sie sich von der Verwandtschaft.
Ich konnte sie verstehen. Ihr Äußeres war ungewöhnlich anziehend, und sie war überdurchschnittlich intelligent; sie sehnte sich nach einem abwechslungsreicheren Leben und fühlte sich benachteiligt. Sie haßte die gönnerhafte Haltung der Westerings, und sie war einsam, weil niemand sie liebte, weil sie mit niemandem über ihre Probleme sprechen konnte.
Zwei Wochen nach Christabels Ankunft begaben sich meine Eltern in unser Haus in London, weil sie bei Hofe anwesend sein mußten.
»Das muß wirklich aufregend sein«, meinte Christabel. »Ich würde so gern einmal bei Hofe vorgestellt werden.«
»Meine Mutter macht sich eigentlich nichts daraus«, antwortete ich. »Sie kommt nur mit, weil mein Vater es gern sieht.«
»Wahrscheinlich hält sie es für besser, wenn sie bei ihm ist.« Christabel preßte die Lippen zusammen. »Ein Mann wie er ...«
Ich war verblüfft. Das klang wie eine Kritik an meinem Vater, und ich hatte seit einiger Zeit beobachtet, daß sie in seiner Gegenwart befangen war. Das wunderte mich, denn schließlich hatte er sie in unser Haus gebracht, und wenn sie sich bei uns wohler fühlte als im Pfarrhaus, so verdankte sie es ausschließlich ihm.
Mein Tagesablauf war nun genau geregelt. Am Vormittag unterrichtete mich Christabel, nach dem Mittagessen ritten wir aus oder gingen spazieren, und gegen fünf Uhr nachmittags kehrten wir wieder ins Schulzimmer zurück. Um diese Zeit war es schon finster, so daß wir bei Kerzenlicht weiterarbeiteten; für gewöhnlich stellte sie Fragen zum Stoff des Vormittags.
Einmal fragte ich sie, ob sie sich bei uns wohl fühle, und sie antwortete zornig: »Wie kommst du nur auf die Idee, daß ich mich nicht wohl fühle? Es ist das angenehmste Haus, das ich kenne.«
»Das freut mich.«
»Du gehörst zu den Glücklichen.« Ihr Ton klang vorwurfsvoll, und ich wußte, daß sie die Lippen wieder einmal zusammenpreßte.
Als wir eines Nachmittags von unserem Ausritt zurückkehrten, wußte ich in dem Augenblick, in dem wir zum Stall kamen, daß etwas vorgefallen war, denn überall herrschte geschäftiges Treiben. Zuerst glaubte ich, daß meine Eltern zurückgekehrt waren. Dann begriff ich, daß es sich nicht um meine Eltern handelte, und geriet in Erregung. Ich konnte es kaum erwarten, aus dem Sattel und ins Haus zu kommen.
Ich hörte ihre Stimmen und rief: »Leigh! Edwin! Wo seid ihr?«
Leigh stand oben auf der Treppe. In Uniform sah er wundervoll aus. Er war groß, hatte ein hageres Gesicht und strahlend blaue Augen, die einen faszinierenden Gegensatz zum schwarzen Haar bildeten, genau wie bei seiner Mutter. Als er mich sah, leuchteten seine Augen auf, und ich empfand wieder die Erregung, die mich bei jedem Wiedersehen mit ihm überkam.
Er lief die Stufen herunter, hob mich hoch und drehte sich mit mir im Kreis. »Hör sofort auf!« befahl ich ihm. Er gehorchte, um-schloß mein Gesicht mit beiden Händen und drückte mir einen schallenden Kuß auf die Stirn.
»Du bist doch tatsächlich gewachsen, schöne Base«, stellte er fest.
Er nannte mich immer »schöne Base«. Wenn ich darauf hinwies, daß wir überhaupt nicht verwandt wären, erklärte er: »Aber wir sollten es sein. Ich habe zugesehen, wie sich das häßliche kleine Entlein zu einem schönen Schwan entwickelt hat. Als du auf die Welt kamst, sahst du aus wie ein kleiner Affe, und jetzt bist du eine Gazelle, meine schöne Base.«
Leigh neigte zu Übertreibungen. Bei ihm war alles entweder wunderbar oder entsetzlich. Meinem Vater ging er damit auf die Nerven, aber mir gefiel seine Art, wie mir überhaupt alles an ihm gefiel; er war der vollkommene ältere Bruder, und ich wünschte mir oft, daß er es wirklich wäre. Natürlich liebte ich Edwin. Er war sanft und immer bestrebt, niemanden zu verletzen. Er war den Dienern gegenüber sehr höflich, und sie waren ihm ergeben; aber die Frauen zogen Leigh vor.
Inzwischen hatte Leigh Christabel bemerkt, die mit leicht geröteten Wangen und ein wenig zerzausten Locken hinter mir hereingekommen war.
Ich stellte sie einander vor, und er verneigte sich galant. Christabel musterte ihn, und ich erwähnte nicht, daß sie meine Gouvernante war; ich wollte es ihm zu gegebener Zeit erzählen. Ich hatte nämlich das Gefühl, daß es ihr Spaß machte, für einen Gast des Hauses gehalten zu werden, wenn auch nur für kurze Zeit.
»Wir sind ausgeritten«, erklärte ich. »Wann bist du angekommen? Ist Edwin auch hier?«
»Wir sind zusammen gereist. Edwin!« rief er. »Wo bist du? Priscilla fragt nach dir.«
Edwin tauchte auf der Treppe auf. Auch er sah sehr gut aus, sogar besser als Leigh, obwohl er kleiner und nicht so kräftig gebaut war.
»Priscilla!« Er kam die Treppe herunter. »Es tut gut, dich zu sehen. Wo ist Mutter?« Er hatte sich Christabel zugewandt.
»Mistress Connalt«, stellte ich vor. Und dann zu Christabel: »Mein Bruder, Lord Eversleigh.«
Edwin verbeugte sich.
»Sie sind bei Hof«, beantwortete ich seine Frage.
Edwin zuckte enttäuscht die Schultern.
»Vielleicht kommen sie zurück, während ihr noch da seid. Könnt ihr lange bleiben?«
»Eine Woche, vielleicht auch etwas länger.«
»Drei, vier Wochen«, schlug Leigh vor.
»Ich freue mich so sehr. Ich lasse eure Zimmer herrichten ...«
»Ist nicht notwendig«, unterbrach mich Leigh. »Sally Nullens hat uns schon gesehen und flattert aufgeregt herum. Sie freut sich so sehr, ihre kleinen Lieblinge wieder bei sich zu haben.«
»Sie wissen ja, wie Kinderfrauen sind, Mistress Connalt«, sagte Edwin, »wenn sie ihre Schutzbefohlenen wieder um sich haben.«
Er hatte erkannt, daß Christabel unsicher und zurückhaltend war, und wollte ihr die Befangenheit nehmen.
»Ich hatte nie eine, also kann ich nicht mitreden«, antwortete sie.
»Dann sind Sie dieser Unterdrückung entgangen«, warf Leigh leichthin ein.
»Wir waren zu arm«, fuhr Christabel beinahe herausfordernd fort.
Ich fühlte mich unbehaglich; jetzt war die Erklärung fällig. »Christabel ist hier, um mich zu unterrichten. Sie hat vorher in einem Pfarrhaus in Sussex gelebt.«
»Wie geht es Carl im Pfarrhaus?« erkundigte sich Edwin. »Und wo steckt er überhaupt?«
»Wahrscheinlich im Sommerhaus, um Flageolett zu spielen.«
»Der arme Junge! Er muß ja ganz erfroren sein.«
»Wenigstens verschont er uns mit dem entsetzlichen Lärm, den er produziert«, bemerkte Leigh.
»Was wolltest du eigentlich jetzt tun?« fragte Edwin.
»Waschen, umziehen und dann ist es Zeit fürs Abendessen.«
»Wir werden unsere Uniformen ablegen«, sagte Leigh. Er grinste Christabel und mich an. »Ich weiß, daß wir in ihnen verführerisch aussehen, und Sie werden über die Verwandlung entsetzt sein, Mistress Connalt. Priscilla ist daran gewöhnt, deshalb muß ich sie nicht erst warnen.«
Ich freute mich darüber, daß er versuchte, Christabel in die Unterhaltung einzubeziehen. Sie erinnerte mich an ein Kind, das die Zehen ins Wasser taucht–es möchte hinein, getraut sich aber nicht.
Ich musterte die beiden: ihre breitkrempigen Hüte mit den prächtigen Federn, die prunkvollen Mäntel, die Kniehosen, die glänzenden Stiefel, die Degen.
»Ihr seht recht gut aus, aber keineswegs verführerisch«, dämpfte ich Leighs Übermut, »und wir wissen ohnehin, daß ihr das gute Aussehen nur der Uniform verdankt, nicht wahr, Christabel?«
Sie lächelte. Die beiden hatten es tatsächlich geschafft, ihren Unmut zu vertreiben.
»Kommt jetzt«, forderte ich sie auf. »Wir müssen uns waschen und umziehen... wir alle. Das Essen wird sonst kalt, und ihr wißt, daß das die Köchin kränkt.«
»Befehle«, rief Leigh. »Mein Gott, du bist ärger als unser Kommandant. Nicht zu übersehen, daß wir wieder zu Hause sind, was, Edwin?«
»Es tut gut, wieder hier zu sein«, konstatierte Edwin freundlich.
An diesem Abend sah Christabel sehr hübsch aus. Vielleicht war es das Kerzenlicht, vielleicht eine andere Ursache. Meine Mutter behauptete immer, daß Kerzenlicht einer Frau mehr schmeichle als alle Schönheitsmittel. Außerdem trug sie eine wundervolle Robe. Das lange, spitz zulaufende Mieder war tief ausgeschnitten und ließ ihre makellosen Schultern frei. Eine Locke hatte sich aus dem Knoten in ihrem Nacken gelöst und hing auf eine Schulter herab. Das Kleid war aus lavendelfarbiger Seide und das Unterkleid aus grauem Satin. Ich fragte mich, wie sie indem knickrigen Pfarrhaus zu so einem Kleid gekommen war, und erfuhr später, es sei eines der abgelegten Kleider von Lady Letty.
Edwin und Leigh waren aus ihren prächtigen Uniformen geschlüpft, sahen aber auch in den knielangen Hosen und den kurzen Jacken gut aus. Der Mode entsprechend waren ihre Jacken mit Schleifen besetzt, wobei Edwin eher des Guten zuviel getan hatte, denn er richtete sich sklavischer nach der Mode als Leigh. Letzterer hielt nicht viel von den Spitzen und Bändern, die als Reaktion auf die früheren puritanischen Kleidervorschriften en vogue waren.
Carl war vor Freude ganz aus dem Häuschen, so daß wir eine fröhliche Tischrunde bildeten. Ich mußte daran denken, wie enttäuscht meine Mutter darüber sein würde, daß sie die beiden versäumt hatte.
Sie erzählten von ihren Abenteuern, denn sie waren geradewegs aus Frankreich gekommen. Von den Gesprächen an diesem Abend prägten sich mir jedoch am nachhaltigsten die Bemerkungen über Titus Oates und die papistische Verschwörung ein, dem Vorspiel zu den Ereignissen, die kurz darauf folgten.
»Die Stimmung in England ist heute anders als zu der Zeit, da wir uns nach Frankreich einschifften«, bemerkte Leigh.
»Veränderungen ergeben sich oft sehr rasch«, stimmte Edwin zu, »und wenn man aus dem Ausland zurückkehrt, merkt man sie deutlicher als die Daheimgebliebenen, die sich allmählich daran gewöhnt haben.«
»Veränderungen?« fragte ich. »Was für Veränderungen?«
»Der König ist nicht alt«, meinte Edwin. »Er ist erst fünfzig.«
»Fünfzig!« rief Carl. »Das ist ja uralt.«
Alle lachten.
»Nur für ein Kind, mein Junge«, meinte Leigh. »Nein, Old Rowley wird noch eine gute Weile am Leben bleiben. Er muß am Leben bleiben. Ein Jammer, daß er keinen Sohn hat.«
»Ich war der Meinung, daß er mehrere Söhne hat«, warf Christabel ein.
»Leider sind sie alle unehelich.«
»Mir tut die Königin leid«, sagte Edwin. »Die arme, sanfte Frau.«
»Es ist einfach idiotisch zu behaupten, daß sie an einer Verschwörung beteiligt ist, die sich den Tod des Königs zum Ziel gesetzt hat«, fügte Leigh hinzu.
Carl beugte sich vor. Er war so aufgeregt, daß er sogar seine Lieblingsspeise, die Lammpastete, vergaß. Er war frühreif, denn mein Vater hatte immer darauf bestanden, ihn als Erwachsenen zu behandeln. Er wußte über den König, seine Mätressen und seine unehelichen Kinder genau Bescheid.
»War sie denn nicht daran beteiligt?« fragte er. »Wollte sie den König denn nicht töten? Hat sie keinen Liebhaber?«
»Was bist du doch für ein blasierter alter Knabe«, rief Leigh. »Die Königin ist die tugendhafteste Frau von England – Anwesende ausgenommen. Wenn sich dieser Titus Oates nicht vorsieht, wird er sich noch selbst an den Galgen bringen.«
»Vorerst hat er es geschafft, etliche andere an den Galgen zu bringen«, bemerkte Christabel.
»Wenn man nur beweisen könnte, daß der König Lucy Walter geheiratet hat. Dann wäre nämlich Jimmy Monmouth der nächste in der Thronfolge.«
»Eignet er sich denn zum König?« wollte Christabel wissen.
»Ich habe gehört, daß er ziemlich wild ist«, bemerkte ich.
»Er liebt weibliche Gesellschaft, das ist richtig«, gab Leigh zu. »Aber wer tut das nicht? Der König selbst ist ein großer Damenfreund. Aber Charles ist verschlagen, klug, listig und geistreich. Er hat erklärt, daß er nie mehr ein flatterhaftes Leben führen wird, wenn er nach dem langen Exil nach England zurückkehrt, und damit war es ihm sicherlich ernst.«
»Das Volk liebt ihn«, sagte Edwin. »Er besitzt den unverkennbaren Charme der Stuarts, und solchen Menschen wird leicht vergeben.«
Leigh ergriff meine Hand und küßte sie. »Vergibst du eigentlich mir meines Charmes wegen, schöne Base?«
Wir lachten alle; es war schwierig, in dieser Stimmung ein Thema ernsthaft zu erörtern, und wie hätten wir damals wissen können, daß die Politik unseres Landes noch eine so große Rolle in unserem Leben spielen würde?
Christabel strahlte an diesem Abend. Lady Lettys Kleid stand ihr ausgezeichnet, und Leigh und Edwin halfen ihr, ihre innere Unsicherheit zu überwinden. Sie wollte unbedingt beweisen, daß sie in der Geschichte des Landes besser bewandert war als ich, und lenkte das Gespräch wieder auf aktuelle Ereignisse.
»Vielleicht läßt sich der König scheiden, heiratet wieder und zeugt einen Sohn«, meinte sie.
»Das würde er nie tun«, widersprach Leigh.
»Zu bequem?« fragte Christabel.
»Zu sanftmütig«, wies Edwin sie zurecht. »Sind Sie je bei Hof eingeführt worden, Mistress Connalt?«
Das bittere Lächeln erschien wieder für einen Augenblick. »In meiner Stellung, Lord Eversleigh?«
»Denn wenn Sie vorgestellt worden wären«, fuhr Edwin fort, »hätten Sie sofort erkannt, was für ein toleranter Mann er ist. Wir sprechen hier freimütig über ihn – unter einem anderen Herrscher wäre das lebensgefährlich. Wenn er uns jetzt zuhören könnte, würde er sich an der Diskussion über seinen Charakter beteiligen und sogar selbst auf seine Fehler aufmerksam machen. Unsere Behauptungen würden ihn amüsieren, nicht ärgern. Er ist zu klug, um ein falsches Bild von sich selbst zu haben. Nicht wahr, Leigh?«
Leigh stimmte ihm zu. »Ich bin ganz deiner Meinung. Eines Tages wird allen bewußt werden, wie klug er ist. Wir haben in Frankreich gesehen, wie geschickt er ist. Der französische König glaubt, daß er Charles völlig beherrscht, aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Nein, solange Karl unser König ist, ist alles in Ordnung. Das Problem ist die Thronfolge. Deshalb beklagen wir, daß er so viele Söhne hat, die eigentlich nicht hätten zur Welt kommen dürfen – und die obendrein die Staatskasse ganz schön belasten – und nicht fähig ist, den einen zu zeugen, der die Antwort auf die brennende Frage ›Wer ist der nächste?‹ wäre.«
»Hoffen wir, daß er ewig lebt«, sagte ich. »Trinken wir!«
»Ein Hoch auf Seine Majestät!« rief Leigh, und wir hoben unsere Gläser.
Carl wurde allmählich schläfrig und bemühte sich verzweifelt, wach zu bleiben. Meine Mutter hatte dagegen protestiert, daß er so viel Wein trinken durfte, wie er wollte, aber mein Vater war der Meinung gewesen, Carl müsse dazu erzogen werden, Alkohol zu vertragen. Diese Erziehung war in vollem Gang.
Christabel trank genauso mäßig wie ich, und die leichte Röte ihrer Wangen sowie ihre leuchtenden Augen waren nicht auf den Wein zurückzuführen. Sie war vollkommen verändert, und sie genoß den Abend beinahe wie in einer Art Fieber. Sie tat mir leid, denn solche Abende gab es in unserem Haus oft. Wie eintönig mußte ihr Leben in dem düsteren Pfarrhaus verlaufen sein.
Sie kannte sich in der Politik weit besser aus als ich und war bestrebt, es den beiden Männern zu beweisen.
»Eigentlich handelt es sich um einen religiösen Konflikt«, sagte sie, »wie bei fast allen politischen Konflikten. Es geht nicht so sehr um Monmouths Legitimierung als um die Frage, ob wir einen Katholiken auf dem Thron haben wollen.«
»Richtig«, Edwin lächelte ihr zu. »Daß Jakob katholisch ist, steht zweifelsfrei fest.«
Leigh beugte sich vor und flüsterte: »Ich habe gehört, daß Seine Majestät mit dem Gedanken an diesen Glauben spielt – aber behaltet es für euch.«
Ich warf Carl, der vor seinem Teller eingenickt war, einen Blick zu. Leigh neigte dazu, leichtsinnig zu sein.
Edwin sagte rasch: »Es handelt sich nur um eine Vermutung. Der König hat es bestimmt nicht darauf angelegt, das Mißfallen seiner Untertanen zu erregen.«
»Was wird er also tun?« wollte ich wissen. »Monmouth legitimieren oder seinen katholischen Bruder als Thronfolger akzeptieren?«
»Ich hoffe inbrünstig, daß es Monmouth sein wird«, antwortete Leigh, »denn wenn ein katholischer König den Thron besteigt, kommt es zu einer Revolution. Seine Untertanen sind dagegen. Erinnern wir uns doch nur an die Scheiterhaufen von Smithfield.«
»Auf beiden Seiten gab es religiöse Verfolgungen«, warf Christabel ein.
»Aber die Menschen werden Smithfield, den Einfluß Spaniens und die drohende Gefahr der Inquisition nie vergessen. Sie werden sich an Bloody Mary erinnern, solange England ein Königreich ist. Deshalb bleibt Old Rowley nichts anderes übrig, als weitere zwanzig Jahre zu leben.« Leigh erhob sein Glas. »Noch einmal, auf das Wohl Seiner Majestät.«
Danach sprachen wir über Titus Oates, der dadurch Aufsehen erregt hatte, daß er angeblich die papistische Verschwörung aufgedeckt hatte.
Edwin erzählte uns, daß Titus die geistlichen Weihen empfangen und vom Herzog von Norfolk eine kleine Pfründe erhalten hatte, bis er in einen Prozeß verwickelt wurde, im Anschluß daran sein Amt aufgab und schließlich Kaplan in der Flotte wurde.
»Ich bin davon überzeugt, daß er sich auf mehr oder weniger ehrliche Weise durchs Leben schlägt«, griff Leigh ein, »und die Aufdeckung der papistischen Verschwörung sollte ihm sicherlich zum Vorteil gereichen.«
»Das Volk war bereit, ihm zu glauben«, erklärte Christabel, »weil die Menschen immer schon Angst vor einer Bedrohung des Protestantismus hatten. Nun ist der Herzog von York Thronerbe, man weiß allgemein, welcher Seite er zuneigt, und da ist es natürlich leicht, den Unmut der breiten Masse zu wecken.«
»Genau«, bestätigte Edwin und lächelte ihr bewundernd zu. »Angeblich wollten die Verschwörer, lauter Katholiken, die Protestanten umbringen – so wie in der Bartholomäusnacht in Frankreich die Hugenotten umgebracht wurden –, den König ermorden und seinen Bruder Jakob auf den Thron setzen. Es ist Oates gelungen, die Massen aufzuwiegeln, und die Situation spitzt sich zu.«
»Ich könnte schwören, daß kein Wort davon wahr ist«, fügte Leigh hinzu.
»Ja, es ist blanker Unsinn«, pflichtete ihm Edwin bei.
»Aber ein gefährlicher Unsinn«, meinte Leigh. »Wenn man bedenkt, was er Oates eingetragen hat – eine Pension von neunhundert Pfund jährlich und eine Wohnung in Whitehall, von der aus er die Untersuchung führt.«