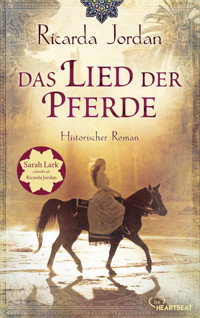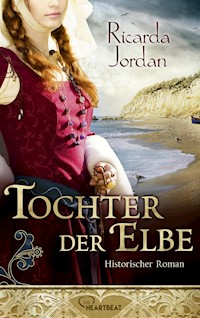9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es war einmal vor langer Zeit... weit draußen im Mittelmeer. 1229: Das Heer des spanischen Königs Jaume belagert die Hauptstadt Mallorcas, das unter maurischer Herrschaft steht. Die Christen ignorieren sämtliche Kapitulationsangebote des Wesirs, den Bürgern drohen Plünderung, Versklavung, Tod. In seiner Verzweiflung sendet der maurische Herrscher König Jaume ein besonderes Weihnachtsgeschenk: ein Mädchen, ausgebildet in allen Künsten der Liebe. Vorgeblich soll die Haremssklavin Samira den König milde stimmen. Tatsächlich soll sie ihn töten. Samira glaubt, dass sie durch ihre Tat ihren Geliebten retten kann – doch das ist ein bitterer Trugschluss …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ricarda Jordan
Das Geschenk des Wesirs
Eine Weihnachtsgeschichte aus dem alten Mallorca
Über dieses Buch
1229: Das Heer des spanischen Königs Jaume belagert die Hauptstadt Mallorcas, das unter maurischer Herrschaft steht. Die Christen ignorieren sämtliche Kapitulationsangebote des Wesirs, den Bürgern drohen Plünderung, Versklavung, Tod. In seiner Verzweiflung sendet der maurische Herrscher König Jaume ein besonderes Weihnachtsgeschenk: ein Mädchen, ausgebildet in allen Künsten der Liebe. Vorgeblich soll die Haremssklavin Samira den König milde stimmen. Tatsächlich soll sie ihn töten. Samira glaubt, dass sie durch ihre Tat ihren Geliebten retten kann – doch das ist ein bitterer Trugschluss …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung und Landkarte Igor Kuprin
Foto der Autorin © privat
ISBN 978-3-644-31091-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Madina Mayurqa
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Epilog
Die Autorin
Madina MayurqaDezember 1229
1
«He, Manuel, Lust auf ein Spielchen?»
«Manuel, träumst du, oder redest du nicht mehr mit uns?»
Elias wandte sich erst beim zweiten Anruf um. Er fühlte sich immer noch nicht angesprochen, wenn ihn jemand Manuel nannte. Zumal der Name im Heer ständig fiel – seinem Gefühl nach hieß dort fast jeder dritte Kämpfer so. Lediglich José und Juan hörte man noch häufiger. Offenbar zeigten die Christen wenig Phantasie bei der Wahl der Namen ihrer Söhne.
Elias bemühte sich jetzt um ein Lächeln. Die drei Männer hatten es sich mit einem Satz Würfel am Feuer vor ihren Zelten bequem gemacht, aber er hatte keine Lust, sich zu ihnen zu gesellen. Obwohl er als Kaufmannssohn gelernt hatte, geschäftliche Risiken einzugehen, lag es ihm doch fern, sein Glück bei unsicheren Unternehmungen zu versuchen. Aus eigenem Antrieb wäre Elias auch nie mit dem König ins Feld gezogen.
An diesem Tag hatte er zumindest eine gute Ausrede, sich dem Würfelspiel zu entziehen. «Tut mir leid, ich war in Gedanken. Aber ich habe sowieso keine Zeit. Der König hat mich angefordert. Es gibt neue Verhandlungen mit dem Wesir.»
Elias war der Einzige im Kreuzfahrerheer von König Jaume, der die arabische Sprache beherrschte. Das war allerdings erst aufgefallen, als sich gleich am ersten Tag der Invasion Mallorcas ein bereitwilliger Verräter bei den Spaniern gemeldet hatte. Der König und seine Ratgeber hatten kein Wort verstanden, als der arabische Wortschwall über sie hereingebrochen war. An die Mitnahme eines Übersetzers hatte niemand gedacht. Also war herumgefragt worden, und er, Elias Abrabanel, hatte sich gemeldet. Seitdem übersetzte er für den König. Als Übersetzer war er wertvoll, man schickte ihn nicht in erster Gefechtslinie in den Kampf. Er empfand das zunächst als Privileg, seit einer Weile jedoch zog man ihn bei der Befragung Gefangener hinzu, und manchmal hatte Elias den Eindruck, in den Zelten der Folterknechte mehr Blut zu sehen als seine Kameraden auf dem Schlachtfeld.
«Gibt der alte Mohr endlich nach?», fragte einer der Spieler am Feuer, erfreut über die Nachricht. «Sag dem König, er soll ja nicht weich werden! Keine kampflose Übergabe! Wir wollen dieses hübsche Städtchen plündern!»
«Vor allem den Harem des Mohren!», grölte der zweite der Männer.
An ihn und die anderen als Kameraden zu denken, fiel Elias ebenso schwer wie die Annahme seines christlichen Namens. «Da macht euch mal keine Sorgen, die Moncadas geben nicht nach», beschied er die Soldaten nun und machte sich endlich davon.
Die Moncadas waren eine sehr einflussreiche Familie, und zwei ihrer Mitglieder waren gleich zu Beginn der Kämpfe in einen Hinterhalt der Mallorquiner geraten. Ihre Verwandten forderten nun Rache für ihren Tod – und sie gehörten zu den wichtigsten Ratgebern des Königs.
Elias erwartete denn auch nicht viel von den neuen Verhandlungen mit Abu Yahya Muhammad ibn Ali ibn Abi Imran at-Tinmalali, dem Wesir von Mallorca. Dabei war der Maure durchaus willig. Er wusste schließlich genau, dass ihm das Invasionsheer waffentechnisch weit überlegen war. Madina Mayurqa hatte bei dieser Belagerung keine Aussicht auf Sieg. Die Stadt würde über kurz oder lang eingenommen werden. Schon jetzt kämpften die eingeschlossenen Bewohner mit dem Mut der Verzweiflung. Sie kamen kaum nach, ihre Stadtmauern zu reparieren, wenn die Söldner des Königs ihre schweren Katapulte abgefeuert hatten.
Vor den Ställen im Zentrum des von einem Palisadenzaun umgebenen Heerlagers warteten bereits König Jaume und seine Begleitung. Abu Yahya hatte den feindlichen Herrscher und seine Ratgeber zu Kapitulationsverhandlungen in seinen Palast gebeten. Zweifellos wollte er ihnen die Pracht und den Reichtum der Stadt vorführen, die sie im Begriff waren zu zerstören.
Der junge Jaume, König von Aragon und Graf von Katalonien, saß schon auf dem Pferd, umgeben von seinen Männern. Alle waren prächtig gekleidet. Selbst die Geistlichen hatten auf ihre Soutanen verzichtet, sie trugen stolz die Farben ihrer Familien. Das rotbraune, üppig gelockte Haar des Königs wurde von einem goldenen Reif zurückgehalten. Er war kaum gerüstet, nur ein Kettenhemd unter seiner rostroten Tunika sorgte für etwas Schutz vor Geschossen aus dem Hinterhalt. Die meisten seiner Berater trugen keine Rüstung, sondern schwere Mäntel gegen die Winterkälte und den Regen, der dem Heer seit Wochen zu schaffen machte. Für die Sicherheit der Gesandtschaft sorgten zwanzig voll bewaffnete Ritter, die später einen festen Ring um die Würdenträger schließen würden.
«Worauf warten wir noch?», fragte Alfonso Berenguer eben ungeduldig, als Elias endlich eintraf und Anstalten machte, sich entschuldigend vor dem König zu verneigen. «Auf den Juden womöglich? Das darf nicht wahr sein, Herr, dass Ihr den wieder hinzuzieht! Unter den Gaunern in der Stadt sprechen doch wohl genügend unsere Sprache!»
König Jaume warf dem jungen Mann einen strafenden Blick zu. «Ich bevorzuge Übersetzer, die auf meiner Seite stehen», beschied er den ungestümen Kaufmannssohn. «Und Ihr wisst sehr wohl, dass Don Manuel kein Jude ist. Also bitte unterlasst diese Sticheleien! Es steht christlichen Kreuzfahrern nicht an, untereinander uneins zu sein!»
Elias brachte seine Entschuldigung vor und dachte dabei, dass es wohl größerer Anstrengungen bedürfte als der eines Kreuzzugs, um Einigkeit zwischen den Berenguers und den Abrabanels herbeizuführen. Beide waren reiche Kaufmannsfamilien. Sie agierten von Barcelona aus, und sie waren von jeher Rivalen. Der Wunsch, endlich mit den Berenguers gleichzuziehen, war letztlich der Grund für die Taufe seines Vaters Salomon Abrabanel fast drei Jahre zuvor gewesen. Christliche Kaufleute hätten einige Vorteile, hatte Abrabanel seiner zweifelnden Frau und seinen Söhnen erklärt, und Gott erlaube den Vertretern seines auserwählten Volkes die Scheinkonvertierung, sofern sie dem Judentum im Herzen treu blieben.
Elias hatte dem nicht widersprochen, obwohl er sehr gut wusste, dass dies eigentlich nur bei Gefahr für Leib und Leben galt, nicht zur Vermeidung erhöhter Steuerlasten. Verfolgung drohte den Juden jedoch nicht unter König Jaume. Im Gegenteil – Jaume zählte einen jüdischen Arzt, Acac Abenvenist, zu seinen engsten Vertrauten und wichtigsten Beratern, und bei diesem Kreuzzug gegen Mallorca hatte er die konvertierten Juden ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen.
Elias’ Vater hatte sich das nicht zweimal sagen lassen. Sobald er gehört hatte, dass die Berenguers mehrere Familienmitglieder mitschickten, hatte er seinen jüngsten Sohn genötigt, ebenfalls das Kreuz zu nehmen. Der Kaufmannschaft von Barcelona war sehr am Erfolg des Feldzugs gelegen. Das Unternehmen diente zwar vorgeblich der Bekehrung der Ungläubigen mit Feuer und Schwert, war aber tatsächlich eine Strafexpedition gegen Seeräuberei. Die Truppen des Königs – neben Katalanen und Aragonesen nahmen auch Vertreter französischer und italienischer Handelsstädte am Kreuzzug teil – gedachten, endlich mit den Gefahren für den Seehandel aufzuräumen, die von Mallorca ausgingen. Mit der Kaperung und Requirierung zweier reicher katalanischer Schiffe hatten Abu Yahya und seine Männer den Bogen endgültig überspannt. Der Seeweg zur Levante musste wieder sicherer werden, und die katalanische Kaufmannschaft war bereit, das ihrige dazu zu tun.
Die Berenguers, Girards, Gronys und Abrabanels unterstützten das Unternehmen großzügig mit hohen Geldsummen und der Entsendung von Kämpfern. Mindestens ein Familienmitglied musste dabei sein, um den König ja nicht vergessen zu lassen, wer ihn da finanzierte. Für den jungen Elias Abrabanel bedeutete das, nun wirklich als Christ zu leben. Bislang hatte er den Namen Manuel nur pro forma getragen. Über einen wöchentlichen Kirchgang hinaus hatte die Taufe das Leben der Abrabanels nicht verändert. Sie hatten einander weiterhin mit ihren jüdischen Namen angesprochen und jeden Freitagabend den Sabbat begrüßt. Jetzt jedoch wurde es ernst für Elias. Der junge Mann hasste jeden Augenblick, in dem man ihn zwang, sein Schwert mit einem Gebet auf den Lippen in die Leiber von Männern zu stoßen, mit denen er eigentlich nichts zu tun hatte.
Elias war nicht feige, aber er fand keinen Gefallen am Kriegshandwerk. Schon als Junge hatte er den Kopf lieber in Schriftrollen gesteckt, als sich im Schwertkampf zu üben. Er beherrschte mehrere Sprachen und verstand sich auf Buchführung und Diplomatie. Wenn es eben möglich war, bevorzugte er es, Streitigkeiten friedlich beizulegen. Das galt auch für diesen Konflikt mit den Mallorquinern.
Elias bestieg sein Pferd und blickte zu der Stadt hinüber, deren weiße Paläste, Türme und Minarette verheißungsvoll zum Lager der Eroberer herübergrüßten. Egal, was die Moncadas planten, er würde versuchen, die Menschen in Madina Mayurqa vor Raub und Mord zu bewahren.
2
«Giulietta …»
Mit einem Mimosenzweig streichelte Thabit über Samiras Brüste, zeichnete die Konturen ihres wohlgeformten Körpers nach und malte Kreise um ihre Pforte der Lust, bis sie aufstöhnte und sich ihm entgegenhob. Er liebte es, die junge Frau langsam zu erregen, sie ein wenig zu quälen, indem er zusah, wie sie mehr als bereit für ihn wurde, bevor er endlich in sie eindrang. Thabit ibn Abu Yahya verstand sich auf das Spiel der Liebe, zu dem auch der geschickte Umgang mit Worten gehörte. Der Name Giulietta, den Samira seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gehört hatte, schien allein wie eine Liebkosung. Thabit sprach ihn sanft aus, weich, die Silben perlten wie Honig von seinen Lippen.
«Meine wunderschöne Giulietta … wie konnte ich jemals leben ohne dich? Wie konnte überhaupt jemals die Sonne scheinen, das Gras ergrünen, das Meer gegen die Strände branden, bevor du diese Insel betreten hast?»
Samira lachte. «Und trotzdem willst du mich jetzt schon verlassen», tadelte sie ihn. «Nach nur einer Stunde in unseren Gärten. Dafür, Geliebter, lohnte es sich kaum, meine Augen mit Kajal zu umranden.»
Die beiden lagen in einem Pavillon in einem der Gärten des Gouverneurspalastes von Madina Mayurqa. Von ihrem Lager aus bot sich ein Blick auf Wasserspiele und üppiges Grün, alte Bäume, die im Sommer Schatten spendeten, und kunstvoll arrangierte Pflanzen, deren farbenfrohe Blüten nur auf die Frühlingssonne warteten, um die Gärten mit ihren Düften zu betören. Zurzeit jedoch war es noch kühl. Die Insel befand sich im Griff eines außergewöhnlich regenreichen und harten Winters. Thabit und Samira spürten davon allerdings nichts. Um ihr Lager herum waren Kohlebecken aufgestellt, um sie vor der Winterkälte zu schützen.
«Deine Augen brauchen keinen Kajal, um zu strahlen», schmeichelte Thabit. «Dein Körper braucht keine Öle, um zu duften. Du bist schön, so wie Allah dich schuf – du bist sein Meisterwerk! Und du weißt genau, dass ich dich nicht aus eigenem Antrieb verlasse. Gleich kommen diese verfluchten Katalanen. Und mein Vater fordert meine Anwesenheit.»
«Kann ich … nicht mit?» Samira griff nach einer der langen schwarzen Haarsträhnen ihres Geliebten und wand sie sich verführerisch um die Finger. «Ich mache mir Sorgen, weißt du? Alle Mädchen machen sich Sorgen …»
Tatsächlich hatten die Frauen im Harem des Palastes Samira den ganzen Morgen über bestürmt, ihrem Geliebten beim nächsten Treffen ein paar Informationen zu entlocken. Die Ehefrauen und Konkubinen des Wesirs und seines Sohnes Thabit – es waren fast zweihundert – lebten abgeschieden von der Welt in größtem Prunk, aber hinter hohen Mauern. Sie hörten die Geschosse der Trebuchets in der Stadt einschlagen und spürten die angespannte Atmosphäre. Alle litten unter der Wasserknappheit. König Jaume hatte sein Lager am Zufluss des raffinierten Kanalisationssystems errichtet, das die Stadt mit Wasser versorgte. Nun gelangte weder Frischwasser herein noch Abwasser hinaus. In den Straßen stank es faulig, und die Bäder waren seit Tagen geschlossen. Selbst die temperierten Wasserbecken, in denen sich die Frauen zu räkeln pflegten, und die Wasserspiele in den Gärten waren trockengelegt. Hungern mussten die verwöhnten Haremsdamen zwar noch nicht, aber sie mussten sich einschränken. Die Gerichte, die auf dem Speisezettel standen, waren nicht mehr so üppig, seit die Invasoren die Lieferungen von Gütern in die Stadt blockierten. Samira und die anderen Frauen wussten sehr genau, dass etwas vor sich ging. Sie konnten sich ausmalen, was ihnen bevorstand, wenn es tatsächlich zu Plünderungen kam.
Thabits Lippen streiften Samiras Stirn, bevor er antwortete. «Du musst dich nicht sorgen, Licht meines Lebens. Mein Vater macht den Christen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Wir werden allerdings umziehen müssen, Giulietta, mein Traum. Nach Nordafrika, wie es aussieht. Mein Vater wird den Christen Geld bieten, damit sie uns gehen lassen.»
«Ich würde trotzdem gern dabei sein, wenn ihr mit ihnen verhandelt.»
Samira ließ Thabits Haarsträhne los, ihre Finger wanderten über seine Schulter und seinen Arm hinunter. Staunend sah er auf ihre zarte, kunstvoll mit Blütenranken verzierte Hand in seinen kräftigen dunklen Fingern. Abu Yahya und seine Söhne waren keine «Mohren», wie die spanischen Soldaten höhnten, doch sie hatten einen dunklen Teint. Samiras Haut war dagegen hell wie Frühlingshonig, ihr Haar sehr fein wie gesponnenes Sonnenlicht, und ihre Augen strahlten smaragdgrün. Samira war eine außergewöhnliche Schönheit – Abu Yahya hatte sich das Geschenk zum zwanzigsten Geburtstag seines Sohnes etwas kosten lassen.
«Es wird langweilig sein, Liebste. Und so viel siehst du gar nicht von der Galerie aus.»
Thabit war nicht begeistert von Samiras Ansinnen, den Übergabeverhandlungen mit den Spaniern beizuwohnen. Dabei sorgte er sich nicht um ihre Tugend. Selbst wenn er sie mitnahm, würde keiner der Feinde – und auch keiner der Ritter seines Vaters – die junge Frau zu Gesicht bekommen. Muslimische Frauen waren interessiert an den Geschäften ihrer Gatten und Väter, und viele Männer schätzten den Rat ihrer Gemahlinnen. Insofern wies denn auch fast jeder Empfangsraum in maurischen Häusern eine Empore auf, von der aus die Frauen, versteckt hinter kunstvoll gefertigten hölzernen Gitterkonstruktionen, den Gesprächen der Männer zu lauschen vermochten. Thabit konnte sich nur nicht vorstellen, was Samira daran reizte. Er selbst interessierte sich kein bisschen für Politik. Thabit war durch und durch Krieger. Er liebte den Kampf und hatte sich als Seeräuber längst einen Namen gemacht. Die Kaperung der katalanischen Handelsschiffe, die den Konflikt mit den Spaniern ausgelöst hatte, war sein Werk gewesen.
«Oder willst du einfach nur deine Sprache mal wieder hören, Giulietta?», fragte er plötzlich scheinbar verständnisvoll. «Natürlich! Du könntest uns sogar als Übersetzerin dienen, nicht wahr?» Er lachte vergnügt.
Samira seufzte. Sie liebte Thabit, aber manchmal ärgerte sie sich über seine Ignoranz. Abu Yahya ließ seine Söhne von den besten Lehrern unterrichten, doch Thabit hörte nur zu, wenn es um Strategien und Kampftechniken ging.
«Ich würde meine Sprache wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen», erklärte sie. «Ich habe sie ewig nicht mehr gehört. Ich war fünf Jahre alt, als ich gefangen genommen wurde. Zudem kam die Galeere, auf der wir damals reisten, aus Genua. Das ist nicht in Katalonien oder in Aragon, sondern in Italien, man spricht dort kein Katalanisch.»
Thabit lachte wieder, weit davon entfernt, ihre Kritik übelzunehmen oder auch nur als solche zu erkennen. «Na, umso besser. Mir würd’s nicht wirklich gefallen, wenn du eine der ihren wärst!» Er zog ihre Hand an seine Lippen und küsste sie.
«Ich bin Muslimin, Thabit!», fuhr Samira auf. «Seit meinem fünften Lebensjahr. Ich kenne keinen anderen Glauben, und ich habe keine andere Sprache mehr gehört als die deine. Mit König Jaume und seinen Leuten habe ich nichts gemein, ich habe nie zu ihrem Volk gehört, und ihr Glaube ist mir fremd. Das wird sie allerdings nicht daran hindern, mich auf einem Scheiterhaufen brennen zu lassen, falls sie herausfinden, woher ich komme. Deine Giulietta wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit christlich getauft, und es wird Jaumes Priester nicht ein bisschen kümmern, dass sich Samira daran nicht mehr erinnert. Thabit, wach endlich auf! Wenn die Verhandlungen deines Vaters keinen Erfolg haben, schänden dieser König und seine Männer den Harem! Danach werden sie die von Geburt an muslimischen Frauen verkaufen und die jüdischen auch. Aber Christinnen, die den Islam angenommen haben, die bringen sie um!»
«Wir werden Erfolg haben!» Thabit streichelte sie beruhigend. «Und überhaupt, es weiß doch keiner, wo du herkommst. Du könntest von Geburt an Muslimin sein.»
Samira schnaubte. «Was glaubst du wohl, was Zinaida ihnen erzählt?», fragte sie böse. «Sie wird mich verraten, Thabit, und wenn es das Letzte ist, was sie tut. Also versteh bitte, dass ich mich sorge! Und nimm mir die Angst, indem du mich bei diesen Verhandlungen zusehen lässt, Thabit! Du weißt, wie selten ich dich um etwas bitte.»
3
«Padre Jacobo, möchtet Ihr noch ein Gebet sprechen, bevor wir aufbrechen? Wir sollten Gott um ein Gelingen unseres Vorhabens bitten und um eine sichere Rückkehr aus der Stadt der Feinde.»
Der König wandte sich an den jungen Geistlichen, der neben ihm auf einem prächtigen Pferd saß. Dem hochgewachsenen jungen Mann, der in den Farben der Familie Moncada gekleidet war, sah man den Priester zumindest auf den ersten Blick nicht an. Er reagierte zunächst auch nicht auf die Ansprache. Erst als König Jaume ihn mit einem Funken Spott in den Augen ansah, verneigte er sich.
«Sehr gern, Majestät, so es Euch beliebt. Aber vielleicht möchte der Bischof die Gebete lieber persönlich sprechen.»