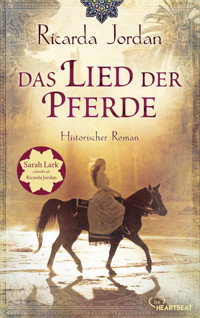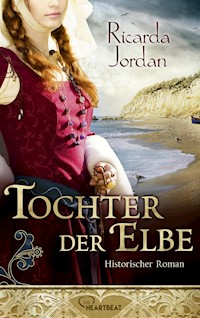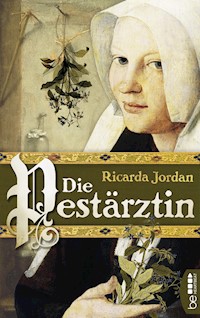Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane von Bestseller-Autorin Ricarda Jordan
- Sprache: Deutsch
Vier Menschen, ein Schicksal - und eine verheerende Verschwörung.
Mainz und Köln, 1212. Zwei junge Frauen lehnen sich auf gegen ihre arrangierte Zukunft: Konstanze will nicht ins Kloster und Gisela nicht mit einem Ritter verheiratet werden, dem ein schrecklicher Ruf vorauseilt.
Zur gleichen Zeit brechen im Orient zwei junge Männer auf: Armand wird vom Großkomtur der Tempelritter mit einem geheimen Auftrag nach Europa entsandt, und der Sultan von Alexandria schickt seinen Sohn Malik auf eine nur scheinbar harmlose Reise ...
Die Wege der zwei Frauen und der beiden Männer kreuzen sich. Und sie geraten in das Räderwerk einer unglaublichen Verschwörung, die im Vatikan ihren Ursprung zu haben scheint ...
Die Autorin entführt uns als Sarah Lark ins ferne Neuseeland, als Ricarda Jordan zeigt sie uns das farbenprächtige Mittelalter.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 23 min
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Rupertsberg bei Bingen – Sommer 1206
Herler Burg bei Köln – Sommer 1206
Visionen – Frühjahr 1212
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Dem Himmel nah – Sommer 1212
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Der Eid der Kreuzfahrer – Spätsommer 1212
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Glaube, Liebe, Hoffnung – Herbst 1212
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nachwort
Danksagung
Über die Autorin
Weitere historische Romane der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Mainz und Köln, 1212. Zwei junge Frauen lehnen sich auf gegen ihre arrangierte Zukunft: Konstanze will nicht ins Kloster und Gisela nicht mit einem Ritter verheiratet werden, dem ein schrecklicher Ruf vorauseilt.
Zur gleichen Zeit brechen im Orient zwei junge Männer auf: Armand wird vom Großkomtur der Tempelritter mit einem geheimen Auftrag nach Europa entsandt, und der Sultan von Alexandria schickt seinen Sohn Malik auf eine nur scheinbar harmlose Reise …
Die Wege der zwei Frauen und der beiden Männer kreuzen sich. Und sie geraten in das Räderwerk einer unglaublichen Verschwörung, die im Vatikan ihren Ursprung zu haben scheint …
Ricarda Jordan
Der Eid derKreuzritterin
Historischer Roman
Rupertsberg bei BingenSommer 1206
Konstanze besaß einen Kupferpfennig. Es war das erste Geld, das sie je in Händen gehabt hatte, und es sollte wohl auch das letzte sein. Aber die kleine Münze bot ihr doch fast so etwas wie Trost und Hoffnung. Gut, am Abend dieses Tages würde sie der Welt entsagen, aber jetzt hatte sie ihren Kupferpfennig, und in Bingen war Jahrmarkt. Schon von Weitem hörte man Musik und Gelächter, das Feilschen der Händler und das Wiehern der Pferde. Konstanze warf ihrem Vater einen bittenden Blick zu.
»Können wir nicht hingehen? Nur eine Stunde … wir haben doch noch so viel Zeit!«
Philipp von Katzberg zögerte. »Zur Stunde der Non erwarten sie dich«, sagte er. »Spätestens …«
Konstanze nickte resigniert. »Aber es ist doch noch nicht einmal Mittag«, wandte sie dennoch ein. »Und ich …«
Über das Gesicht ihres Vaters flog ein Lächeln. »Du möchtest deinen Kupferpfennig ausgeben, ja? So gedacht war das eigentlich nicht. Du solltest ihn der Kirche spenden. Die Mutter Oberin würde es zu würdigen wissen.«
Philipp sah seine jüngste Tochter ernst an, aber es fiel ihm sichtlich schwer, an diesem Tag streng mit ihr zu sein.
»Die Mutter Oberin kriegt schon meine ganze Mitgift!«, begehrte Konstanze auf. »Den Pfennig hat der Herr Gottfried mir gegeben. Er hat nicht gesagt, dass ich ihn spenden muss. Bitte, Vater!«
Philipp nickte widerstrebend. Gottfried von Aubach, der Graf, auf dessen Burg seine Familie lebte und in dessen Diensten er stand, hatte keine Bedingungen daran geknüpft, als er Konstanze huldvoll zum Abschied beschenkte. Aber natürlich wusste er von ihrer besonderen Gabe, und er hatte sich für ihre Aufnahme auf dem Rupertsberg eingesetzt, obwohl die Katzbergs nur Lehnsleute des Grafen waren.
»Du weißt doch, dass du nichts behalten darfst«, erinnerte er seine Tochter. »Also kauf keinen Tand, du hättest nur ein paar Stunden, um dich daran zu erfreuen.«
Ein paar Stunden wären besser als nichts, dachte Konstanze, aber sie hatte ohnehin nicht geplant, ihr Geld für Kleider oder Schmuck auszugeben. Eher dachte sie an kandierte Früchte, gebrannte Mandeln oder andere Süßigkeiten, die sie bislang nie gekostet hatte. Dies war schließlich ihre letzte Gelegenheit dazu, und sie war ein Schleckermaul. Sie hatten den Jahrmarkt fast erreicht, und das Wasser lief dem Mädchen schon im Munde zusammen.
Von Wasser und Brot zu leben würde Konstanze nicht leichtfallen – aber vielleicht musste sie das ja gar nicht. Womöglich hatte die Äbtissin nur Spaß gemacht, als sie auf das asketische Leben der jungen Hildegard von Bingen verwies, der Konstanze in Zukunft nacheifern sollte.
Philipp von Katzberg sah seiner Tochter bedauernd nach, als sie kurze Zeit später von einem Marktstand zum anderen tänzelte, ganz erfüllt von dem Wunsch, aus ihrem kleinen Schatz das Beste zu machen. Konstanze war erst zehn Jahre alt, aber sie würde einmal schön werden, mit ihrem fast ebenholzfarbenen glatten Haar, ihrem herzförmigen Gesicht mit den klaren tiefblauen Augen, über die sich wohlgeformte, kräftige dunkle Brauen wölbten. Man hätte sie ebenso gut verheiraten können. Wenn sie bloß nicht so anders wäre … oder wenn seine Frau zumindest darauf verzichtet hätte, das stolz in alle Welt hinauszuposaunen!
Philipp erstand in einer Garküche ein paar Bratwürste und rief Konstanze dann zu sich, die sich eifrig darüber hermachte. Dabei schwärmte sie von den hübschen Stoffen aus Flandern, die sie an einem der Stände hatte betasten können, und den seltsamen Öllampen, die ein orientalisch wirkender Händler feilbot.
»Ob ich nicht doch so eine mitnehmen kann?«, fragte sie ohne große Hoffnung. »Es ist doch sicher dunkel in so einer … Klause …«
»Der Herr wird dich erleuchten«, antwortete Philipp mechanisch. »Du wirst nichts brauchen.«
Konstanze seufzte, schlang rasch ihr letztes Stück Würstchen herunter und wandte sich wieder dem bunten Treiben des Marktes zu. Eine Zeit lang lauschte sie einem Bader, der mit vielen schönen Worten eine Wundermedizin anpries, und schlenderte dann zu einer Art Bühne weiter, die Gaukler auf ihrem Wagen errichtet hatten. Fasziniert sah sie zu, wie die farbenfroh gewandeten Akrobaten jonglierten und auf Stelzen liefen.
Konstanze war so vertieft in das Spiel, dass sie erschrak, als sie plötzlich eine Stimme neben sich hörte.
»Na, kleines Fräulein …möchtest du nicht einen Blick in deine Zukunft tun?«
Das Mädchen sah sich verwirrt um. Blassblaue, ungemein wache Augen in einem von Runzeln gezeichneten, uralten Gesicht musterten es interessiert. Direkt hinter Konstanze befand sich ein winziger Verschlag, in dem eine Wahrsagerin hockte. Ihre Kleidung hatte sicher schon bessere Tage gesehen. Das Gewand dürfte einmal bunt gewesen sein, war jetzt aber abgetragen, fleckig und zerrissen. Die Alte hielt den verschlissenen Vorhang zur Seite, der zwei Stühle und einen Tisch notdürftig den Blicken der Umstehenden entzog.
»Gib mir einfach die Hand«, lockte die Frau, »und ich lese daraus dein Geschick …«
Konstanze schüttelte den Kopf. »Das kenn ich schon längst …«, murmelte sie, ausnahmsweise froh darüber, dass ihre Zukunft nun wirklich festgeschrieben war. So musste sie nicht zugeben, dass sie der Gabe der Alten misstraute. Konstanze hatte selbst Visionen – und sie wusste, dass längst nicht alles eintraf, was ihr Gott oder seine Engel, oder auch der Teufel und seine Dämonen, am Himmel zeigten.
»Du kennst deine Zukunft?« Die Frau lachte meckernd. »Oder glaubst du nur nicht an Wahrsagerei?«
Während sie die letzten Worte sprach, griff sie rasch nach Konstanzes Hand. Das Mädchen war zu verblüfft, um sie rechtzeitig wegzuziehen. Die Alte hatte sie bereits umgedreht und studierte mit ernstem Gesicht die Furchen und Linien.
»Oh, tatsächlich, dir fehlt es am Glauben an die alten Künste«, kicherte die Vettel. »Aber die Menschen sagen, du seiest gesegnet. Obwohl man deine Gabe auch als Fluch bezeichnen könnte … Wie auch immer … du bist ein kluges Mädchen. Du wirst viel lernen … und Weisheit gewinnen … du bist viel stärker, als du glaubst … und du wirst …«
»Lass ab von dem Mädchen, Weib! Nimm deine dreckigen Finger von ihm!« Philipp von Katzberg hatte jetzt erst bemerkt, wo seine Tochter hineingeraten war. Er schob sich entschlossen durch die Menge auf sie zu. »Und du ergibst dich hier finsterstem Aberglauben, Konstanze!«, rügte er auch das Mädchen, noch bevor er den Stand ganz erreichte. »Wahrsagerei! Das ist deiner nicht würdig!«
Konstanze hätte sich befreien können, aber die Worte der alten Frau hatten sie in ihren Bann gezogen. Woher wusste sie von ihrer Gabe – oder ihrem Fluch? Sie war begierig, Weiteres zu hören, auch wenn sie damit vielleicht eine Sünde beging.
»Habe ich nicht gesagt, du sollst sie loslassen?« Konstanzes Vater riss den Vorhang beiseite und zog die Hand seiner Tochter energisch aus den Fingern der Alten. »Meine Tochter braucht deine Schwarze Kunst nicht. Ihr Schicksal ist vorgezeichnet, sie geht heute noch ins Kloster.«
»Ins Kloster?« Die Gauklerin lachte schallend. Dann wandte sie sich wieder Konstanze zu. »Das ist nicht, was dir bestimmt ist, Kind. Ich sah dich in den Armen eines Königs …«
Das Mädchen riss die Augen weit auf. Dann lächelte es beschämt, da Philipp die Alte erneut beschimpfte. Konstanze raffte die Röcke ihres schlichten, kostbaren Samtkleides, das man extra für diesen Tag gefertigt hatte. Zu weit allerdings für das zarte Kind – aber das war nicht weiter schlimm, denn vom kommenden Tag an würde ihre Schwester Waltraut es tragen. Während sie … Konstanze meinte, die kratzige Klosterkleidung bereits am Körper zu spüren.
Philipp machte Anstalten, seine Tochter fortzuziehen. Konstanze jedoch sah sich noch einmal um. Als ihr Vater nicht hinsah, glitt ihr Kupferpfennig in die Hand der Alten.
Konstanze konnte nicht anders, aber als sie schließlich die Klosterpforte passierten und die Nonnen in ihren schwarzen Habiten zur Kirche streben sahen, fühlte sie sich an Krähen erinnert. Angst beschlich sie, denn Krähen hatten auch ihre letzten Visionen bevölkert. Sollte irgendetwas in ihren Träumen sie vor dem Rupertsberg gewarnt haben? Oder lag es nur an den Märchen, die ihre Großmutter erzählte, Märchen, in denen Krähen die Vorboten des Todes waren?
Eines Nachts hatte Konstanze vor ihrem inneren Auge die Vögel aufs Feld der Schefflers niederschweben sehen – obwohl es dort nachweislich keine Krähen gab. Kurz darauf war die alte Schefflerin gestorben. Für Konstanzes Mutter ein weiterer Beweis der unheimlichen Begabung ihrer Tochter. Andererseits hatten die Dörfler schon tagelang mit dem Ableben der Schefflerin gerechnet. Konstanzes Großmutter, die sich ein bisschen auf Heilpflanzen verstand, war mehrfach bei ihr gewesen. Sie hatte versucht, ihr Leiden zu lindern, indem sie ihr Kräutertränke verabreichte und warme Packungen auf den Leib legte. Aber geholfen hatte das alles nichts – und man brauchte eigentlich keine hellseherischen Fähigkeiten, um den Tod der Frau vorauszusehen.
Konstanze versuchte, nicht an diese letzte Vision zu denken und sie vor allem nicht zu deuten. Das missglückte nach ihren Erfahrungen immer. Besser war es, das Ganze genau so zu erzählen, wie sie es gesehen hatte. Die Erwachsenen fanden dann schon ein Ereignis, zu dem es passte.
Und das Beste war überhaupt zu schweigen. Wenn sie das von Anfang an getan hätte, wäre sie jetzt nicht an diesem Ort. Aber zu Anfang war Konstanze noch sehr klein gewesen und hatte Vision und Wirklichkeit verwechselt. Mitunter verfiel sie auch in Trance, wenn andere Leute dabei waren. Die fragten dann natürlich, was sie gesehen hatte.
Während Konstanze noch grübelte, erschien eine junge Nonne an der Pforte, um das Mädchen und seinen Vater abzuholen. Sie knickste höflich, sah Philipp von Katzberg aber nicht an. Konstanze betrachtete sie dafür umso neugieriger. Ob ihr zweifelhafter Ruhm wohl schon bis ins Kloster gedrungen war?
»Die Ehrwürdige Mutter erwartet Euch«, bemerkte die Nonne. Sie trug einen reinweißen Schleier, der sie als Novizin auszeichnete. »Es wird gleich zur Non läuten. Ihr möchtet Euch beeilen, da Ihr spät seid.«
Nach besonders herzlichem Willkommen klang das nicht. Philipp von Katzberg fühlte sich denn auch gleich bemüßigt, Entschuldigungen auszusprechen. Er ärgerte sich jetzt, seiner lebenshungrigen Tochter den Jahrmarktsbesuch erlaubt zu haben. Konstanze selbst bereute nichts. Sie hatte den Geschmack der Rostbratwürstchen noch auf der Zunge – und auch das innerliche Beben war noch nicht völlig verebbt, das die Worte der Wahrsagerin in ihr ausgelöst hatten.
Ich sah dich in den Armen eines Königs.
Wider alle Vernunft wollte Konstanze an einen schönen, starken Mann in seidenen Kleidern und mit einer goldenen Krone auf dem Haupt glauben – und nicht an den König des Himmels, dem man sie an diesem Tag noch anverloben wollte.
Die Novizin begleitete Konstanze und ihren Vater durch den Klostergarten auf eines der Backsteingebäude zu. Eine weitläufige Anlage – Konstanze atmete auf. Man würde sie also nicht einmauern, wie damals die kleine Hildegard im Kloster Disibodenberg.
Wahrscheinlich war es ganz unsinnig, dass sie immer größere Angst empfand, je näher sie den Räumen der Mutter Oberin kamen. Dies war ein großes, bekanntes Kloster, und Mädchen aus den besten Häusern bewarben sich um die Aufnahme. Schon Hildegard von Bingen hatte nur hochadelige Novizinnen angenommen, und mitunter hatten Kirchenfürsten sie dafür gescholten, dass sie den Frauen ein Dasein in gewissem Wohlstand gestattete. Konstanze erwartete an diesem Ort wahrscheinlich ein besseres Leben denn als Gattin eines Mannes aus dem Ministerialenstand. Sie würde weniger arbeiten müssen als ihre Mutter und Großmutter, sie würde lesen und schreiben lernen, musizieren und handarbeiten. Wobei die Nonnen auf dem Rupertsberg sicher nicht mit kratziger Wolle webten, sondern feinstes Linnen herstellten, das sie dann bestickten.
Konstanze rief sich alles vor Augen, was ihr die Mutter und auch Irmtraud von Aubach, die Gattin des Grafen, vom Leben der Benediktinerinnen erzählt hatten. Und trotzdem … ihr Herz schlug heftig, als die junge Nonne sie nun durch lange Korridore führte und schließlich an eine schwere Eichentür klopfte.
»Ehrwürdige Mutter … der Herr von Katzbach wäre jetzt hier …«
Konstanze verfolgte, wie die Novizin sich zuerst ins Zimmer schob und dort in einen tiefen Knicks versank.
Eine tiefe Stimme antwortete ihr. »Gut, Renate, du kannst dann zur Kirche gehen. Beginnt das Gebet ruhig ohne mich, ich stoße dann zu euch, sobald ich hier fertig bin … Tretet ein, Herr von Katzberg. Ich habe Euch bereits erwartet.«
Philipp von Katzberg schob Konstanze vor sich her in das Zimmer der Oberin, das zu ihrer Verwunderung kaum weniger vornehm ausgestattet war als die Kemenate der Frau von Aubach. Es gab Teppiche, kunstvoll geschnitzte Truhen, ein prasselndes Kaminfeuer, bequeme Stühle mit gedrechselten Beinen – und sogar weiche Kissen. Konstanze bemerkte ein Stehpult, auf dem ein schweres, aufgeschlagenes Buch lag. Sie hätte sich zu gern die Bilder, die ihr in verlockenden Farben und teilweise vergoldet entgegenleuchteten, darin angesehen. Aber vorerst bannte die Äbtissin des Rupertsberger Klosters den Blick des Mädchens. Die Ehrwürdige Mutter thronte aufrecht auf einem hohen Stuhl am Feuer. Sie machte sich nicht die Mühe, aufzustehen, um ihre Besucher zu begrüßen, aber sie ließ immerhin ihre Stickerei, ein kostbares Altartuch, sinken.
Im Licht des Kaminfeuers erkannte Konstanze ein hageres, längliches Gesicht mit hellen, forschenden Augen. Die Haut der Äbtissin wirkte sehr blass, aber vielleicht war das nur der Kontrast zu ihrer tiefschwarzen Ordenstracht, die lediglich durch einen weißen Rand am Schleier aufgelockert wurde.
Die Ehrwürdige Mutter musterte Konstanze aufmerksam. Das Mädchen schien unter ihrem forschenden Blick noch kleiner zu werden, als es ohnehin war. Konstanze merkte nur zu gut, wie abschätzend die Oberin sie betrachtete, wie sie ihr zu großes, und nun auch noch von Reisestaub und Bratwurstfett beschmutztes, zerknittertes Kleid fixierte. Konstanze versuchte ungeschickt, es glattzustreichen.
»Du willst also unseren Herrn Jesus und seine Engel sehen«, bemerkte die Äbtissin mit fragendem Unterton.
Konstanze schüttelte den Kopf. »Nein, Frau … Edle …«
»Mutter!«, half ihr Philipp.
Die Oberin warf ihm einen strafenden Blick zu.
»Ehrwürdige Mutter«, korrigierte sie.
Konstanze holte tief Luft. »Nein, Ehrwürdige Mutter«, erklärte sie. »Ich will sie gar nicht sehen. Aber ich sehe sie. Manchmal …«
»Du willst unseren Herrn nicht sehen?« Die Äbtissin runzelte die Stirn. »Nun, wie auch immer. Bist du sicher, Kind, dass es nicht der Teufel ist, der dich da narrt?«
Konstanze zuckte die Schultern. »Den Teufel sehe ich auch manchmal«, gab sie zu. »Aber unser Herr zermalmt ihn unter seinen Füßen. So wie auf einigen Bildern in der Kirche.«
»Du siehst also nur das, was du aus Bildern in der Kirche kennst!«
Das klang triumphierend, und Konstanze war fast versucht, es einfach zu bejahen. Aber ihr Vater hatte ihr zuvor extra noch gesagt, sie dürfte die Mutter Oberin auf keinen Fall belügen, sondern sollte sie genauso achten wie den Pfarrer in der Kirche. Also schüttelte sie den Kopf.
»Nein, Ehrwürdige Mutter. Ich … ich sehe verschiedene Bilder. Und sie bewegen sich. Also die Engel … und die Heiligen … und die Teufel.«
»Du sagst, der Herr spricht zu dir?«, fragte die Äbtissin.
Konstanze verneinte wieder. »Das nicht. Aber manchmal zeigt er mir Dinge. Oder die Engel …«
»Sie hat von einem Pferd geträumt«, kam Philipp von Katzbach seiner Tochter jetzt zu Hilfe. »Einem sehr schönen Pferd. Und gleich darauf sandte der Bischof von Mainz unserem Herrn von Aubach einen wertvollen Hengst! Und sie träumte von einem gescheckten Kalb – wie weiland die Mutter Hildegard, Gott habe sie selig …«
Hildegard von Bingen hatte ebenfalls schon als Kind Visionen gehabt, und eine der im Volk bekanntesten bezog sich auf ihre genaue Schilderung eines noch ungeborenen Kalbes.
Konstanze hätte dazu einiges sagen können, verriet dann aber lieber nicht, dass sie damals ein weißes Pferd gesehen hatte, während der Bischof von Mainz einen Braunen sandte. Und das Kalb, das sie gesehen hatte, glich dem Bullen aufs Haar, der es gezeugt hatte. Außerdem träumte sie nicht – zumindest nicht mehr als andere Kinder. Die Visionen überkamen sie eher im Wachzustand – oft beim Spinnen oder Weben, oder wenn sie müde war und in die Flammen des Kaminfeuers starrte.
»Es geht hier nicht um Viehzucht, Herr von Katzbach!«, bemerkte die Mutter Oberin. »Es geht um Gott und seine Engel. Das Kind behauptet, berufen zu sein. Wir werden das prüfen!«
Philipp von Katzbach senkte den Kopf. »Das steht Euch frei, Ehrwürdige Mutter. Aber wir alle sind uns sicher, dass Konstanze wahrhaft reinen Herzens ist. Sie lügt nicht, und die Bilder, die sie sieht, sind sicher nicht des Teufels!«
»Man wird sehen«, beschied ihn die Äbtissin. »Ihr könnt Euch jetzt von Eurer Tochter verabschieden. Aber macht nicht zu lange. Sie wird dann mit mir die Messe besuchen.«
Konstanze sah Tränen in den Augen ihres Vaters, als er sie zum Abschied küsste. Und sie hoffte, dass sie wirklich ihr galten, und nicht dem teuren Stoff für das Kleid, das Waltraut nun wohl nicht haben würde. Schließlich machte die Mutter Oberin keine Anstalten, ihre neue Novizin einkleiden zu lassen, bevor sie das Mädchen mit in die Kirche nahm, und sie würde Philipp kaum erlauben, im Kloster zu warten.
Konstanze seufzte. Hätte sie das nur vorausgesehen, dann wäre ihre Gabe wenigstens ein wenig nützlich gewesen!
Herler Burg bei KölnSommer 1206
»Bleibst du denn mein Freund?«, fragte Gisela leise.
Rupert hatte ihr eben ihren Zelter gesattelt, und sie wusste, es war Zeit für den Abschied. Es war besser, Rupert jetzt auf Wiedersehen zu sagen, bevor ihr Vater auftauchte und seinen schweren Rappen bestieg, oder bis gar die Eskorte von zwei Rittern zu ihnen stieß, die sie nach Meißen begleiten würde.
Rupert gab einen unverständlichen Schnaufton von sich. »Sicher …«, nuschelte der Pferdebursche. Es klang nicht, als ob er Gisela jetzt schon vermisste.
»Du wirst doch hier sein, wenn ich zurückkomme?«, fragte sie ängstlich.
Rupert schnaubte erneut. »Wo soll ich schon hingehen?«, murmelte er.
Es klang verärgert oder eher mutlos. Gisela überlegte, ob ihr Freund sie vielleicht beneidete. Rupert war elf Jahre alt, aber er wusste jetzt schon, dass er den Hof ihres Vaters vermutlich nie verlassen würde. Gisela dagegen trat an diesem Tag ihre erste Reise an – ihr Vater brachte sie zur Erziehung an den Hof der Jutta von Meißen. Ein berühmter Hof, der den Zöglingen alle Tore öffnete. Es konnte gut sein, dass Gisela einmal nach Sizilien oder Frankreich verheiratet wurde. Das Mädchen war von hohem Adel, man würde sehen, welche Verbindung seinem Vater in einigen Jahren am besten erschien.
Das hatte jedoch noch Zeit. Gisela war erst acht Jahre alt – sehr jung, um in Pflege gegeben zu werden. Aber in Friedrich von Bärbachs Haushalt gab es keine Frau. Giselas Mutter war bei der Geburt ihrer Zwillingsbrüder gestorben. Die einzigen weiblichen Wesen auf der Burg waren Dienstboten und eine bärbeißige Amme, Ruperts Mutter. Gisela hatte von jeher das Gefühl, dass die alte Margreth sie hasste – was gut möglich war. Rupert, ihr Ältester, war stark und hochgewachsen, aber Giselas Milchbruder Hans war dumm und auch körperlich etwas mickrig geraten. Die Amme mochte das darauf zurückführen, dass ihm Gisela die Kraft geraubt hatte – auf jeden Fall hatte sie den Kindern ihres Dienstherrn nie mütterliche Gefühle entgegengebracht. Und höfische Erziehung war von ihr erst recht nicht zu erwarten. Friedrich von Bärbach hatte folglich seine Entscheidung getroffen: Gisela musste fort.
Das Mädchen selbst schwankte zwischen Abenteuerlust und Angst vor dem Neuen. Vor allem würde es Rupert vermissen. Der Junge war ihm wie ein Bruder. Gisela war ihm schon als kleines Kind wie ein Hündchen nachgelaufen, wenn er aus den Ställen in die Küche kam, um heimlich von dem Honigbrei zu kosten, den seine Mutter für die Kinder des Grafen zubereitete. Gisela liebte seinen Geruch nach Pferden und Heu, und sie fand es aufregend, wenn er sie mit in die Wälder rund um die Burg nahm, mit ihr Kaulquappen fing und Steine nach Eichhörnchen warf. Rupert selbst duldete sie sicher mehr, als er sie liebte, aber auch ihm fehlte es an Spielkameraden, und er sonnte sich in der Bewunderung des kleinen Burgfräuleins.
»Wenn du wiederkommst, wirst du mich gar nicht mehr kennen«, brummte er jetzt, während er letzte Hand an den Sattelgurt ihrer Stute legte. »Wer weiß, ob du überhaupt wiederkommst, vielleicht verheiraten sie dich gleich.«
Gisela seufzte. Das war möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich. »Aber du vergisst mich nicht?«, vergewisserte sie sich.
Rupert schüttelte den Kopf. Dieses halbe Versprechen war das Einzige, woran Gisela sich klammern konnte, als sie schließlich in Begleitung ihres Vaters und seiner Ritter durch das innere Tor der Burg und dann über die Zugbrücke ritt. Heute ging es noch am Rhein entlang bis Köln. Dort wollte von Bärbach sich einer Karawane von Kaufleuten anschließen. Man reiste sicherer in Begleitung, gerade durch die dichten Wälder in Sachsen. Insgesamt würden sie etwa zwanzig Tage unterwegs sein.
Gisela war zunächst etwas bedrückt und ritt wortlos neben ihrem Vater her, aber je weiter sie sich von der Burg entfernten, desto mehr gewann ihre Abenteuerlust die Überhand. In Köln selbst konnte sie sich schließlich vor Staunen kaum halten ob der riesigen Kirchen, des Marktes auf dem Domplatz und der vielen Kaufleute und Pilger aus aller Herren Länder.
Arno Dompfaff, der Handelsherr, dessen Gruppe man sich anschloss, erwies sich obendrein als gesprächig und umgänglich. Er war selbst Vater von zehn quirligen Kindern und fand das kleine Fräulein, das seine Reise mit tausend Fragen begleitete, entzückend. Hannes ritt lieber neben der vergnügten Gisela her als neben den ernsten, anderen Kaufleuten – Letztere meist Juden, die ohnehin den Eindruck erweckten, bevorzugt unter sich zu sein.
Gisela sonnte sich in seiner Aufmerksamkeit und genoss die Reise. Das lange Reiten machte ihr nichts aus. Ihr Pferd ging weich und lebhaft voran, und sie saß fest im Sattel. Das Mädchen wäre auch ohne Sitzkissen zurechtgekommen, denn mit Rupert hatte Gisela oft auf dem blanken Pferderücken des Schlachtrosses ihres Vaters gesessen und den riesigen Rappen zur Schwemme geritten. Friedrich von Bärbach wusste natürlich nichts davon. Manchmal lenkte seine Tochter sogar eines der Streitrosse über die Bahn, auf der die Ritter fürs Turnier übten. Die Pferde gingen dabei stets brav wie die Lämmchen. Gisela hatte Geschick im Umgang mit Tieren. Sie freute sich schon auf die Falkenjagd.
So vergingen die Wochen der Reise schnell, zumal sich die Befürchtungen ihres Vaters nicht bewahrheiteten. Raubritter und Gauner, die Reisenden gern auflauerten, schreckten vor der Größe der Karawane zurück, mit der immer drei Fernhandelskaufleute mit ihren Planwagen zogen, dazu einige kleinere Krämer und ein paar Pilger auf der Heimreise von ihrer Wallfahrt ins heilige Köln. Selbstverständlich reisten die Händler nicht ohne Eskorte. Der Trupp wurde von insgesamt dreißig schwer bewaffneten Reitern begleitet.
Gisela trennte sich ungern von ihren Reisegefährten, als sie Meißen schließlich erreichten und Friedrich von Bärbach die gewaltigen Burgen auf dem Albrechtsberg ansteuerte. Arno Dompfaff und die anderen Händler ritten derweil weiter in die Stadt. Das Mädchen tröstete sich ein bisschen mit dem Haarreif aus Emaille, den Dompfaff ihm zum Abschied schenkte.
»Das Grün passt zu Euren Augen, Fräulein. Passt auf, Ihr werdet allen Rittern auf der Burg den Kopf verdrehen!«, lachte der Kaufmann und winkte Gisela nach. Auch ihm schien der Abschied schwerzufallen.
Friedrich von Bärbach schien dagegen froh, die Gesellschaft der städtischen Krämer und Pilger verlassen zu können. »Jüdisches Pack«, murmelte er, als sie den Burgberg hinaufsprengten. »Und christliche Gauner, die den Kopf zu hoch tragen, weil sie sich in ihren Städten ›Bürger‹ nennen dürfen. Letztlich alle ihren Grundherren entlaufen …«
Gisela sagte nichts dazu. Ihr Vater hielt nicht viel von den Magistraten in Köln und Mainz, aber sie verstand nicht warum, und es war ihr auch egal. Sie fieberte der ersten Begegnung mit ihrer neuen Ziehmutter entgegen. Ob sie streng und böse mit ihr sein würde wie die Amme? Sollte sie den neuen Haarreif tragen, oder würde ihr das als Hoffart ausgelegt?
Dann erwiesen sich jedoch all ihre Befürchtungen als grundlos. Während der Truchsess des Burgherrn ihren Vater und seine Ritter im Burghof willkommen hieß und ihnen einen Schluck edelsten Weines kredenzte, erschienen zwei fröhliche, für Giselas Augen fast festlich gekleidete Mädchen, um die Kleine in Empfang zu nehmen.
»Oh, sie ist hübsch!«, gurrte die eine. »Das wird die Herrin freuen!«
»Aber wir sollten sie noch umkleiden. Vielleicht auch ein Bad nach der langen Reise«, plapperte die andere.
Ehe Gisela noch ganz begriff, wie ihr geschah, hatten die Mädchen sie in eine gut geheizte Kemenate geführt, in der schon ein Waschzuber auf sie wartete. Sie seiften sie lachend ein und ergingen sich in Schmeicheleien über ihr seidiges blondes Haar und ihre großen grünen Augen.
»Wir müssen das Haar in Eigelb spülen, dann glänzt es noch mehr!«, riet Hiltrud, die Jüngere, und Luitgard, die Ältere, suchte ein leichtes leinenes Unterkleid und eine Surkotte aus grasgrüner Seide aus einer der Truhen. Keines der Mädchen machte Anstalten, Giselas eigene Kleidung auszupacken. Das würden die Mägde später tun. Vorerst bedienten sie sich aus der offenbar unerschöpflichen Kleidersammlung des Hofes.
»Jetzt bist du schön!«, erklärte Hiltrud, als Gisela schließlich mit offenem glänzendem Haar, geschmückt mit dem Emaillereif, und in dem neuen Kleid vor ihr stand. »Nur den Saum sollten wir noch umlegen, damit du nicht darüber stolperst.«
Die Mädchen steckten den Rock mit Fibeln provisorisch fest und führten Gisela dann stolz wie eine frisch angekleidete Puppe die Stufen des Söllers hinunter. Der Weg führte zunächst durch einen Küchengarten und dann in den weitläufigen Burggarten. Es gab bunte Blumenrabatten, riesige Bäume, die Schatten spendeten, und überall hörte man fröhliche Stimmen und das Lachen von Mädchen und jungen Rittern, die sich vergnügten.
Jutta von Meißen erwartete ihr neues Ziehkind im Rosengarten. Sie saß in einer Laube, umgeben von einem Meer von Blüten und in einem Kreis jüngerer und älterer Mädchen und Frauen. Ein Spielmann unterhielt sie mit Lautenspiel und Gesang.
»Frau Jutta? Hier ist Gisela von Bärbach«, stellte Luitgard eifrig vor und schob Gisela vor ihre Pflegemutter.
Jutta von Meißen war in feines Tuch gewandet. Sie trug eine weinrote Surkotte, unter der ein dunkelgrünes Unterkleid hervorschimmerte, dazu einen goldenen Gürtel. Die Farbe ihres Haares konnte man nicht erkennen, sie versteckte es züchtig unter einem Gebende aus feinstem Leinen, aber ihre nussbraunen Augen musterten Gisela mit Wärme.
»Lass dich willkommen heißen, meine Kleine!«, sagte sie huldvoll. »Ach was, komm her und gib mir einen Kuss. Es wird mir eine Freude sein, ein so kleines Ding bei mir zu haben, fast wie eine Tochter … Du magst meinem Kind eine Gespielin sein!«
Gisela erkannte jetzt, dass Jutta von Meißen gesegneten Leibes war, und lächelte ihr zu. Sie nahm ihren leichten Rosenduft wahr, als sie weisungsgemäß ihre Wange küsste. Aber Jutta von Meißen umfing sie mit ihren Armen und küsste sie auf den Mund.
»Und wie hübsch du bist! Herr Walther, ist sie nicht eine kleine Schönheit?« Frau Jutta wandte sich an den Spielmann, einen vierschrötigen, rotgesichtigen Mann, dessen kräftigen Fingern man kaum zutraute, so geschickt die Laute zu schlagen. »Dies ist Herr Walther von der Vogelweide, Gisela. Er erweist uns die Ehre, uns zu zerstreuen.«
»Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, Herrin!«, bemerkte der Spielmann. »Und es wird mich freuen, dieser neuen Zierde Eures Hofes ein paar Verse zu widmen.« Er verneigte sich in Richtung Giselas.
Jutta lachte und drohte ihm mit dem Finger. »Aber nicht zu schlüpfrige, Herr Walther! Man kennt Eure Neigung zur Derbheit. Erschreckt mir nicht diese kleine Blüte, die erst noch zur Rose heranwachsen muss.«
Gisela hörte aufmerksam zu, obwohl ihr all das Getändel und die Schmeicheleien schnell zu viel wurden. Dies war zweifellos höfisches Benehmen, aber Gisela lag anderes am Herzen.
Und warum sollte sie sich nicht trauen? Die Markgräfin schien schließlich überaus freundlich. Gisela holte tief Luft. »Und wo sind die Falken?«, fragte sie aufgeregt.
VisionenFrühjahr 1212
Kapitel 1
Konstanze trug ihren Korb über die Blumenwiese zum Waldrand. Er war jetzt schon zur Hälfte mit verschiedenen Pflanzen, Blüten und Kräutern gefüllt, denen Hildegard von Bingen Heilkräfte zugeschrieben hatte. Die Schwestern sammelten sie regelmäßig und stellten daraus Elixiere, Salben und Tees her – auch wenn Konstanze nicht von jedem der Rezepte überzeugt war. Mitunter widersprachen die Angaben der Klostergründerin über die Wirkung der Essenzen dem, was das Mädchen viel älteren Aufzeichnungen in Latein und Griechisch entnahm.
Die Klosterbibliothek enthielt verschiedene, fast vergessene Schriften berühmter Ärzte wie Hippokrates und Galen. Allerdings interessierte sich kaum eine der Nonnen für diese verstaubten Codices, die oft nicht einmal gebunden, sondern in Schriftrollen vorlagen. Es gab zwar hochgelehrte Frauen unter den Schwestern – die Benediktinerinnen fertigten sehr korrekte Abschriften lateinischer und griechischer Texte und verstanden durchaus, was sie da kopierten –, die meisten von ihnen verfügten jedoch nicht über den Wissensdurst ihrer Klostergründerin.
Hildegard von Bingens Forscherdrang war legendär, und oft genug beschäftigten sich die Schreiberinnen im Kloster auch mit der Kopie ihrer Briefe und Abhandlungen. Dabei wurden die Ergebnisse der Prophetissa Teutonica, der teutonischen Seherin, wie man sie auch nannte, allerdings nie kritisiert oder gar nachgeprüft – nur Konstanze fragte sich manchmal, was davon zu halten war. Viele »Erkenntnisse« der Mystikerin beruhten auf Visionen statt auf Erfahrungen, und die Schriften der alten Meister hatten sich der Klosterfrau schon deshalb nicht erschlossen, weil sie kein Latein und erst recht kein Griechisch lesen konnte.
Konstanze vertiefte sich lieber in die geheimen Schätze der Bibliotheken, als sich mit dem Wissen um die Heilkräfte von Edelsteinen zu belasten oder Tierherzen zu Pulver zu zermahlen, um damit Herzleiden bei Menschen zu behandeln. Natürlich durfte sie das niemandem erzählen – sie galt ohnehin schon als renitent und absonderlich, und wäre sie nicht so klug und geschickt im Bereich der Medizin gewesen, so hätte man sie wahrscheinlich nie aus den Klostermauern heraus und allein in die Felder und Wiesen gelassen.
Konstanze atmete die frische Luft tief ein und genoss die Düfte des Frühlings. Sie dachte noch mit Grauen an die ersten Jahre im Kloster, in denen es ihr fast nie erlaubt worden war, ihre Zelle, die Studierzimmer und die Kirche zu verlassen. Zwar hatte man sie nicht eingesperrt, aber es kam mehr oder weniger auf das Gleiche hinaus: Die Novizin Konstanze von Katzbach stand unter ständiger Beobachtung – und ihre Meisterinnen waren alles andere als wohlwollend. Dabei wusste Konstanze bis jetzt nicht, was sie damals falsch gemacht hatte.
Die anderen Mädchen hatten sie anfangs argwöhnisch beäugt, weil sie nicht von hohem Adel war. Unter sich protzten die Novizinnen auf ganz weltliche Weise mit den Gütern ihrer Väter und der Mitgift, die sie ins Kloster eingebracht hatten. Ihre Tracht war aus feinstem Tuch, während Konstanze nur der eher schlichte Stoff zugeteilt wurde, den auch die Laienschwestern in der Küche und im Garten trugen. Die Mädchen lachten über sie, weil sie manche Fertigkeiten nicht beherrschte, die man den hohen Fräulein schon als Kindern beigebracht hatte. Konstanze war im Haushalt eines Bauern groß geworden: Sie konnte melken, weben und einen Küchengarten betreuen. Sticken oder Laute spielen hatte sie nie gelernt.
Natürlich wusste jeder von ihren Visionen und brannte darauf, daran teilzuhaben. Besonders am Anfang hoffte man auf zukunftsweisende Offenbarungen, aber hier hatte Konstanze mehrmals versagt. Die Schwestern, vor allem die Äbtissin, deuteten die Bilder nicht so wohlgesonnen wie die Menschen in Konstanzes Heimatdorf. Eher stellte man endlose Fragen, ließ das Mädchen die Visionen immer wieder beschreiben und suchte nach möglichen Verbindungen zu höllischen Mächten.
Konstanze wurde Anmaßung vorgeworfen, und man beschuldigte sie, sich hoffärtig in den Vordergrund stellen zu wollen. Dabei wäre es ihr recht gewesen, hätte man sie einfach in Ruhe gelassen. Sie wollte diese Visionen nicht und war nicht stolz darauf, aber im Kloster stellten sie sich noch häufiger ungefragt ein als zuvor in ihrem Dorf. Kein Wunder, die endlosen Gebete, der immer gleiche Ablauf der Messen, Gesänge und Lesungen waren gähnend langweilig. Konstanzes wacher Geist schweifte dann leicht ab, und wenn er sonst nichts fand, mit dem er sich beschäftigen konnte, schlich sich schnell eine der unwillkommenen Visionen ein. Sie sah Engel, die den Chor der Nonnen verstärkten, nachdem sie sich auf einer goldenen Leiter vom Himmel herabgehangelt hatten. Zu Pfingsten beobachtete sie den Herrn Jesus segnend über die Felder gehen, gefolgt von einer Schar fröhlich tanzender Engel, und als sie zitternd vor Kälte in der ungeheizten Kirche die Christmette verfolgte, sah sie Maria und Josef – ebenso frierend – bei der Herbergssuche. Dabei wusste sie zu dieser Zeit schon lange, dass die beiden wahrscheinlich gar nicht gefroren hatten. Im Heiligen Land war es im Dezember nicht allzu kalt.
Konstanze empfand allein bei dem Gedanken an die Ehrwürdige Schwester Maria ein warmes Gefühl. Die Klosterärztin war die Einzige, die sie in den ersten Jahren nach dem Eintritt freundlich behandelt hatte. Selbst dann noch, als sie hinter ihre Schwindeleien kam.
Denn irgendwann hatte die kleine Konstanze angefangen, ihre Mitschwestern schamlos zu belügen. Sie war es einfach leid gewesen, dass man sich über ihre Erscheinungen lustig machte, weil tanzende Engel und frierende Gottesmütter so gar nicht zu den hehren Visionen der Hildegard von Bingen passten. Der Prophetissa Teutonica hatten sich schließlich wahre Wunderdinge rund um den Lauf von Sonne und Mond, die Heilkunst und die Musik erschlossen – während Konstanze bislang nichts zu Glaube und Lehre beitrug.
Eines Tages wurde ihr jedoch im Unterricht der Schwester Maria bewusst, dass sie in Bezug auf Heil- und Gewürzpflanzen über deutlich mehr Kenntnisse verfügte als die anderen Novizinnen und die meisten Nonnen. Sie verdankte das nicht Gott, sondern ihrer kräuterkundigen Großmutter – aber irgendwann ritt sie der Teufel, und sie behauptete, ein Engel habe ihr in einer Vision erzählt, dass Salbei gegen rauen Hals hülfe und Beinwell Schmerzen lindere! Zu Konstanzes Überraschung glaubten die meisten ihrer Mitschwestern jedes Wort – nur die Mutter Oberin blieb skeptisch. Schließlich enthüllte Konstanze da ja nichts wirklich Neues. Aber das Mädchen war schon damals die beste unter den Klosterschülerinnen, wenn es um die Kenntnis der alten Sprachen ging, und schließlich entdeckte es die ersten vergessenen Handschriften in der Bibliothek.
Konstanze studierte sie aufgeregt, und von da an verrieten die »Engel« der kleinen Novizin die Kardinalszeichen der Entzündung und Rezepte zur Entwässerung des Körpers. Die Äbtissin war endlich beeindruckt!
Konstanze begann dann auch bald, gezielt nach Mitteln gegen Krankheiten zu suchen, die im Kloster grassierten. Aber eines Tages, als sie gerade ein Werk des Hippokrates auf die Linderung von Augenkrankheiten hin durchforstete, da eine alte Mitschwester langsam der Sehkraft beraubt wurde, erschien Schwester Maria hinter ihrem Stehpult.
»Darin wirst du die Antwort nicht finden«, sagte sie freundlich, als das Mädchen die griechische Schriftrolle erschrocken wegsteckte, »sie steht hier.«
Damit wies sie auf einen der Codices in den obersten Regalen der Büchersammlung. Hier langte niemand hinauf, und folglich wurden die dort aufbewahrten Schriften auch selten gelesen.
»Du müsstest allerdings eine weitere Sprache erlernen, um sie entziffern zu können«, fügte die Schwester lächelnd hinzu.
Konstanze, zu verblüfft, um sich ertappt zu fühlen, sah genauer hin. »Aber das ist … das ist die Sprache der Sarazenen …«, bemerkte sie, als sie die seltsame, völlig unleserliche Schrift besah, die Blütenranken ähnelte.
Die Schwester lächelte. »Die Gott in seiner unerforschlichen Weisheit physisch genauso geschaffen hat wie die Franken«, bemerkte sie. »Weshalb man ihre Heilkunst denn auch durchaus übertragen kann.«
»Aber … ich dachte … sie sind Heiden«, stotterte Konstanze.
»Das war der hier auch!«, erklärte die Medica und zeigte auf Hippokrates’ Lehrwerk. »Hippokrates schwor seinen ärztlichen Eid auf Apollon, von Jesus Christus hatte er nie gehört. Wie auch, unser Erlöser war zu seiner Zeit noch nicht einmal geboren.« Schwester Maria bekreuzigte sich, als sie den Namen Jesu erwähnte.
»Und Ihr meint, da stünde mehr über … Heilmittel?«, fragte Konstanze und schaute begehrlich auf den Codex über ihr. »Über solche, die man hier … nicht kennt?«
Die Schwester lachte. »O ja, die Engel könnten dir da noch manches offenbaren«, sagte sie spöttisch.
Konstanze errötete zutiefst. »Ihr … Ihr wisst …? Und Ihr … habt mich nicht verraten?«
Die Medica schüttelte den Kopf. »Nein. Warum auch? Die Engel haben dir ja nichts Falsches erzählt – schade nur, dass sie sich unserer hochverehrten Prophetissa nicht schon mit diesen Erkenntnissen genähert haben. Ich hätte in den letzten Jahren manche Krankheiten besser behandeln können.«
Konstanze bemühte sich zu begreifen. »Also habt Ihr … all das gewusst, was hier steht?« Sie zeigte auf die Werke von Hippokrates und Galen. »Aber Ihr …«
»Ich behandle meine Patienten auf der Grundlage der medizinischen Erkenntnisse unserer Klostergründerin Hildegard – die zweifellos über ein großes Grundlagenwissen verfügte, das sie für die Nachwelt niedergeschrieben hat. In unserer eigenen Sprache. Es ist also vielen Menschen zugänglich, und sie hat sich damit sicher verdient gemacht vor Gott und seiner Schöpfung. Aber neu war das nicht. Und besonders die Dinge, die der Prophetin von den Engeln offenbart wurden … Hm, ich würde sagen … du hast da die kundigeren Engel!«
Konstanze verstand und lächelte verschämt. Allerdings warf jede Antwort, die Schwester Maria gab, neue Fragen auf.
»Und Ihr könnt auch das lesen?«, erkundigte sie sich und wies auf die arabischen Codices. »Wo habt Ihr das gelernt?«
Maria zog sich eine Leiter heran, kletterte hinauf und holte eine der Schriften herunter. »Das habe ich schon als Kind gelernt«, erklärte sie und fuhr über den Einband der Schrift, die sie dann vorsichtig auf das Pult vor Konstanze legte. »Im Heiligen Land. Es ist meine Muttersprache.«
Konstanze war jetzt völlig verwirrt. Fragend sah sie der Medica in die Augen. Kohlschwarze Augen und ein dunkles Gesicht. Bisher war ihr nie aufgefallen, welch ungewöhnliche Erscheinung die Schwester war. Man achtete hier kaum auf das Äußere, das schwarze Habit glich alle einander an. Aber Schwester Maria sah tatsächlich nicht aus, als habe ihre Wiege im Rheinland gestanden.
»Ich wurde in Akkon geboren«, erklärte sie gelassen. »Als Tochter eines sarazenischen Fürsten. Mein richtiger Name ist Mariam al-Sidon. Als die Stadt von den Franken erobert wurde, ergab sich mein Vater, und mein Bruder und ich kamen als Geiseln an einen teutonischen Hof. Ich wuchs dort auf, wurde christlich erzogen – und als ich heimkehren und verheiratet werden sollte, weigerte ich mich. Stattdessen ging ich ins Kloster. Mein Bruder kehrte zurück ins Heilige Land – ich habe nie wieder von ihm gehört. Und auch nicht von meiner sonstigen Familie. Aber meine Sprache ist mir geblieben … Schau, dies ist eine Schrift von Abu Ali al-usayn ibn Abd Allah ibn Sina – die Franken nennen ihn Avicenna.«
Konstanze interessierte sich jetzt nicht mehr so sehr für die Schriften. Schwester Marias Geschichte erschien ihr fesselnder als die Medizin.
»Aber … aber warum wolltet Ihr denn nicht heiraten?«, brach es aus ihr heraus. »Warum habt Ihr … das hier … vorgezogen?«
Die Medica lächelte – fast ein bisschen wehmütig.
»Mein Vater wollte mich nach Alexandria verheiraten. An einen muslimischen Hof. Ich hätte also meinen alten Glauben wieder annehmen müssen – jedenfalls, wenn ich als geehrte erste Gattin in den Harem meines Herrn eintreten wollte, und nicht als Konkubine!«
Konstanze musterte die Schwester mit ganz neuer Ehrfurcht. Sie war die erste zum Christentum bekehrte Muslimin, die ihr begegnete. Bisher hatte sie nur von Kreuzzügen und fränkischen Märtyrern gehört, die sich für Christus aufopferten. Schwester Maria hatte sogar der Ehe entsagt …
»Ich fürchtete mich vor dem Harem«, gestand die Medica. »Meine Pflegemutter schilderte ihn mir wie ein Abbild der Hölle – obwohl ich mich gar nicht an so Schreckliches erinnerte, schließlich wurde ich in einem Harem geboren. Aber ich glaubte meiner Pflegemutter und den Priestern, ich wollte nicht eingesperrt irgendwo in einem Frauengemach leben.« Schwester Maria lächelte. »Und nun frage ich mich manchmal, wo der Unterschied liegt zwischen dem Leben, das ich ablehnte, und dem, das ich führe … aber das grenzt an Ketzerei, Kleines, das hast du nicht gehört! Genau wie ich nichts von den Hintergründen deiner Visionen weiß. Willst du jetzt lernen, wie man diese Codices liest?«
Konstanze zögerte. »Könnt Ihr es mir nicht einfach sagen, was ich wissen möchte, Ehrwürdige Schwester?«, fragte sie. »Ich meine, wenn Ihr doch Kenntnis darüber habt, wie man diese Augenkrankheit heilt …«
Schwester Maria seufzte. »Ach Kind, diese Krankheit … es gibt ein Mittel, aber es ist eine chirurgische Maßnahme: Man muss in das Auge hineinstechen. Ich würde mir das nicht zutrauen, und ich würde deinen Engeln auch nicht raten, es vorzuschlagen. Schließlich können wir uns nicht mit den Badern auf Jahrmärkten gleichstellen – auch wenn die manch altes Wissen bewahrt haben. Also, vergiss die Augen von Schwester Benedicta. Aber du kannst hier etwas über andere Heilmittel erfahren. Wahrscheinlich mehr als das Wenige, an das ich mich erinnere. Es ist lange her, seit ich diese Bücher studiert habe, Mädchen. Und du hast jüngere Augen.«
Von da an unterrichtete die Schwester aus dem Heiligen Land das Mädchen vom Rhein in ihrer Sprache. Und in Konstanzes »Visionen« schlichen sich immer mehr Offenbarungen aus dem Orient ein, entnommen den Schriften von Ar-Razi oder Ibn Sina.
Während sie so zur anerkannten »Seherin« aufstieg, ließen Konstanzes tatsächliche Visionen im Laufe der Jahre nach. Jetzt, mit sechzehn, empfing sie kaum noch Bilder und war heilfroh darüber. Auch die Hänseleien der anderen Novizinnen waren mit der Zeit verstummt. Konstanze galt als designierte Nachfolgerin Schwester Marias in der Klosterapotheke, und sie war damit nicht unzufrieden. Im kommenden Jahr würde sie ihre Gelübde ablegen und konnte sich dann noch intensiver der Medizin und Krankenpflege widmen.
Das junge Mädchen sagte sich immer wieder, dass es Gott für dieses Leben danken sollte, das da wie ein leicht lesbares Buch vor ihm aufgeschlagen lag. Außerhalb des Klosters hätte Konstanze niemals Sprachen erlernt, die Welt der Bibliotheken wäre ihr verschlossen geblieben, und sie hätte sehr viel härter im Haushalt arbeiten müssen. Auf dem Rupertsberg wurden die Novizinnen nur zu kleinen Helfertätigkeiten herangezogen, die Schwestern widmeten sich lediglich ihren speziellen Aufgabenbereichen in der Kirche und in den Studier- und Schreibstuben. Sie lebten recht angenehm, verwöhnt von Laienschwestern, deren Rang nicht weit über dem von Dienstboten stand, finanziert durch die Spenden adeliger Damen, die das Kloster großzügig alimentierten. Das Essen war reichlich und gut, die Kleidung kam sauber und ordentlich aus der Klosterwäscherei. Verglichen mit dem Leben ihrer Mutter und Großmutter war dies das Paradies – aber Konstanze konnte sich nicht helfen: Sie hasste jeden einzelnen Tag, den sie im Kloster verbringen musste!
Das Mädchen schalt sich dieser Gedanken, während es wilden Bärlauch entdeckte, pflückte und der Kräutersammlung beifügte. Je näher das Ablegen ihrer ewigen Gelübde rückte, desto häufiger drängte sich Konstanze der Wunsch nach Freiheit auf, die Sehnsucht danach, hinaus in die Natur zu gehen, ohne vorher eine Erlaubnis dafür einzuholen. Oder einmal, ein einziges Mal nur, eine Nacht durchzuschlafen, statt kurz nach Mitternacht zur Vigil geweckt zu werden und im Halbschlaf die immer gleichen Gebete zu sprechen! Nach Konstanzes Auffassung hatte Gott die Nacht geschaffen, um seinen Geschöpfen Ruhe zu gönnen. Sie empfand es fast als Frevel, dieses Geschenk zurückzuweisen – auch wenn es nur dazu geschah, dem Herrn zu huldigen.
Konstanze sehnte sich zudem nach dem Gespräch mit anderen Menschen – die kleine Frauengemeinschaft im Kloster war ihr nicht genug. Sie hätte sich auch gern einmal wieder mit Männern unterhalten! Dabei glaubte sie nicht, dass dieser Wunsch auf Lüsternheit basierte, wie ihr die Mutter Oberin vorwarf, wenn es ihr wirklich einmal gelang, ein paar Worte mit dem Priester zu wechseln, der auf dem Rupertsberg die Messe las.
Tatsächlich fühlte sie sich weder zu ihm noch zu ihrem Beichtvater oder einem der anderen, ihr vage bekannten Mönche hingezogen. Sie träumte nie davon, von ihnen geküsst oder umarmt zu werden. Aber sie hatte die Korrespondenz der Hildegard von Bingen mit Männern wie Bernhard von Clairvaux studiert. Sie hatte die Schriften der Ärzte und Philosophen gelesen. Konstanze sehnte sich nach Austausch. Sie hätte ihre Gedanken gern mit Menschen geteilt, deren Horizont weit über die Klostermauern von Rupertsberg hinausging. Und wenn sie manchmal auch von einem Ritter träumte, der sie anlächelte und in die Arme nahm … so waren das sicher nur kleine Versuchungen des Teufels, über die sie leicht hinwegkommen würde, wenn man sie nur ließe!
Tatsächlich gab es nur ein einziges männliches Wesen, mit dem Konstanze außerhalb des Klosters Umgang pflegte. Und hier hatte sie sich in Sachen Lüsternheit nichts vorzuwerfen. Peterchen, ihr kleiner Freund, war schließlich höchstens zehn Jahre alt. Genau wusste er das nicht, seine Eltern gehörten zum Gesinde eines Außenwerks des Klosters und konnten nicht lesen und schreiben. Die Jahre zählten sie höchstens nach der Anzahl ihrer Kinder – Peterchens Mutter brachte so ziemlich in jedem Jahr ein neues Kind zur Welt.
Peter war ihr Ältester und hatte bereits wichtige Aufgaben im Dorf: Er hütete die Schafe, deren Wolle später zwar nicht das feine Tuch für die Gewänder der Schwestern, aber doch den Grundstoff für die Kleider der Knechte und Laienschwestern lieferte. Im Winter trieb er die Tiere tagtäglich hinaus, damit sie auf den kargen Weiden eine Futterergänzung zum spärlich vorhandenen Heu fanden, und im Sommer lebte er mit ihnen draußen und wanderte von einem Weidegrund zum anderen.
Konstanze traf den Knaben und seine Herde fast jedes Mal, wenn sie zum Kräutersammeln in Wald und Flur ging, und es gefiel dem oft gelangweilten Kind, ihr dabei zu helfen. Inzwischen überraschte Peterchen sie meist schon mit einem Sträußlein Blüten und Gräser, und oft trocknete er seine Ausbeute gleich für sie in der Sonne. Als Gegenleistung pflegte Konstanze ihm kleine Köstlichkeiten aus der Klosterküche mitzubringen.
Auch an diesem Tag hatte sie ein paar Krapfen stibitzt und hielt sie in ihrem Korb für den Jungen bereit. Peterchen war eigentlich immer hungrig. Sein Vater brachte die große Familie nur mit Mühe durch und erwartete von dem kleinen Schäfer, dass er sich zumindest teilweise selbst verpflegte. Peterchen stellte denn auch pflichtschuldig Fallen für Kleingetier auf, aber in seine Schlingen verirrte sich nur selten ein Hase, und auch mit der Schleuder hätte der Junge keinen Goliath besiegt. Peterchen war ein schmächtiges Kind – und die karge Kost sowie die oft kalten Nächte, die er im Sommer mit den Tieren auf der Weide verbrachte, trugen nicht dazu bei, ihn zu stärken.
Konstanze wunderte sich, warum er noch nicht aufgetaucht war. Sie lief seit bald einer Stunde über einladend grüne Wiesen, und im Allgemeinen entwickelte Peterchen eine Art sechsten Sinn dafür, wann und wo sie ihrer Arbeit nachging. Für ihn war ihr Besuch schließlich eine ebenso willkommene Abwechslung wie der Ausflug für sie, und er liebte es, mit ihr zu plaudern, während er die mitgebrachten Leckereien mit vollen Backen kaute. Konstanze brachte es nie übers Herz, ihn dafür zu rügen. Niemand erwartete höfische Umgangsformen von einem Bauernkind.
An diesem Tag fehlte von Peter jede Spur, und Konstanze begann irgendwann, sich Sorgen zu machen. Womöglich war der Kleine ja krank oder verletzt, und niemand hatte etwas gemerkt. Solange die Schafe nicht verloren gingen, kümmerte sich keine Seele um den jungen Hirten. Das Mädchen warf einen prüfenden Blick in den Himmel. Die Sonne stand bereits hoch, und es sollte zur Non zurück im Kloster sein.
Die Kräuter, die sie suchte, mussten nach Ansicht der Hildegard von Bingen um die Mittagszeit gepflückt werden. Später verlören sie angeblich ihre Wirkstoffe. Konstanze hielt das für Aberglauben, hatte aber die strikte Auflage von Schwester Maria, sich daran zu halten. Die Medica wollte keinen Ärger – soweit wie möglich, hielt sie sich an die Vorgaben der Klostergründerin. Konstanze hatte getan wie ihr geheißen, konnte sich aber nicht dazu entschließen, den Heimweg anzutreten. Der Gedanke an Peter ließ sie nicht los.
Sie kannte den Unterschlupf des Kleinen. Er hatte ihr einmal gezeigt, wo er gewöhnlich schlief, wenn er nachts bei den Tieren blieb. Der Platz war klug gewählt, es gab dort ein paar Felsen, die nah beieinanderstanden. Wenn man einen Mantel darüberbreitete, hatte man ein wenig Schutz vor Regen und Wind. Natürlich fehlte dem Kind dann der Mantel, aber der Junge besaß ein Schaffell, mit dem er seine Höhle auspolsterte und auf dem er sich zusammenrollte. Wenn Konstanze dem Bach folgte, der fröhlich zwischen den Wiesen hindurchplätscherte, war sie in kurzer Zeit in Peters Lager. Sie konnte nach ihm sehen und ihre Krapfen abliefern – Konstanze beschloss, dass diese Handlung unter Almosen fiel. Es war sicher keine Sünde, dafür ein Stundengebet ausfallen zu lassen.
Tatsächlich traf das Mädchen bald auf die ersten Schafe, als es sich Peters Unterschlupf näherte. Die Tiere grasten weit verstreut – Peter hielt sie offensichtlich nicht zusammen, und auch sein struppiger Hund war nicht bei der Arbeit. Konstanze erkannte darin ein weiteres Alarmzeichen und lief schneller.
Dann aber sah sie ein munter flackerndes Feuer vor Peters Lager. Der Kleine war also da und musste am Leben sein. Konstanze atmete auf.
Und schließlich begrüßte sie auch der Hütehund, der mit Peter seinen Unterstand teilte. Er bellte, kam aber nicht heraus. Den Grund dafür erkannte das Mädchen schnell, als es die improvisierte Hütte endlich erreichte. Peter lag zusammengekrümmt in der hintersten Ecke des Unterstands und hielt das Tier umklammert.
»Peterchen, was ist denn? Fehlt dir etwas?« Konstanze musste niederknien, um in die Hütte hineinsehen zu können. Sie erkannte, dass der Kleine zitterte. »Bist du krank, Peter?«
Peter kam nicht heraus, schüttelte aber den Kopf.
Konstanze setzte sich vor dem Unterstand ins Gras und wartete.
»Nun, wenn du nicht krank bist, willst du ja vielleicht einen von diesen Krapfen essen«, bemerkte sie schließlich und packte ihren Korb aus. »Aber wenn du keinen Hunger hast … dann ess ich ihn allein.«
Sie machte Anstalten, in das Gebäck zu beißen, woraufhin immerhin der Hund winselte und Anstrengungen machte, Peters Griff zu entkommen. Auch er mochte Krapfen, und Peter war immer bereit, die Leckereien mit seinem einzigen Freund und Vertrauten zu teilen. Vom Duft der Krapfen angelockt, krochen letztendlich beide aus der Hütte.
Konstanze registrierte erleichtert, dass Peterchen wirklich nicht krank wirkte – allerdings eingeschüchtert und verängstigt bis ins Mark.
»Was ist dir denn geschehen, Junge?«, fragte sie noch einmal und strich dem Kind über sein wirres, schmutziges Haar.
Peter saß jetzt neben ihr und schlug ausgehungert die Zähne in den ersten Krapfen. »Ich … ich hab den Herrn gesehen«, stieß der Kleine hervor, wie immer ohne das Kauen dabei einzustellen.
»Du hast was?«, fragte Konstanze.
»Ich hab … den Herrn gesehen. Und … und die Sterne sind vom Himmel gefallen. Was ein Zeichen ist, hat er gesagt.«
Konstanze lächelte. »Es sind ein paar Sternschnuppen gefallen in den letzten Nächten«, erklärte sie. Das Phänomen war den Nonnen auf dem Kirchgang nicht entgangen, und tatsächlich wurde auch auf dem Rupertsberg darüber spekuliert, was Gott damit ankündigen wollte. »Aber die Bedeutung der Lichter kennt man nicht. Es ist jedoch sicher nichts Bedrohliches. Ich denke, der Herr will uns nur damit segnen und Kindern wie dir ein Licht schenken in der Nacht.«
Peter schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, nein, er hat schon gesagt, was er damit meint. Feuer und Schwert wird er schicken, oder so was. Wenn ich es nicht mache …«
Konstanze runzelte die Stirn. »Wenn du was nicht machst? Schluck erst mal runter, die Krapfen laufen ja nicht weg. Der Herr hat also mit dir gesprochen?«
Peter nickte und schluckte nun wirklich.
»Er ist an mein Feuer gekommen«, erklärte er. »Sah aus wie … wie so ein Mönch oder ein Pilger. Ja, ich glaub, ein Pilger, er hatte so einen Hut auf.«
»Er ist also nicht einfach erschienen?«, erkundigte sich Konstanze. In ihren eigenen Visionen materialisierten sich die Engel und Heiligen immer ziemlich plötzlich.
»Nein, er kam da her!« Peterchen wies in Richtung Wald. Im weitesten Sinne führte dieser Pfad auf die Straße nach Mainz, aber es gab zahlreiche Abzweigungen. »Und er fragte, ob er sich setzen darf.«
Konstanze wunderte sich. In ihren persönlichen Erscheinungen und denen der Hildegard von Bingen trat Jesus Christus herrischer auf. Aber gut, einigen Heiligen war er wohl auch als Pilger oder Bettler erschienen.
»Ich hab gesagt, ja, und ich hab ihm auch was von meinem Essen gegeben«, fuhr der kleine Peter fort.
»Er hat mit dir gegessen?«, fragte Konstanze verwirrt. »Der Herr Jesus Christus?«
»Vielleicht war’s auch nur ein Engel«, schränkte Peterchen ein.
Zumindest schien die Erscheinung keine Schwierigkeiten damit gehabt zu haben, sich an weltlicher Speise zu laben.
»Und dann hat er erzählt, dass er es gewohnt ist, Hunger zu leiden. Und wie schlimm und gefährlich es ist im Heiligen Land.«
»Im Heiligen Land? Hat er gesagt, er käme daher?« Konstanze erschien es immer unwahrscheinlicher, dass Peter wirklich nur Bilder gesehen hatte.
»Ja … nein … ich weiß nicht … Aber er hat gesagt, im Himmel wären sie alle sehr traurig. Weil die Ungläubigen da immer noch sitzen … also im Heiligen Land. Und weil sie so böse zu den Pilgern sind – all so was. Aber ich soll das jetzt ändern.« Der Krapfen schien Peters Lebensgeister geweckt zu haben. Er sprach wieder flüssiger und schickte jetzt auch den Hund aus, die Schafe einzutreiben.
»Du, Peterchen?«, fragte Konstanze belustigt. Das Ganze klang immer verrückter. »Du sollst Jerusalem befreien?«
Peter nickte und pfiff seinem Hund. »Ja«, bestätigte er dann. »Weil ich zu den Unschuldigen gehöre. Nur die Unschuldigen können die Heilige Stadt befreien. Deshalb soll ich jetzt nach Mainz gehen und erzählen, was mir der Engel – oder der Herr, ich bin nicht sicher, aber ich glaub fast, es war der Herr Jesus Christus … – also jedenfalls soll ich berichten, was er gesagt hat. Und dann soll ich die anderen Unschuldigen nach Jerusalem führen und beten. Die Heiden würden ihre Schwerter dann niederlegen und sich zu Christus bekehren.«
»Aber Peterchen, wie wollt ihr denn dahin kommen?«, lächelte Konstanze und schob dem Kleinen den zweiten Krapfen zu.
»Von hier nach Jerusalem – das sind mehr als tausend Meilen! Und dazwischen liegt das Mittelmeer …«
»Das Meer wird sich teilen«, erklärte Peter ernst. »Das hat der Engel versprochen. Oder der Herr. Wir werden trockenen Fußes hinüberschreiten. Wie damals die … die …«
»… die Kinder Israels«, half Konstanze. »Unter Moses. Aber das ist lange her …«
»Aber er hat es gesagt!«, beharrte Peter zu Konstanzes Verwunderung, ohne zuvor den Krapfen anzubeißen. »Es ist nur … es ist nur, dass ich so Angst habe. Ich kann nicht predigen, ich bin doch kein Pfarrer. Und ich will hier auch gar nicht weg.«
Konstanze nickte und legte den Arm um die Schultern des Jungen. Die Berührung fiel ihr schwer, sie war es nicht mehr gewohnt, so vertraut neben einem anderen Menschen zu sitzen oder ihn gar zu liebkosen. Früher, mit ihren Geschwistern, war ihr das selbstverständlich erschienen – und jetzt, als Peterchen sich Hilfe suchend in ihre Arme schmiegte, merkte sie, wie sehr sie es vermisst hatte. Aber sie musste dem Kind erst einmal die Angst nehmen. Konstanze erschien es unmöglich, dass ihm tatsächlich ein Engel erschienen war. Viel wahrscheinlicher war es ein Pilger, der von Jerusalem erzählte. Peterchen musste etwas falsch verstanden haben. Oder der Mann selbst war verwirrt gewesen. Auf jeden Fall durfte Peter auf keinen Fall irgendetwas von Visionen und Erscheinungen herumerzählen! Konstanze wusste zu genau, wohin das führte.
»Pass auf, Peterchen, du tust jetzt erst mal gar nichts!«, riet sie dem Jungen. »Vergiss die Geschichte einfach, kümmere dich um deine Schafe, und sag niemandem etwas davon.«
Peterchen biss jetzt doch in seinen Krapfen, wenn auch nicht so heißhungrig wie sonst.
»Aber was ist mit dem Feuer vom Himmel?«, fragte er ängstlich. »Der Herr wird mich doch strafen, wenn ich nicht auf ihn höre.«
»Das Feuer am Himmel hat jeder gesehen, Peter. Das hat vielleicht gar nichts zu tun mit dem Engel. Und so schnell straft Gott dich auch nicht. Kennst du die Geschichte von Jonas, Peter, der kein Prophet sein wollte?« Der Priester hatte sie erst am letzten Sonntag in der Predigt behandelt, Peter sollte sich eigentlich erinnern.
Der kleine Junge nickte unschlüssig. »Den frisst ein Fisch, nicht?«, überlegte er.
Konstanze nickte. »Richtig. Aber vorher fragt Gott dreimal nach, ob er seine Botschaft wirklich nicht verbreiten möchte. Und dann spuckt ihn der Wal auch wieder aus, weil Gott es nämlich gar nicht so böse gemeint hat. Und da soll er dich gleich verbrennen, weil du ein bisschen Angst hast? Glaub mir, Peter, wenn der Herr tatsächlich eine Aufgabe für dich hat, dann erscheint er dir wieder! Und solange bleibst du ganz ruhig und erzählst es niemandem. Ja?«
Peter biss jetzt herzhafter in seinen Krapfen. »Ihr meint, dann findet der Herr vielleicht einen anderen?«, fragte er hoffnungsvoll.
Konstanze lächelte. »Vielleicht. Jedenfalls brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Gott der Herr meint es gut mit dir. Er wird dir nichts auferlegen, was du nicht leisten kannst.«
Sie küsste das Kind auf die Stirn und stand auf – natürlich nicht ohne den letzten Krapfen aus dem Korb zu holen. Peterchen teilte ihn getröstet mit seinem Hund, und Konstanze machte sich auf den Heimweg. Bis zur Non würde sie es nicht mehr ins Kloster schaffen, sie würde sich beeilen müssen, die Kräuter bis zur Vesper so zu versorgen, dass sie nicht verdarben.
Über der Suche nach einer passenden Ausrede für ihre Verspätung vergaß sie den Pilger, das Flammenschwert und die Eroberung Jerusalems.
Kapitel 2
Gisela von Bärbach machte sich keine Sorgen, als ihre Ziehmutter Jutta von Meißen sie zu sich rufen ließ. Im Gegenteil, meist bedeutete die persönliche Einladung ein kleines Privileg – vielleicht eine Rolle in einem der Historienspektakel, die die Markgräfin gern aufführen ließ, oder die Aufforderung, vor einem geehrten Gast zu singen und die Laute zu spielen.
Gisela beherrschte beides sehr gut, und sie schaffte es sogar, dabei still zu sitzen. Ansonsten war sie auch jetzt noch das lebhafte, kaum zu bändigende Mädchen, als das es vor Jahren an den Hof von Meißen gekommen war: eine verwegene Reiterin und anerkannte Falknerin. Sie gehörte zu den wenigen Edelfräulein, die ihre Vögel selbst ausbildeten, und die Stallknechte vertrauten ihr gern junge, feurige Pferde an.
Auch an diesem Tag ereilte sie der Ruf ihrer Ziehmutter bei den Ställen. Sie kam eben von einem Ausritt zurück, Juttas kleinen Sohn Otto vor sich im Sattel, gefolgt von seiner Schwester Hedwig, die bereits allein reiten durfte. Ihr Pferdchen musste sich anstrengen, um mit Giselas Stute Schritt zu halten. Im Grunde kam es nur mit, weil das Mädchen sein Pferd zurückhielt. Schließlich sollte Otto nicht herunterfallen. Der kleine Junge hatte hier jedoch keine Befürchtungen, ihm konnte es nicht schnell genug gehen.
»Morgen reite ich einen Hengst!«, rief er, als ihn ein Knappe aus dem Sattel hob. »Oder meinst du, ich kann das nicht?« Unternehmungslustig wedelte er mit seinem Holzschwert.
Gisela lachte. »Ach, weißt du, Otto, das ist gar nicht so schwer. So ein Hengst ist wie ein junger Ritter: immer das Schwert gezückt und auf sein Ziel los, ohne links und rechts zu schauen. Eine Stute dagegen ist schwerer zu lenken, man braucht Takt und Fingerspitzengefühl.«
Der helfende Knappe wurde umgehend rot, worauf es Gisela natürlich angelegt hatte. Am Minnehof der Jutta von Meißen übten sich Damen und Ritter in der Kunst der klugen und durchaus etwas anzüglichen Tändelei. Und hübschen, umschwärmten Mädchen wie Gisela gefiel es auch manchmal, die Jünglinge zu necken und verlegen zu machen, die ihre Ritterwürde noch nicht erlangt hatten. Vom Alter her standen sie ihr schließlich näher als die meisten Minneherren der Jutta von Meißen, die ihre Schwertleite längst gefeiert und in der Regel bereits erste Kämpfe bestanden hatten.