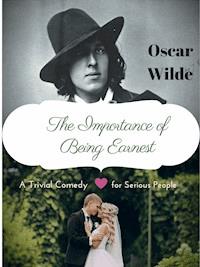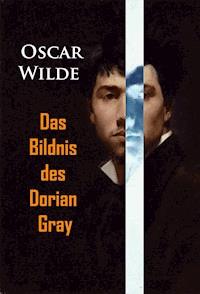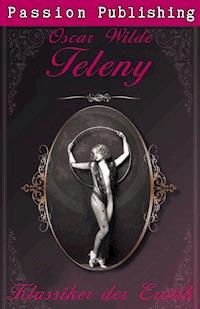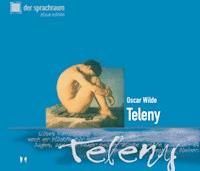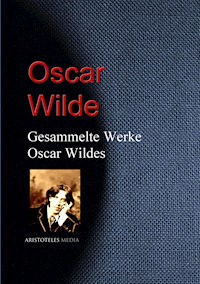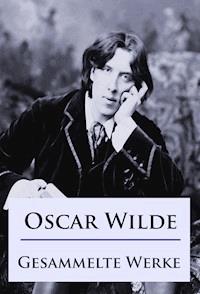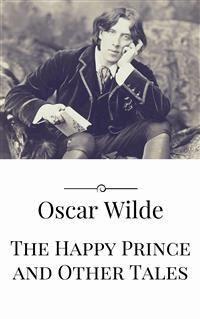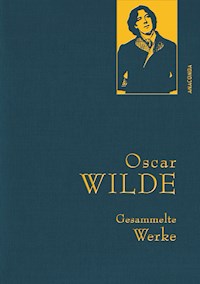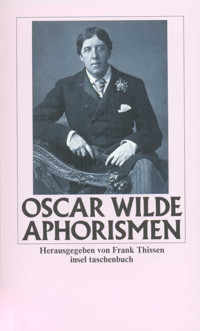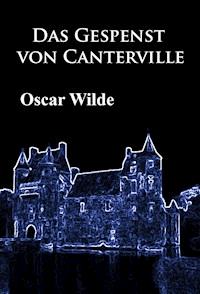Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Horror bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung beinhaltet sechs Kurzgeschichten von Oscar Wilde. - Das Gespenst von Canterville - Der glückliche Prinz - Die Nachtigall und die Rose - Der egoistische Riese - Der ergebene Freund - Die bedeutende Rakete Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oscar Wilde
Das Gespenst von Canterville
und fünf andere Erzählungen
Oscar Wilde
Das Gespenst von Canterville
und fünf andere Erzählungen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Franz BleiIllustrationen: Heinrich Vogeler EV: Insel-Verlag, Leipzig, 1905 2. Auflage, ISBN 978-3-962817-49-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Das Gespenst von Canterville
Der glückliche Prinz
Die Nachtigall und die Rose
Der egoistische Riese
Der ergebene Freund
Die bedeutende Rakete
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Horror bei Null Papier
Vampire - Tödliche Verführer
Frankenstein
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Dracula
Das Bildnis des Dorian Gray
Der Golem
Japanische Geistergeschichten
Die vergessene Welt
Das Ende der Welt
Horror
und weitere …
Das Gespenst von Canterville1
Originaltitel: »The Canterville Ghost« <<<
I.
Als Mr. Hiram B. Otis, der amerikanische Gesandte, Schloss Canterville kaufte, sagte ihm ein jeder, dass er sehr töricht daran täte, da dies Schloss ohne Zweifel verwünscht sei. Sogar Lord Canterville selbst, ein Mann von peinlichster Ehrlichkeit, hatte es als seine Pflicht betrachtet, diese Tatsache Mr. Otis mitzuteilen, bevor sie den Verkauf abschlossen.
»Wir haben selbst nicht in dem Schloss gewohnt«, sagte Lord Canterville, »seit meine Großtante, die Herzoginmutter von Bolton, einst vor Schreck in Krämpfe verfiel, von denen sie sich nie wieder erholte, weil ein Skelett seine beiden Hände ihr auf die Schultern legte, als sie gerade beim Ankleiden war. Ich fühle mich verpflichtet, es Ihnen zu sagen, Mr. Otis, dass der Geist noch jetzt von verschiedenen Mitgliedern der Familie Canterville gesehen worden ist, sowie auch vom Geistlichen unserer Gemeinde, Hochwürden Augustus Dampier, der in King’s Kollege, Cambridge, den Doktor gemacht hat. Nach dem Malheur mit der Herzogin wollte keiner unserer Dienstboten mehr bei uns bleiben, und Lady Canterville konnte seitdem des Nachts häufig nicht mehr schlafen vor lauter unheimlichen Geräuschen, die vom Korridor und von der Bibliothek herkamen.«
»Mylord«, antwortete der Minister, »ich will die ganze Einrichtung und den Geist dazu kaufen. Ich komme aus einem modernen Lande, wo wir alles haben, was mit Geld zu bezahlen ist; und ich meine, mit all unsern smarten jungen Leuten, die Ihnen Ihre besten Tenöre und Primadonnen abspenstig machen, das: Gäbe es wirklich noch so etwas wie ein Gespenst in Europa, würden wir dasselbe in allerkürzester Zeit drüben haben, entweder bei Barnum oder auf einem Jahrmarkt.«
»Ich fürchte, das Gespenst existiert wirklich«, sagte Lord Canterville lächelnd, »wenn es auch bis jetzt Ihren Impresarios gegenüber sich ablehnend verhalten hat. Seit drei Jahrhunderten ist es wohl bekannt, genau gesprochen seit 1584, und es erscheint regelmäßig, kurz bevor ein Glied unserer Familie stirbt«
»Nun, was das anbetrifft, das macht der Hausarzt gerade so, Lord Canterville. Aber es gibt ja doch gar keine Gespenster, und ich meine, dass die Gesetze der Natur sich nicht der britischen Aristokratie zuliebe aufheben lassen.«
»Sie sind jedenfalls sehr aufgeklärt in Amerika«, antwortete Lord Canterville, der Mr. Otis’ letzte Bemerkung nicht ganz verstanden hatte, »und wenn das Gespenst im Hause Sie nicht weiter stört, so ist ja alles in Ordnung. Sie dürfen nur nicht vergessen, dass ich Sie gewarnt habe.«
Wenige Wochen später war der Kauf abgeschlossen, und gegen Ende der Saison bezog der Gesandte mit seiner Familie Schloss Canterville. Mrs. Otis, die als Miss Lucretia R. Tappan, W. 53 New York, für eine große Schönheit gegolten hatte, war jetzt eine sehr hübsche Frau in mittleren Jahren, mit schönen Augen und einem tadellosen Profil. Viele Amerikanerinnen, die ihre Heimat verlassen, nehmen mit der Zeit das Gebaren einer chronischen Kränklichkeit an, da sie dies für ein Zeichen europäischer Kultur ansehen, aber Mrs. Otis war nie in diesen Irrtum verfallen. Sie besaß eine vortreffliche Konstitution und einen hervorragenden Unternehmungsgeist. So war sie wirklich in vieler Hinsicht völlig englisch und ein vorzügliches Beispiel für die Tatsache, dass wir heutzutage alles mit Amerika gemein haben, ausgenommen natürlich die Sprache. Ihr ältester Sohn, den die Eltern in einem heftigen Anfall von Patriotismus Washington genannt hatten, was er zeit seines Lebens beklagte, war ein blonder, hübscher junger Mann, der sich dadurch für den diplomatischen Dienst geeignet gezeigt hatte, dass er im Newport Kasino während dreier Winter die Françaisen kommandierte und sogar in London als vorzüglicher Tänzer galt. Gardenien und der Gotha waren seine einzigen Schwächen. Im Übrigen war er außerordentlich vernünftig. Miss Virginia E. Otis war ein kleines Fräulein von fünfzehn Jahren, graziös und lieblich wie ein junges Reh und mit schönen klaren blauen Augen. Sie saß brillant zu Pferde und hatte einmal auf ihrem Pony mit dem alten Lord Bilton ein Wettrennen um den Park veranstaltet, wobei sie mit 1½ Pferdelängen Siegerin geblieben war, gerade vor der Achillesstatue, zum ganz besonderen Entzücken des jungen Herzogs von Cheshire, der sofort um ihre Hand anhielt und noch denselben Abend unter Strömen von Tränen nach Eton in seine Schule zurückgeschickt wurde. Nach Virginia kamen die Zwillinge, entzückende Buben, die in der Familie, mit Ausnahme des Herrn vom Hause natürlich, die einzigen wirklichen Republikaner waren.
Da Schloss Canterville sieben Meilen von der nächsten Eisenbahnstation Ascot entfernt liegt, hatte Mr. Otis den Wagen bestellt, sie da abzuholen, und die Familie befand sich in der heitersten Stimmung. Es war ein herrlicher Juliabend, und die Luft war voll vom frischen Duft der nahen Tannenwälder. Ab und zu ließ sich die süße Stimme der Holztaube in der Ferne hören, und ein buntglänzender Fasan raschelte durch die hohen Farnkräuter am Wege. Eichhörnchen blickten den Amerikanern von den hohen Buchen neugierig nach, als sie vorbeifuhren, und die wilden Kaninchen ergriffen die Flucht und schossen durch das Untergehölz und die moosigen Hügelchen dahin, die weißen Schwänzchen hoch in der Luft. Als man in den Park von Schloss Canterville einbog, bedeckte sich der Himmel plötzlich mit dunklen Wolken; die Luft schien gleichsam stillzustehen; ein großer Schwarm Krähen flog lautlos über ihren Häuptern dahin, und ehe man noch das Haus erreichte, fiel der Regen in dicken schweren Tropfen.
Auf der Freitreppe empfing sie eine alte Frau in schwarzer Seide mit weißer Haube und Schürze: Das war Mrs. Umney, die Wirtschafterin, die Mrs. Otis auf Lady Cantervilles inständiges Bitten in ihrer bisherigen Stellung behalten wollte. Sie machte jedem einen tiefen Knicks, als sie nacheinander ausstiegen, und sagte in einer eigentümlich altmodischen Art: »Ich heiße Sie auf Schloss Canterville willkommen.« Man folgte ihr ins Haus, durch die schöne alte Tudor-Halle in die Bibliothek, ein langes, niedriges Zimmer mit Täfelung von schwarzem Eichenholz und einem großen bunten Glasfenster. Hier war der Tee für die Herrschaften gerichtet, und nachdem sie sich ihrer Mäntel entledigt, setzten sie sich und sähen sich um, während Mrs. Umney sie bediente.
Da bemerkte Mrs. Otis plötzlich einen großen roten Fleck auf dem Fußboden, gerade vor dem Kamin, und in völliger Unkenntnis von dessen Bedeutung sagte sie zu Mrs. Umney: »Ich fürchte, da hat man aus Unvorsichtigkeit etwas verschüttet.«
»Ja, gnädige Frau«, erwiderte die alte Haushälterin leise, »auf jenem Fleck ist Blut geflossen.«
»Wie grässlich!«, rief Mrs. Otis. »Ich liebe durchaus nicht Blutflecke in einem Wohnzimmer. Er muss sofort entfernt werden.«
Die alte Frau lächelte und erwiderte mit derselben leisen, geheimnisvollen Stimme: »Es ist das Blut von Lady Eleanore de Canterville, welche hier auf dieser Stelle von ihrem eigenen Gemahl, Sir Simon de Canterville, im Jahre 1575 ermordet wurde. Sir Simon überlebte sie um neun Jahre und verschwand dann plötzlich unter ganz geheimnisvollen Umständen. Sein Leichnam ist nie gefunden worden, aber sein schuldbeladener Geist geht noch jetzt hier im Schlosse um. Der Blutfleck wurde schon oft von Reisenden bewundert und kann durch nichts entfernt werden.«
»Das ist alles Humbug«, rief Washington Otis, »Pinkertons Universal-Fleckenreiniger wird ihn im Nu beseitigen«, und ehe noch die erschrockene Haushälterin ihn davon zurückhalten konnte, lag er schon auf den Knien und scheuerte die Stolle am Boden mit einem kleinen Stumpf von etwas, das schwarzer Bartwichse ähnlich sah. In wenigen Augenblicken war keine Spur mehr von dem Blutfleck zu sehen.
»Na ich wusste ja, dass Pinkerton das machen würde«, rief er triumphierend, während er sich zu seiner bewundernden Familie wandte; aber kaum hatte er diese Worte gesagt, da erleuchtete ein greller Blitz das düstere Zimmer, und ein tosender Donnerschlag ließ sie alle in die Höhe fahren, während Mrs. Umney in Ohnmacht fiel.
»Was für ein schauderhaftes Klima!«, sagte der amerikanische Gesandte ruhig, während er sich eine neue Zigarette ansteckte. »Wahrscheinlich ist dieses alte Land so übervölkert, dass sie nicht mehr genug anständiges Wetter für jeden haben. Meiner Ansicht nach ist Auswanderung das einzig Richtige für England.«
»Mein lieber Hiram«, sprach Mrs. Otis, »was sollen wir bloß mit einer Frau anfangen, die ohnmächtig wird?«
»Rechne es ihr an, als ob sie etwas zerschlagen hätte, dann wird es nicht wieder vorkommen«, sagte der Gesandte, und in der Tat, schon nach wenigen Augenblicken kam Mrs. Umney wieder zu sich. Aber es war kein Zweifel, dass sie sehr aufgeregt war, und sie warnte Mrs. Otis, es stände ihrem Hause ein Unglück bevor.
»Ich habe mit meinen eigenen Augen Dinge gesehen, Herr«, sagte sie, »dass jedem Christenmenschen die Haare davon zu Berge stehen würden, o manche Nacht habe ich kein Auge zugetan aus Furcht vor dem Schrecklichen, das hier geschehen ist.« Jedoch Herr und Frau Otis beruhigten die ehrliche Seele, erklärten, dass sie sich nicht vor Gespenstern fürchteten, und nachdem die alte Haushälterin noch den Segen der Vorsehung auf ihre neue Herrschaft herabgefleht und um Erhöhung ihres Gehaltes gebeten hatte, schlich sie zitternd auf ihre Stube.
II.
Der Sturm wütete die ganze Nacht hindurch, aber sonst ereignete sich nichts von besonderer Bedeutung. Am nächsten Morgen jedoch, als die Familie zum Frühstück herunterkam, fanden sie den fürchterlichen Blutfleck wieder unverändert auf dem Fußboden.
»Ich glaube nicht, dass die Schuld hiervon am Paragon-Fleckenreiniger liegt«, erklärte Washington, »denn den habe ich immer mit Erfolg angewendet – es muss also das Gespenst sein.« Er rieb nun zum zweiten Mal den Fleck weg, aber am nächsten Morgen war er gleichwohl wieder da. Ebenso am dritten Morgen, trotzdem Mr. Otis selbst die Bibliothek am Abend vorher zugeschlossen und den Schlüssel in die Tasche gesteckt hatte. Jetzt interessierte sich die ganze Familie für die Sache. Mr. Otis fing an zu glauben, dass es doch allzu skeptisch von ihm gewesen sei, die Existenz aller Gespenster zu leugnen. Mrs. Otis sprach die Absicht aus, der Psychologischen Gesellschaft beizutreten, und Washington schrieb einen langen Brief an die Herren Myers & Sodmore über die Unvertilgbarkeit blutiger Flecken im Zusammenhang mit Verbrechen. In der darauffolgenden Nacht nun wurde jeder Zweifel an der Existenz von Gespenstern für immer endgültig beseitigt.
Den Tag über war es heiß und sonnig gewesen, und in der Kühle des Abends fuhr die Familie spazieren. Man kehrte erst gegen neun Uhr zurück, worauf das Abendessen eingenommen wurde. Die Unterhaltung berührte in keiner Weise Gespenster, es war also nicht einmal die Grundbedingung jener erwartungsvollen Aufnahmefähigkeit gegeben, welche so oft dem Erscheinen solcher Phänomene vorangeht. Die Gesprächsthemata waren, wie mir Mrs. Otis seitdem mitgeteilt hat, lediglich solche, wie sie unter gebildeten Amerikanern der besseren Klasse üblich sind, wie z. B. die ungeheure Überlegenheit von Miss Fanny Davenport über Sarah Bernhardt als Schauspielerin; die Schwierigkeit, Grünkern- und Buchweizenkuchen selbst in den besten englischen Häusern zu bekommen; die hohe Bedeutung von Boston in Hinsicht auf die Entwickelung der Weltseele; die Vorzüge des Freigepäck-Systems beim Eisenbahnfahren; und die angenehme Weichheit des New Yorker Akzents im Gegensatz zum Londoner Dialekt. In keiner Weise wurde weder das Übernatürliche berührt, noch von Sir Simon de Canterville gesprochen. Um elf Uhr trennte man sich, und eine halbe Stunde darauf war bereits alles dunkel. Da plötzlich wachte Mr. Otis von einem Geräusch auf dem Korridor vor seiner Türe auf. Es klang wie Rasseln von Metall und schien mit jedem Augenblick näher zu kommen. Der Gesandte stand sofort auf, zündete Licht an und sah nach der Uhr. Es war Punkt eins. Er war ganz ruhig und fühlte sich den Puls, der nicht im Geringsten fieberhaft war. Das sonderbare Geräusch dauerte fort, und er hörte deutlich Schritte. Er zog die Pantoffel an, nahm eine längliche Phiole von seinem Toilettentisch und öffnete die Türe. Da sah er, sich direkt gegenüber, im blassen Schein des Mondes, einen alten Mann von ganz gräulichem Aussehen stehen. Des Alten Augen waren rot wie brennende Kohlen; langes graues Haar fiel in wirren Locken über seine Schultern; seine Kleidung von altmodischem Schnitt war beschmutzt und zerrissen, und schwere rostige Fesseln hingen ihm an Füßen und Händen.
»Mein Lieber«, sagte Mr. Otis, »ich muss Sie schon bitten, Ihre Ketten etwas zu schmieren, und ich habe Ihnen zu dem Zweck hier eine kleine Flasche von Tammanys Rising Sun Lubricator mitgebracht. Man sagt, dass schon ein einmaliger Gebrauch genügt, und auf der Enveloppe finden Sie die glänzendsten Atteste hierüber von unsern hervorragendsten einheimischen Geistlichen. Ich werde es Ihnen hier neben das Licht stellen und bin mit Vergnügen bereit, Ihnen auf Wunsch mehr davon zu besorgen.« Mit diesen Worten stellte der Gesandte der Unionsstaaten das Fläschchen auf den Marmortisch, schloss die Tür und legte sich wieder zu Bett.
Für einen Augenblick war das Gespenst von Canterville ganz starr vor Entrüstung; dann schleuderte es die Flasche wütend auf den Boden und floh den Korridor hinab, indem es ein dumpfes Stöhnen ausstieß und ein gespenstisch grünes Licht um sich verbreitete. Als es gerade die große eichene Treppe erreichte, öffnete sich eine Tür, zwei kleine weiß gekleidete Gestalten erschienen, und ein großes Kissen sauste an seinem Kopf vorbei. Da war augenscheinlich keine Zeit zu verlieren, und indem es hastig die vierte Dimension als Mittel zur Flucht benutzte, verschwand es durch die Täfelung; worauf das Haus ruhig wurde.
Als das Gespenst ein kleines geheimes Zimmer im linken Schlossflügel erreicht hatte, lehnte es sich erschöpft gegen einen Mondstrahl, um erst wieder zu Atem zu kommen, und versuchte sich seine Lage klar zu machen. Niemals war es in seiner glänzenden und ununterbrochenen Laufbahn von 300 Jahren so gröblich beleidigt worden. Es dachte an die Herzoginmutter, die bei seinem Anblick Krämpfe bekommen hatte, als sie in ihren Spitzen und Diamanten vor dem Spiegel stand; an die vier Hausmädchen, die hysterisch wurden, als es sie bloß durch die Vorhänge eines der unbewohnten Schlafzimmer hindurch anlächelte; an den Pfarrer der Gemeinde, dessen Licht es eines Nachts ausgeblasen, als derselbe einmal spät aus der Bibliothek kam, und der seitdem beständig bei Sir William Guch, geplagt von Nervenstörungen, in Behandlung war; an die alte Madame du Tremouillac, die, als sie eines Morgens früh aufwachte und in ihrem Lehnstuhl am Kamin ein Skelett sitzen sah, das ihr Tagebuch las, darauf sechs Wochen fest im Bett lag an der Gehirnentzündung und nach ihrer Genesung eine treue Anhängerin der Kirche wurde und jede Verbindung mit dem bekannten Freigeist Monsieur de Voltaire abbrach.
Es erinnerte sich der entsetzlichen Nacht, als der böse Lord Canterville in seinem Ankleidezimmer halb erstickt gefunden wurde mit dem Karo-Buben im Halse und gerade noch ehe er starb beichtete, dass er Charles James Fox vermittelst dieser Karte um 50.000 Pfund Sterling betrogen hatte und dass ihm nun das Gespenst die Karte in den Hals gesteckt habe.
Alle seine großen Taten kamen ihm ins Gedächtnis zurück, von dem Kammerdiener an, der sich in der Kirche erschoss, weil er eine grüne Hand hatte, an die Scheiben klopfen sehen, bis zu der schönen Lady Stutfield, die immer ein schwarzes Sammetband um den Hals tragen musste, damit die Spur von fünf in ihre weiße Haut eingebrannten Fingern verdeckt wurde, und die sich schließlich in dem Karpfenteich am Ende der Promenade ertränkte.