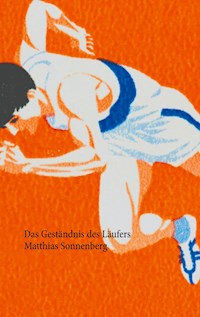
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein ungewöhnlicher Roman, der dank seiner Ansiedlung in der Leistungssportszene dem Leser gleichzeitig ein Stück DDR-Kulturgeschichte vermittelt, was aufgrund der ausgezeichneten Recherche ungemein fesselnd ist. Martins Jugend in der DDR wird einfühlsam und lebensecht gezeichnet. Sein Ehrgeiz und Wille zum Sieg als Mittel zum Zweck, um seine Flucht vorzubereiten, werden emotional großartig aufgebaut und gipfeln in einem überraschenden Höhepunkt. Auch seine psychische Neurose, die ihn von Zeit zu Zeit überfällt und zu einem "bösen" Menschen macht, lassen diese Figur zu einem besonderen Typus werden, der sich quasi über die Massen der Normalos erhebt, wenn auch nicht im positiven Sinne... Aber es sind von jeher die außergewöhnlichen Protagonisten, die großen Romanen ihr Leben einhauchen. Und dieser Martin könnte einer von ihnen sein..." Gaby Hoffmann, Autorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Der Läufer
Operation „Nelkenblut“
Teil 1 Der Läufer
1
Über mir kleben neben verblichenen Wasserflecken zwei erschlagene Mosquitos an der Decke. Seit Stunden beobachte ich sie schon. Mal werden sie kleiner, mal größer, mal verschwimmen sie. Ihr getrocknetes Blut leuchtet noch ganz frisch, wie Erdbeeren. Ja, wie frische Erdbeeren.
Mein Bett ist nicht mehr frisch. Es stinkt nach muffiger Strohmatratze und Schweiß. Ich schwitze. Unter meinem Rücken ist alles nass und schmierig. Meine Achseln riechen wie vergorene Ziegenmilch. Eine Sauerei ist das. Und das Atmen fällt mir schwer. Ich kriege nur im Liegen Luft, mit einem Kissen im Rücken. Diese Schwüle!
Aber ich will nicht jammern und über Krankheiten reden oder zermatschte Mosquitos, sondern über etwas, das lange zurückliegt. Seit über zehn Jahren schleppe ich das mit mir herum. Hier in der Pampa, wo es nur Staub, Sonne und blökende Rinder gibt. Es kommt immer wieder hoch. Ich sehe den Glitzerstaub auf ihrer Stirn, ihren starren Blick, ihre erbleichenden Wangen und das letzte Zucken ihrer Unterlippe. Ich sehe sie im Schlaf, beim Treiben der Kühe, am Lagerfeuer und gerade jetzt. Das muss endlich raus! Ich kann nicht länger schweigen.
2
Aber wo beginnen? Vielleicht bei dem Spaziergang an der Mulde. Das war vor zweiundzwanzig Jahren, im Oktober 1969. In der DDR, in Wolkenburg, Bezirk Karl-Marx-Stadt. Ich war elf und hatte Herbstferien. Die Sonne schien mild, die gelb und braun gewordenen Blätter segelten von den Bäumen und Kastanien knallten auf die Straße, rollten umher. Letzte Fliegen kreisten kraftlos durch die Luft. Meine Mutter hatte mich gebeten, mit ihr an den Fluss zu gehen. Gern kam ich dem nach, so konnte ich Kiesel in das trübe, schaumbedeckte Wasser werfen und am Ufer nach Spielzeug, toten Fischen oder Flaschen suchen. Oder nach noch interessanteren Dingen. Einmal fand ich eine Handtasche mit Geld und einen Lederfußball, später ein Kirchenkreuz, ein aufgedunsenes Schwein, eine SED-Fahne mit herausgeschnittenem Emblem, BHs, ein Trabi-Dach, zwei bemalte Klobrillen und sogar, bei Wassertiefstand, ein verrostetes Motorrad und alte Gewehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Absurditäten aller Art. An den Gestank von Schlamm, Weichspüler und Abwasser, der aus dem Fluss stieg, hatte ich mich gewöhnt. Kannte es nicht anders. Der Geruch kam von der Textilfabrik mit den Waschmaschinen, die einige Kilometer flussaufwärts stand, und war mal stärker, mal schwächer. An jenem Oktobertag war er besonders stark. Es schäumte wild. Weiße Blasenhaufen glitten über das Wasser, die der Wind über das Ufer hinaus bis in die Auen verteilte. Sogar in den verkrüppelten Weiden und Holundersträuchern klebte der Schaum. Und alles war umstrahlt vom Sonnenlicht.
„Na geh schon runter!“, rief meine Mutter, als sie bemerkte, dass ich auf die Steine am Fluss schielte. „Aber pass ja auf!“
Das tat ich und sprang vorsichtig von Stein zu Stein. Immer die Zwischenräume der Findlinge absuchend, um keine Rarität zu übersehen. Schon manches Mal hatte ich in die Schule nach Penig das eine oder andere Fundstück für meine Freunde Gunnar und Felix mitgebracht. Ich war bekannt dafür, dass ich Schätze hob. Ich glaube, man beneidete mich sogar deswegen. Wer wohnte schon so nah am Fluss und konnte solch spannende Dinge bergen?
Gerade als ich zwischen zwei Findlingen nach einer Flasche greifen wollte, zuckte ich zusammen. Vor mir saß ein Mann. In blauer Schlosserjacke und gelben, dreckverschmierten Gummistiefeln. Den hatte ich noch nie gesehen. Er hockte auf einem dieser Steine und starrte aufs Wasser. Dabei drehte er einen Grashalm zwischen den Fingern. An seiner Hand bröckelte die Kruste einer Schürfwunde.
„Na?“, fragte er mit merkwürdigem Unterton.
„Tag!“, gab ich zurück und nickte.
Er schaute mich mit dunklen Augen durchdringend an. Ein stechender Blick, hinter dem etwas Unheimliches schwoll. Darüber wucherten buschige, zusammengewachsene Augenbrauen und dichte silbergraue Haare.
Ich roch sein süßes, fliederähnliches Rasierwasser und bekam weiche Knie. Mein Atem stockte. Wollte er etwas von mir? Schnell ging ich weiter. Spürte, dass er mir nachsah. Hastig übersprang ich die Steine, bis ich den Mann ein Stück entfernt glaubte. Folgte er mir? Ich stoppte. Drehte mich um. Nein, doch er sah hinter mir her. Aber er war außer Reichweite. Ich atmete durch. Daraufhin bückte ich mich nach einem flachen Stein, um ihn ins Wasser zu schleudern und damit das befremdliche Gefühl loszuwerden. Und den Rasierwassergeruch. Ich wollte den Kiesel so werfen, dass er mehrfach auf dem Wasser aufschlug, ohne unterzutauchen. Ich hatte mir angewöhnt, die Wasserberührungen dabei zu zählen. Neunmal war mein Rekord, aber jetzt gelang es nicht. Der Stein versank sofort. Wasser spritzte auf.
„Mist!“
Ich weiß nicht, was in dem Moment mit mir geschah. Es ist schwer zu erklären. Der Mann war weit weg. Aber plötzlich schlug mein Herz schneller. Direkt nach dem Wurf. In meinem Unterleib kribbelte es, als liefen Ameisen darin umher. Mir wurde sonderbar. Ich dachte, ich würde krank werden. So ein Gefühl stieg immer in mir hoch, wenn sich eine Erkältung anbahnte. Alles um mich herum rückte hinter eine Wand. Ich hörte meine Atmung in mir drin, wie mit einem inneren Ohr. Draußen entfernte sich alles. Als ob es in einem Radio plappert und man hört nur die Stimme. Von dem, was gesagt wird, versteht man nix. Nur Blablabla ... Gleichzeitig fällt man in einen dumpfen, zeitlosen Zustand, der sogar angenehm ist. Beunruhigendes wird betäubt und verschüttete Erinnerungen erwachen. Der Verstand dämmert. Und man ist, trotz des inneren Nebels, ganz bei sich selbst.
Aber mit einer Erkältung hatte das nichts zu tun. Denn mir schoss das Bild des Mannes ins Bewusstsein. Ohne es zu wollen, ohne dass ich das Bild herbeigedacht hätte, wie eine Urlaubserinnerung von der Ostsee. Dort war ich mit den Eltern oft gewesen. In unserem gelb- grünen Zelt hinter den Dünen vom FKK-Strand, im Kiefernwald von Prerow, wo es nach Chlor und Plumpsklo stank.
Der Mann erschien nun noch klarer vor meinem inneren Auge. Diese wulstigen, zuckenden Augenbrauen. Und sein Blick, der nicht mehr durchdringend war, sondern unterwürfig. Wie der von einem verängstigten Hund. Ich stellte mir vor, wie ich einen Stein in die Hand nahm und dem Kerl damit auf den Kopf schlug. Mit voller Härte.
Ich war aufgedreht und verwirrt. Fühlte mich mächtig, als ob ich schwebte. Wie ein Gott. Zugleich fürchtete ich mich, ohne zu wissen, wovor. Ich wagte keine Bewegung. Glaubte, dass mich etwas ergreifen könnte. Und dann tauchten Bilder auf, in denen das Blut fontänenartig aus seinem Schädel schoss und sich über seine Haare, Stoffjacke und Gummistiefel verteilte. Er begann zu stöhnen: „Ah, ah, ah.“ Doch er tat mir nicht leid, nicht wie sonst, wenn jemand litt. Und wie es sich gehörte, wie es meine Mutter mir eingetrichtert hatte. Nein, im Gegenteil, mein Unterleib und Bauch zogen sich zusammen. Ein aufregendes Zucken und Pulsieren kam hinzu, das sich wellenartig im Körper ausbreitete. Ich atmete schneller, bis ein ungewolltes „Jaaa!" aus meinem Mund kam. Das hörte meine Mutter
„Martin, was ist los?“
„Eh ... nichts!“, stockte ich. „Da war nur ein Mann ...“
„Ein Mann?“
Sie hatte ihn nicht gesehen. Die Weiden am Ufer versperrten ihr die Sicht.
„Ja, ja. Der hat bloß geguckt. Aufs Wasser.“ Ich hätte ihr niemals die Wahrheit erzählen können.
Langsam spazierten wir weiter. Ich wollte mich nach dem Fremden umdrehen, ihn noch einmal sehen, aber ich traute mich nicht. Ich spürte, dass er wusste, was in mir vorgegangen war. Irgendetwas sagte es mir. Oder war das Einbildung? Nein! Sicher wusste er es, wie auch immer das möglich war.
Dann bogen wir um eine Kurve, und das Kribbeln flaute ab. Nur meine Hände und Beine zitterten noch schwach. Ich fühlte mich erleichtert, aber auch bedrückt. In Gedanken hörte ich meine Mutter schimpfen: „Bist du verrückt? Was stellst du dir für Sachen vor?“ Und sah dabei ihre aufgerissenen Augen vor mir, die mich oft an die Augen Großvaters erinnerten oder an einen Wolf. Von jetzt auf gleich konnten sie diesen bösen Ausdruck bekommen und in mir dieses Erstarren und diesen Brustdruck mit Atemlosigkeit auslösen. Aber Recht hätte sie. Warum dachte ich solche Dinge?
„Du Spinner!“, schimpfte ich mich in Gedanken.
Vielleicht hatte ja der Fremde alles provoziert, durch den bedrohlichen Unterton in der Stimme und seinen sonderbaren Blick? Und ich war schuldlos, hätte mich nur gewehrt.
„Ich weiß es nicht“, antwortete ich im Geist Mutter. „Tut mir leid!“
Wir spazierten weiter. Ich schaute auf den ruhig vor sich hin treibenden Fluss und die Flaschen, die abgetrennten Puppenbeine und die zerbröselten weißen Styroporstücke zwischen den Steinen am Ufer, die nun jeden Reiz verloren hatten. Ich bückte mich nicht mehr. Schwankte. War noch immer aufgedreht, bestürzt und ratlos.
Nach einer guten Stunde beendeten wir unseren Spaziergang. Langsam zogen graue Wolken auf und schoben sich vor die milchige Herbstsonne. Einsetzender Wind wirbelte vor unserem Haus die heruntergefallenen Blätter auf, und die Fliegen tauchten ab.
„Schön war‘s!“, rief meine Mutter zum Schluss und wischte sich ihre braunen glänzenden Haare aus dem Gesicht, die der Wind zerzaust hatte. Bestimmt waren sie frisch gewaschen, denn die Locken hielten noch. Sie umspielten ihre rotgefleckten, leicht hängenden Bernhardinerwangen, was ihr Gesicht breiter erscheinen ließ. Manchmal stellte ich mir meine Mutter ohne ihre Wangentaschen vor, wodurch wir einander noch ähnlicher sahen. Mein Gesicht ist schmal und lang. Doch die dichten braunen Haare, die kurze Oberlippe und die grünen, zurückgesetzten Augen kommen von ihr. Ich mochte meine Mutter, aber ich mochte sie auch nicht. Mehr noch, ich fürchtete sie, besonders ihre Wutausbrüche. Da wurde sie rasend. Urplötzlich, wenn ihr irgendetwas nicht passte, schoss es aus ihr heraus: „Spinnst du?“, „Räum dein Zimmer auf!“ oder „Du Schwein!“.
Und dann setzte es Ohrfeigen. Klatsch! Davor ging sogar mein Vater in Deckung, der ein besonnener, ruhiger Zeitgenosse war. Und schmächtiger als meine Mutter, die mit ihrer aufbrausenden Art und den wuchtigen, weiß leuchtenden Oberarmen alles bestimmte.
„Wir können da nichts machen. Sie ist halt so“, sagte mein Vater dazu.
Nach außen hin mimte meine Mutter die Nette. Von ihren Ausrastern wusste keiner. Die konnten sich so weit hochschaukeln, dass sie meinen Hals packte und mich durchschüttelte. Mein Kopf wackelte dabei und sie schrie: „Was habe ich dir gesagt? Du sollst aufräumen! Verdammt, du …“ Dabei bekam ich dieses Pinkelgefühl und mein Unterleib zog sich zusammen. Ich hatte plötzlich das Gefühl, aufs Klo zu müssen, obwohl nichts kam.
Das Schlimme daran war, dass es jederzeit passieren konnte. Man wusste nie, wann sie austickte. Das hing wie eine dunkle Wolke über allem. Ich musste ständig aufpassen, was ich tat. War immer angespannt und zitterte innerlich. Wenn sie brüllte, wenn dieser widerlich-lächerliche Gesichtsausdruck kam, diese schreiende Fratze, durfte man nicht wegsehen. Bis sie mit einem fertig war. „Sieh mich an!“, schrie sie, wobei ihre Spucktropfen auf mein Gesicht schossen. Ich fühlte mich danach so klein, so niedergemacht, nicht mehr wie ich, wie ein anderer Mensch. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr in mich rein fressen. Ein Ventil öffnete sich, und ich heulte, schrie, schlug mit der Faust gegen die Tür, wenn sie weg war. Stellte mir vor, wie ich sie bespuckte und würgte. Aus Ohnmacht, aus Scham, aus Rache. Aber was konnte ich als Kind sonst dagegen unternehmen? Heute glaube ich, dass damit alles begann.
Ich wusste nicht, was ich auf ihr „Schön war´s“ antworten sollte. Nickte bloß.
Die nächsten Tage versuchte ich, nicht mehr an den Mann zu denken. Es gelang mir auch. Kurz. Und nur am Tage. Aber nachts träumte ich von ihm. Sah ihn in unserem Kartoffelkeller sitzen, auf einer Liege, die nie dort stand. Eine Kerze flackerte verschwommen. Er starrte mich an, rieb seine Stiefel und winkte mir zu. Ich hatte ein Brett in der Hand. Wollte es ihm auf den Kopf donnern.
„Komm her!“, befahl er.
„Nein!“, schrie ich.
„Komm her!“
Da ging ich auf ihn los und schlug zu. Wieder und wieder und wachte verschwitzt auf. Und noch als meine Augen offen waren, sah ich den blutverschmierten Kopf.
Um all dies zu unterbinden und wahrscheinlich aus Schuldgefühlen heraus, stürzte ich mich in den nächsten Tagen auf meine Schularbeiten. Ich half meinem Vater freiwillig im Gewächshaus bei den Rosen. Machte auch beim Füttern der Kaninchen und Hühner mit. Ich besaß mein eigenes Kaninchen, Karli. Es war graubraun mit einem Flaumfell. Am Hals besaß es dichte weiche Stellen. Die streichelte ich am liebsten.
„Junge, was ist los mit dir? Spuck´s aus!“, forderte mein Vater mich auf. Seinen Rundrücken, bei dem die linke Seite gewölbter war als die rechte, kratzte er sich ab und zu mit einem Stock. „Weil es juckt“, behauptete er. Mir kam es vor, als wolle er den Buckel wegreiben.
„Ich will dir nur helfen“, antwortete ich.
Ungläubig verzog mein Vater den Mund mit den schuppigen Lippen. Immer, wenn er angespannt war, verzogen sie sich zu Strichen.
„Na, was haste angestellt?“
„Nichts angestellt“, schüttelte ich den Kopf. Natürlich behielt ich meine Vorstellungen für mich und half sogar meiner Mutter beim Abwaschen. Eine Arbeit, um die ich mich normalerweise drückte. Ich wollte es wiedergutmachen, es weghaben.
„Was hast du ausgefressen? Ist was in der Schule passiert?“, fragte auch sie prompt.
„Nein. Ich helfe dir nur!“
„Na …?“
Schließlich ging ich noch einmal zu der Stelle, wo der Mann gesessen hatte. Obgleich ich fürchtete, dass er da war. Es musste sein. Ich wollte, dass er da war. Und ich wollte es auch nicht. Wieder kribbelte es in meinen Händen, im Bauch, im Unterleib. Aber er war nicht da. Nur der schmutzige, weiß-gelbe Schaum der Mulde klebte auf dem großen Stein und wehte flockenweise auf die Wiese. Ich war erleichtert und enttäuscht. Fühlte mich sonderbar und wusste nicht, was ich denken sollte. Endlich wurde das Kribbeln schwächer. Und als ich nach Hause ging, verschwand es ganz. Erledigt, dachte ich.
Zwei Wochen später passierte etwas Seltsames: Ich ging meinen Karli füttern, ging in sein Gatter auf dem Hof, wo es nach Stroh, feuchtem Holz und Kaninchenmist muffte. Es war nachmittags. Am Himmel hingen graue Wolken. Windstöße blähten die Wäsche im Hof auf. Ich gab Karli Löwenzahn. Den hatte ich von den Muldeauen mitgebracht. Dort wuchs er in rauen Mengen. Im Frühjahr war alles gelb, es duftete süß, sodass es in der Nase juckte. Am liebsten fraß Karli die frischen Blätter. Ich öffnete den Käfig, nahm ihn heraus und blickte in seine lieben schwarzen glänzenden Augen. In ihnen konnte ich mich erkennen, sah eine ovale Spiegelung meines Gesichts. Manchmal bewegte ich meinen Kopf schnell von ihm weg und wieder auf ihn zu, um mein sich veränderndes Gesicht zu betrachten. Aber nur, wenn niemand zusah. Im Geist hörte ich meinen Vater kopfschüttelnd sagen: „Jetzt ist er völlig durchgedreht.“
Karli schnurpzte gerade ein Löwenzahnblatt. Ich schaute zu und streichelte ihn, obwohl er es nicht mochte, wenn man ihn beim Fressen störte. Er kroch dann in die hinterste Ecke des Käfigs. Und das tat er auch diesmal. Und genau in diesem Augenblick begann es wieder. Die Fantasien kamen. Ich sah mich dabei Karlis Hals greifen und zudrücken. Seine Füße strampelten vor meinem inneren Auge, und das Kribbeln im Unterleib setze ein. „Hör auf!“, sagte ich zu mir. „Schluss!“ So ging das eine Weile, doch irgendwann konnte ich es nicht mehr zurückhalten. In meinen Händen begannen sich die Muskeln zu spannen und die Finger verkrampften sich. Dann packten sie zu. Ich griff nach Karlis Hals und würgte ihn. Es blieb mir nichts anderes übrig. Diese Bilder brachten mich dazu. Mir war, als würde sich eine fremde Kraft in mir ausbreiten und mich zur Seite schieben. Nicht ich war es, der das tat! Ich wurde benutzt.
Beim Würgen traten Karlis Augen hervor, in denen ich die Augen meiner Mutter sah. Das Pinkelgefühl kam hinzu, übertünchte das Kribbeln, vermischte sich damit. Die Muskeln und Sehnen an seinem dünnen Hals zuckten. Ein lautes Pfeifen und Fiepen drang aus seinem Maul. Ein letztes? Karli, ein schreiendes Kind? Ich war geschockt und wütend. Spuckte ihn an. Der Rotz hing an seinen Ohren: „Drecksvieh!“
Einen Augenblick später brannte es mir am Unterarm. Eine Kralle seiner strampelnden Pfoten hatte mich erwischt.
Das brachte mich zurück, und ich realisierte, was geschehen war. Ich hatte tatsächlich zugedrückt! Und vermutlich wäre er tot, hätte er sich nicht gewehrt. Ein roter Streifen leuchtete an meinem Arm.
Nun war mir Karli aus den Händen gerutscht und rannte zitternd und desorientiert davon. Ich sank vor dem Gatter zusammen, den Kopf zwischen meinen Knien. Was war passiert? Mein Karli! Ich schlug mir zweimal gegen die Wange und stieß mit der Stirn gegen das Gatter.
„Schwein! Dreckiges Schwein!“, beschimpfte ich mich. Der Stoß schmerzte nicht genug.
Lange blieb ich so sitzen, bis meine Mutter schrie: „Martin, komm, hilf mir mal!“
Aber ich reagierte nicht.
„Los! Kartoffeln schälen.“
Ich zwang mich aufzustehen und schlich wie betäubt zu ihr in die Küche.
3
Das liegt jetzt über fünfundzwanzig Jahre zurück. Doch nie habe ich es vergessen. Damit hatte alles begonnen. Und ohne jene Ereignisse wäre ich wahrscheinlich nicht hier auf der Rinderfarm „Villa Maria“. Meiner Rinderfarm! Hier in Argentinien nahe Comallo. Aber was heißt nah? Dreißig Kilometer liegt die Stadt entfernt, und da ich kein Auto habe, ist das weit. Um dahin zu gelangen, müsste ich mit den rostigen „la guagua“ fahren. Aber Busse meide ich. Dicht mit den Latinos zusammensitzen, nein. Die triefen und stinken nach Schweiß, „orina“ und Kokosöl. Sie plappern und schreien pausenlos: „Me gusta cantar.“, „¡Arriba, arriba!“, „¿Dónde está?“. Oder sie singen. „Uno, dos, uno, dos …“ Oder die Stoßdämpfer hämmern unter dem Sitz, stundenlang, bis der Arsch taub wird oder der Rücken sticht. Dazu kommt der viele Staub. Nein, ich brauche Platz und habe mich an die Weite gewöhnt. Die Pampa ist weit.
In Südamerika lebe ich seit 1981. Als ich mit dem Schiff herkam, war es Winter. Das war vor elf Jahren. Seitdem bin ich aus der DDR und von den Eltern weg. Über den Mauerfall 1989 habe ich nur gelesen und gestaunt. Stand ja in sämtlichen Zeitungen. Was muss da los gewesen sein? Auf den Fotos sah man Trabis in Westberlin mit Fahnen, aus denen das DDR-Emblem herausgeschnitten war. Jubelnde Leute, die auf der Mauer tanzten und Silvesterraketen in den Himmel jagten. Unfassbar! Zu meiner Zeit wäre das unmöglich gewesen. An sich kann ich es noch immer nicht richtig glauben. Aus Karl-Marx-Stadt haben die wieder Chemnitz gemacht. Weil die Stadt früher so hieß. Wusste ich gar nicht. Für mich war es immer Karl-Marx-Stadt gewesen. Die Stadt mit dem „Nischel“, dem Karl-Marx-Kopf. Das dicke Denkmal. Es war ein Verliebtentreff, da wurde Händchengehalten. Ob der „Nischel“ noch dasteht oder weggehauen wurde? Wer weiß. Hätte ich damals geahnt, dass die Wende kommt, es wäre einiges anders gelaufen. Manches wäre vielleicht nie passiert.
Da war mein Name übrigens noch Martin Stern, hier in Argentinien dagegen bin ich Michael Strollenthal. So steht es in meinem neuen Pass. Und auch, dass ich aus Hamburg stamme. Seit 1981 bin ich ein Westdeutscher. Michael Strollenthal aus Hamburg. Heute, hier in Argentinien kann ich mir kaum noch vorstellen, jemals ein anderer gewesen zu sein.
Ich liebe die Pampa. Sie hat einen eigenen Geruch, den es nur hier gibt. Vor allem, wenn der Regen auf den Boden schlägt, der mit gelben und dunkelroten Flechten überzogen ist, oder er gelangt auf die Stellen, wo Moose, Gräser und Eukalyptushaine wachsen. Dann riecht es nach mineralischer Erde, Eukalyptus und feuchtem Grün. So stark. So frisch. Wunderbar! Wenn man das einatmet, kommt man in einen berauschenden Zustand. Die Pampaerde muss etwas Besonderes in sich haben: Düfte, die der Regen freisetzt.
Ganz abgesehen von diesen Naturgeräuschen herrscht völlige Stille, nur der Wind pfeift. Und die Sonnenaufgänge erst! In verschwommenem Rot, Gelb und Orange steigt die Sonne in den Himmel. Ganz nah. Von der Goldmünze bis zum Granatapfel ist farblich alles dabei. Zu manchen Zeiten hängt sie so tief, dass man glaubt, man könne sie berühren. Nicht umsonst ist es ein Brauch der Gauchos, das Lasso nach ihr auszuwerfen. „Bringt la fortuna“, sagen sie. Doch nicht nur, dass die Sonne der Erde in der Pampa näherkommt als anderswo. Je nach Jahreszeit zeigt sie auch andere Farbtöne. Im Frühjahr ist ihr Gelb und Rot klar und dunkel, im Winter verwaschen, milchig und hell. Mit den Jahren habe ich herausbekommen, was auch die alten Gauchos schon immer wussten. Sie erfanden sogar Namen für die unterschiedlichen Sonnenphasen, so wie die Fischer in Patagonien für den Wind. Bei ihnen geht die Windstärke nicht nur bis zehn, sondern bis dreißig, bis zum „fuerte huracán“, dem Orkan. Unten, vor Kap Horn. Glücklicherweise habe ich noch keinen miterlebt. Ich bin auch nicht scharf drauf. Ich mag die Pampa. Wenn die Sonnenstahlen auf die Flechten mit dem Morgentau scheinen und es bis zum Horizont schimmert, da vergisst du alles! Dazu das Grillenzirpen: Eine beginnt, die anderen folgen. Dieser Ton bleibt Stunden im Kopf, macht süchtig, ist Melodie.
Aber die Pampa hat auch Schattenseiten. Nicht solche, die ein Baum spendet. Der ist ja gut. Ich rede von der Hitze! Wenn es wochenlang nicht regnet und die Sonne erbarmungslos glüht, und um dich herum nur weißer, flimmernder Himmel. Alles glüht und flimmert. Bekommst du das ab, sticht und hämmert es dir bis unter die Schädeldecke. Leuchtet und flackert vor den Augen. Selbst wenn du einen Sombrero trägst. Das geht trotzdem da rein. Du kannst nicht mehr klar denken und dir wird schwindlig. Kriegst Pusteln im Gesicht. Oder du musst dich übergeben. Schon ein paar Mal hatte ich das. Gerade als ich am Anfang herkam und mich einzuleben begann.
Nicht zu vergessen die Schwüle, wie jetzt nach der Regenzeit. Bei der geringsten Bewegung läuft der Schweiß. Dein Hemd klebt auf der Haut, die Hose matscht in der Arschritze. Ständig hast du diesen Schweißfilm. Du rutschst beim Reiten auf dem Sattel hin und her. Alles feucht. Auch das Pferd schnieft, schwitzt, stinkt, und Schaum bildet sich an seinem Maul. Das lockt die Mosquitos an. Wie hart für die unerfahrenen Kälber, wenn die Sauger in Schwärmen kommen. Sich blutgierig auf ihre Nasen, Lippen, Augen stürzen. Manche Rinder drehen durch. Schlagen aus, brüllen. Oh, ich kenne diese Schreie, wenn etwas nicht stimmt!
Oder wenn ein Sturm kommt. Der wirbelt alles auf, bildet gewaltige Staubwolken. Nichts siehst du mehr, nur noch verschwommenes Gelb. Dazu der pfeifende, krachende Wind, der den Sand überall hin bläst. Ins Haus, ins Essen, ins Bett, in die Schränke, selbst wenn die verschlossen sind. Sogar in die zugeschraubte Teebüchse. Wenn du isst, knirscht der Staub zwischen deinen Zähnen, und dir bleibt nichts, als ihn herunterzuschlucken. Trinkst du Kaffee, hast du eine Schicht Sand in der Tasse. Die Rinder draußen haben ihn in den Ohren, in den Augen, im Arsch. Alles voll. Und wenn du selbst in einen Sandsturm kommst und dein Halstuch baumelt zu Hause am Ständer, dann gnade dir Gott! Ruckzuck füllt sich deine Nase mit Sand, auch dein Mund. Deine Luftröhre wird trocken und schwillt an. Juckt. Du bekommst keine Luft, glaubst zu ersticken. Die Augen brennen, nichts siehst du mehr. Die Sandkörner schießen dir ins Gesicht, an die Wangen, an die Ohren, in die Augen, gegen den Hals, gegen die Arme, gegen die Brust, wie Nadelstiche. Wie das später brennt! Darüber könnte ich Einiges erzählen.
Manchmal spielen bei solch einem Sturm die Rinder verrückt, sie gehen durch. Ich meine, wenn es richtig dick kommt. In den folgenden Tagen muss man sie mühsam zusammensuchen. Manche bleiben für immer weg. Das kostet „mucho dinero“. Zwei oder drei Rinder weniger oder eine Kuh mit gebrochenem Bein, die du notschlachten musst. Hart! Mein Nachbar Rodrigo hat einmal achtzehn Rinder verloren. Sie hatten sich in der La Santo-Schlucht verlaufen und waren abgerutscht. Hatten jegliche Peilung verloren und waren quer durchs Gelände gestürzt. Danach machte Rodrigo niemals mehr Witze: „¡Es horrible!”
Hoffe, mir passiert das nicht. Das ginge an die Substanz. Steht ohnehin schon auf Messers Schneide mit der Farm. Vor allem, wenn ich hier im Bett liegen muss.
Am meisten aber hasse ich die Mosquitos. Die hier deutlich größer sind als in der DDR. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sie schlüpfen jedenfalls am Ufer des Rio Curacao oder in den fauligen Moorlöchern an den Eukalyptushainen. Danach ziehen sie zu uns rüber, weil sie die Rinder wittern. Riesige Schwärme. Wenn die einen erwischen! Ihre Saugrüssel kommen durch Hosen und Pullover. Besonders abends ist es schlimm oder wenn die Weibchen Eier legen und Blut brauchen. Manchmal sind es so viele, dass man von den Rindern nicht mal mehr die Augen sehen kann. Der ganze Schädel ist voll davon. Alles schwarz, alles surrt und kreist. Überall flirrende Flügel.
Zurzeit besitze ich sechsunddreißig Rinder und vier Kälber. Viel ist das nicht. Die großen „estancias“ haben mehrere Hundert, ja Tausende, mit dutzend Gauchos und ganzen Gauchodörfern, in denen ihre Familien leben, inklusive Bäcker und Fleischer.
Aber mir genügen meine Farm und mein Haus. Das Haus ist eigentlich hellrot, ohne Putz, aber der Staub hat es fast überall grau werden lassen. Deutsche Aussiedler haben es vor Jahren aus Ziegelsteinen gebaut. Mit einem Wellblechdach, das nun an einigen Stellen durchgerostet ist. Aber es regnet nicht rein, weshalb Paula und ich weiter darin wohnen können. Paula lebt bei mir. Vor fünf Jahren ist sie gekommen. Aber wir sind kein richtiges Paar, mehr eine Zweckgemeinschaft oder irgendetwas dazwischen. Mit Frauen war das bei mir immer so eine Sache.
Paula stammt von Indianern ab und kommt aus der Gegend. Darum ihre braune Haut mit dem Rotstich, die im Gesicht dunkle Flecken hat. Die sehen wie Schmutzstellen aus, ist aber von der Sonne. Sie hat grobe Wangenknochen und ihre dicken schwarzen Haare reichen ihr bis zum Gesäß. Bei der Arbeit bindet Paula sie zu einem Zopf. Und damit sie glänzen, schmiert sie Palmöl drauf. „Brillo“, sagt sie dazu. Das ganze Haus riecht nach dem Zeug. Auch ihre kleinen, eingefetteten Hände kenne ich nicht ohne diesen Veilchengeruch, der von dem Öl stammt.
Und wie lieb und fürsorglich Paula ist! Ihr warmer Blick kriecht direkt ins Herz. Das spürte ich sofort. Anders als bei meiner Mutter, die mir mit ihren Wutanfällen viel zerstörte. Oder ihre Warmherzigkeit nur nach außen hin spielte und zu Hause ihrem Zorn freien Lauf ließ.
Paula hat schmale Schultern und füllige Hüften. Eine Birnenhüfte. Sie ist zierlich, nur einen Meter fünfundfünfzig groß, mit Watschelgang, bei dem sie ihre Hüfte dreht. Ich dagegen bin einen Meter siebenundachtzig und schlank. Manchmal fühle ich mich regelrecht eckig und spitz. Als ob meine Finger Nägel und meine Ellenbogen rechte Winkel wären. Wie eine Holzgliederpuppe.
Paula redet wenig. Unterscheidet sich damit von den anderen Latinofrauen mit deren Explosionen, Kalaschnikowsprechtempo und hysterischem Geschrei. Nur wenn ihr beim Kochen etwas misslingt, meckert sie: “¿Qué haces?”oder „¡Fíjate por dónde pisas!”
Doch unglaublich, wie diese Frau kocht! Ihr Schmorfleisch mit Zwiebelsoße oder ihre Nackensteaks mit Basilikum, Honig und gelbem Chili sind „fantástico“. Wenn ich daran denke, wird mein Mund sofort feucht. In ihrer Küche darf man nichts anfassen. Da hat sie ihre Ordnung, und jeder Eingriff wird mit: „Fuera!“ kommentiert. Zudem muss alles blitzblank sein. Ich soll mir ständig mit Kernseife die Hände waschen, was sie sogar kontrolliert. „Michael nicht wie dreckig Schwein leben! Du doch ordentlicher Deutschmann“, heißt es dann. Wie soll das in der Pampa gelingen?
Kennengelernt haben wir uns 1987 über Alberto, dessen Schwester sie ist. Als ich damals meine Rinderfarm kaufte, haben wir uns auf Anhieb verstanden. Obwohl sie zwölf Jahre älter ist als ich. Sie suchte jemanden, bei dem sie bleiben konnte. Ihr Mann war gestorben. Und da sie offenbar nichts Besseres fand, blieb sie hier. Richtig war es. Ich merkte gleich, bei der Arbeit mit den Rindern packt Paula ordentlich mit an. Dabei trägt sie ihren Strohhut mit grünem flatterndem Seidenband und den blauen blumenbestickten Poncho. Obwohl das hier Männersache ist, treibt sie mit mir die Rinder, wobei sie laut „Hur, hur!“ ruft, dabei die Lippen wie bei einem Kuss spitzt und ihre merkwürdig geraden Augenbrauen weit nach oben zieht. Beim Reiten scheint sie mit dem Pferd verwachsen zu sein. Ihre Bewegungen wirken geschmeidig, natürlich und gekonnt, und man spürt, dass sie von klein auf im Sattel sitzt. Paula hilft auf der Farm überall mit, ob beim Tränken, Schlachten oder Kalben. Und so jemanden brauche ich. Ein Zuckerpüppchen, das auf seine lackierten Fingernägel Glitzersternchen klebt, oder eine launische Schnepfe mit Goldarmbändern und Schaukelohrringen, die vor anderen auftrumpfen will, nein, das wäre nichts. Mit anpacken muss man hier.
Alberto ist Gaucho und winzig. Fast so klein wie Paula. Manchmal hilft er uns. Vor allem, wenn neue Rinder kommen, die Brandzeichen nötig haben, oder eine Impfung ansteht. Denn wehe, die Rinder erwischt ein Virus! Der kann die ganze Herde wegraffen! Da heißt es aufpassen, höllisch aufpassen. Auch jetzt, da ich im Bett liege, hilft Alberto aus. Ist eben Familie.
Albertos rote Baskenmütze mit Blechansteckern, die immer etwas schief sitzt, lässt mich schmunzeln. Ohne diese Mütze habe ich ihn noch nie gesehen, und ich frage mich, was darunter ist. Aber egal. Alberto reitet wie der Teufel. Er wirft das Lasso völlig sicher, haut nie daneben und lässt kein Tier aus den Augen. Mit seinem flinken, schwarz-weiß gescheckten Lampo saust er um die Herde herum. Pfeift durch die Zahnlücke, mehrmals kurz und schnell hintereinander, und treibt mit schwingendem Seil die Tiere dorthin, wo er sie haben will. Im Reitwettbewerb der Gauchos letztes Jahr in El Puncho war er Zweiter geworden. Das war schon was. Beim Rodeo lag er senkrecht in der Luft, fiel aber nicht herunter. Meinte nur lässig: „Nada especial“, mit seiner kratzigen Stimme, die ihm seine selbstgedrehten Zigaretten eingebracht haben.
Ganz nehme ich ihm diese Bescheidenheit nicht ab. Seine Augen bekommen, wenn er so etwas sagt, einen stolzen, fast überheblichen Blick. Irgendwo las ich: „Man weist Beifall nur zurück, um noch heller zu glänzen.“ Oder so ähnlich.
Das bezieht sich auch auf die Gauchos und ihr Ego. Viele leiden, weil ihr Status von einst futsch ist. Als sie noch die Könige der Pampa und nicht die Knechte der „estancia“ waren und Rinderhüter etwas galten. Den Frust darüber lassen sie hin und wieder raus. Vor allem, wenn sie abends am Lagerfeuer einen gehoben haben. Mit billigem Rum, den sie aus ihren verbeulten, rußgeschwärzten Aluminiumtassen schlürfen, aus denen sie tagsüber Mate-Tee trinken. Dabei gestikulieren sie mit ihren lederhäutigen, sehnigen Armen und die hervorschnellenden Finger schießen wie Pfeile durch die Luft. Und ihre dunklen Augen glühen plötzlich böse und verlieren den unterdrückt traurigen oder wütenden Ausdruck, so wie am Tag ohne Rum. Dabei schreien sie und beleidigen einander. Am nächsten Tag ist meist alles wieder vergessen.
Wie auch immer. Ohne Alberto wäre ich lange am Ende, so wie Argentinien selbst 1990 beim großen Crash. Da haben viele ihre Farm verloren. Manch einer hat sich aufgehängt. Zwei Farmen weiter konnte man Lionel Torres am Hoftor baumeln sehen. Sein Geld war futsch. Alles weg. Die sind schnell am Boden, die „Argentinos“, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Oder es kippt, und sie werden „emotionale“. Da schlagen sie dann ihre Frau und Kinder blitzeblau. Nicht umsonst gibt es in Argentinien so viele Psychoanalytiker.
Aber ich muss eine Lanze für die Gauchos brechen.
Kann man sie nicht verstehen? Ständig auf sich allein gestellt. Arbeitslosengeld gibt es nur kurz und knapp. Dafür dauernd Angst vor der Pleite oder der nächsten Rinderseuche. Das nagt an einem. „Padre“- Staat sorgt kaum für sie. Da war es in der DDR besser. Aber das sieht man erst, wenn man weg ist. Freiheit ist gut, doch ohne Peso taugt auch sie nichts. Besonders mit dem „doctor“ ist es schwierig. Auf unsere Farm kommt keiner, wir sind zu weit draußen. Und wenn keine Pesos rascheln, schon gar nicht. So ist´s auch bei der „policía“. Die halten die Hand auf, wenn du was willst. Ohne Pesos – „¡Adios amigo!“ Das ist „Argentina!“ Vieles ist mir hier noch immer fremd, obwohl ich schon seit zehn Jahren aus der DDR weg bin. Das Heimweh bleibt. Besonders an den Sonntagen, wenn man weder arbeitet noch Ablenkung hat, denkt man an zu Hause. Oder wenn Geburtstag oder Weihnachten ist. Da feiert man mit Mücken und Rindern. Wo bleiben der Gänsebraten mit Äpfeln und Honigkruste von Mama und der Weihnachtsbaum? Manchmal schmücke ich mir im Dezember einen Kaktus hinter dem Haus und singe Weihnachtslieder. Ich lache dabei, doch dann laufen mir die Tränen übers Gesicht. So verloren wie ich mich fühle. Aber zurückgehen nach Deutschland? Bei meiner Vergangenheit? Unmöglich. Mir bleibt nur, Zähne zusammenbeißen und mich mit Erinnerungen an früher über Wasser halten: an das Rodeln, an die zugeschneite, glitzernde Aue vor unserem Haus, an die gefrorene Mulde, die nur in der Mitte offen blieb und magisch dampfte, und an meine Eisenbahnplatte, für die ich jedes Jahr eine Lok mit Anhänger bekam. Ob es die Platte noch gibt? Einmal schenkte mir Großvater ein Luftgewehr. Lange hatte ich darum gebettelt. Meine Mutter war allerdings dagegen. Sie kassierte es ein, und erst als ich sechszehn war, durfte ich damit schießen. Wenn mein Vater dabei war. Ob sie noch lebt?
Nur gut, dass mich Paula tröstet, wenn ich unten bin. Dabei streichelt sie mir über die Haare. Das hilft. Habe ich Paula überhaupt verdient?
Noch eine kuriose Sache gibt es: Wenn ich manchmal mit Matilde, meiner kastanienbraunen Stute, in die Pampa galoppiere, einfach so, mache ich ein Feuer, träume und sehe in die flirrende Weite. Wenn ich das nicht hätte. Es kommt vor, da singe ich da draußen Lieder. Pionierlieder, die ich noch aus der Schule kenne. Das befreit. Wirklich! Ein Lied geht so:
„Lasst euch grüßen, Pioniere, Kinder aus der ganzen Welt, ihr, in Afrika geboren, wo die Freiheit Einzug hält, ihr aus Frankreich, ihr aus Polen, ihr von Finnlands tausend Seen, ihr aus Lenins großem Lande, Tor und Herz euch offen stehen.
Sport und Spiel und Tanz und Singen, knüpfe Freundschaft tief und fest, denn aus Freundschaft wächst der Frieden, der uns glücklich leben lässt. Sprechen wir auch viele Sprachen, können wir uns doch verstehen, weil wir auf der breiten Straße, die wir Freundschaft nennen, gehen.“
Keine Ahnung, warum ich ausgerechnet dieses Lied singe. Nach ein paar Jahren hier fiel´s mir wieder ein. Ich summte die Melodie zuerst aus Spaß, und jetzt trällere ich den Text ständig. Hätte nie gedacht, dass ich mal freiwillig Pionierlieder singe. Die habe ich in der Schule, der POS Ernst-Thälmann, gehasst. Dieses Kommunistenzeug! Aber in der Pampa bekommt alles eine andere Bedeutung. Man vermisst Dinge, die man früher nicht beachtete. Ich würde sonst was für die gefüllten Knödel meiner Mutter geben. Mit Sauerkohl und Meerrettichsoße zubereitet. Mit so einer Fleischpaste im Knödel. Köstlich! Oder ihr Pflaumenkuchen mit Marzipan, Mandeln und frischer Schlagsahne. Wunderbar! Ich schmecke das noch. In solchen Momenten erscheint mir meine Flucht als gewaltiger Fehler. Hätte ich ein paar Jahre gewartet, dann hätte ich legal ausreisen können. Aber wer konnte wissen, dass die Wende kommt? Niemand. Ich wollte raus. Andere vor mir hatten es ja auch getan.
Ich muss Pause machen. Mir fällt das Luftholen zu schwer. Als ob flüssiger Beton in meiner Lunge wäre. Und ich gegen einen Widerstand atmen muss. Und dazu diese Schwüle, jetzt nach der Regenzeit. Mir wird schwindlig … Ich …
4
Es geht wieder. Hoffentlich ist das bald weg. Das muss eine Bronchitis sein.
Wo war ich stehen geblieben? Bei Karli! Danach kam die Sache bei Großvater. In den Sommerferien besuchte ich ihn regelmäßig, so auch 1970. Das war ein knappes Jahr nach dem Vorfall mit meinem Kaninchen. Heiß waren jene Augustwochen. Alles stürmte die Eisbuden, obwohl es nur zwei Sorten gab, Erdbeere und Vanille. In den Freibädern tummelte sich Jung und Alt. Jeder schwitzte. Natürlich kein Vergleich zu der Hitze hier in La Pampa.
Ich mochte meinen Großvater und fuhr gern zu ihm. Er war fast immer gut gelaunt. Den brachte nichts aus der Ruhe. Er war das Gegenteil seiner Tochter. Und der Druck auf der Brust und die Angst, die ich unterschwellig in ihrer Gegenwart oft hatte, waren wie weggeblasen. Auch war Großvater sehr klug. Er konnte alles Mögliche leicht und verständlich erklären. Besser als die Lehrer in der Schule. Wenn ich etwas wissen wollte, ging ich zu ihm. Er hatte große Ohren, sehr große Ohren, mit denen er wackeln konnte. Wie Affenohren sahen die aus, besonders wenn er seine Nickelbrille trug. Auch der Igelschnitt, das Grau der Haare und sein breites Lächeln erinnerten an ein Äffchen. Wenn er mit den Mundwinkeln nach einem Witz mehrmals nach oben zuckte und seine grauweißen Zähne zeigte, dachte man sofort an „mono“. Jeder mochte Großvater.
In Leipzig leitete er eine große Apotheke, die viele Medikamente selbst herstellte. Oft durfte ich dabei zusehen und helfen. Am meisten freute ich mich auf die Blutegel, die in großen Glasbehältern für die Krankenhäuser gezüchtet wurden. Manchmal nahm ich mir einen Wurm, setzte ihn mir auf den Arm und beobachtete, wie er sich festsaugte, wie sein muskulöser, schwarzer, glitschiger Körper mit wellenartigen Bewegungen das Blut abzapfte. Und wie er sich wehrte, sich kringelte und drehte, wenn ich ihn wieder lösen wollte. Die Egel brauchten ständig frisches Wasser. Und sie mussten umgesetzt werden, mit der bloßen Hand. Da sich die meisten Frauen in der Apotheke davor ekelten, waren sie froh, wenn ich in den Ferien kam. Das war ein Spaß!
Es war an einem Montagnachmittag, als es zurückkam. Gerade, als ich die Tiere aus dem Glas nahm, fing es an. Obwohl ich in meinem Leben schon unzählige Regenwürmer und Mistkäfer zerquetscht hatte, war es diesmal anders. In meinen Ohren summte es plötzlich. Ich war ganz aufgeregt und spürte einen inneren Druck, die Fantasien, die mir durch den Kopf schossen, umzusetzen. Darauf zerdrückte ich ein Tier nach dem anderen und zerschnitt sie mit einer Pflasterschere. Blut spritzte aus ihren schleimigen Körpern. Sie wanden sich um ihre eigene Achse und versuchten, sich an meinen Fingern festzusaugen. Doch es half ihnen nichts, sie wurden zerteilt und gekillt. Mit jedem toten Egel fühlte ich mich besser und kam in ein berauschendes Hoch. Ihr Blut verwischte ich auf den dunkelgelben, nach Desinfektionsmittel stinkenden Bodenfliesen und malte Gesichter daraus.
Plötzlich schallte eine grelle, aufgebrachte Frauenstimme in den Raum:
„Hey, Freundchen, was machst du denn?“
„Irgendetwas“, stotterte ich. Das Hochgefühl war schlagartig weg.
„Sag mal! Du kannst die Egel doch nicht ... Was wird das hier?“
Frau Schmidt schaute mich mit größer werdenden, empörten Augen an und stützte ihre Arme in die Seite. Falten zogen auf ihre Stirn. Sie starrte auf den Boden zu den Fratzen. Dann zu mir, dann wieder auf den Boden. Ich spürte, dass ich reagieren musste.
„Ich wollte das nicht.“
„Ach nein? Das ist ja …! Bist du blutrünstig?“
Sie rang nach Worten. An Frau Schmidts faltigem Hals trat eine pulsierende Ader hervor. Sie war eine langjährige Mitarbeiterin meines Großvaters. Trug eine Hornbrille auf der Nase, leicht nach vorn geschoben, und hatte grauglänzende Haare, die stets zu einer Kugel nach oben gebunden waren. Sie schob mich wütend zur Seite und sammelte wortlos die zertrennten, noch immer zuckenden Egelkörper auf. Meine Wangen glühten.
„Sagen Sie Opa nichts! Bitte!“
Sie schaute mich entsetzt an.
„Ich helfe mit saubermachen“, stammelte ich.
Mein Magen krampfte sich zusammen. Sie schwieg. Dann wurde ihr Blick plötzlich milder. „Aber nicht noch mal, mein Freundchen! Wehe, ich sehe das noch mal, dann ...!“, drohte sie und hob ihren schiefen Zeigefinger. Sie holte Besen und Eimer, ich kehrte die Reste der zuckenden Würmer hinein, und sie wischte das Blut auf.
„So etwas!", murmelte sie und verschwand. Sah mich noch einmal streng an, als sie zur Tür hinausging. Die Holzsohlen ihrer Sandalen knallten auf den Fliesen. Hallten im Raum. Ich atmete auf und hoffte, dass sie schwieg. Sie tat es.
Zwei Tage später ging ich mit Großvater in den Giftkeller. Er lag unter der Apotheke, wo es mehrere Räume und Verhaue gab.
Die Apotheke befand sich in einem gelben Backsteinziegelhaus. Über der Eingangstür hing ein goldener Adler mit schlagenden Flügeln und schreiendem Schnabel. Darunter stand in altdeutscher Schrift „Adler-Apotheke". In den Fluren, im Treppenhaus und in den Zimmern roch es nach verbranntem Spiritus und nach dem süßen Hustensaft, den sie dort brauten. Einen mit Lakritze.
Im Giftkeller lagerte Großvater all die Stoffe, die er für seine Medikamente brauchte. Weshalb der Raum verschlossen war. Nur Großvater besaß einen Schlüssel und Frau Schmidt.
„Martin, hier gehst du nie alleine rein! Ist das klar?“ Er sah mich ernst an.
„Wegen dem Gift?“
„Richtig, hier lagern wir es.“





























