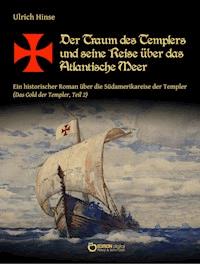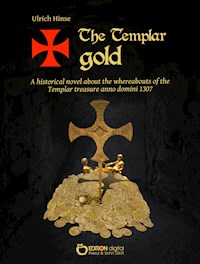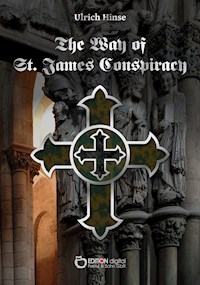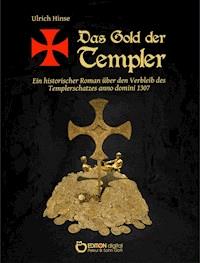
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Gold der Templer
- Sprache: Deutsch
Jaques de Molay, der Großmeister des in der ganzen Welt des Orients und des Okzidents bekannten, geschätzten aber auch gefürchteten Templerordens war entsetzt. Sein Orden sollte aufgelöst, die Ritter verhaftet werden und das riesige Vermögen der französischen Krone zufallen. Die Haftbefehle waren bereits ausgestellt und an alle Gouverneure und Bischöfe in Frankreich verteilt worden. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, sollen in den Morgenstunden überall im Land die Vasallen des Königs jeden Templer festnehmen und einkerkern. Alle Templer zu retten scheint dem Großmeister nicht mehr möglich. Deshalb stellt er in aller Eile drei Maultierkarawanen zusammen, die mit wenigen Leuten das Archiv und das Gold in Sicherheit bringen sollen. Eine Karawane ist für England bestimmt, eine soll über See nach Portugal gehen und eine weitere auf die Festung der Templer nach Ponferrada in Spanien gebracht werden. Der junge flandrische Tempelritter Jan van Koninck hat zusammen mit dem Stellvertreter des Großmeisters die Ehre, die Karawane nach Spanien in Sicherheit zu bringen, als in den Pyrenäen sein Mentor erschlagen wird. Die Verantwortung lastet ab sofort auf seinen Schultern. Gelingt es ihm wirklich, die kleine Karawane gegen alle Widerstände im Winter über die Pyrenäen zu bringen und Ponferrada zu erreichen? Eine stattliche Anzahl französischer Soldaten, geführt von einem alten Landsknecht, hat sich auf seine Spur gesetzt. Und auch innerhalb der sonst eingeschworenen Templer gibt es Widerstände. Es erscheint mehr als fraglich, das Gold vor dem gierigen französischen König Philipp IV. und seiner nicht viel besseren Frau Johanna von Navarra in Sicherheit zu bringen. Ein Roman aus der Zeit des finsteren Mittelalters, in der es ehrenhafte Ritter aber ebenso viele Schurken gab. 699 Jahre später versucht in dem Roman „Das Jakobsweg-Komplott“ eine skrupellose Gruppe, das Gold zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Ulrich Hinse
Das Gold der Templer
Ein historischer Roman über den Verbleib des Templerschatzes anno domini 1307
ISBN 978-3-86394-601-2 (E-Book)
ISBN 978-3-86394-603-6 (Buch)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital ® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Die Glocken am Kirchturm der Stadt Kortrijk in Flandern läuteten. Dumpf wummerte ihr Klang über das Schlachtfeld. Sie verkündeten den glanzvollen Sieg der Flandern gegen die Franzosen. Jan van Koninck, der zweiundzwanzigjährige junge Mann mit den gekräuselten roten Haaren, den blauen Augen und der kräftigen, durchtrainierten Figur unter dem jetzt Blut bespritzten ledernen Wams, stand etwas gebeugt, auf sein blutiges Schwert gestützt, am Rande eines Eschenwäldchens. Eine Wurfaxt, die schon aus normannischer Zeit bekannte Franziska, steckte im Gürtel. Er schaute auf die Szene vor ihm in der Niederung. Dicht gedrängt vor einem Bach, der sich durch die morastige Senke schlängelte, lagen Hunderte von toten Rittern in ihren ehemals glänzenden, jetzt nach der Schlacht aber stumpfen, blutigen Rüstungen und ebenso viele tote oder schwer verletzte Pferde.
Jan summte ein leises Lied. Es war das Totenlied für die Ritter des französischen Königs Philipp des Schönen, der selbst nicht an dem Massaker teilgenommen hatte. Der Sieg war ohnehin eingeplant. An eine Niederlage war nicht im Entferntesten gedacht worden. Deshalb hatte er seinen einäugigen Kanzler Pierre Flote als Feldherrn gesandt und Jaques de Chatillon als zukünftigen Gouverneur gleich mitgeschickt. Die unruhigen Flandern sollten zur Raison und der lukrative Tuchhandel mit England und der Hanse unter französische Kontrolle gebracht werden.
Aber es war dann doch anders gekommen. Fast alle nordfranzösischen Ritter hatten ihr Leben für den König auf dem Schlachtfeld lassen müssen, nur wenige waren entkommen.
Über das Schlachtfeld mit den unzähligen Toten und Schwerverletzten wuselten unzählige junge und alte zerlumpte Menschen und Bürger aus Kortrijk, die den Toten und Sterbenden ihre Wertgegenstände abnahmen. Van Koninck nestelte an seinem Wams. Mit etwas Mühe zog er den goldenen Anhänger hervor und betrachtete ihn. Er war, wie die Kette auch, aus purem Gold. Langsam strich er mit seinen Fingern über das Wappen. Ein französisches Wappen, ein Königswappen, was die drei Lilien verrieten. Er hatte es einige Monate vorher von einem französischen Ritter bekommen, der den Aufstand der flämischen Bürger in Brügge gegen die französische Besatzung nicht überlebt hatte. Eigentlich hatte er den verletzten Franzosen aus Wut töten wollen, weil er durch seine Gegenwehr die Flucht des Gouverneurs Jaques de Chatillon ermöglicht hatte. Hasserfüllt hatte Jaques de Chatillon noch zurückgerufen, dass er schon allein deshalb zurückkommen würde, nur um ihm eigenhändig den Kopf abzuschlagen. Der verletzte Ritter hatte sich mit Mühe die Kette mit dem Wappen abgenommen und dem jungen Flandern gegeben. Vielleicht bringt es dir irgendwann einmal Glück, hatte der Franzose gemurmelt, dann war er verschieden. Jan hatte das Medaillon zwar genommen, aber sonst hatte ihn der nach seiner Kleidung offensichtlich adelige Franzose nicht weiter interessiert. Er hatte ihn in seinem Blut liegen lassen und war den anderen flüchtenden Franzosen hinterhergelaufen.
Sein Vater Pieter, sein Bruder Wim und er, der jüngste Sohn des Webers Pieter van Koninck, waren kurz darauf wegen ihres Mutes und ihres verwegenen Vorgehens bei der Befreiung von Flandern von Robert von Bethune, dem Grafen von Flandern, zum Ritter geschlagen worden.
Dieses Mal war ihm de Chatillon nicht entkommen. Selbstgefällig war er in die Falle geritten und im sumpfigen Ufer des kleinen Flüsschens vor Kortrijk stecken geblieben. Seine Rüstung war zu schwer, als dass er hätte problemlos absitzen und mit dem Schwert kämpfen können. Das war sein Todesurteil. Die flämische Infantrie war dem schwerfälligen Ritter zu Fuß deutlich überlegen und Jan van Koninck hatte genau aufgepasst, wo Jaques de Chatillon hingeritten war. So kreuzten sich auf dem Schlachtfeld ihre Wege erneut. De Chatillon erkannte sofort, wer sich ihm in den Weg stellte, und versuchte mit kräftigen Schwerthieben, dem Jüngsten der Koninck-Sippe den Garaus zu machen. Aber der flinke, junge Flame wich allen Hieben geschickt aus, wehrte mit seiner Wurfaxt und dem Schwert die Hiebe ab und ließ den Franzosen sich müde schlagen. Wobei Jan höllisch aufpassen musste. Die Fechtkunst von de Chatillon war legendär. Aber dazu gehörte natürlich auch, dass sich der Ritter schnell und trickreich bewegen konnte. Aber genau das fehlte hier. Nur wenige Schritte gelangen dem schwer gerüsteten Ritter im Sumpf. Er sank immer tiefer ein und konnte sich nur noch auf einem Fleck stehend verteidigen, während Jan in seiner leichten Kleidung um ihn herumstapfte. Wenn er in seinem Rücken stand, hatte er Mühe, seinen Gegner durch die Sehschlitze zu erkennen. Als einige weitere Franzosen heranritten, um dem Gouverneur zu Hilfe zu eilen, machte Jan dem Kampf ein schnelles Ende. Er wehrte einen Schlag des Franzosen mit seiner Franziska ab und stieß ihm mit der ganzen Kraft seines rechten Arms das Schwert von unten durch den Rüstungsschlitz zwischen Helm und Harnisch in den Hals. Augenblicklich sackte de Chatillon zusammen und starb. Mit einem Ruck zog Jan sein Schwert aus dem Körper des Sterbenden, um die heranreitenden Franzosen abwehren zu können. Aber als die sahen, dass Reiten in dem Sumpf nicht möglich und ihr Anführer bereits gestorben war, zügelten sie die Pferde und ritten auf festen Untergrund zurück. Jan nahm noch an dem einen oder anderen Scharmützel teil, aber der so ungleich begonnene Kampf war letztlich zugunsten der Flandern entschieden. Das, was niemand zu glauben gewagt hatte, war eingetreten. Die bürgerlichen flandrischen Infanteristen hatten mit ihren selbst gebastelten Waffen gegen die Truppe aus hochdekorierten, gut gerüsteten französischen Rittern gewonnen. Die Ritter waren nicht zuletzt an ihrer Arroganz gescheitert. Flandern war unabhängig geblieben und musste sich Philipp dem Schönen nicht beugen.
Sicherlich hatte es bei den flämischen Fußknechten einen hohen Blutzoll gegeben, aber die tapfer kämpfenden Franzosen wurden unter die Wälle der Stadt Kortrijk getrieben, wo ihre Pferde in den Ronduitebach stürzten oder im Uferschlamm versanken. Sie konnten sich nicht durch Überlaufen retten, denn die Ritter wurden alle an ihren Wappen erkannt und von den Fußknechten niedergemacht. Dem letzten Rest, der sich im Kreis aufgestellt hatte, um die wütenden Angriffe der Flandern abzuwehren, wurde vom Grafen Robert van Bethune ein Angebot gemacht, sich zu ergeben, und Thibaut, der Herzog von Lothringen, nahm das Angebot an. Ein Teil der Flandern murrte zwar, beugte sich aber der Entscheidung ihres Grafen.
Nur eine kurze Zeit wurden noch die flüchtigen Franzosen verfolgt, dann wandten sich die Flandern dem französischen Lager zu, um es zu plündern.
Etwas abseits befand sich das Eschenwäldchen, zu dem Jan gegangen war, nachdem er Jaques de Chatillon vom Leben zum Tode befördert hatte. Jetzt, nachdem alles vorbei war, stellte er fest, dass er sich nicht freuen konnte. Weder am Tod des verhassten Gouverneurs noch am Sieg über das französische Ritterheer. Er suchte auch nicht nach seinem Vater oder seinem Bruder, die irgendwo auf dem Schlachtfeld lagen oder sich bei den Siegern befanden, die sich gerade über das Lager der Franzosen hermachten.
Jetzt, wo der Kampf zu Ende war, starrte er auf den furchtbaren Anblick. Mit einem leichten Schauder sah er die vielen Leichen von Menschen und Pferden, die mit Fahnen und verschiedensten Waffen wirr durcheinander lagen. Hier und da sah man einen Sterbenden, den Arm bittend nach Hilfe ausgestreckt. Und zu allem gesellten sich das dumpfe Wiehern und Röcheln sterbender Pferde und die jauchzenden Siegesrufe der siegreichen Flandern.
Während Jan, das Medaillon streichelnd, die schreckliche Szene betrachtete, hörte er ein Stöhnen, das aus einem Knäuel gefallener Franzosen und Pferde herüberklang. Jan steckte sein Schwert in den Gürtel und suchte. Nachdem er einige Leichen beiseitegeschafft hatte, fand er einen sterbenden flämischen Ritter. Er lag ausgestreckt auf dem Rücken, ganz mit Blut bedeckt. Mit der rechten Hand hielt er sein Schwert umkrampft, als wollte er weiterkämpfen. Seine bleichen Gesichtszüge ließen den nahen Tod erahnen. Jan erkannte Gerald van Nieuwland, der mit ihm zusammen zum Ritter geschlagen worden war.
Jan löste den Riemen des Harnisches und hob den Kopf des Sterbenden aus dem Schlamm. Er ließ sich von einem der vorbeihastenden Flandern etwas Wasser geben und befeuchtete Geralds Lippen. Dankbar schluckte der schwer Verletzte. Der junge van Koninck erkannte, dass der Bolzen einer Armbrust Gerald durch den Harnisch in die rechte Brust geschlagen war und ein Schwerthieb das halbe rechte Bein abgetrennt hatte. Der Blutverlust musste enorm und die Schmerzen fürchterlich sein.
«Du bist ein guter Kerl, Jan», flüsterte Gerald van Nieuwland, «hier in Flandern hast du keine Zukunft. Hier bleibst du immer nur der jüngere Bruder. Du hast ein mitleidiges Herz. Geh zu den Templern. Da bist du richtig.»
Mühsam hatte van Nieuwland die Worte hervorgequält. Jan sah ihn ausdruckslos an. Natürlich hatte er von den Templern gehört, aber sich bisher keine Gedanken gemacht. Vermutlich weil es zumeist französische Ritter waren, die dem Orden angehörten. Warum sollte er ausgerechnet zu denen gehen. Als wenn Gerald seine Gedanken gelesen hätte, fuhr er leise und stoßweise fort:
«Der Orden ist unabhängig und jeder ist gleich. Bleibst du in Flandern, bist du immer der Jüngste und hast zu tun, was Vater und Bruder dir vorschreiben. Geh zu den Templern.»
Der Sterbende keuchte und hustete Blut. Mit einer Bewegung deutete er an, dass Jan ihm den Brustharnisch komplett entfernen sollte. Vorsichtig löste er die Riemen und zog den Blechpanzer ab.
Als er dabei den Armbrustbolzen aus der Wunde zog, verdrehte Gerald die Augen und wurde ohnmächtig. Jan betupfte die Stirn des ritterlichen Freundes mit Wasser und wartete geduldig, bis er wieder zu sich kam. Als er die Augen wieder aufschlug, nahm er seinen gesunden Arm und hielt sich am Lederwams von Jan fest. Er zog den Freund nah zu sich herunter.
«In meiner Brusttasche», stöhnte er leise und versuchte mit der verletzten Hand auf seine Brust zu zeigen, «nimm es und zeige es den Templern.»
Als wenn ihn die letzten Worte den Rest seiner Lebenskraft gekostet hätten, atmete Gerald van Nieuwland noch einmal tief durch, dann starb er in den Armen seines jungen Freundes. Jan drückte ihm die Augen zu und murmelte ein Gebet. Dann fasste er dem Toten in die Brusttasche und zog ein kleines Siegel hervor. Auf der einen Seite befand sich das bekannte Templerkreuz, auf der anderen Seite saßen zwei Reiter hintereinander auf einem Pferd. Den Rand bildete ein Text. Sigillum Militum Christi - Siegel der Soldaten Christi - las Jan, schüttelte verwundert den Kopf und steckte das Siegel ein. Dann verließ er langsam das Schlachtfeld, um sich in Kortrijk nach einer Unterkunft umzusehen.
Er streifte durch die Stadt. Der Freudentaumel des Sieges war umfassend. Überall tanzten und sangen Fußknechte und Handwerker und schütteten sich Bier und Wein - und was sonst noch alles an Trinkbarem erreichbar war - in sich hinein. Jan suchte nach seinem Vater und seinem Bruder, fand sie aber nicht. Vielleicht war es auch ganz gut so. Sie hätten wahrscheinlich kein Verständnis dafür gehabt, wenn er ihnen eröffnet hätte, ausgerechnet jetzt nach Paris zu wollen. Er kramte einige Münzen hervor und kaufte von einem stark angetrunkenen Fußknecht einen französischen Hut, den dieser im Lager des Feindes erbeutet hatte. Darunter wollte er seine feuerroten Haare verstecken, die ihn möglicherweise auf dem Weg in die französische Königsstadt hätten verraten können. So ausstaffiert, lief ihm doch noch sein Bruder über den Weg.
«He, Bruder, wie siehst du denn aus? Vater und ich haben dich beim Fest der Weber vermisst. Wir feiern unseren großartigen Sieg.»
Jan nickte.
«Das dachte ich mir, dass ihr feiert. Und was ist mit den vielen Toten?»
„Ach, lass die doch auf dem Schlachtfeld verrotten. Was kümmern uns die toten Franzosen.“
„Bruder, die sind mir auch egal. Was ist mit den vielen Flandern, die ihr Leben für die Freiheit unseres Landes gegeben haben. Die verdienen es nicht, dort draußen zu verrotten.“
„Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die Toten zu beerdigen», brummte Wim van Koninck. Diese Ignoranz regte Jan auf.
„Weißt du Bruder, wir sind zum Ritter geschlagen worden und das heißt, dass wir auch Barmherzigkeit zeigen müssen. Das, was du und Vater zeigen, ist das Gegenteil davon. Ich hab Gerald van Nieuwland gefunden und es war traurig, wie unser Freund auf dem Schlachtfeld ums Leben gekommen ist. Kein Mensch kümmert sich um seine Leiche. Das ist nicht in Ordnung.“
Wim sah seinen Bruder erstaunt an, dann fing er an zu grinsen.
„Ich glaube es nicht. Was ist denn in dich gefahren? Willst du deinen Weberberuf an den Nagel hängen und Pfaffe werden? Das muss ich Vater erzählen. Was glaubst du, was er dir dazu sagt?“ Laut lachend verschwand Wim in der Menge, um nur wenige Minuten mit Pieter van Koninck wieder zu erscheinen. Er hatte den Vater am Schulterriemen gefasst und zog ihn so durch die Menge. Man sah auf den ersten Blick, dass Pieter van Koninck nicht mehr nüchtern war.
„Ah, da bist du ja, mein Sohn“, brüllte der Innungsmeister der Weber seinem Jüngsten schon von Weitem entgegen, „was habe ich gehört? Du willst Pfaffe werden? Das kommt überhaupt nicht infrage. Das gestatte ich nicht. Du bist nicht zum Ritter geschlagen worden, um in der Kirche fromme Lieder zu singen. Ich befehle dir, sofort mit uns zu kommen.“
Kaum hatte Vater van Koninck die letzten Worte gebrüllt, schlug er auch schon lang hin. Mitten in den tiefen Straßendreck. Er war offenbar über sein Schwert gefallen, das ihm zwischen die Beine geraten war. Über und über war er mit Matsch besudelt. Mit Mühe zog Wim seinen Vater aus dem Straßenkot. Als Dank schlug ihm der Alte mit der Faust ins Gesicht. Dadurch, dass Wim sich schnell beiseite gedreht hatte, traf ihn die Faust nicht voll.
„Wo ist Jan?“, brüllte der Alte erneut, „ich will mit ihm reden.“
Jan hatte die Szene mit Widerwillen betrachtet. So hatte er seinen Vater noch nie erlebt. Bisher war er immer ein liebevoller und rücksichtsvoller Mann gewesen. Aber der Sieg schien ihm ebenso wie das Bier zu Kopf gestiegen zu sein. Jan schob zwei Landsknechte zur Seite und stellte sich vor ihn.
„Sollten wir mit dem Reden nicht warten, bis du wieder nüchtern bist?“, versuchte Jan sich dem Gespräch zu entziehen.
„Was erlaubst du dir? Mir Vorschriften zu machen, wann und wie ich mit dir, meinem Sohn, reden will? Komm sofort zu mir und mache den Kniefall vor deinem Vater oder du bekommst von mir Prügel, dass dir Hören und Sehen vergeht.“
Etliche Menschen auf der Straße waren stehen geblieben. Teils aus Respekt vor dem Meister der Weber, teils aus Neugier, was denn noch so kommen könnte.
„Meinen Respekt hast du, Vater», antwortete Jan van Koninck kühl auf das väterliche Gebrüll, „einen Kniefall bekommst du von mir nicht. Ich gehe ab sofort meine eigenen Wege. Als Weber wirst du auf mich verzichten müssen. Ich habe ohnehin nichts zu erwarten, denn die Weberei wird Wim erben. Was bleibt mir? Euer Knecht zu sein? Nein, das ist nicht das Leben, das ich mir erträumt habe. Dafür habe ich nicht für die Freiheit unseres Volkes gekämpft und mein Leben eingesetzt. Ich gehe nach Paris.“
„Wohin gehst du? Nach Paris? Zum Feind? Das gestatte ich nicht.“
„Vater, du hast mir nichts mehr zu gestatten. Ich gehe nicht zum Feind und ich werde mich auch nicht König Philipp anschließen. Aber hier bleibe ich auch nicht.“
Pieter van Koninck wankte mit unterlaufenen Augen auf seinen jüngsten Sohn zu. Kurz bevor er ihn erreichte, zog er sein Schwert aus der Scheide und hob es über den Kopf.
„Bevor du nach Paris gehst, schlage ich dir eigenhändig den Kopf ab“, schrie van Koninck zornesrot, während sein Sohn Wim versuchte, ihm das Schwert zu entreißen und auch einige andere Leute, die den Streit miterlebten, stellten sich van Koninck in den Weg.
„Lasst es gut sein, Meister,“ versuchte einer aus der Metzgerinnung den Weber zu beruhigen. Als der weiter auf seinen Sohn eindrang, rang ihm der Metzger das Schwert aus der Hand und gab es Wim.
„Junge, sieh zu, dass du deinen Vater ins Quartier bringst, damit er kein Unheil anrichtet», sagte der bärenstarke Metzger und half, den in sich zusammensinkenden Weber beiseite zu schleppen.
Mit Entsetzen hatte Jan bewegungslos die Szene verfolgt. Sein Vater hätte ihn beinahe erschlagen. Sicher war er betrunken, aber so weit hätte er nicht gehen dürfen. Jetzt war ihm klar, dass Gerald van Nieuwland Recht gehabt hatte. Hier in Flandern gab es für ihn keine Zukunft mehr. Deshalb nahm er seinen Hut, drehte sich um und verließ Kortrijk, ohne sich von Vater und Bruder zu verabschieden. Er machte sich auf den Weg nach Paris.
Die Strecke bis Lille kannte Jan. Von dort hatte er vor gut einem Jahr die Ritter um Jaques de Chatillon abgeholt und nach Schloss Wynendael geführt. Freiwillig hatte er das damals nicht getan und den einen oder anderen Umweg mit eingebaut. De Chatillon hatte sich irgendwann in einem engen Hohlweg an einem Brombeergebüsch leicht gekratzt, seinen rechten Ärmel zurückgestreift und gesehen, dass ihm ein Dorn die Haut verletzt hatte. Obwohl es keine große Sache war und die kleine Verletzung von ihm selbst verursacht worden war, hatte de Chatillon auf den Flandern geschimpft.
„Ich glaube, der Junge führt uns absichtlich durch solch schauderhafte Wege. Ich denke, ich werde ihn am nächsten Baum aufknüpfen. Komm einmal näher, du Lump“, hatte er gerufen und Jan zu sich gewunken. Der aber war zurückgewichen und es sah aus, als wenn er flüchten wollte. De Chatillon war noch ägerlicher geworden und hatte seine Knappen aufgefordert, den Jungen zu fangen und am nächsten Baum aufzuhängen. Da erst war ein zweiter Ritter eingeschritten und hatte die Aktion gestoppt.
„Schluss jetzt mit diesem Theater, de Chatillon. Reißt Euch am Riemen. Wir müssen nach Wynendael, und zwar heute noch. Also reitet und lasst den Flandern am Leben.“
Der Ritter, der de Chatillon zur Ordnung gerufen hatte, war ein stattlicher Mann mit einem weißen Mantel und einem roten Tatzenkreuz unter der linken Schulter. Der Franzose hatte zwar noch ein paar Einwände, um sich ohne Gesichtsverlust aus der Angelegenheit zu lösen, gab dann aber knurrend nach, nicht ohne noch eine Drohung zuzurufen.
«Wenn wir uns wiedersehen, wirst du es nicht überleben.“
„Wir werden ja sehen“, hatte Jan geantwortet und war im dichten Wald verschwunden, während die Ritter fluchend ohne Führer weiterreiten mussten.
Jetzt, wo er genau diesen Weg allein zurückging, mit einem neuen Ziel vor Augen und ohne sich von Vater und Bruder verabschiedet zu haben, ging er natürlich direkt und ohne Umweg. Von der Mutter konnte er sich nicht verabschieden. Sie war schon lange tot. Bei seiner Geburt war sie gestorben. Und obwohl sie ihm das Leben geschenkt hatte, empfand er nichts für sie. Sie war für ihn nicht da. Die Magd Marie, die ihn und auch seinen Bruder großgezogen hatte, war inzwischen auch verstorben.
Die Sonne war gerade im Osten aufgegangen, rot leuchtend und umrandet von Regen verheißenden Wolken. Noch aber war es trocken und so schritt er kräftig aus. Verschiedenen Reitertrupps, die er frühzeitig erkannte, wich er in die Gehölze links und rechts des Weges aus. Deshalb wusste er nicht, ob es Franzosen, Engländer oder Flandern waren. Gegen Abend hatte er die Gegend um Lille erreicht. In einem steinernen Gasthaus kehrte er ein und nachdem der Wirt sich überzeugt hatte, dass der junge Mann im ledernen Wams und dem großen Schwert an der Seite kein Wegelagerer, Räuber oder Dieb war und eine Unterkunft auch bezahlen konnte, wischte er an einem Tisch draußen im Hof die Essensreste weg und stellte einen Humpen mit Bier und ein Stück Brot auf den Tisch. Dann trollte er sich wieder in seine Schankstube. Während Jan in den Abendhimmel starrte und darüber nachdachte, ob es noch regnen oder trocken bleiben würde, kam ein kleiner Reitertrupp in den Hof. Der Kleidung nach war es ein Templer mit einigen Getreuen und mehreren Pferden. Sofort stürzte der Wirt mit einigen Knechten auf den Hof und nahm den Templern die Pferde ab. Der Ritter mit dem weißen Mantel lachte und hieb dem Gastwirt freundlich die rechte Hand auf die Schulter. Obwohl der Wirt kein schmächtiger Mensch war, knickte er doch merklich ein, was den Ritter noch mehr belustigte.
„Bringe er uns gut zu trinken und noch besser zu essen und dann lasse er uns zufrieden“, erklärte der Weißmantel und setzte sich an den Nebentisch, ohne Jan zu beachten. Nachdem die Getreuen des Ritters das umfangreiche Gepäck versorgt hatten, setzten sie sich wie selbstverständlich mit an den Tisch, sehr ungewöhnlich für eine Zeit, wo Herren und Knechte immer getrennt saßen. Was sie sich dort erzählten, konnte Jan nicht verstehen, obwohl er sich alle Mühe gab.
Jan kramte nach dem Siegel, das er in seiner Brusttasche stecken hatte. Erst etwas unsicher, dann etwas forscher spielte er mit dem münzähnlichen Siegel.
Wie von selbst rollte das plötzlich vom Tisch herunter, hüpfte über die gepflasterten Steine und blieb vor dem Fuß des Ritters liegen. Der hatte den Vorfall gar nicht bemerkt. Erst einer seiner Getreuen machte ihn durch ein Nicken des Kopfes darauf aufmerksam. Er bückte sich und klaubte den Gegenstand auf. Erstaunt zog er die Augenbrauen zusammen, als er erkannte, was er aufgehoben hatte. Dann drehte er sich um.
„Euch ist etwas heruntergefallen“, sagte er mit einem merkwürdigen Unterton in der Stimme, „seid Ihr sicher, dass es rechtmäßig Euch gehört?“
Jan bekam einen Kloß in den Hals und nahm allen Mut zusammen, dem Ritter so zu antworten, dass der seine Anspannung nicht merkte.
„Ja, edler Herr, das Siegel gehört mir. Ich erhielt es von meinem Freund Gerald van Nieuwland.“
„Ach, wirklich? Warum sollte Bruder Gerald gerade Euch dieses Siegel geben? Ihr habt es ihm gewiss gestohlen. Deshalb werde ich es behalten.“
„Nein, mein Herr, das Siegel gehört mir und ich will es von Euch wieder zurück.“ Fordernd hielt Jan dem Ritter seine Hand vor die Brust. Der schaute erst verwundert auf die Hand, dann auf Jan van Koninck.
„Holla, genug Mut habt Ihr ja. Aber bevor ich Euch das Siegel zurückgebe, will ich genau wissen, wie und wann ihr es erhalten habt. Und keine Lügen.“
Jan schluckte einen Moment, dann trank er aus seinem Krug einen Schluck und begann seinen Bericht über die Schlacht von Kortrijk, den Tod seines Freundes Gerald und das Geschenk, was ihm der sterbende junge Ritter gemacht hatte. Und was er damit wollte.
Der Templer hatte zugehört, ohne ihn zu unterbrechen. Auch seine Gefährten hatten interessiert dem Bericht gelauscht. Als Jan geendet hatte, streckte er erneut die Hand aus.
„Kann ich mein Siegel jetzt wiederhaben. Ich schulde es meinem Freund, dass ich nicht leichtfertig damit umgehe.“
Der Ritter lachte.
„So, so. Nicht leichtfertig damit umgehen. Und was hat dazu geführt, dass es mir vor die Füße rollte?“
„Das habe ich so gewollt.“
Erstaunt lehnte sich der Ritter zurück.
„So, so, das hat er so gewollt?“, äffte er den jungen Mann nach.
„Ja, edler Herr, ich möchte zu den Templern und sah darin eine Möglichkeit, mit Euch ins Gespräch zu kommen.“
„Seht her, Brüder“, rief der Templer seinen Gefährten zu, „er will zu den Templern und treibt sein Spiel mit mir. Was sagt ihr dazu?“
„Ist er ein Ritter oder ein Handwerker?“, rief einer der Gefährten, die mit dem Templer an einem Tisch saßen.
„Ich bin beides“, erklärte Jan, „ich habe Weber gelernt und wurde vom Grafen Robert von Bethune zum Ritter geschlagen. Zusammen mit meinem Freund Gerald van Nieuwland, meinem Bruder und meinem Vater und dann haben wir gegen die Franzosen gekämpft.“
„Ja, ja, ich habe gehört. Die französischen Ritter haben den Streit mit euch Flandern überraschend verloren. Respekt. Das hatte niemand erwartet“, und dann grinste der Templer, „und Philipp der Schöne schon gar nicht. Kommt her, setzt Euch zu uns an den Tisch. Ich werde Euch ein wenig von unserem Orden erzählen und dann entscheidet, ob Ihr mit uns reitet. Wir wollen nach Paris, in die dortige Komtur, unseren Temple.“
Jan erhob sich, nahm seinen Krug und das Brot und setzte sich zu den Templern. Der Ritter mit dem weißen Mantel und dem roten Tatzenkreuz unter der linken Schulter grinste. Er schlug Jan auf die Schulter.
„Weißt du, mein Freund“, sagte er und trank einen kräftigen Schluck Wein aus dem Becher, der vor ihm stand, „wir Tempelritter sind alle Individualisten. Wir pfeifen auf die Gesetze aller weltlichen Herrscher, halten uns aber streng an unsere eigenen Regeln. Unser Name und unser Tatzenkreuz symbolisieren Freiheit, sie sind unser Warenzeichen. Wir sind geachtet und gefürchtet. Wir sind zwar ein Mönchsorden, aber gleichzeitig Abenteurer und vor allem geschickte Geschäftsleute. Nicht nur die wenigen adeligen Ritter, auch viele zu Rittern aufgestiegene Handwerker und bewaffnete Knappen haben sich im Orden zusammengefunden. Bezahlt werden wir mit einer Währung, für die Männer besonders empfänglich sind. Mit Macht. Die Mehrzahl von uns, und das sage ich in voller Freizügigkeit, sind Typen, die ohne Tatzenkreuz auf der linken Schulter abgehalfterte Herumtreiber wären, die irgendwann einmal am Strick des Henkers geendet hätten. Stattdessen erhalten wir Ehrerbietung und Respekt. Wer kann, geht uns aus dem Weg und legt sich nicht mit uns an. Unser weißer Mantel leuchtet auch in der Dunkelheit. Das schreckt Gesindel und Räuber ab. Aber es hat einen Nachteil. Wer uns finden will, der findet uns.“
„Der weiße Mantel hat aber auch einen Vorteil“, wandte Jan ein.
„Und der wäre?“, knurrte der Templer.
„Wer Euch finden will, der findet Euch.“
Einen Moment dachte der Ritter verdutzt nach. Dann schlug er sich mit einem lauten Lachen auf den Schenkel.
„Mein junger Freund, Ihr habt Humor. Das schätze ich. Ich nehme Euch mit nach Paris. Ihr bekommt eines meiner Pferde und müsst nicht mehr durch den Dreck der Straße laufen. Aber Ihr habt Euch noch nicht vorgestellt. Wer seid Ihr?“
„Ich bin Ritter Jan van Koninck, der Sohn von Ritter Pieter van Koninck, dem Führer der Weberinnung in Flandern, und Bruder von Ritter Wim van Koninck.“
„Recht so, Ritter Jan, Ihr seht zwar nicht wie ein Ritter aus, aber ich will Euch das erst einmal glauben“, antwortete der Templer, stand auf und deutete eine leichte Verbeugung an, „und ich bin Ritter Guido de Voisius aus Rennes le Château, einem kleinen Ort in den Pyrenäen. Ich bin der Seneschall des Ordens und vertrete unseren Großmeister Jaques de Molay hier in Frankreich. Und die Gefährten mit den braunen Mänteln sind Sergeanten unseres Ordens. Der im schwarzen Umhang ist unser Kaplan. Sie sind wie meine Brüder.“
Dann wies er auf einen jüngeren Mann, der ein paar Plätze weiter saß.
„Und das ist Johann Laurenz. Er ist mein direkter Mitstreiter. Er ist der Sohn eines Baders aus Aachen und schon einige Zeit bei uns im Temple in Paris. Er wird dir mein zweites Pferd übergeben, damit du nicht hinter uns herlaufen musst. Es ist nicht gut, wenn ein Ritter zu Fuß nach Paris kommt.“
Der Gefährte, der Johann Laurenz genannt wurde, deutete eine leichte Verbeugung an und lächelte.
„Morgen früh bei Sonnenaufgang geht es weiter. Rothaar, seid pünktlich, sonst reiten wir ohne Euch“, mahnte der Sergeant. Sie wechselten noch einige Worte, dann verzogen sich alle auf ihre Nachtlager. Jan fiel die Disziplin der Männer auf. Keiner betrank sich, keiner ging eigene Wege. Eine Truppe wie aus einem Guss, stellte er fest. Und dann konnte er nicht schlafen. Unruhig wälzte er sich auf seinem Strohlager hin und her und so war er zum Sonnenaufgang unausgeschlafen, aber pünktlich auf dem Hof.
Auf ein Zeichen des Seneschalls setzte sich der kleine Zug in Bewegung und ritt aus dem Tor. Dort erlebte Jan eine Überraschung. Es warteten etwa zwanzig Knechte mit vier großen Englischen Wagen. Die Wagen waren zu groß gewesen, um in den Hof der Gaststätte hineinzufahren, und standen deshalb vor dem Tor.
Der Englische Reisewagen des Mittelalters war ein großer Planwagen mit vier großen Holzrädern mit je sechs Speichen, fünfzehn bis zwanzig Ellen lang, einem Leiterwagen ähnlich, mit einer Rundplane, in die Fensteröffnungen eingeschnitten wurden, die mit Vorhängen fest verschlossen werden konnten. Vom Kutschbock konnte man den Innenraum betreten. Nach hinten führte eine einziehbare Leiter hinunter. Er wurde je nach Fracht von zwei oder vier Pferden, Maultieren oder großen französischen Eseln gezogen. Die Templer hatten vier Pferde vor jeden Wagen gespannt.
Der Zug der Wagen und Reiter bewegte sich langsam Richtung Paris. Sie hatten es nicht eilig. Ein Fußgänger war nicht viel langsamer und so dauerte es einige Tage, bis sie die Häuser der Stadt an der Seine sahen und den Temple erreichten. Aber die Reise verlief ohne Vorkommnisse, die auch keiner besonderen Erwähnung bedurften. In den Pausen unterrichtete Guido de Voisius den neuen Templeranwärter in den Dingen, die ein Tempelritter unbedingt wissen musste, um vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft zu werden. Und immer wieder die Frage, ob er sich das auch wirklich antun wolle. Und genauso oft nickte Jan zustimmend.
Gelegentlich sah Jan, wie der Aachener Badersohn dem einen oder anderen Gefährten bei Verletzungen half. Verwundert fragte er den Sergeanten auf flämisch, was dieser offenbar fließend beherrschte.
„Sag, Bruder Johann, wo habt Ihr die Kunst eines Medikus gelernt? Oder seid Ihr als Medikus bei den Templern tätig?“ Der Aachener lachte.
„Nein, Ritter Jan, ich bin kein Medikus. Aber ich habe bei meinem Vater das Baderhandwerk gelernt und dabei auch einiges über die ärztliche Kunst erfahren. Und das ist genau das, was ich hier anwende, um so meinen Brüdern zu helfen. Da gehe ich auch dem richtigen Medikus zur Hand. Ihr wisst, Templer sind immer da, wo sie gebraucht werden und wo sie der Großmeister oder sein Vertreter hinstellt. Mich hat er gefragt, ob ich neben Kämpfen auch Heilen will, und ich habe das bestätigt. Also mache ich das, was ich darf und was anderen hilft. So einfach ist das bei den Templern.“
Jan saugte das neue Wissen in sich auf wie ein Schwamm. Gewiss, Templer waren ein Mönchsorden, aber ihre Art war weit entfernt von dem bigotten Gehabe der Priester, die er bisher kennengelernt hatte, und auch weit entfernt von dem furchtsamen Verhalten und dem Aberglauben der Menschen, wenn es um Glaubensfragen ging. Hier bei den Templern war niemand abergläubisch. Hier war er auf Menschen getroffen, die ein sehr genaues und realistisches Bild vom christlichen Leben und von politischen Entwicklungen hatten. Das ritterliche Gehabe und die Prunksucht der adeligen Ritter war ihnen fremd und blieb es auch. Die ritterlichen Tugenden hingegen wurden gepflegt. Jetzt wusste Jan, warum Gerald van Nieuwland nach seinem Ritterschlag zum Orden gegangen war und warum er ihn zum Orden gelotst hatte.
In dem kleinen Ort Saint Jean de Greve, nur wenige Hundert Schritte nordöstlich von Paris angekommen, staunte der Weber aus Flandern über die Größe der Ordensanlage. Sie war etwas mehr als zweitausend mal zweitausend Schritte groß. Und von einer Mauer umgeben. Über die Mauer grüßten ein großer Bergfried und mehrere steinerne Gebäude. Auf einem kleinen Hügel standen vier Windmühlen und gegenüber von dem großen Tor konnte Jan in der Ferne die Seine glitzern sehen. Direkt hinter der Mauer befanden sich auf der ganzen Länge Felder und Gärten, in denen Gemüse und Getreide aller Art angebaut wurden. Um zum Bergfried zu gelangen, musste man durch die Kirche und durch das Ordenshaus. Neben dem Tor waren die Ställe für Pferde und daneben die mit Stroh gedeckten Fachwerkhäuser, in denen die Sergeanten und Knechte untergebracht waren. Da auf dem Gelände die Zunftfreiheit herrschte und Kirchenasyl gewährt wurde, lebten dort unterschiedlichste Bevölkerungsschichten.