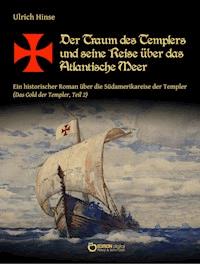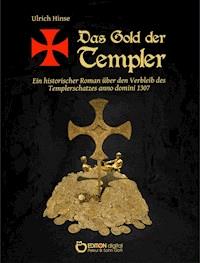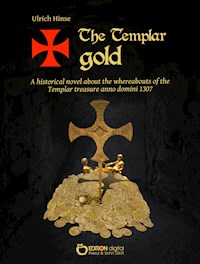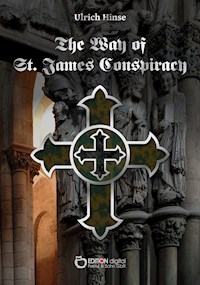14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
König Philipp IV. von Frankreich will den Templerorden vernichten und dessen riesiges Vermögen konfiszieren. Die Tempelritter versuchen, den größten Teil des Barmögens durch eine Karawane über die Pyrenäen in Sicherheit zu bringen. Aber sie werden verfolgt. In Portugal finden sie eine neue Heimat. Einige von ihnen stürzen sich in ein neues Abenteuer und segeln mit einem Teil des Goldes über das Atlantische Meer in Richtung Westen. Dort trennen sich die Templer im Streit. Während einige wenige zurück nach Europa segeln, fährt der andere Teil mit Eingeborenen durch den Urwald bis ins Gebirge. Das Gold führen sie mit sich. Am Ziel angekommen, werden sie vom Eingeborenenstamm der Chachapoya freundlich aufgenommen und integriert. Aber sie geraten in einen Krieg mit den Inkas. Ein Roman aus der Zeit des Mittelalters mit ehrenhaften Tempelrittern und ebenso vielen unehrenhaften Schurken. Das E-Book vereint die drei Teile „Das Gold der Templer“, „Der Traum des Templers und seine Reise über das Atlantische Meer“ und das „Gold der Andentempler“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 860
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Gold der Templer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Der Traum des Templers und seine Reise über das Atlantische Meer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
imes New Roman"'> 17. Kapitel
Das Gold der Andentempler
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Erläuterungen
Ulrich Hinse
E-Books von Ulrich Hinse
Impressum
Ulrich Hinse
Templer-Gold. Träume und Tod
Das Gold der Templer, Teile 1-3
ISBN 978-3-95655-949-5 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2018 EDITION digital ® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Das Gold der Templer
1. Kapitel
Die Glocken am Kirchturm der Stadt Kortrijk in Flandern läuteten. Dumpf wummerte ihr Klang über das Schlachtfeld. Sie verkündeten den glanzvollen Sieg der Flandern gegen die Franzosen. Jan van Koninck, der zweiundzwanzigjährige junge Mann mit den gekräuselten roten Haaren, den blauen Augen und der kräftigen, durchtrainierten Figur unter dem jetzt Blut bespritzten ledernen Wams, stand etwas gebeugt, auf sein blutiges Schwert gestützt, am Rande eines Eschenwäldchens. Eine Wurfaxt, die schon aus normannischer Zeit bekannte Franziska, steckte im Gürtel. Er schaute auf die Szene vor ihm in der Niederung. Dicht gedrängt vor einem Bach, der sich durch die morastige Senke schlängelte, lagen Hunderte von toten Rittern in ihren ehemals glänzenden, jetzt nach der Schlacht aber stumpfen, blutigen Rüstungen und ebenso viele tote oder schwer verletzte Pferde.
Jan summte ein leises Lied. Es war das Totenlied für die Ritter des französischen Königs Philipp des Schönen, der selbst nicht an dem Massaker teilgenommen hatte. Der Sieg war ohnehin eingeplant. An eine Niederlage war nicht im Entferntesten gedacht worden. Deshalb hatte er seinen einäugigen Kanzler Pierre Flote als Feldherrn gesandt und Jaques de Chatillon als zukünftigen Gouverneur gleich mitgeschickt. Die unruhigen Flandern sollten zur Raison und der lukrative Tuchhandel mit England und der Hanse unter französische Kontrolle gebracht werden.
Aber es war dann doch anders gekommen. Fast alle nordfranzösischen Ritter hatten ihr Leben für den König auf dem Schlachtfeld lassen müssen, nur wenige waren entkommen.
Über das Schlachtfeld mit den unzähligen Toten und Schwerverletzten wuselten unzählige junge und alte zerlumpte Menschen und Bürger aus Kortrijk, die den Toten und Sterbenden ihre Wertgegenstände abnahmen. Van Koninck nestelte an seinem Wams. Mit etwas Mühe zog er den goldenen Anhänger hervor und betrachtete ihn. Er war, wie die Kette auch, aus purem Gold. Langsam strich er mit seinen Fingern über das Wappen. Ein französisches Wappen, ein Königswappen, was die drei Lilien verrieten. Er hatte es einige Monate vorher von einem französischen Ritter bekommen, der den Aufstand der flämischen Bürger in Brügge gegen die französische Besatzung nicht überlebt hatte. Eigentlich hatte er den verletzten Franzosen aus Wut töten wollen, weil er durch seine Gegenwehr die Flucht des Gouverneurs Jaques de Chatillon ermöglicht hatte. Hasserfüllt hatte Jaques de Chatillon noch zurückgerufen, dass er schon allein deshalb zurückkommen würde, nur um ihm eigenhändig den Kopf abzuschlagen. Der verletzte Ritter hatte sich mit Mühe die Kette mit dem Wappen abgenommen und dem jungen Flandern gegeben. Vielleicht bringt es dir irgendwann einmal Glück, hatte der Franzose gemurmelt, dann war er verschieden. Jan hatte das Medaillon zwar genommen, aber sonst hatte ihn der nach seiner Kleidung offensichtlich adelige Franzose nicht weiter interessiert. Er hatte ihn in seinem Blut liegen lassen und war den anderen flüchtenden Franzosen hinterhergelaufen.
Sein Vater Pieter, sein Bruder Wim und er, der jüngste Sohn des Webers Pieter van Koninck, waren kurz darauf wegen ihres Mutes und ihres verwegenen Vorgehens bei der Befreiung von Flandern von Robert von Bethune, dem Grafen von Flandern, zum Ritter geschlagen worden.
Dieses Mal war ihm de Chatillon nicht entkommen. Selbstgefällig war er in die Falle geritten und im sumpfigen Ufer des kleinen Flüsschens vor Kortrijk stecken geblieben. Seine Rüstung war zu schwer, als dass er hätte problemlos absitzen und mit dem Schwert kämpfen können. Das war sein Todesurteil. Die flämische Infantrie war dem schwerfälligen Ritter zu Fuß deutlich überlegen und Jan van Koninck hatte genau aufgepasst, wo Jaques de Chatillon hingeritten war. So kreuzten sich auf dem Schlachtfeld ihre Wege erneut. De Chatillon erkannte sofort, wer sich ihm in den Weg stellte, und versuchte mit kräftigen Schwerthieben, dem Jüngsten der Koninck-Sippe den Garaus zu machen. Aber der flinke, junge Flame wich allen Hieben geschickt aus, wehrte mit seiner Wurfaxt und dem Schwert die Hiebe ab und ließ den Franzosen sich müde schlagen. Wobei Jan höllisch aufpassen musste. Die Fechtkunst von de Chatillon war legendär. Aber dazu gehörte natürlich auch, dass sich der Ritter schnell und trickreich bewegen konnte. Aber genau das fehlte hier. Nur wenige Schritte gelangen dem schwer gerüsteten Ritter im Sumpf. Er sank immer tiefer ein und konnte sich nur noch auf einem Fleck stehend verteidigen, während Jan in seiner leichten Kleidung um ihn herumstapfte. Wenn er in seinem Rücken stand, hatte er Mühe, seinen Gegner durch die Sehschlitze zu erkennen. Als einige weitere Franzosen heranritten, um dem Gouverneur zu Hilfe zu eilen, machte Jan dem Kampf ein schnelles Ende. Er wehrte einen Schlag des Franzosen mit seiner Franziska ab und stieß ihm mit der ganzen Kraft seines rechten Arms das Schwert von unten durch den Rüstungsschlitz zwischen Helm und Harnisch in den Hals. Augenblicklich sackte de Chatillon zusammen und starb. Mit einem Ruck zog Jan sein Schwert aus dem Körper des Sterbenden, um die heranreitenden Franzosen abwehren zu können. Aber als die sahen, dass Reiten in dem Sumpf nicht möglich und ihr Anführer bereits gestorben war, zügelten sie die Pferde und ritten auf festen Untergrund zurück. Jan nahm noch an dem einen oder anderen Scharmützel teil, aber der so ungleich begonnene Kampf war letztlich zugunsten der Flandern entschieden. Das, was niemand zu glauben gewagt hatte, war eingetreten. Die bürgerlichen flandrischen Infanteristen hatten mit ihren selbst gebastelten Waffen gegen die Truppe aus hochdekorierten, gut gerüsteten französischen Rittern gewonnen. Die Ritter waren nicht zuletzt an ihrer Arroganz gescheitert. Flandern war unabhängig geblieben und musste sich Philipp dem Schönen nicht beugen.
Sicherlich hatte es bei den flämischen Fußknechten einen hohen Blutzoll gegeben, aber die tapfer kämpfenden Franzosen wurden unter die Wälle der Stadt Kortrijk getrieben, wo ihre Pferde in den Ronduitebach stürzten oder im Uferschlamm versanken. Sie konnten sich nicht durch Überlaufen retten, denn die Ritter wurden alle an ihren Wappen erkannt und von den Fußknechten niedergemacht. Dem letzten Rest, der sich im Kreis aufgestellt hatte, um die wütenden Angriffe der Flandern abzuwehren, wurde vom Grafen Robert van Bethune ein Angebot gemacht, sich zu ergeben, und Thibaut, der Herzog von Lothringen, nahm das Angebot an. Ein Teil der Flandern murrte zwar, beugte sich aber der Entscheidung ihres Grafen.
Nur eine kurze Zeit wurden noch die flüchtigen Franzosen verfolgt, dann wandten sich die Flandern dem französischen Lager zu, um es zu plündern.
Etwas abseits befand sich das Eschenwäldchen, zu dem Jan gegangen war, nachdem er Jaques de Chatillon vom Leben zum Tode befördert hatte. Jetzt, nachdem alles vorbei war, stellte er fest, dass er sich nicht freuen konnte. Weder am Tod des verhassten Gouverneurs noch am Sieg über das französische Ritterheer. Er suchte auch nicht nach seinem Vater oder seinem Bruder, die irgendwo auf dem Schlachtfeld lagen oder sich bei den Siegern befanden, die sich gerade über das Lager der Franzosen hermachten.
Jetzt, wo der Kampf zu Ende war, starrte er auf den furchtbaren Anblick. Mit einem leichten Schauder sah er die vielen Leichen von Menschen und Pferden, die mit Fahnen und verschiedensten Waffen wirr durcheinander lagen. Hier und da sah man einen Sterbenden, den Arm bittend nach Hilfe ausgestreckt. Und zu allem gesellten sich das dumpfe Wiehern und Röcheln sterbender Pferde und die jauchzenden Siegesrufe der siegreichen Flandern.
Während Jan, das Medaillon streichelnd, die schreckliche Szene betrachtete, hörte er ein Stöhnen, das aus einem Knäuel gefallener Franzosen und Pferde herüberklang. Jan steckte sein Schwert in den Gürtel und suchte. Nachdem er einige Leichen beiseitegeschafft hatte, fand er einen sterbenden flämischen Ritter. Er lag ausgestreckt auf dem Rücken, ganz mit Blut bedeckt. Mit der rechten Hand hielt er sein Schwert umkrampft, als wollte er weiterkämpfen. Seine bleichen Gesichtszüge ließen den nahen Tod erahnen. Jan erkannte Gerald van Nieuwland, der mit ihm zusammen zum Ritter geschlagen worden war.
Jan löste den Riemen des Harnisches und hob den Kopf des Sterbenden aus dem Schlamm. Er ließ sich von einem der vorbeihastenden Flandern etwas Wasser geben und befeuchtete Geralds Lippen. Dankbar schluckte der schwer Verletzte. Der junge van Koninck erkannte, dass der Bolzen einer Armbrust Gerald durch den Harnisch in die rechte Brust geschlagen war und ein Schwerthieb das halbe rechte Bein abgetrennt hatte. Der Blutverlust musste enorm und die Schmerzen fürchterlich sein.
«Du bist ein guter Kerl, Jan», flüsterte Gerald van Nieuwland, «hier in Flandern hast du keine Zukunft. Hier bleibst du immer nur der jüngere Bruder. Du hast ein mitleidiges Herz. Geh zu den Templern. Da bist du richtig.»
Mühsam hatte van Nieuwland die Worte hervorgequält. Jan sah ihn ausdruckslos an. Natürlich hatte er von den Templern gehört, aber sich bisher keine Gedanken gemacht. Vermutlich weil es zumeist französische Ritter waren, die dem Orden angehörten. Warum sollte er ausgerechnet zu denen gehen. Als wenn Gerald seine Gedanken gelesen hätte, fuhr er leise und stoßweise fort:
«Der Orden ist unabhängig und jeder ist gleich. Bleibst du in Flandern, bist du immer der Jüngste und hast zu tun, was Vater und Bruder dir vorschreiben. Geh zu den Templern.»
Der Sterbende keuchte und hustete Blut. Mit einer Bewegung deutete er an, dass Jan ihm den Brustharnisch komplett entfernen sollte. Vorsichtig löste er die Riemen und zog den Blechpanzer ab.
Als er dabei den Armbrustbolzen aus der Wunde zog, verdrehte Gerald die Augen und wurde ohnmächtig. Jan betupfte die Stirn des ritterlichen Freundes mit Wasser und wartete geduldig, bis er wieder zu sich kam. Als er die Augen wieder aufschlug, nahm er seinen gesunden Arm und hielt sich am Lederwams von Jan fest. Er zog den Freund nah zu sich herunter.
«In meiner Brusttasche», stöhnte er leise und versuchte mit der verletzten Hand auf seine Brust zu zeigen, «nimm es und zeige es den Templern.»
Als wenn ihn die letzten Worte den Rest seiner Lebenskraft gekostet hätten, atmete Gerald van Nieuwland noch einmal tief durch, dann starb er in den Armen seines jungen Freundes. Jan drückte ihm die Augen zu und murmelte ein Gebet. Dann fasste er dem Toten in die Brusttasche und zog ein kleines Siegel hervor. Auf der einen Seite befand sich das bekannte Templerkreuz, auf der anderen Seite saßen zwei Reiter hintereinander auf einem Pferd. Den Rand bildete ein Text. Sigillum Militum Christi - Siegel der Soldaten Christi - las Jan, schüttelte verwundert den Kopf und steckte das Siegel ein. Dann verließ er langsam das Schlachtfeld, um sich in Kortrijk nach einer Unterkunft umzusehen.
Er streifte durch die Stadt. Der Freudentaumel des Sieges war umfassend. Überall tanzten und sangen Fußknechte und Handwerker und schütteten sich Bier und Wein - und was sonst noch alles an Trinkbarem erreichbar war - in sich hinein. Jan suchte nach seinem Vater und seinem Bruder, fand sie aber nicht. Vielleicht war es auch ganz gut so. Sie hätten wahrscheinlich kein Verständnis dafür gehabt, wenn er ihnen eröffnet hätte, ausgerechnet jetzt nach Paris zu wollen. Er kramte einige Münzen hervor und kaufte von einem stark angetrunkenen Fußknecht einen französischen Hut, den dieser im Lager des Feindes erbeutet hatte. Darunter wollte er seine feuerroten Haare verstecken, die ihn möglicherweise auf dem Weg in die französische Königsstadt hätten verraten können. So ausstaffiert, lief ihm doch noch sein Bruder über den Weg.
«He, Bruder, wie siehst du denn aus? Vater und ich haben dich beim Fest der Weber vermisst. Wir feiern unseren großartigen Sieg.»
Jan nickte.
«Das dachte ich mir, dass ihr feiert. Und was ist mit den vielen Toten?»
„Ach, lass die doch auf dem Schlachtfeld verrotten. Was kümmern uns die toten Franzosen.“
„Bruder, die sind mir auch egal. Was ist mit den vielen Flandern, die ihr Leben für die Freiheit unseres Landes gegeben haben. Die verdienen es nicht, dort draußen zu verrotten.“
„Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die Toten zu beerdigen», brummte Wim van Koninck. Diese Ignoranz regte Jan auf.
„Weißt du Bruder, wir sind zum Ritter geschlagen worden und das heißt, dass wir auch Barmherzigkeit zeigen müssen. Das, was du und Vater zeigen, ist das Gegenteil davon. Ich hab Gerald van Nieuwland gefunden und es war traurig, wie unser Freund auf dem Schlachtfeld ums Leben gekommen ist. Kein Mensch kümmert sich um seine Leiche. Das ist nicht in Ordnung.“
Wim sah seinen Bruder erstaunt an, dann fing er an zu grinsen.
„Ich glaube es nicht. Was ist denn in dich gefahren? Willst du deinen Weberberuf an den Nagel hängen und Pfaffe werden? Das muss ich Vater erzählen. Was glaubst du, was er dir dazu sagt?“ Laut lachend verschwand Wim in der Menge, um nur wenige Minuten mit Pieter van Koninck wieder zu erscheinen. Er hatte den Vater am Schulterriemen gefasst und zog ihn so durch die Menge. Man sah auf den ersten Blick, dass Pieter van Koninck nicht mehr nüchtern war.
„Ah, da bist du ja, mein Sohn“, brüllte der Innungsmeister der Weber seinem Jüngsten schon von Weitem entgegen, „was habe ich gehört? Du willst Pfaffe werden? Das kommt überhaupt nicht infrage. Das gestatte ich nicht. Du bist nicht zum Ritter geschlagen worden, um in der Kirche fromme Lieder zu singen. Ich befehle dir, sofort mit uns zu kommen.“
Kaum hatte Vater van Koninck die letzten Worte gebrüllt, schlug er auch schon lang hin. Mitten in den tiefen Straßendreck. Er war offenbar über sein Schwert gefallen, das ihm zwischen die Beine geraten war. Über und über war er mit Matsch besudelt. Mit Mühe zog Wim seinen Vater aus dem Straßenkot. Als Dank schlug ihm der Alte mit der Faust ins Gesicht. Dadurch, dass Wim sich schnell beiseite gedreht hatte, traf ihn die Faust nicht voll.
„Wo ist Jan?“, brüllte der Alte erneut, „ich will mit ihm reden.“
Jan hatte die Szene mit Widerwillen betrachtet. So hatte er seinen Vater noch nie erlebt. Bisher war er immer ein liebevoller und rücksichtsvoller Mann gewesen. Aber der Sieg schien ihm ebenso wie das Bier zu Kopf gestiegen zu sein. Jan schob zwei Landsknechte zur Seite und stellte sich vor ihn.
„Sollten wir mit dem Reden nicht warten, bis du wieder nüchtern bist?“, versuchte Jan sich dem Gespräch zu entziehen.
„Was erlaubst du dir? Mir Vorschriften zu machen, wann und wie ich mit dir, meinem Sohn, reden will? Komm sofort zu mir und mache den Kniefall vor deinem Vater oder du bekommst von mir Prügel, dass dir Hören und Sehen vergeht.“
Etliche Menschen auf der Straße waren stehen geblieben. Teils aus Respekt vor dem Meister der Weber, teils aus Neugier, was denn noch so kommen könnte.
„Meinen Respekt hast du, Vater“, antwortete Jan van Koninck kühl auf das väterliche Gebrüll, „einen Kniefall bekommst du von mir nicht. Ich gehe ab sofort meine eigenen Wege. Als Weber wirst du auf mich verzichten müssen. Ich habe ohnehin nichts zu erwarten, denn die Weberei wird Wim erben. Was bleibt mir? Euer Knecht zu sein? Nein, das ist nicht das Leben, das ich mir erträumt habe. Dafür habe ich nicht für die Freiheit unseres Volkes gekämpft und mein Leben eingesetzt. Ich gehe nach Paris.“
„Wohin gehst du? Nach Paris? Zum Feind? Das gestatte ich nicht.“
„Vater, du hast mir nichts mehr zu gestatten. Ich gehe nicht zum Feind und ich werde mich auch nicht König Philipp anschließen. Aber hier bleibe ich auch nicht.“
Pieter van Koninck wankte mit unterlaufenen Augen auf seinen jüngsten Sohn zu. Kurz bevor er ihn erreichte, zog er sein Schwert aus der Scheide und hob es über den Kopf.
„Bevor du nach Paris gehst, schlage ich dir eigenhändig den Kopf ab“, schrie van Koninck zornesrot, während sein Sohn Wim versuchte, ihm das Schwert zu entreißen und auch einige andere Leute, die den Streit miterlebten, stellten sich van Koninck in den Weg.
„Lasst es gut sein, Meister,“ versuchte einer aus der Metzgerinnung den Weber zu beruhigen. Als der weiter auf seinen Sohn eindrang, rang ihm der Metzger das Schwert aus der Hand und gab es Wim.
„Junge, sieh zu, dass du deinen Vater ins Quartier bringst, damit er kein Unheil anrichtet», sagte der bärenstarke Metzger und half, den in sich zusammensinkenden Weber beiseite zu schleppen.
Mit Entsetzen hatte Jan bewegungslos die Szene verfolgt. Sein Vater hätte ihn beinahe erschlagen. Sicher war er betrunken, aber so weit hätte er nicht gehen dürfen. Jetzt war ihm klar, dass Gerald van Nieuwland Recht gehabt hatte. Hier in Flandern gab es für ihn keine Zukunft mehr. Deshalb nahm er seinen Hut, drehte sich um und verließ Kortrijk, ohne sich von Vater und Bruder zu verabschieden. Er machte sich auf den Weg nach Paris.
Die Strecke bis Lille kannte Jan. Von dort hatte er vor gut einem Jahr die Ritter um Jaques de Chatillon abgeholt und nach Schloss Wynendael geführt. Freiwillig hatte er das damals nicht getan und den einen oder anderen Umweg mit eingebaut. De Chatillon hatte sich irgendwann in einem engen Hohlweg an einem Brombeergebüsch leicht gekratzt, seinen rechten Ärmel zurückgestreift und gesehen, dass ihm ein Dorn die Haut verletzt hatte. Obwohl es keine große Sache war und die kleine Verletzung von ihm selbst verursacht worden war, hatte de Chatillon auf den Flandern geschimpft.
„Ich glaube, der Junge führt uns absichtlich durch solch schauderhafte Wege. Ich denke, ich werde ihn am nächsten Baum aufknüpfen. Komm einmal näher, du Lump“, hatte er gerufen und Jan zu sich gewunken. Der aber war zurückgewichen und es sah aus, als wenn er flüchten wollte. De Chatillon war noch ägerlicher geworden und hatte seine Knappen aufgefordert, den Jungen zu fangen und am nächsten Baum aufzuhängen. Da erst war ein zweiter Ritter eingeschritten und hatte die Aktion gestoppt.
„Schluss jetzt mit diesem Theater, de Chatillon. Reißt Euch am Riemen. Wir müssen nach Wynendael, und zwar heute noch. Also reitet und lasst den Flandern am Leben.“
Der Ritter, der de Chatillon zur Ordnung gerufen hatte, war ein stattlicher Mann mit einem weißen Mantel und einem roten Tatzenkreuz unter der linken Schulter. Der Franzose hatte zwar noch ein paar Einwände, um sich ohne Gesichtsverlust aus der Angelegenheit zu lösen, gab dann aber knurrend nach, nicht ohne noch eine Drohung zuzurufen.
«Wenn wir uns wiedersehen, wirst du es nicht überleben.“
„Wir werden ja sehen“, hatte Jan geantwortet und war im dichten Wald verschwunden, während die Ritter fluchend ohne Führer weiterreiten mussten.
Jetzt, wo er genau diesen Weg allein zurückging, mit einem neuen Ziel vor Augen und ohne sich von Vater und Bruder verabschiedet zu haben, ging er natürlich direkt und ohne Umweg. Von der Mutter konnte er sich nicht verabschieden. Sie war schon lange tot. Bei seiner Geburt war sie gestorben. Und obwohl sie ihm das Leben geschenkt hatte, empfand er nichts für sie. Sie war für ihn nicht da. Die Magd Marie, die ihn und auch seinen Bruder großgezogen hatte, war inzwischen auch verstorben.
Die Sonne war gerade im Osten aufgegangen, rot leuchtend und umrandet von Regen verheißenden Wolken. Noch aber war es trocken und so schritt er kräftig aus. Verschiedenen Reitertrupps, die er frühzeitig erkannte, wich er in die Gehölze links und rechts des Weges aus. Deshalb wusste er nicht, ob es Franzosen, Engländer oder Flandern waren. Gegen Abend hatte er die Gegend um Lille erreicht. In einem steinernen Gasthaus kehrte er ein und nachdem der Wirt sich überzeugt hatte, dass der junge Mann im ledernen Wams und dem großen Schwert an der Seite kein Wegelagerer, Räuber oder Dieb war und eine Unterkunft auch bezahlen konnte, wischte er an einem Tisch draußen im Hof die Essensreste weg und stellte einen Humpen mit Bier und ein Stück Brot auf den Tisch. Dann trollte er sich wieder in seine Schankstube. Während Jan in den Abendhimmel starrte und darüber nachdachte, ob es noch regnen oder trocken bleiben würde, kam ein kleiner Reitertrupp in den Hof. Der Kleidung nach war es ein Templer mit einigen Getreuen und mehreren Pferden. Sofort stürzte der Wirt mit einigen Knechten auf den Hof und nahm den Templern die Pferde ab. Der Ritter mit dem weißen Mantel lachte und hieb dem Gastwirt freundlich die rechte Hand auf die Schulter. Obwohl der Wirt kein schmächtiger Mensch war, knickte er doch merklich ein, was den Ritter noch mehr belustigte.
„Bringe er uns gut zu trinken und noch besser zu essen und dann lasse er uns zufrieden“, erklärte der Weißmantel und setzte sich an den Nebentisch, ohne Jan zu beachten. Nachdem die Getreuen des Ritters das umfangreiche Gepäck versorgt hatten, setzten sie sich wie selbstverständlich mit an den Tisch, sehr ungewöhnlich für eine Zeit, wo Herren und Knechte immer getrennt saßen. Was sie sich dort erzählten, konnte Jan nicht verstehen, obwohl er sich alle Mühe gab.
Jan kramte nach dem Siegel, das er in seiner Brusttasche stecken hatte. Erst etwas unsicher, dann etwas forscher spielte er mit dem münzähnlichen Siegel.
Wie von selbst rollte das plötzlich vom Tisch herunter, hüpfte über die gepflasterten Steine und blieb vor dem Fuß des Ritters liegen. Der hatte den Vorfall gar nicht bemerkt. Erst einer seiner Getreuen machte ihn durch ein Nicken des Kopfes darauf aufmerksam. Er bückte sich und klaubte den Gegenstand auf. Erstaunt zog er die Augenbrauen zusammen, als er erkannte, was er aufgehoben hatte. Dann drehte er sich um.
„Euch ist etwas heruntergefallen“, sagte er mit einem merkwürdigen Unterton in der Stimme, „seid Ihr sicher, dass es rechtmäßig Euch gehört?“
Jan bekam einen Kloß in den Hals und nahm allen Mut zusammen, dem Ritter so zu antworten, dass der seine Anspannung nicht merkte.
„Ja, edler Herr, das Siegel gehört mir. Ich erhielt es von meinem Freund Gerald van Nieuwland.“
„Ach, wirklich? Warum sollte Bruder Gerald gerade Euch dieses Siegel geben? Ihr habt es ihm gewiss gestohlen. Deshalb werde ich es behalten.“
„Nein, mein Herr, das Siegel gehört mir und ich will es von Euch wieder zurück.“ Fordernd hielt Jan dem Ritter seine Hand vor die Brust. Der schaute erst verwundert auf die Hand, dann auf Jan van Koninck.
„Holla, genug Mut habt Ihr ja. Aber bevor ich Euch das Siegel zurückgebe, will ich genau wissen, wie und wann ihr es erhalten habt. Und keine Lügen.“
Jan schluckte einen Moment, dann trank er aus seinem Krug einen Schluck und begann seinen Bericht über die Schlacht von Kortrijk, den Tod seines Freundes Gerald und das Geschenk, was ihm der sterbende junge Ritter gemacht hatte. Und was er damit wollte.
Der Templer hatte zugehört, ohne ihn zu unterbrechen. Auch seine Gefährten hatten interessiert dem Bericht gelauscht. Als Jan geendet hatte, streckte er erneut die Hand aus.
„Kann ich mein Siegel jetzt wiederhaben. Ich schulde es meinem Freund, dass ich nicht leichtfertig damit umgehe.“
Der Ritter lachte.
„So, so. Nicht leichtfertig damit umgehen. Und was hat dazu geführt, dass es mir vor die Füße rollte?“
„Das habe ich so gewollt.“
Erstaunt lehnte sich der Ritter zurück.
„So, so, das hat er so gewollt?“, äffte er den jungen Mann nach.
„Ja, edler Herr, ich möchte zu den Templern und sah darin eine Möglichkeit, mit Euch ins Gespräch zu kommen.“
„Seht her, Brüder“, rief der Templer seinen Gefährten zu, „er will zu den Templern und treibt sein Spiel mit mir. Was sagt ihr dazu?“
„Ist er ein Ritter oder ein Handwerker?“, rief einer der Gefährten, die mit dem Templer an einem Tisch saßen.
„Ich bin beides“, erklärte Jan, „ich habe Weber gelernt und wurde vom Grafen Robert von Bethune zum Ritter geschlagen. Zusammen mit meinem Freund Gerald van Nieuwland, meinem Bruder und meinem Vater und dann haben wir gegen die Franzosen gekämpft.“
„Ja, ja, ich habe gehört. Die französischen Ritter haben den Streit mit euch Flandern überraschend verloren. Respekt. Das hatte niemand erwartet“, und dann grinste der Templer, „und Philipp der Schöne schon gar nicht. Kommt her, setzt Euch zu uns an den Tisch. Ich werde Euch ein wenig von unserem Orden erzählen und dann entscheidet, ob Ihr mit uns reitet. Wir wollen nach Paris, in die dortige Komtur, unseren Temple.“
Jan erhob sich, nahm seinen Krug und das Brot und setzte sich zu den Templern. Der Ritter mit dem weißen Mantel und dem roten Tatzenkreuz unter der linken Schulter grinste. Er schlug Jan auf die Schulter.
„Weißt du, mein Freund“, sagte er und trank einen kräftigen Schluck Wein aus dem Becher, der vor ihm stand, „wir Tempelritter sind alle Individualisten. Wir pfeifen auf die Gesetze aller weltlichen Herrscher, halten uns aber streng an unsere eigenen Regeln. Unser Name und unser Tatzenkreuz symbolisieren Freiheit, sie sind unser Warenzeichen. Wir sind geachtet und gefürchtet. Wir sind zwar ein Mönchsorden, aber gleichzeitig Abenteurer und vor allem geschickte Geschäftsleute. Nicht nur die wenigen adeligen Ritter, auch viele zu Rittern aufgestiegene Handwerker und bewaffnete Knappen haben sich im Orden zusammengefunden. Bezahlt werden wir mit einer Währung, für die Männer besonders empfänglich sind. Mit Macht. Die Mehrzahl von uns, und das sage ich in voller Freizügigkeit, sind Typen, die ohne Tatzenkreuz auf der linken Schulter abgehalfterte Herumtreiber wären, die irgendwann einmal am Strick des Henkers geendet hätten. Stattdessen erhalten wir Ehrerbietung und Respekt. Wer kann, geht uns aus dem Weg und legt sich nicht mit uns an. Unser weißer Mantel leuchtet auch in der Dunkelheit. Das schreckt Gesindel und Räuber ab. Aber es hat einen Nachteil. Wer uns finden will, der findet uns.“
„Der weiße Mantel hat aber auch einen Vorteil“, wandte Jan ein.
„Und der wäre?“, knurrte der Templer.
„Wer Euch finden will, der findet Euch.“
Einen Moment dachte der Ritter verdutzt nach. Dann schlug er sich mit einem lauten Lachen auf den Schenkel.
„Mein junger Freund, Ihr habt Humor. Das schätze ich. Ich nehme Euch mit nach Paris. Ihr bekommt eines meiner Pferde und müsst nicht mehr durch den Dreck der Straße laufen. Aber Ihr habt Euch noch nicht vorgestellt. Wer seid Ihr?“
„Ich bin Ritter Jan van Koninck, der Sohn von Ritter Pieter van Koninck, dem Führer der Weberinnung in Flandern, und Bruder von Ritter Wim van Koninck.“
„Recht so, Ritter Jan, Ihr seht zwar nicht wie ein Ritter aus, aber ich will Euch das erst einmal glauben“, antwortete der Templer, stand auf und deutete eine leichte Verbeugung an, „und ich bin Ritter Guido de Voisius aus Rennes le Château, einem kleinen Ort in den Pyrenäen. Ich bin der Seneschall des Ordens und vertrete unseren Großmeister Jaques de Molay hier in Frankreich. Und die Gefährten mit den braunen Mänteln sind Sergeanten unseres Ordens. Der im schwarzen Umhang ist unser Kaplan. Sie sind wie meine Brüder.“
Dann wies er auf einen jüngeren Mann, der ein paar Plätze weiter saß.
„Und das ist Johann Laurenz. Er ist mein direkter Mitstreiter. Er ist der Sohn eines Baders aus Aachen und schon einige Zeit bei uns im Temple in Paris. Er wird dir mein zweites Pferd übergeben, damit du nicht hinter uns herlaufen musst. Es ist nicht gut, wenn ein Ritter zu Fuß nach Paris kommt.“
Der Gefährte, der Johann Laurenz genannt wurde, deutete eine leichte Verbeugung an und lächelte.
„Morgen früh bei Sonnenaufgang geht es weiter. Rothaar, seid pünktlich, sonst reiten wir ohne Euch“, mahnte der Sergeant. Sie wechselten noch einige Worte, dann verzogen sich alle auf ihre Nachtlager. Jan fiel die Disziplin der Männer auf. Keiner betrank sich, keiner ging eigene Wege. Eine Truppe wie aus einem Guss, stellte er fest. Und dann konnte er nicht schlafen. Unruhig wälzte er sich auf seinem Strohlager hin und her und so war er zum Sonnenaufgang unausgeschlafen, aber pünktlich auf dem Hof.
Auf ein Zeichen des Seneschalls setzte sich der kleine Zug in Bewegung und ritt aus dem Tor. Dort erlebte Jan eine Überraschung. Es warteten etwa zwanzig Knechte mit vier großen Englischen Wagen. Die Wagen waren zu groß gewesen, um in den Hof der Gaststätte hineinzufahren, und standen deshalb vor dem Tor.
Der Englische Reisewagen des Mittelalters war ein großer Planwagen mit vier großen Holzrädern mit je sechs Speichen, fünfzehn bis zwanzig Ellen lang, einem Leiterwagen ähnlich, mit einer Rundplane, in die Fensteröffnungen eingeschnitten wurden, die mit Vorhängen fest verschlossen werden konnten. Vom Kutschbock konnte man den Innenraum betreten. Nach hinten führte eine einziehbare Leiter hinunter. Er wurde je nach Fracht von zwei oder vier Pferden, Maultieren oder großen französischen Eseln gezogen. Die Templer hatten vier Pferde vor jeden Wagen gespannt.
Der Zug der Wagen und Reiter bewegte sich langsam Richtung Paris. Sie hatten es nicht eilig. Ein Fußgänger war nicht viel langsamer und so dauerte es einige Tage, bis sie die Häuser der Stadt an der Seine sahen und den Temple erreichten. Aber die Reise verlief ohne Vorkommnisse, die auch keiner besonderen Erwähnung bedurften. In den Pausen unterrichtete Guido de Voisius den neuen Templeranwärter in den Dingen, die ein Tempelritter unbedingt wissen musste, um vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft zu werden. Und immer wieder die Frage, ob er sich das auch wirklich antun wolle. Und genauso oft nickte Jan zustimmend.
Gelegentlich sah Jan, wie der Aachener Badersohn dem einen oder anderen Gefährten bei Verletzungen half. Verwundert fragte er den Sergeanten auf flämisch, was dieser offenbar fließend beherrschte.
„Sag, Bruder Johann, wo habt Ihr die Kunst eines Medikus gelernt? Oder seid Ihr als Medikus bei den Templern tätig?“ Der Aachener lachte.
„Nein, Ritter Jan, ich bin kein Medikus. Aber ich habe bei meinem Vater das Baderhandwerk gelernt und dabei auch einiges über die ärztliche Kunst erfahren. Und das ist genau das, was ich hier anwende, um so meinen Brüdern zu helfen. Da gehe ich auch dem richtigen Medikus zur Hand. Ihr wisst, Templer sind immer da, wo sie gebraucht werden und wo sie der Großmeister oder sein Vertreter hinstellt. Mich hat er gefragt, ob ich neben Kämpfen auch Heilen will, und ich habe das bestätigt. Also mache ich das, was ich darf und was anderen hilft. So einfach ist das bei den Templern.“
Jan saugte das neue Wissen in sich auf wie ein Schwamm. Gewiss, Templer waren ein Mönchsorden, aber ihre Art war weit entfernt von dem bigotten Gehabe der Priester, die er bisher kennengelernt hatte, und auch weit entfernt von dem furchtsamen Verhalten und dem Aberglauben der Menschen, wenn es um Glaubensfragen ging. Hier bei den Templern war niemand abergläubisch. Hier war er auf Menschen getroffen, die ein sehr genaues und realistisches Bild vom christlichen Leben und von politischen Entwicklungen hatten. Das ritterliche Gehabe und die Prunksucht der adeligen Ritter war ihnen fremd und blieb es auch. Die ritterlichen Tugenden hingegen wurden gepflegt. Jetzt wusste Jan, warum Gerald van Nieuwland nach seinem Ritterschlag zum Orden gegangen war und warum er ihn zum Orden gelotst hatte.
In dem kleinen Ort Saint Jean de Greve, nur wenige Hundert Schritte nordöstlich von Paris angekommen, staunte der Weber aus Flandern über die Größe der Ordensanlage. Sie war etwas mehr als zweitausend mal zweitausend Schritte groß. Und von einer Mauer umgeben. Über die Mauer grüßten ein großer Bergfried und mehrere steinerne Gebäude. Auf einem kleinen Hügel standen vier Windmühlen und gegenüber von dem großen Tor konnte Jan in der Ferne die Seine glitzern sehen. Direkt hinter der Mauer befanden sich auf der ganzen Länge Felder und Gärten, in denen Gemüse und Getreide aller Art angebaut wurden. Um zum Bergfried zu gelangen, musste man durch die Kirche und durch das Ordenshaus. Neben dem Tor waren die Ställe für Pferde und daneben die mit Stroh gedeckten Fachwerkhäuser, in denen die Sergeanten und Knechte untergebracht waren. Da auf dem Gelände die Zunftfreiheit herrschte und Kirchenasyl gewährt wurde, lebten dort unterschiedlichste Bevölkerungsschichten.
Neben den Ordensbrüdern gab es Händler, die ihre Geschäfte machten, die unterschiedlichsten Gewerbetreibenden und es lebten hier Adelige und Bürger, die Schutz vor wem auch immer gesucht hatten. Kurz, ein buntes Völkchen trieb sich im Tempel umher. Sie durften auf dem Gelände überall hin, nur der Bergfried war verboten und von den Rittern und Knechten streng bewacht.
Johann hatte ihm anvertraut, dass der französische König Philipp der Schöne angeblich seinen Staatsschatz dort untergebracht hatte, als er sich nach verlorenem Krieg gegen die Engländer mit der murrenden Bevölkerung auseinandersetzen musste. Seinerzeit habe sich der König in Paris nicht mehr sicher gefühlt und sei mit seiner Frau Johanna von Navarra zu den Templern geflohen. Alles in allem war der Tempel eine Stadt für sich, in der weit über tausend Menschen lebten.
Anfangs musste Jan sich in dem weitläufigen Gebäude und Gelände erst einmal zurechtfinden. Johann hatte sich angeboten, nach getaner Arbeit ihm alles zu zeigen und ihn in die Gepflogenheiten einzuweihen. So hatten sie sich angefreundet. Ritter Guido hatte ihm gleich zu Anfang im Ordenshaus, dort, wo alle Ritter wohnten, eine kleine Zelle zugewiesen. Sie lag etwas abseits und war nicht leicht zu erreichen. Ein einfaches Strohlager, abgedeckt mit zwei Schaffellen, war in dem kleinen Raum, eine mittelgroße Holzkiste für die wenigen Habseligkeiten, die er behalten durfte, eine Bank, auf der er knien und beten konnte und über der ein Holzkreuz hing. Ein Schemel zum Sitzen und ein schmaler Tisch vervollständigten das Inventar. Neben der Kniebank befand sich ein schmales Fenster und ermöglichte einen Blick in den weitläufigen Hof, auf dem Knechte die Pferde versorgten, die Waren gestapelt wurden und die täglichen Waffenübungen absolviert werden mussten. Vor allem an die täglichen Kirchenbesuche musste er sich gewöhnen, denn Jan war zwar getauft worden, aber so richtig intensiv hatte weder sein Vater noch er selbst die Kirche besucht und die Kleriker ernst genommen.
Es dauerte einige Zeit, aber dann fühlte er sich heimisch bei den Ordensrittern. Irgendwann hatte Ritter Guido ihn rufen lassen und ihm mitgeteilt, dass der Großmeister des Ordens, Ritter Jaques Molay, einen weiteren Wagenzug mit einem Teil des Vermögens des Ordens erwarte. Der Großmeister selber würde ihn in Kürze in den Orden aufnehmen und das Gelübde von ihm verlangen. Wenn er es sich überlegt habe und nicht bleiben wolle, dann könne er jetzt noch ohne Schwierigkeiten gehen. Niemand würde ihm Hindernisse in den Weg legen.
Jan hatte dem Seneschall erklärt, dass er sich um die Aufnahme in den Orden als Tempelritter bemühen werde, und Ritter Guido hatte ihm geantwortet, dass er diese Entscheidung dem Großmeister mitteilen werde.
Jan de Koninck hatte es inzwischen längst gelernt, was es bedeutete, Tempelritter zu sein: Gehorsam, Strenge, wenig Schlaf und Fleiß. Jeden Tag wurde er mit einigen anderen Rittern und Sergeanten vom Frater Antonius in der hohen Kunst des Schwertkampfes, des Zweikampfes zu Fuß und zu Pferd und im Schießen mit dem englischen Langbogen unterwiesen. Jeder trug nach einer Lehrstunde mindestens blaue Flecken, wenn nicht sogar kleine Wunden davon, die sofort vom Bruder Medikus versorgt wurden. Schnell fand er Gefallen am Schießen mit dem Langbogen und war bald seinem Lehrmeister ebenbürtig. Die Schnelligkeit, mit der es ihm gelang, 10 Pfeile hintereinander ins Ziel zu bringen, beeindruckte Frater Antonius sichtlich und auch der englische Ritter aus Aquitanien, der das Bogenschießen bei den Templern eingeführt hatte, sah den Bemühungen sehr aufmerksam zu. Eigentlich war das Bogenschießen etwas für Knechte und nichts für Ritter, die lieber mit Helm und Schwert kämpften, aber die Möglichkeiten des Bogens überzeugten den einen oder anderen.
Inzwischen war eine lange Wagenkarawane angekommen. Etliche Ritter und mehr als doppelt so viele Knechte und Sergeanten hatte sie zu ihrem Schutz im Gefolge. Die mussten alle versorgt werden und ihre Unterkunft bekommen und so war tagelang Unruhe im Ordenshaus. Im Garten hinter dem Wohnhaus des Großmeisters waren etliche Zelte aufgestellt worden, in denen Ritter schliefen. Und in den Häusern der weiteren Umgebung waren ebenfalls Ritter einquartiert worden.
Von der Balustrade seiner Wohnräume sah Jaques de Molay wie so häufig dem Treiben auf dem Innenhof nachdenklich zu. Er strich sich den langen weißen Bart, während er die jungen Ritter und Sergeanten beobachtete. Auf zwei der neuen Mitglieder des Ordens, den Flandern Jan und den Aachener Johann, achtete er besonders. Der Flandern vermochte brillant mit der Wurfaxt und dem englischen Langbogen umzugehen und der Aachener war ebenso gut mit dem Schwert und auch noch als Medikus zu verwenden. Er hatte offensichtlich hervorragende Kenntnisse und stand dem richtigen Medikus des Tempels im Wissen um nichts nach. Das hatte ihm sein Seneschall bereits erklärt und er hatte sich selbst davon überzeugen können.
Jaques de Molay erfüllte dreifache Pflichten. Das Amt des Großmeisters der Templer erforderte sowohl politischen und wirtschaftlichen Weitblick als auch die Fürsorge für seine Ordensleute und Gehorsam gegenüber dem Papst. Der erfahrene Kämpfer an der Spitze des mächtigsten Ordens des Okzidents war sich sehr wohl bewusst, dass es nicht gelingen konnte, die drei Aufgaben gleich gut zu bewältigen. Aber er versuchte es immer wieder. Die väterliche Fürsorge gegenüber seinen Rittern nahm er mit harter, aber gerechter Strenge wahr. Zu streng, murrten oft die Ritter, Sergeanten und Knechte.
Jan hatte seine Übungsstunde auf dem Hof der Ordensburg hinter sich gebracht, die Waffen an Frater Antonius übergeben und sich von Johann verabschiedet, der zu den Sergeantenhäusern ging. Als der Flander sich umdrehte, prallte er heftig mit einem anderen Ritteranwärter zusammen.
„He, nicht so ungestüm, Flander. Oder willst du mich auf diese Weise fordern?“ Mit wütendem Gesichtsausdruck stand ein etwa gleichaltriger junger Mann vor ihm. Der Kleidung nach war es ein französischer Adeliger, der auch um Aufnahme in den Orden gebeten hatte.
„Warum sollte ich Euch fordern?“, fragte Jan verwundert und fuhr fort, „wir sind Templer und die fordern sich nicht und Ihr habt mir nichts getan und ich Euch auch nicht. Dass wir jetzt zusammengestoßen sind, ist ein Versehen, für das ich mich entschuldige.“
„So nicht“, entgegnete der Franzose, „wiederhole laut deine Entschuldigung, damit sie jeder auf dem Hof hören kann, sonst schlage ich dich nieder. Du bist schließlich ein einfacher flämischer Emporkömmling, eigentlich ein Unfreier, ein Ministerialer und kannst keinen Stammbaum vorweisen. Mein Onkel ist Großkomtur und einer der Vertreter des Großmeisters.“
Die Miene von Jan verdüsterte sich. Er blickte sich nach Frater Antonius und nach Johann um, aber von beiden war keine Spur zu sehen. Dafür waren einige andere Ritter neugierig stehen geblieben.
„Eure Abstammung ist mir egal. Ich weiß nicht, warum Ihr aus einer kleinen Unachtsamkeit unter Brüdern einen solchen Aufstand macht. Ich habe mich entschuldigt und damit lasst es auch gut sein.“ Jan versuchte sich an seinem Gegenüber vorbeizudrücken, um in seine Kammer zu gelangen. Aber das war nicht so einfach, wie er sich das gedacht hatte. Der Franzose verstellte ihm erneut den Weg.
„Damit Ihr wisst, mit wem Ihr es zu tun habt: Ich bin Geoffroy de Charny, Sohn des Grafen Richard de Charny aus der Champagne, und wer seid Ihr?“
„Ich bin Jan de Koninck, Sohn eines Webers aus Flandern, und wenn ich mich richtig erinnere, konnte Euer Vater vom Schlachtfeld in Kortrijk fliehen und ließ die Ritter des Königs im Stich, um sein Leben zu retten. Oder irre ich mich?“, antwortete der Flander so laut, dass die Umstehenden es vernehmen konnten. Das Gesicht des Franzosen nahm die Farbe einer reifen Tomate an.
„Für diese Beleidigung werdet Ihr mir büßen“, keuchte der Champagner, „so etwas lasse ich mir von einem hergelaufenen Weber nicht vorwerfen. Er zog ein langes Messer aus dem Gürtel und drang auf Jan de Koninck ein. Der wich geschickt aus und ließ den vor Ärger Unachtsamen ins Leere laufen.
„Hier bin ich, Bruder Geoffroy“, stichelte Jan aus dem Rücken des Angreifers. Der drehte sich blitzschnell um und stach in die Richtung, aus der er die Stimme hatte kommen hören. Dort stand aber niemand mehr. Jan hatte keine eigene Waffe, deshalb tänzelte er seinen Angreifer elegant aus. Aber ganz so tölpelhaft war der auch nicht. Seine schäumende Wut hatte sich während des Kampfes etwas abgekühlt. Umso bedachter führte er die Auseinandersetzung weiter. Der Mann aus der Champagne war ein guter Kämpfer, das merkte der Flander sehr schnell. Immer mehr Ritter und Sergeanten waren stehen geblieben und scharten sich um die beiden. Seitens der Ritter ringsum war Murren zu hören.
„Werft Euer Messer weg, Ritter Geoffroy“, hörte man aus dem Kreis der Zuschauer rufen, „das ist nicht ritterlich. Euer Gegner hat keine Waffe, um sich zu verteidigen.“
Trotzdem dauerte es noch eine Weile, bis sich Geoffroy entschloss, das Messer in hohem Bogen fortzuwerfen und allein mit den Fäusten weiterzukämpfen. Auch versuchte der Champagner eine List. Einem Angriff von Jan entzog er sich, indem er sich auf die Erde warf, abrollte und dabei eine Handvoll Sand aufnahm. Bei dem ersten Kontakt mit Jan, der gewartet hatte, bis Geoffroy aufgestanden war, warf dieser dem Flandern den feinen Sand ins Gesicht. Jan war irritiert, konnte nichts mehr sehen und steckte einige schwere Schläge gegen den Kopf und in den Bauch ein. Nur Schatten sah er. Durch eher zufällige geschickte Körperdrehungen entging er dem endgültigen Schlag, fast sah es so aus, als tanzte er vor seinem Gegner, was den noch mehr in Rage versetzte. Der Sand schmerzte in den Augen und trotzdem versuchte er, seinen Gegner zu erkennen. Der war sich seines Sieges schon sicher. Ein fürchterlicher Schlag sollte das Ende bringen. Doch Jan hatte noch eine Finte parat. Er drehte eine Pirouette, streckte dabei den Arm aus, ballte die Hand zur Faust und mit dem Schwung der Drehung traf er die Schläfe seines Gegners. Der hatte mit dem Schlag nicht gerechnet und keinerlei Deckung durch seine Hände und Arme gehabt. Von einem Augenblick zum anderen strömte Blut aus seinem Mund und er war ganz betäubt, denn der Schlag hatte ihm das Gehirn erschüttert. Langsam sackte er vornüber auf die Knie und fiel der Länge nach in den Dreck.
Die umstehenden Zuschauer murmelten bewundernd und zogen sich nach und nach zurück. Jan wischte noch mit einer Ecke seines Hemdes den Dreck aus den Augen. Dann erkannte er Johann, der sich um seinen Gegner kümmerte. Als Jan ihm helfen wollte, schob Johann ihn zurück.
„Lasst es gut sein, Jan, ich schaffe das schon allein und ich glaube nicht, dass Ritter Geoffroy erfreut wäre, wenn Ihr ihm auch noch helfen würdet. Ich denke, Ihr habt in ihm keinen Freund fürs Leben gefunden. Geht in Euer Quartier.“
Ohne sich umzublicken, ging Jan zum Ordenshaus. Vor dem Eingang erwartete ihn Ritter Guido. Er sah nicht erfreut aus.
„Was war das denn, Jan de Koninck?“, wollte er wissen, „es gab weder ein Turnier, noch war ein Zweikampf angesetzt, bei dem man die Kräfte hätte messen können. Und eine Gasthausschlägerei ist nichts, mit dem sich Templer beschäftigen sollten. Wir sind nicht das gemeine Volk. Wir sind ein Orden. Das solltet Ihr in der Zwischenzeit verinnerlicht haben. Ich erwarte, dass sich ein solches Verhalten nicht wiederholt. Von Euch hatte ich mehr erwartet als derart rüpelhaftes, landsknechthaftes Verhalten.“
Als Jan ansetzte, um die Angelegenheit zu erklären, winkte Ritter Guido ab und fuhr ihm über den Mund.
„Ihr werdet Buße tun und die nächsten zwei Tage in Eurer Zelle darüber nachdenken, was verkehrt gelaufen ist. Kniet Euch auf die Bank und betet.“ Dann zwinkerte er dem jungen Mann zu.
„Wenn Ihr verloren hättet, hättet Ihr übrigens eine Woche darüber nachdenken dürfen. Und nun geht“, erklärte der Seneschall, drehte sich um und ging über den Hof zu Geoffroy de Charny. Jan schluckte einmal und begab sich dann aber unverzüglich in seine Zelle. Aus den Augenwinkeln sah er noch, wie der Seneschall einige wenige Worte mit Johann redete, den fortschickte und sich dann Ritter Geoffroy zuwandte. In seiner Kammer angekommen, überlegte er einen Moment, ob er sich wirklich hinknien und beten sollte, dann aber ließ er sich auf seine Schaffelle fallen, legte sich lang, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und starrte an die Decke. Nach kurzer Zeit kramte er das Amulett aus seinem Beutel, den er zwischen den Schaffellen und den Strohsäcken versteckt hatte. Er wusste, als Angehöriger des Ordens durfte er keine persönlichen Sachen besitzen, außer der Großmeister erlaubte es ihm. So beschloss er, um eine Audienz beim Großmeister nachzusuchen, um die Genehmigung hierfür zu erhalten. Er sollte den Termin schneller bekommen, als er gedacht hatte.
2. Kapitel
Jaques de Molay war überrascht, als sich ein unbekannter Ritter bei ihm anmeldete und erklärte, er habe etwas Dringendes und Wichtiges mitzuteilen. Der Großmeister empfing ihn in seinem Arbeitszimmer. Während sich der Sergeant, der den Ritter geführt hatte, schweigend zurückzog, bot Jaques de Molay seinem Gegenüber, der eine Kapuze tief in die Stirn gezogen hatte, einen Stuhl an.
„Wer seid Ihr?“
„Mein Name tut nichts zur Sache. Aber Ihr sollt wissen, dass ich mich dem Orden verbunden fühle und großes Ungemach sehe, das auf Euren Orden zukommt.“
De Molay zog die Augenbrauen hoch und während ein Bruder hereinkam und zwei Pokale mit Wein vor die beiden Ritter stellte, zog der Franzose seine Kapuze etwas tiefer in die Stirn.
„Das müsst Ihr nicht, Ritter, Eure Anwesenheit wird nicht bekannt und schon gar nicht ausgeplaudert“, versicherte Molay. Aber der andere winkte ab.
„Vorsicht hat noch niemandem geschadet.“
„Dann muss Eure Mitteilung aber wirklich wichtig sein.“
„Ja, das ist sie ganz gewiss.“
Jaques de Molay hob den Pokal und trank. Sein Gegenüber tat es ihm nach. Dann schlug er doch die Kapuze zurück und Jaques de Molay erhob sich erstaunt von seinem Stuhl.
„Sire, Ihr kommt selbst zu mir? Und so geheimnisvoll?“
„Ja, als König von Frankreich komme ich zu Euch. Und Ihr sollt von mir selbst wissen, was Euch und Eurem Orden bevorsteht. De Molay, ich habe vor wenigen Tagen einen Haftbefehl für alle Templer ausfertigen lassen. Alle sind ausnahmslos zu verhaften, - Capti tenantur et ecclesiae iudicio preserventur -, gefangen zu halten und dem Urteil der Kirche zuzuführen. Ihre Besitztümer und bewegliche Habe sind zu beschlagnahmen und zu treuen Händen aufzubewahren - omnia bona sua mobilia et immobilia saisiantur et ad manum nostram saisita fideliter conserventur. So habe ich es schreiben und verteilen lassen. Am 13. Oktober, einem Freitag, soll in aller Frühe der Haftbefehl in ganz Frankreich vollzogen werden. Ihr könnt Euch und Eure Ritter retten, indem Ihr unverzüglich das Land verlasst und alles zurücklasst“, erklärte der König und sah erwartungsvoll in das Gesicht des Großmeisters.
Doch Jaques De Molay sagte gar nichts. Er sah sein Gegenüber unverwandt und unbewegt mit seinen dunklen Augen an. Nach einer Weile des Schweigens, in dem die Zeit für den König fast unbehaglich wurde, räusperte sich der alte Ritter.
„Sire, und was werft Ihr uns vor?“
„De Molay, das ist doch egal. Ich sage es Euch hier unter vier Augen ganz offen. Ihr kennt doch Esquieu de Floryan.“
„Sicher, ich selbst habe ihn aus dem Orden entfernt, weil er sich nicht an die Regeln halten wollte.“
„Ja, ja, er ist dann zu mir gekommen und hat von ungeheuerlichen Vorgängen im Orden gesprochen, von denen Sodomie noch der geringste ist. Ich weiß, die Vorwürfe sind aus der Luft gegriffen. Sie dienen aber hervorragend dazu, vor aller Welt Euch und den Orden zu diffamieren. Jeder Bürger des Landes wird verstehen, wenn wir deshalb Euer Vermögen und die Ländereien der Krone zuführen.“
„Sire, wir sind nicht Euch, sondern allein dem Papst Gehorsam schuldig. Ihr könnt nicht ohne Genehmigung von Papst Clemens gegen uns vorgehen.“
„De Molay, Ihr vergesst, dass Bertrand de Got noch vor zwei Jahren Bischof von Bordeaux war und seit jeher einen engen und vertrauensvollen Zugang zu mir hat. Ich habe ihn ja auch vor zwei Jahren in Lyon bei seiner Wahl zum Papst unterstützt. Nicht zuletzt deshalb hat er Rom verlassen und ist nach Avignon gezogen. Nein, der Papst wird Euch nicht schützen. Er hält zu mir. So, Großmeister, mehr kann ich für Euch nicht tun. Macht was draus. Gut vier Wochen habt Ihr Zeit. Ich war nicht bei Euch. Adieu, Ritter. Euer Leben ist in Eurer eigenen Hand.“
König Philipp stand unvermittelt auf und ging zur Tür. De Molay hielt ihn zurück.
„Sire, auf ein Wort.“
Der König hielt inne und blickte sich um.
„Was habt Ihr noch?“
„Warum schleicht Ihr Euch wie ein Tagedieb zu mir in den Tempel und teilt mir mit, dass Ihr uns verhaften wollt? Das macht doch keinen Sinn.“
Der König lachte bitter und zog sich, bevor er antwortete, wieder die Kapuze über das Gesicht.
„Oh doch. Für mein Seelenheil macht es Sinn. Seit Ihr uns vor dem Mob von Paris gerettet habt, bin ich Euch was schuldig.“
„Ihr seid uns etwas schuldig?“, fragte der Großmeister etwas überrascht.
„Ja. Ich durfte damals einen Blick in Eure gut gefüllte Schatzkammer werfen. Das hat mich, besonders aber meine Frau, beeindruckt. Seit dieser Zeit bedrängen mich Johanna von Navarra, mein Kanzler Nogaret und mein sehr verehrter Finanzminister de Marigny Euch das Vermögen wegzunehmen. Mit den Juden hat das ja auch geklappt. Warum sollte das mit den Templern nicht auch gelingen. Ich habe mich lange geziert. Auch wenn Ihr mich seinerzeit als Tempelritter abgelehnt habt. So gebe ich Euch aus, sagen wir Verbundenheit, zumindest eine Chance. Sie ist nicht groß, aber Ihr könnt sie nutzen. Nun gehabt Euch wohl. Mehr kann ich nicht mehr für Euch tun.“
„Sire, Ihr seid zynisch. Die Juden haben viel für Euch getan und wir auch“, stellte der Großmeister der Templer fest. Der König zuckte nur mit den Schultern.
„Es ist, wie es ist. Nun wisst Ihr es“, sagte er lakonisch und drehte sich wieder zur Tür, die sich wie von Geisterhand öffnete. Der Sergeant, der ihn gebracht hatte, holte ihn auch wieder ab und führte ihn zurück zum Torhaus.
Ritter Jaques de Molay sah ihm nicht nach und wartet auch nicht ab, sondern ließ sofort den Großkomtur, der die Aufsicht über den Ordensschatz, und den Seneschall, der die Aufsicht über die Waffen und das Kriegswesen hatte, zu sich rufen. Lange saßen die drei Ritter zusammen. Dann hatten sie sich für einen Plan entschieden und gingen jeder an seine Stelle, um die nächsten Schritte des Ordens in die Wege zu leiten. Zunächst, da waren sie sich alle einig, sollten die jungen Anwärter in den Orden aufgenommen werden.
3. Kapitel
Der Großmeister des Templerordens empfing Jan de Koninck in seinen Räumen hinter dem Ordenshaus, von dort hatte er sowohl einen Blick auf den Bergfried, in dem die Schätze des Ordens aufbewahrt wurden, als auch auf den Hof, auf dem die Ritter Tag für Tag übten. Neugierig sah der Ordensobere dem jungen Mann entgegen.
„Was gibt es so Wichtiges, dass du um ein Gespräch nachgesucht hast?“, empfing ihn der Großmeister.
„Herr, ich weiß, dass Eure Zeit wichtig ist und Ihr etwas anderes zu tun habt, als mir zuzuhören“, begann Jan sein Gespräch sehr devot.
„Komm zur Sache“, antwortete de Molay barsch und eine steile Falte bildete sich zwischen seinen Augen. Molay mochte derart devotes Gehabe nicht.
„Herr, ich habe bei den Kämpfen um die Freiheit meines Landes Flandern einen Franzosen getötet.“
„Gut, das ist nicht schön, aber es kommt bei Kämpfen nun einmal vor. Es wird nicht der Letzte sein, der durch dich stirbt“, orakelte der Großmeister.
„Er gab mir einen goldenen Anhänger, auf den ich immer aufpassen und ihn nicht aus der Hand legen soll. Es habe ihm gefallen, wie mutig ich gekämpfte habe. Dann starb er. Seither habe ich diesen Anhänger immer bei mir. Wenn ich aber in den Orden aufgenommen werden sollte, darf ich keine eigenen Wertsachen mehr besitzen. Was soll ich tun?“
„Zeige ihn mir“, forderte de Molay und hielt ihm die offene Hand hin. Jan nestelte das Schmuckstück aus seinem Kittel und legte es in die Hand des Ordensoberen. Der sah sich den Anhänger lange an und dachte nach. Schließlich gab er die Kette wieder an Jan zurück.
„Weißt du, was das Schmuckstück bedeutet?“, wollte de Molay wissen.
Jan schüttelte den Kopf.
„Ich weiß zwar, dass die französischen Lilien darauf sind. Das Wappen ist mir aber unbekannt.“
„Ich gestatte dir ausdrücklich, dass du dieses Schmuckstück weiter behalten darfst“, erklärte der Großmeister, ohne auf das Wappen näher einzugehen, „trage es immer bei dir und zeige es nicht herum. Es kann dir irgendwann einmal sehr nützlich sein. So und jetzt gehe wieder in deine Kammer.“
Mit einer Handbewegung war Jan entlassen und konnte gehen. Kurz bevor er die Tür erreichte, rief ihn de Molay noch einmal zurück.
„Sag einmal, was war das für eine unstandesgemäße Prügelei auf dem Hof, an der du beteiligt warst?“
Jan stotterte herum. Er wollte einerseits seinen Gegner nicht hereinreißen, andererseits musste er seinem Ordensoberen ehrlich Rede und Antwort stehen.
„Herr, es war ein hitziges Gefecht, eher eine späte Fortsetzung der heftigen Übungskämpfe, nur dass Frater Antonius nicht mehr dabei war.“
„So, so, eine Fortsetzung der Übungskämpfe“, murmelte de Molay und sah sein junges Gegenüber mit einem nachdenklichen Blick an, „ohne dass Frater Antonius dabei war.“
Dem jungen Flandern wurde ganz ungemütlich. Aber dann entließ ihn der Großmeister. Kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen, kam der Seneschall hinter dem Vorhang hervor, der einen Nebenraum von der Kemenate abgrenzte. Er grinste.
„Na, Bruder Jaques, was habe ich gesagt? Nicht ungeschickt, wie er sich aus der Affäre gezogen hat, und ganz ohne Geoffroy de Charny anzuschwärzen. Mit ihm haben wir einen guten Mann.“
„Ja, das glaube ich auch, Bruder Guido. Und das, was mich besonders beeindruckt hat, er hat mir das Wappen der Könige von Frankreich gezeigt. Es gehörte mit Sicherheit der Familie Valois, wenn ich mich nicht sehr irre. Er hat es offenbar von Charles bekommen, der in Flandern gefallen ist. Ich habe ihm geraten, es gut zu verwahren. Es könnte ihm noch einmal nützlich sein.“
Der Seneschall nickte.
„Ja, das könnte schon sein. Und es ist gut, dass ich weiß, dass Ihr ihm erlaubt habt, das Amulett zu tragen.“
„Und nun lasst uns über die Zeremonie reden. In einigen Tagen wollen wir die jungen Leute in den Orden aufnehmen und dann gibt es noch wichtige Dinge zu bereden. Wir haben wenig Zeit.“
Die beiden Ordensoberen vertieften sich ins Gespräch und baten noch den einen oder anderen aus der Ordensspitze hinzu.
Dann kam der Tag, an dem Jan und einige andere Bewerber in den Orden aufgenommen werden sollten.
Jan wurde von seiner Kammer abgeholt und in eine andere Kammer geführt, in die wiederum zwei Ordensbrüder traten. Einer der beiden, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, fragte:
„Wollt Ihr in die Gemeinschaft des Templerordens aufgenommen und an seinem geistlichen und weltlichen Wirken teilhaben?"
„Ja, das will ich.“
„Ihr begehrt, was groß ist, und Ihr kennt die harten Vorschriften nicht, die in diesem Orden befolgt werden. Ihr seht uns mit schönen Gewändern, schönen Pferden, großer Ausrüstung, aber das strenge Leben des Ordens könnt Ihr nicht kennen; denn wenn Ihr auf dieser Seite des Meeres sein wollt, so werdet Ihr auf die andere Seite des Meeres geschickt und umgekehrt; wollt Ihr schlafen, so müsst Ihr wachen, und hungrig müsst Ihr fortgehen, wenn Ihr essen wollt. Ertragt Ihr all dies zur Ehre, zur Rettung und um das Heil Eurer Seelen Willen?“
„Ja, das alles ertrage ich.“
„Seid Ihr katholischen Glaubens?“
„Ja, ich bin katholisch getauft.“
„Befindet Ihr Euch in Übereinstimmung mit der Mutter Kirche, dem Papst und den Gesetzen der Kirche?“
„Ja, das bin ich?“
„Gehört Ihr einem anderen Orden an?“
„Ich war in der Weberinnung in Flandern, bin dort aber nicht mehr gelitten und in einem anderen Mönchsorden war ich nicht und bin ich nicht.“
„Seid Ihr durch Ehebande gebunden?“
„Nein, ich bin frei und keiner Frau versprochen.“
„Habt Ihr körperliche Gebrechen, die den schweren Dienst im Ordenshaus oder im Kampf beeinträchtigen könnten?“
„Ich habe keine Gebrechen und bin nicht krank und die Waffen vermag ich zu führen.“
„Jetzt wartet hier, bis wir den Großmeister unterrichtet haben. Wir werden Euch rufen, wenn es so weit ist.“
Jan kniete sich auf den Schemel. Er konnte an nichts mehr denken. Sein Kopf war leer. So wusste er nicht, wann die Brüder mit ihren Kapuzen wieder zu ihm kamen. Waren eine Stunde oder zwei oder mehr vergangen? So war es für ihn völlig überraschend, als er plötzlich wieder die Stimme hörte, die ihn bereits vernommen hatte.
„Bruder Jan, wir haben den Großmeister unseres Ordens über das positive Ergebnis unserer Befragung unterrichtet. Er wünscht, dass Ihr barhäuptig vor ihm erscheint. Wir werden Euch führen, folge uns. Wenn Ihr vor den Großmeister geführt werdet, bittet Ihr ihn um Aufnahme mit folgendem Satz.“
Der Ritter erläuterte langsam und mit Pausen, was Jan zu sagen hatte. Dann wurde er angewiesen, ihnen zu folgen.
Die beiden Ritter gingen vor ihm durch die Gänge des Ordenshauses, über Flure, Treppen und schmale Steige. Jan wusste schon lange nicht mehr, wo er sich in dem weitläufigen Haus befand. Schließlich betraten sie eine große Halle. An der Kopfseite stand der Großmeister, um ihn herum eine große Anzahl von Tempelrittern in ihren weißen Mänteln mit dem roten Tatzenkreuz über den braunen Kitteln der Mönche.
Vor dem Großmeister angekommen, kniete Jan sich hin und sprach die Bitte aus, die er vor wenigen Minuten gelernt hatte.
„Herr, ich bin vor Euch und vor die Brüder getreten, um Aufnahme in die Gemeinschaft des Ordens zu erbitten.“
„Ich habe es vernommen und die Brüder haben es vernommen“, antwortete Jaques de Molay mit lauter Stimme und hob sie noch einmal an.
„Schwört Ihr bei Gott, dass Ihr immer allen Christen helfen werdet?“
„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.“
„Schwört Ihr bei Gott, niemals den Orden ohne Einwilligung eines Meisters zu verlassen?“
„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.“
„Schwört Ihr bei Gott, dass Ihr immer und jederzeit Euch anvertrautes Templergut behüten und verteidigen werdet?“
„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.“
„Dann bestimmt jetzt drei Personen, für die der Orden bei Eurer Abwesenheit sorgen soll.“
Die Aufforderung traf Jan völlig unvorbereitet. Er schwieg einen Moment und dachte nach. Es entstand eine spannungsgeladene Stille in dem großen Raum. Doch dann hatte er sich entschlossen.
„Herr, es gibt niemanden, für den der Orden in meiner Abwesenheit sorgen soll.“
Wenn er geglaubt hatte, dass er noch einmal gefragt würde, so sah er sich enttäuscht. Jaques de Molay akzeptierte kommentarlos Jans Entscheidung.
„So sei es“, und dann wandte er sich an die anwesenden Brüder, „habt Ihr alle es gehört?“
Zustimmendes Gemurmel erhob sich. Jaques de Molay ließ sich von dem Großtappier, der für die Kleidung im Ordenshaus zuständig war, einen weißen Mantel geben, legte ihn sich über den Arm und nahm sein Schwert. Dann stieg er langsam und würdevoll die Stufen hinunter, legte dem vor ihm knieenden Jan de Koninck das Schwert mit seiner Breitseite auf die linke Schulter.
„Nun seid Ihr ein Ritter des Ordens pauperes militones christi templique salomonici hierosalemitanis - der Armen Ritterschaft Christi und des salomonischen Tempels zu Jerusalem.“
Gleichzeitig legte er Jan de Koninck den weißen Mantel um und küsste den jungen Mann auf den Mund. Dann begab er sich wieder auf die Empore, während der Reihe nach alle Ritter Jan umarmten und ebenfalls auf den Mund küssten. Nachdem der Bewerber nun offiziell aufgenommen war, legte der Seneschall dem neuen Bruder die umfangreiche Ordensdisziplin dar und stellte die wichtigsten Regeln vor. Zu denen gehörten auch die drei Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armut.
„Habt Ihr das alles verstanden?“, fragte der Großmeister.
„Ja, das hab ich alles verstanden“, antwortete Jan.
„Nun gehet hin, Ritter Jan, Gott wird Euch besser machen", beendete der Großmeister die Aufnahme.
Dann wiederholte sich die Zeremonie bei allen, die heute aufgenommen wurden. Neben Geoffroy de Charny befand sich auch sein Freund Johann Laurenz unter den Bewerbern, die an diesem Tag aufgenommen wurden. Er wurde zu Jans Freude aus dem Stand eines Sergeanten angehoben und von Jaques de Molay ganz offiziell zum Ritter geschlagen.
Nachdem die Aufnahmezeremonien beendet waren, begaben sich alle Ritter in einer Prozession in die Kirche und feierten einen Gottesdienst, den der Vertreter des Bischofs, ein Archidiakon, zelebrierte.
Anschließend kam Geoffroy in Begleitung des Seneschalls auf Jan zu. Mit leicht säuerlichem Gesicht aber lauter Stimme entschuldigte er sich für sein Verhalten auf dem Hof vor einigen Tagen. Großmütig nahm Jan die Entschuldigung an.
Dann entfernte sich der Champagnerer wieder, noch immer begleitet von dem Seneschall. Jan und Johann sahen hinter den beiden her.
„Er hat sich zwar bei dir entschuldigt, aber das ist ihm verdammt schwergefallen und hat wahrscheinlich auch nur geklappt, weil der Seneschall ihm auf den Hacken stand“, murmelte Johann, „wie ich schon sagte, ein Freund wird das nie und nimmer mehr.“
„Ja“, antwortete Jan, „da hast du sicher recht. Aber ich weiß nicht, warum er mich ganz bewusst beleidigt hat. Ich hatte ihm nichts getan und weder mit ihm noch mit irgendeinem seiner Verwandten Streit.“
„Ich glaube, du kennst nicht alle seine Verwandten. Oder ist dir bekannt, dass sein Onkel der Marschall des Ordens und ein enger Freund von Jaques de Molay ist und auch noch den gleichen Namen hat wie Ritter Geoffroy.“
„Ja, das ist mir bekannt. Er hatte mir das vor der Auseinandersetzung gesagt. Wohl um mich zu beeindrucken“, antwortete Jan und schaute nachdenklich hinüber zum Ordenshaus, in das sich die obersten Würdenträger zurückgezogen hatten, um mit dem Großmeister zu beraten.
In den folgenden Tagen blieb das Tor der Ordensburg verschlossen und die Zugbrücke war hochgezogen. Es kam niemand herein und ebenso durfte niemand hinaus. Die Wachen aus gut bewaffneten Knechten des Ordens waren verstärkt und die Fuhrwerke im Garten de Molays hinter dem Ordenshaus aufgestellt worden. Auch in den Garten durfte niemand hinein. Auch keine Ritter. Der Großmeister hatte es verboten und die Wachen entsprechend angewiesen. Es war für alle Templer klar, dass irgendetwas im Gange war.
Jan war nach dem Kirchgang am Sonntag überraschend zum Großmeister gerufen worden. Jaques de Molay weinte. Noch niemals zuvor hatte irgendjemand den Großmeister des mächtigen Templerordens weinen sehen. Jan sah ihn fassungslos an. Seine fragenden Augen hefteten sich an die Lippen des alten Großmeisters.
„Der französische König führt gegen uns Templer etwas im Schilde. Es war ein Fehler von mir, das Vermögen des Ordens hier nach Paris zu bringen. Das muss sich ändern. Ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen meines Lebens passieren wird“, hauchte der ehrwürdige alte Großmeister mit dem weißen Bart und den langen, bis auf die Schultern reichenden, schlohweißen Haaren, „aber ich werde vor dem König nicht weglaufen. Ich habe keine Angst vor den Folterknechten, werde mich nicht einschüchtern lassen und auf keinen Fall den Orden verleugnen.“
„Wenn die Häscher kommen, sollten sie besser eine Menge Knechte mitbringen“, ereiferte sich der junge Ritter, „dann tragen wir es aus.“
Der Großmeister legte dem ungestümen jungen Mann seine Hand auf die Schulter.
„Nein, Ritter Jan, schön, dass Ihr uns mit der Kraft Eurer Jugend verteidigen wollt, aber das wäre nicht klug. Wir werden hier sicher nichts austragen. Sie sind zu viele. Widerstand wäre hier in Frankreich und besonders in Paris sinnlos. Nein, mein Junge, wir werden unser Vermögen vor den gierigen Händen des unersättlichen Königs retten und ich persönlich werde auf Hilfe durch den Papst hoffen und versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Nur die Besten werden ausersehen, unser Vermögen zu retten. Euch habe ich mit einigen anderen Brüdern, Sergeanten und Knechten dazu auserwählt, einen großen Teil unseres Schatzes zu retten und damit nach Kastilien zu gehen. Euer Ziel sollte unsere Burg in Ponferrada sein. Dort seid Ihr in Sicherheit und wartet die weitere Entwicklung ab. Auf dem Weg von Rennes nach Ponferrada, dort und auch später, werdet Ihr die alleinige Verantwortung über das anvertraute Vermögen haben. Niemand, auch kein Komtur, hat Euch da hineinzureden. Bis Rennes le Château wird unser Seneschall den Transport führen. Dann werdet Ihr es allein schaffen. Auf dem Weg von Paris bis zu den Pyrenäen könnt Ihr von Ritter Guido lernen.“
Der junge Mann starrte seinen Großmeister an. Es hatte ihm die Sprache verschlagen. Bevor er anfing zu stottern, schwieg er lieber.
„Noch heute Nacht werde ich den anderen meine Entscheidung mitteilen. Warum ich diese Wahl getroffen habe, wird nicht diskutiert. Sie wird akzeptiert. Jetzt geht und seid pünktlich zur Nachtmesse in der Kirche. Ich werde Euch wieder zu mir rufen.“
Noch in der gleichen Nacht zum Montag, man schrieb den 9. Oktober des Jahres 1307, klopfte es an die Zellentür von Jan. Ein älterer Bruder bat ihn, mit zum Großmeister zu kommen. Dort befanden sich bereits der Seneschall Guido de Voisius, Johann Laurenz, Hugo de Chalon, Hugo de Pairaud und Gerard de Villers. Auf einem großen Tisch lagen die Kettenhemden der Templer so hergerichtet, als sei ein Krieg zu bestehen. Der Großmeister, er erschien allen Anwesenden sichtlich um Jahre gealtert, machte eine umfassende Geste.
„Brüder, ich habe für Euch die Kettenhemden herrichten lassen, denn Ihr habt einen schweren Gang vor Euch. Ich vertraue Euch das Vermögen des Ordens an. Es wird in drei Teile geteilt.“ De Molay machte eine kleine Pause, so als ob er schweren Herzens Luft holen müsse.