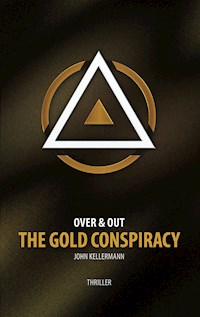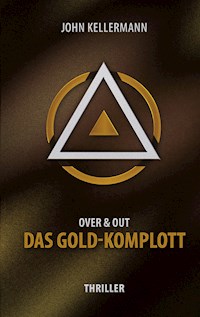
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Frankfurt am Main, an einem kalten Novembermorgen. Griechenland ist pleite. Die Finanzmärkte brechen zusammen. Zur Beruhigung der Bevölkerung holt die Bundesbank ihre im Ausland gelagerten Goldbestände nach Deutschland zurück. Auf dem Weg zur Gold-Pyramide wird ein streng bewachter Goldtransport überfallen. Die Ermittlungen laufen an. Ein Journalist stellt tödliche Fragen. Gefälschte Goldbarren tauchen auf. Aber existiert unser Gold überhaupt noch? Welche Rolle spielt die CIA? Wurden wir alle betrogen? Der Reporter Markus Manx und die Hackerin Lena recherchieren in Frankfurt, Hamburg und Berlin. Sie geraten zwischen alle Fronten. Gnadenlos werden sie von ihren mächtigen Gegnern gejagt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Aber viel zu spät ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Epilog
Vorrede
Frankfurt am Main, 2016
Der Leser, der dieses Buch in den Händen hält, muss wissen, dass alles meiner Phantasie entsprungen ist. Ähnlichkeiten mit existierenden Personen und Sachverhalten können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aussagen über die Zukunft bleiben, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, aber immer Fiktion. Um Beteiligte und Informationsquellen zu schützen, habe ich die Personennamen geändert. Die meisten Orte sind real.
Das, was jetzt folgt, beginnt in naher Zukunft.
gez. John Kellermann
Montag
Polen, Szczytno-Szymany, 01:00 Uhr. Lange Zeit war es geheim gewesen. Streng geheim. Vor 15 Jahren allerdings hatte das Barackenlager in der Nähe des kleinen Flugplatzes im Nordosten Polens eine zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Damals kamen die illegalen Internierungen und Folterungen von Gefangenen ans Tageslicht – nach den Anschlägen von 9/11 hatte der polnische Geheimdienst das Lager der CIA überlassen. Inzwischen jedoch war der Skandal um Waterboarding, Schlafentzug, Schläge und andere Methoden, um Gefangene ohne Rechte zu zweifelhaften Aussagen zu bewegen, wieder in Vergessenheit geraten. Sowohl die polnische Regierung als auch die Amerikaner hatten wiederholt verlauten lassen, das Verhörzentrum mit dem damaligen Codenamen Quarz existiere nicht mehr.
Eine Lüge. Vorübergehende Nichtnutzung bis erneut Bedarf besteht, wäre treffender gewesen, wie die Geschehnisse der vergangenen Nacht verdeutlichten. Da landete eine kleine Maschine vom Typ Gulfstream G550 auf dem Flugplatz Szczytno-Szymany. Die Kennzeichnung auf den Rumpftriebwerken war unkenntlich gemacht worden. Klares Indiz für eine geheime Mission mit hoher Dringlichkeit, welche eine Reaktivierung des Verhörzentrums rechtfertigte. Zumindest in den Augen der Verantwortlichen.
Es ging auf Neumond zu, und um 01:00 Uhr nachts herrschte entsprechende Dunkelheit. Am Rande des Rollfeldes wartete ein schwarzer Chevrolet-Van mit verspiegelten Scheiben, bis aus dem Flugzeug mehrere Personen ausstiegen. Eine Gestalt, die Hände auf den Rücken gefesselt, links und rechts flankiert von schwarz gekleideten Bewachern, wurde über die Landebahn Richtung Fahrzeug geführt. Über den Kopf hatte man ihr einen dunklen Sack gezogen. Es dauerte keine Minute, bis die Personen in den Van eingestiegen waren, der sich nun langsam in Bewegung setzte.
Die Fahrt zum Barackenlager war kurz. Es war umgeben von einem mannshohen, massiven Zaun, oben zusätzlich gesichert mit messerscharfem T-Draht. Hinter dem Zaun lag ein befahrbarer Kontrollstreifen, dann mehrere Reihen Tannen, die einen näheren Blick auf die dahinter liegenden Holzbaracken verwehrten. Erkennbar befanden sich die äußeren Sicherungseinrichtungen der Anlage, im Gegensatz zu den Holzbaracken, in gutem Zustand befanden.
„Stopp!”, rief der mit einer Maschinenpistole bewaffnete Wachposten am Eingangstor. An seinem Tarnanzug fehlten die Hoheitsabzeichen, so dass kein Hinweis auf die Nationalität möglich war. Langsam rollte der Van auf das Tor zu, der Fahrer hielt seinen Ausweis hoch, ohne das Fenster ganz herunterzulassen. Daraufhin salutierte der Posten zackig und ließ das Fahrzeug passieren. Offenbar war er über den Transport instruiert.
*
Fünf Stunden hatte das Verhör gedauert. Für den Spezialisten Ted Branigan normalerweise reine Routine. Er war zuständig für solche Aktionen in Zentral-Europa und hatte Derartiges schon hunderte Male durchgeführt. Je nach Situation wendete er verschiedenste Techniken an, um an die gewünschten Informationen zu kommen. Doch heute war es nicht so gelaufen wie sonst immer. Das Problem war die Zeit. Die Informationen wurden dringend gebraucht.
„Verdammte Scheiße!”, Ted Branigan zog seine blutverschmierten Lederhandschuhe aus und warf sie auf den Betonboden. Sichtlich sauer schnappte er sich sein Satellitentelefon.
„Peter soll mich auf einer abhörsicheren Leitung zurückrufen! … Ja! Sofort!”
Branigan wirkte angespannt, als er auf den Rückruf wartete. Einen Moment später klingelte das Telefon. Beim zweiten Klingelzeichen hatte er das Gerät bereits am Ohr:
„Ja?”
„Ted, was ist los?”, fragte Peter Redman am anderen Ende.
„Du weißt, wo ich gerade bin?”
„Ja, an einem ruhigen Ort, um Informationen zu sammeln”, antwortete Redman.
„Exakt. Ich habe versucht, Neuigkeiten aus dem Huntsman rauszuquetschen. Anfangs hat er wie erwartet auf die Behandlung reagiert”, teilte Branigan seinem Kollegen mit. Sein Gesichtsausdruck zeigte keine Spur von Mitgefühl, für ihn war es einfach nur ein Job. „Er hat gewimmert und gefleht. Und in den ersten Stunden hat er unsere Fragen zufriedenstellend beantwortet.”
„Welche Ergebnisse habt ihr?”
„Wir wissen nun, wo er die Unterlagen und Informationen versteckt hat. Aber in der Sache konnten wir nichts Neues aus ihm rauskriegen. Er hat genau das ausgepackt, was wir schon vorher wussten.” Nach einer kurzen Pause fuhr Branigan fort: „Wir hatten nur noch gut zwei Stunden Zeit, darum haben wir härtere Methoden angewendet.”
„Und? Was hat das gebracht?”
„Nun ja … Vielleicht habe ich ihn schlecht getroffen? … Vielleicht war er labil? … Mitten in der Vernehmung sackte er jedenfalls zusammen. Und das war's.”
„Er ist tot?”
„Ja, verdammt. Ich konnte doch …”
Weiter kam Branigan nicht.
„Du Vollidiot!”, zischte Redman wütend.
Dann war es still in der Leitung. Branigan wusste, dass er einen dramatischen Fehler gemacht hatte. Das hätte ihm nicht passieren dürfen. Aber bei Befragungen dieser Art, auch noch unter Zeitdruck, blieben immer Risiken. Und der Huntsman hatte offenbar ein schwaches Herz gehabt, das der brutalen Prozedur nicht standhielt.
„Ihr wisst also nicht mehr, als wir aus den Papieren schon kennen?”, nahm Peter Redman das Gespräch nach ein paar Sekunden wieder auf.
„Nein.”
„Hat er Namen genannt? Wer wusste außer ihm von der Gold-Geschichte?”
„Er erzählte etwas von einem Miller, der Kontakt zu ihm aufgenommen habe. Aber der Name ist vermutlich falsch, und beschreiben konnte er ihn auch nicht, weil er ihn nie persönlich getroffen hat.”
„Und woher hatte er die Unterlagen?”
„Auch das wusste er angeblich nicht. Er sagte, sie wurden an der Rezeption seines Hotels abgegeben.”
„Verdammter Mist, das bringt uns nicht weiter!”, fluchte Redman.
Er ließ sich von Branigan noch erklären, wo der Huntsman die Unterlagen und die Informationen versteckt hatte, dann gab er ihm neue Instruktionen: „Ted, ihr müsst ihn zurück nach Berlin schaffen, und das schnell. Nichts darf auf eine Befragung schließen lassen.”
Er zögerte einige Sekunden … „Habt ihr einen Plan?”
„Ja, haben wir.” Ted Branigan hatte mehrere Möglichkeiten im Kopf, wie man eine dermaßen übel zugerichtete Person loswurde, ohne viele Fragen zu provozieren. Liefe alles nach Plan, würde auf dem Totenschein nur stehen Todesart: nicht natürlich durch Suizid. Eine oberflächliche Inaugenscheinnahme durch einen Pathologen, der aus finanziellen Motiven nicht so genau hinsah, würde nichts anderes ergeben.
„Die nächsten Schritte besprechen wir, wenn das erledigt ist. Und jetzt keine Fehler mehr, verstanden!” Peter Redman beendete das Gespräch, ohne eine Antwort abzuwarten.
Ted Branigan steckte sein Telefon in die Hosentasche.
Ein zweiter Mann, er hatte etwas abseits in einer dunklen Ecke gesessen und das Verhör die ganze Nacht lang schweigend verfolgt, stand jetzt auf, drehte seinen Kopf leicht nach links. Ein deutliches Knacken seiner Halswirbel war hörbar. Zusammen mit Ted Branigan verließ er den Raum.
Ted musste sich jetzt darum kümmern, dass alles ordentlich aufgeräumt wurde.
*
Frankfurt am Main, Flughafen, 06:10 Uhr. Der Nachthimmel hatte schon einen Hauch ins Stahlblaue, die Luft war kalt und glasklar. Am Ende der Landebahn Süd zeigte sich ein orange leuchtender Strich, der langsam breiter wurde. Gleich würde die Sonne aufgehen …
Die Otto Lilienthal landete auf dem militärischen Abschnitt des Frankfurter Flughafens. Es war ein A310 der Bundesluftwaffe, der gerade aus New York zurückkam. Die Ankunftszeit entsprach exakt der generalstabsmäßigen Planung.
Das graue Langstreckentransportflugzeug von Airbus gehörte zur Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums, es war für spezielle Aufträge bestimmt. Und dieser Auftrag war absolut speziell.
„Pass doch auf, du Vollpfosten!”, brüllte der Frachtführer den Fahrer des Gabelstaplers an. Der war gerade dabei, eine Euro-Palette aus dem Flugzeug in einen gepanzerten Transporter umzuladen. „Die Fracht ist hochsensibel!”, wurde der Gabelstaplerfahrer eindringlich auf die Bedeutung seiner Aufgabe hingewiesen. Es durfte kein Fehler passieren. Fehler konnten sehr teuer werden. Äußerste Vorsicht war angesagt.
Etwas abseits, auf einer eigens dafür aufgebauten Empore, warteten mehrere Journalisten, die das hochgradig gesicherte Umladen der wertvollen Fracht für die Öffentlichkeit aufzeichnen sollten.
„Die Otto Lilienthal ist mit einem laserbasierten Abwehrsystem gegen infrarotgelenkte Raketen ausgerüstet”, ließ einer der Reporter, der mit seinem Teleobjektiv die Szene fotografierte, die anderen wissen, ohne dass ihn jemand danach gefragt hätte. „Und hat eine Reichweite von über 13.000 Kilometern. Schafft die Strecke New York – Frankfurt folglich ohne Zwischenlandung.”
„Klugscheißer!”, murmelte sein fröstelnder Nebenmann, der solche Belehrungen am frühen Morgen nicht vertrug, und rieb sich die kalten Hände. Er wollte einfach nur den Job erledigen und dann unverzüglich zurück in sein warmes Büro.
Aber noch war es nicht so weit. Die Gruppe beobachtete das Umladen der wertvollen Ladung in einen gepanzerten Transporter. Sie hatten an diesem kalten Novembermorgen den Auftrag, Fotos von der kostbaren Fracht zu schießen. Möglichst viele und möglichst beeindruckende Fotos sollten es sein. Und damit alles schön kamerafreundlich glänzte, wurde die Kiste mit dem Gold sogar kurz geöffnet. Zehn Schichten mit jeweils 24 Goldbarren à 12,5 Kilogramm kamen zum Vorschein. Perfekt aufgeschichtet wie große goldfarbene Legosteine, abwechselnd um 90 Grad gedreht, damit der ganze Stapel Halt hatte. Nach einer Minute freien Blicks auf den Goldhaufen klappten zwei mit Sturmhauben vermummte Soldaten, die Seitenwände wieder hoch. Nach dem Arretieren der Metallschnallen hoben sie den Deckel wieder auf die Kiste. Nur wenige Minuten dauerte das Spektakel, und die Männer hatten die Palette verladen und sorgfältig in dem Transporter verstaut. Das Fotoshooting war beendet.
Rasch stiegen Fahrer und Beifahrer in das gepanzerte Fahrzeug und verriegelten die Fahrerzelle von innen. Langsam setzte sich das Gefährt in Bewegung, als Begleitschutz vorweg fuhr ein Jeep mit zwei Soldaten.
„Ankunft Eagle Null-Siebenhundert!”, meldete der Kommandierende über sein Funksprechgerät. „Wir rücken ab! Over and out!”
Schnell wurden noch letzte Fotos von dem abrückenden Konvoi geschossen, dann kam Aufbruchsstimmung unter die Journalisten. Fünf von ihnen schleppten Profiausrüstungen mit großen Teleobjektiven. Nur Markus Manx hatte ein einfaches Equipment dabei, seine Uralt-Canon EOS 50D und ein mageres 300er Hobby-Tele. Er war von der Hessischen Neuesten Presse beauftragt worden, eine Reportage über den Goldrücktransport von New York nach Frankfurt zu schreiben. Und wenn er schon mal vor Ort war, dann sollte er auch gleich ein paar Fotos schießen. Das ersparte der Redaktion, diese später teuer von den Profikollegen kaufen zu müssen.
John Spencer der gerade sein schweres Stativ zusammenpackte war einer dieser Profis. Markus Manx kannte ihn recht gut. Früher hatten sie zusammen eine ganze Reihe Aufträge erledigt. John schoss die Fotos und Markus schrieb die Geschichte dazu. Dass sie sich heute hier begegneten, war reiner Zufall.
„Hallo John, soll ich dir beim Tragen helfen? Ich habe noch eine Hand frei”, bot Markus seinem Kollegen an.
„Gerne. Ich parke nur ein paar hundert Meter entfernt. Allerdings im Halteverbot. Wenn du willst, kannst du auch gleich mit mir zurück in die Stadt fahren. Oder hast du dir zwischenzeitlich ein eigenes Auto angeschafft?”
Markus klemmte sich das zusammengeschobene Fotostativ unter den Arm.
„Du weißt ja, wie mager die Auftragslage noch immer ist und wie schlecht man freie Journalisten bezahlt. Klar, ich fahre gern mit.” John Spencer nickte, und beide machten sich auf den Weg zu seinem Auto.
*
Markus, John und die übrigen Journalisten verließen die Plattform. Nur einer blieb zurück und verschickte mit seinem Notebook erste Fotos bereits an Ort und Stelle.
Als wenn es bei diesem Routineauftrag um Minuten ginge, dachte Markus, als er mit John den Schauplatz räumte. Er hatte keine Ahnung, wie dringend der Auftrag wirklich war.
Der Fotojournalist tippte auf seinem Notebook und dachte mit breitem Grinsen an die Äußerung des wichtigtuerischen Kollegen. A310 mit laserbasiertem Abwehrsystem? … Funktioniert fast immer, nur nicht im Einsatz – wie das Gewehr G36.
Besonders erfreut war er über ein Foto, auf dem keine Spur von Gold zu sehen war. Es zeigte das auf ein Klemmbrett gespannte Papier, das der ranghöchste Offizier an den Oberleutnant überreichte. Dank des 800er Teleobjektivs ließ sich mühelos lesen, welche Route der Einsatzbefehl für den Konvoi vorgab.
„Das Päckchen ist abgeschickt”, flüsterte er in ein abhörsicheres Satellitentelefon. „Es wird heute über Neu-Isenburg geliefert.”
„Verstanden. Das Päckchen kommt über Neu-Isenburg”, kam es aus dem Telefon zurück.
Der mysteriöse Fotograf verstaute das Telefon zusammen mit dem Notebook in seiner Ausrüstungstasche. Er schlug den Kragen seiner Pelzjacke hoch und verschwand in der Morgendämmerung.
*
Währenddessen waren John und Markus bei einem braunen Audi 100 Avant angekommen. Nicht mehr lange, und John kann ein steuerbegünstigtes Oldtimer-Kennzeichen beantragen. Na ja, vermutlich nicht wirklich, weil der Wagen keinesfalls den notwendigen Erhaltungszustand für ein solches Kennzeichen erfüllen wird, dachte Markus, als er den Wagen betrachtete. Der Audi machte einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck, und die braune Farbe – absolut hässlich. Vorsichtig schloss Markus die klapprige Tür. John entfernte das „Presse”-Schild unter der Windschutzscheibe, mit dem er den Parkplatz im Halteverbot rechtfertigte, und fuhr los.
Die Fahrt vom Flughafen in die Frankfurter Innenstadt dauerte nicht lange, um diese Zeit war der Berufsverkehr noch nicht in vollem Gange. Markus und John plauderten über alte Zeiten. Zeiten, in denen alles noch irgendwie besser gewesen war.
„Wem sagst du das! Mit der heutigen Bearbeitungssoftware ist Fotojournalismus ein Geschäft für Jedermann geworden. Du bist mit deiner Amateurkamera der beste Beweis”, frotzelte John und warf Markus einen herausfordernd Blick zu.
„Ja ja, hast ja Recht. Aber ich kann doch auch nichts dafür, wenn die Redaktionen immer mehr sparen und jeden freien Journalisten als eierlegende Wollmilchsau sehen.”
Markus versuchte das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, das ewige Gejammer unter Kollegen nervte ihn. Auch sein eigenes.
„Jedenfalls ganz schön beeindruckend, wenn man die Verladung von drei Tonnen Gold beobachtet. Immerhin reden wir über stramme einhundert Millionen Euro.”
John fingerte umständlich eine Zigarette aus der Brusttasche und zündete sie an. Tief inhalierte er genüsslich den ersten Zug, den Rauch blies er durch das spaltweit geöffnete Seitenfenster nach draußen.
„Ich war schon zum dritten Mal bei einer dieser Verladeaktionen”, kommentierte er. „Immer wieder für andere Auftraggeber. Die Bundesbank und die Bundesregierung wollen offenbar allen auf Teufel komm raus zeigen, wie sie das Gold aus den USA zurückholen.”
„Du hast Recht. Das Ganze ist ein Schauspiel zur Beruhigung der Bevölkerung”, stimmte Markus zu. „Seit der offiziellen Pleite von Griechenland vor sechs Monaten wird eine Menge unternommen, um die panischen Finanzmärkte zu beruhigen.”
Markus betrachtete John von der Seite, wie dieser einen weiteren tiefen Zug nahm.
„Ich verstehe von Börsen und Wirtschaft nicht viel”, gab John zu, nachdem er ruhig den Rauch ausgeatmet hatte, „aber von unserer Regierung komme ich mir schon seit Jahren veräppelt vor. Die 160 Milliarden Euro, die wir den Griechen gegeben haben, waren doch von Anfang an futsch. Das müssen die doch gewusst haben!”
„Sicher. Niemand mit einem gesunden wirtschaftlichen Grundverständnis konnte ernsthaft glauben, dass Griechenland seine Schulden jemals zurückbezahlen würde … Und demnächst kommen Spanien oder Italien daher und fordern einen teilweisen Schuldenverzicht. Dann ist es endgültig aus mit dem Euro.”
„Ich kann das Thema nicht mehr hören”, versuchte jetzt John die Diskussion zu beenden. „Sag mir lieber, wo ich dich rauswerfen soll.” Geschickt flippte er den Zigarettenstummel durch den Fensterspalt auf die Straße.
„Am besten an der Taunusanlage bei der Gold-Pyramide. Ich muss dort noch ein paar Fotos schießen, bevor ich mich an meine Reportage setze.”
John lenkte den Wagen Richtung Taunusanlage.
„Kennst du den schon?”, fragte er.
Markus drehte sich zu ihm um und musste schmunzeln. Es war bisher noch kein einziges Treffen vergangen, an dem John nicht mit einem neuen Witz aufwartete.
„Also”, begann John, „Meine Frau ist heute mitten in der Nacht hochgeschreckt und hat geschrien – ich habe aus Reflex sofort den Müll rausgebracht!”
Aus dem Augenwinkel schaute er auf die Reaktion seines Beifahrers.
Markus grinste, höflichkeitshalber. Seine ehrliche Meinung für diesen typischen Spencer behielt er für sich. Kurz darauf hielt John. Markus bedankte sich für das Mitnehmen.
„Man sieht sich”, erwiderte John und schüttelte ihm die Hand.
Markus stieg aus. Vor ihm erhob sich geradezu majestätisch die Gold-Pyramide. Er ahnte nicht, was ihn heute noch erwartete.
*
Neu-Isenburg, 06:30 Uhr. „Alles läuft planmäßig!” funkte Oberleutnant Noah Schmidt, als der gepanzerte Konvoi Neu-Isenburg erreichte. Schmidt, 28 Jahre, durchtrainierter Körper, resolutes Auftreten war Führer der für den Transport verantwortlichen Gruppe. Neben ihm, auf dem Fahrersitz des Jeeps, saß Unteroffizier Ali. Wegen der Unaussprechbarkeit seines Nachnamens kannten ihn alle nur als Uffz Ali. Hinter dem Jeep folgten im gepanzerten Transporter die erfahrenen Hauptfeldwebel Klaus Nahgold als Fahrer und Patrick Jakobi als Beifahrer.
Ja, alles lief nach Plan. Was sollte schon passieren? Die Fahrstrecke wurde jedes Mal geändert, um das Risiko für Überfälle zu verringern. Schmidt und seine Gruppe erfuhren die Route erst kurz vor der Abfahrt.
Heute hatte die Einsatzzentrale eine Nebenstrecke durch Neu-Isenburg gewählt. Mit gutem Grund: Eine mobile Autobahnbaustelle auf der A3 vor dem Kreuz Frankfurt-Süd führte kurzzeitig zu einer Fahrbahnverengung auf eine einzige Spur. Da es keine Ausweichspur gab, hatten die Spezialkräfte das Nadelöhr als kritisch eingestuft. Aber die Engstelle ließ sich über Neu-Isenburg sicher umfahren, so der Beschluss der Einsatzleitung.
„Eagle, wir haben eure Peilung deutlich auf dem Monitor – Over”, antwortete die Leitstelle in der Zentralbank. Der gepanzerte Transporter hatte sich an der vereinbarten Koordinate Alpha zurückgemeldet. „Alpha wie Araltankstelle, leicht zu merken”, hatte Hauptfeldwebel Nahgold bei der morgendlichen Routenbesprechung gutlaunig kommentiert.
Jene Araltankstelle auf der Friedhofstraße hatten sie soeben passiert, als der Führungsjeep auf einmal stoppte. Ein Feuerwehrmann in voller Montur, mit von weitem sichtbaren fluoreszierenden Leuchtstreifen und blinkender Kelle in der Hand, versperrte den Weg. Hinter Uffz Ali blieb auch sein Hintermann Nahgold mit seinem Fahrzeug stehen. Schmidt kurbelte das Fenster herunter, um die Ursache festzustellen.
„Vollsperrung der Friedhofstraße wegen Verkehrsunfall”, informierte der Feuerwehrmann routiniert. „Am besten Sie nutzen die Umgehung über Buchenbusch. Hier rechts, nach hundert Metern dann links.”
„Okay. Danke”, antwortete Schmidt. Durch die offene Seitenscheibe gab er das Handzeichen zur Weiterfahrt. Der Konvoi setzte sich in Bewegung und bog rechts ab. Das GPS-Navigationsgerät sprang sofort auf die alternative Route um. Hundert Meter weiter die Abbiegung nach links in den Buchenbusch. Die Umgehung war mustergültig ausgeschildert.
Auf Höhe des Alten Friedhofs schoben zwei junge Mütter ihre Kinderwagen über die Straße, sie unterhielten sich angeregt.
Der Konvoi reduzierte die Geschwindigkeit.
„Vorsicht!”, schrie Nahgold im Sicherheitstransporter. Von links raste ein SUV auf den vorausfahrenden Jeep zu. Doch Uffz Ali im Führungsfahrzeug konnte ihn nicht hören. Zum Ausweichen wäre es sowieso zu spät gewesen.
Ein ohrenbetäubender Knall, der sogar durch die gepanzerten Scheiben des Sicherheitstransporters zu hören war, zerriss die morgendliche Idylle. Der schwere VW Touareg, der aus einer Nebenstraße geprescht kam, erwischte das Führungsfahrzeug voll am linken Kotflügel. Glas splitterte, die Wucht des Aufpralls riss Uffz Ali fast das Lenkrad aus den Händen. Instinktiv umklammerte Ali es mit aller Kraft. Vergeblich, der Jeep schleuderte gegen die Bordsteinkante und kippte auf die Beifahrerseite.
Hauptfeldwebel Nahgold und sein Kamerad Jakobi in dem Sicherheitstransporter starrten wie gelähmt auf die Szenerie vor ihnen. Eine Vollbremsung brachte sie gerade noch rechtzeitig zum Stehen.
„Was ist hier los?”, brüllte Nahgold entsetzt.
Die erste Schrecksekunde war noch nicht vergangen, da krachte es noch einmal, rechts neben dem Sicherheitstransporter. Ein hinter ihnen fahrender Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich ruckartig auf den Seitenstreifen aus. Mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit endete er an einem Baum.
„War das wirklich ein Unfall?” Was sich hier gerade abspielte, verunsicherte Nahgold. Er war überfordert und wusste nicht mit der Situation umzugehen.
„Keine Ahnung”, entgegnete Jakobi. „Wir bleiben jedenfalls erstmal hier drinnen sitzen.”
„Aber die Verletzten brauchen Hilfe!”
„Du kennst die Vorschriften”, rüffelte ihn Jakobi zurecht. „Wir informieren als erstes die Leitstelle.”
Schon wenige Sekunden später zeigte sich, wie sinnvoll diese Vorschriften waren. Zwei Vermummte mit Maschinenpistolen eröffneten das Feuer auf das Führungsfahrzeug. Nahgold war völlig schleierhaft, woher sie so plötzlich auftauchten. Sie mussten ganz in der Nähe gelauert haben.
Eine der beiden Mütter schrie auf und versuchte, mit ihrem Kinderwagen hinter dem Transporter Deckung zu finden. Blitzschnell riss auch die zweite Frau ihren Kinderwagen herum und folgte ihr schutzsuchend. Jakobi riss das Funkgerät an sich und informierte die Einsatzzentrale.
„Fahrzeug hat unseren Führungsjeep gerammt. Bewaffnete haben mit MPs das Feuer eröffnet.” Noch während er das sagte, wurde es plötzlich stockdunkel im Fahrzeug. Kurz darauf brach die Funkverbindung zusammen.
*
Frankfurt am Main, Taunusanlage, 06:40 Uhr. „Was willst du? Verpiss dich, du Penner!” schnauzte Markus einen übel riechenden Mann mit Kapuzenpullover an, der ihn um 50 Cent anbettelte. Wenn das so weitergeht, kann man Frankfurt bald abschreiben. Die gerade fertiggestellte Gold-Pyramide zieht Penner und Asylanten magisch an, wie Sch... die Fliegen! Trotz seines Ärgers sprach Markus nicht einmal in Gedanken das Sch-Wort aus. Wegen seiner Kinder hatte er sich das vor Jahren abgewöhnt.
Früher gab es nur eine Handvoll Fixer hier, alles war unter Kontrolle. Aber jetzt wird die Taunusanlage von Hunderten gestrandeter Existenzen bevölkert und verdreckt. Die Stadt war nicht in der Lage, oder nicht willens, für ausreichende Hygienemaßnahmen zu sorgen. Kein Wunder, dass Spötter meinten, der Sicherheitsgraben um das Pyramiden-Bauwerk herum sei der größte Mülleimer Frankfurts.
Aber ein Knaller ist die Gold-Pyramide trotzdem, sinnierte Markus. Er trat dicht an die Absperrung aus Glas und Edelstahl heran. Das Geländer fühlte sich noch eiskalt und feucht von der Nacht an. Nur ein etwa fünf Meter tiefer Graben trennte ihn jetzt noch von den Goldbarren, die dort in großen Stapeln zur Schau gestellt wurden.
In der morgendlichen Dämmerung warf die Pyramide ein golden schimmerndes Licht bis hinüber zur Alten Oper. Träge tanzten die Lichtreflexe auf der hellen Sandsteinfassade des prächtigen Renaissancebaus. Fast schien ihm, als habe die Alte Oper ein zweigeschossiges Eingangsportal aus massivem Gold. Auch die umliegenden Luxus-Wohntürme bekamen ein wenig goldenen Glimmer von der Pyramide ab. Welche Symbolik! Offensichtlich kein Wohngebiet für mies bezahlte Journalisten, folgerte Markus in Gedanken. Fünfstellige Preise pro Quadratmeter sprechen ganz andere Berufsgruppen an.
Böse Zungen behaupteten, die Deutsche Bank habe den Bau der Pyramide mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag bezuschusst. Einzige Bedingung soll der Standort genau im Knick der Taunusanlage gewesen sein. Genauer gesagt zwischen Taunusanlage und Neue Mainzer. Nach den vielen Skandalen der letzten Jahre wolle die Deutsche Bank etwas vom Glanz der Pyramide abbekommen, grummelte es im Volk. Den Bankern war es egal. Die Doppeltürme erstrahlten jetzt jede Nacht gülden – tagsüber in der Unternehmensfarbe blau.
Markus amüsierte der Spottname der Pyramidengegner: Das Zäpfchen der Bundesbank. Bei weitem nicht alle empfanden die horrenden Ausgaben für den Bau als angemessen. Die einzigartigen Sicherheitsvorkehrungen entpuppten sich als Kostentreiber.
„Markus?” hörte er plötzlich hinter sich eine Stimme, die ihn aus seinen Gedanken riss. Neugierig drehte er sich um.
„Mensch Markus”, rief der Mann, „wir haben uns ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Gut siehst du aus. Wie geht's dir?”
Während ihm geradezu euphorisch die Hand geschüttelt wurde, durchsiebte Markus fieberhaft sein Namensgedächtnis. Kurz vor der Blamage fiel es ihm ein: Ja, Thomas! Sie kannten sich aus ihrer gemeinsamen Zeit an der Goethe-Universität.
„Thomas, altes Haus. Gut geht's. Und dir?”
An den Nachnamen konnte er sich beim besten Willen nicht erinnern. Aber dass Thomas einen gutbezahlten Job in einer der Frankfurter Großbanken hatte, das war ihm im Gedächtnis geblieben. Sie hatten beruflich vollkommen unterschiedliche Richtungen eingeschlagen und liefen sich auch deshalb gefühlt nur alle zehn Jahre über den Weg. So wie gerade jetzt.
„Gut geht's mir. Karriere läuft. Obwohl wir gerade super viel Stress mit den unruhigen Finanzmärkten und der Bankenaufsicht haben, die jeden Monat eine neue Sau durchs Dorf treibt”, ließ ihn Thomas wissen, hörbar gutlaunig.
„Verstehe.”
„Und bei dir, Markus? Was macht die Auftragslage? Du bist doch noch Journalist, oder?”
Jovial klopfte er Markus auf die Schulter.
„Läuft so. Man soll nicht klagen.”
Markus spürte keine große Lust, mit dem offenbar blendend aufgelegten Thomas eine intensive Unterhaltung anzufangen, schon gar nicht über seine wenig erbauliche Karriere. Die Auftragslage war bescheiden und sein Jahresverdienst lag vermutlich noch unter dem, was Thomas im Monat verdiente. Deshalb lenkte er das Gespräch in eine andere Richtung. Er zeigte auf das imposante Bauwerk neben ihnen.
„Glaubt man dem Hamburger Architekten Derhan soll die Gold-Pyramide eine Symbiose aus Pariser Louvre, Cheops-Pyramide und der Kuppel des Deutschen Bundestages sein. Mit einer Grundfläche von 75 mal 75 Metern und einer Höhe von fast 50 Metern ist sie doppelt so groß wie die Glas-Pyramide des Louvre”, wollte Markus vor seinem alten Studienkollegen wenigstens mit Wissen glänzen. Dass er sich diese Informationen erst vor kurzem im Vorfeld für seine Reportage angelesen hatte, ließ er offen.
„Ich weiß”, entgegnete Thomas unbeeindruckt. „Ohne Inhalt gerechnet war sie doppelt so teuer wie die Elb-Philharmonie in Hamburg, aber nur halb so groß wie Gizeh – zumindest was den überirdischen Teil betrifft. Und Derhan soll bei der Entwurfspräsentation ironisch gemeint haben, dass man Frankfurt komplett überdachen müsste, wenn man größer als Gizeh sein möchte.”
Thomas kam immer mehr in Fahrt. Markus merkte schnell, dass der Exkommilitone besser informiert war als er. Aber er hatte keine Chance, dessen Redeschwall zu stoppen.
„Und der architektonische Clou ist der: Zwei Pyramiden umgekehrt übereinander. Eine Hälfte über der Erde, die gespiegelte Seite darunter. Alles verglast. Alles Hoch-Sicherheitsglas. Streben aus Titanstahl. Und der freie Blick auf 75 Milliarden Euro in Gold. Fast 2.500 Tonnen, poliert und sorgfältig gestapelt. Sechs Etagen, unendlich lange Regalreihen. Eine goldgelb strahlende Sonne. Fort Knox ist dagegen ein Ponyhof!”
„Ja, da hast du Recht!” Mehr fiel Markus spontan nicht ein. Längst hatte er realisiert, dass Thomas sich offenbar enorm für die Gold-Pyramide interessierte. Und wenn er ihn in Sachen Pyramidenwissen schon nicht schlagen konnte, wollte er wenigstens ein paar Aspekte für seine Reportage aus ihm herauskitzeln. Umgehend schaltete er in den interviewenden Journalistenmodus:
„Sag mal, Thomas, wie siehst du als Experte eigentlich das Rückholkonzept der Bundesbank?”
„Deutschland verfügt hinter den USA über die zweitgrößten Goldreserven der Welt”, begann Thomas wie ein Universitätsprofessor, der vor seinen Studenten eine Vorlesung hält. „3.380 Tonnen an reinem Gold. Diese Bestände sind zur Besicherung von Zahlungen in Krisenfällen bei der Federal Reserve Bank in New York, bei der Banque de France in Paris, bei der Bank of England in London und der deutschen Bundesbank in Frankfurt gelagert.”
„Und warum holen Bundesbank und Bundesregierung deiner Meinung nach das Gold nun nach Deutschland zurück?”
„Der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass das deutsche Gold im Ausland sicher aufgehoben ist”, vermutete Thomas.
„Das bemängeln die aber doch schon seit Jahren.”
„Genau. Aber seit der Pleite Griechenlands und den Finanzierungsproblemen in Italien nimmt die Unruhe in der Bevölkerung zu. Und nur darauf reagiert die Bundesregierung”, bekräftigte Thomas seinen Ansatz. „Deshalb hat der Bundestag das neue Goldlagerstellenkonzept verabschiedet. Dahinter verbirgt sich die Rückführung aller Goldreserven nach Deutschland. Und zwar möglichst öffentlichkeitswirksam. Daher wird die Presse bei der Rückholaktion aktiv eingebunden. Die Bevölkerung soll sehen, wie reich Deutschland ist. Die Botschaft lautet: Kein Grund zur Sorge, Leute, das bundesdeutsche Gold ist sicher!”
Markus schätzte die detaillierten Informationen seines ehemaligen Kommilitonen, trotzdem nervte ihn die streberhafte Art des Vortrages. Demonstrativ blickte er auf seine Rolex-Armbanduhr. Die Oyster mit einem sich selbst aufziehenden Perpetual-Uhrwerk war ein Erbstück seines Großvaters.
„Tut mir leid, Thomas. Ich muss hier noch ein paar Fotos für eine Reportage schießen, die ich heute abgeben muss. War nett, dich zu sehen. Mach’s gut.”
Ohne eine Antwort abzuwarten, zog er seine Canon aus der Tasche, ging zur linken Ecke des Pyramidengeländers und schoss aus der Hocke erste Fotos. Thomas warf einen letzten Blick auf die Gold-Pyramide, hob die Hand zum Abschiedsgruß und ging.
Markus schoss eine Reihe von Fotos. Der Industriekletterer im Sicherheitsgraben der Pyramide, der sich tagtäglich in den Morgenstunden in den Graben abseilte, um den makellosen Schein von neuem herzustellen, kam ihm gerade recht. So hatte er etwas Aktion im Bild, anstatt simple Architektur-Motive liefern zu müssen. Auch wenn es nur so wimmelte von Gold.
Es ist gut, dass wir unser Gold aus dem Ausland zurückholen, dachte Markus, als er schließlich seinen Weg fortsetzte.
*
Wenige Minuten später öffnete Markus Manx die Tür zu seinem Büro. Alles war noch ziemlich dunkel. Mit der rechten Hand flippte er den Lichtschalter neben der Tür nach oben. Manuelle Kippschalter, diese Technik gehörte bereits seit Jahrzehnten ins Museum.
Sein Büro in einer Redaktionsgemeinschaft freier Journalisten war das erste Zimmer gleich rechts hinter der Eingangstür. Vor dem Dachfenster, das tagsüber eine halbwegs ordentliche Belichtung des Raumes ermöglichte, stand ein wuchtiger alter Holzschreibtisch. Alle Wände waren vollgestellt mit deckenhohen Regalen, die von Zeitungen und ausgeschnittenen Artikeln überquollen. Was nicht in Regale und Ordner passte, verteilte sich auf etwa fünfzehn Quadratmeter Bodenfläche. Das Gemeinschaftsbüro befand sich in einer Altbauwohnung. Die Miete war für Frankfurter Verhältnisse bezahlbar.
Genau so muss der Arbeitsraum eines Reporters aussehen, dachte er, als er wieder einmal das Chaos vor sich selbst rechtfertigte. Und jetzt erstmal einen Kaffee!
Die Kaffeemaschine stand zwei Türen weiter in der ehemaligen Küche. Von den Ecken der Oberschränke, mintgrün und irgendwie aus der Zeit gefallen, löste sich langsam die Kunststoffbeschichtung. Den Elektroherd mit vier gusseisernen Kochplatten hatte der Vermieter letztes Jahr stillgelegt. Sicherheitsbedenken. An der Kaffeemaschine, dem modernsten Gerät der Küche, klebte mit Tesafilm fixiert ein handgeschriebener Zettel:
Becher ziehen
Geld einwerfen
Kaffeesorte wählen
Anleitung für Dummies, schmunzelte Markus, als er den Weg zum Kaffeeglück zum tausendsten Mal las. Immer wenn er vor der Maschine stand und auf den ersehnten Kaffee wartete, überflog er die Anleitung, unweigerlich. Vermutlich wird diese Anleitung häufiger gelesen als die meisten meiner Artikel, sinnierte er, als die Betriebsanzeige endlich grün aufleuchtete und das Display ‚betriebsbereit‘ anzeigte. Er zog einen Pappbecher aus dem Spender neben der Maschine und stellte ihn mittig unter den Kaffeeauslauf. Gibt es das Wort ‚Pappbecherspender‘ überhaupt, oder handelt es sich nicht doch um ein ‚Einzel-Pappbecher-Fördergerät‘? Aber selbst, wenn es dieses Wortungetüm geben sollte, dieses Exemplar verdiente eine solche Bezeichnung keinesfalls. Denn grundsätzlich warf es nur drei zusammenhängende Becher aus, auch bei Einzelabruf. Die überzähligen Becher stapelten sich dann während des Tages auf der Maschine. Warum niemand die Becher benutzte, blieb Markus schleierhaft. Er selber benutzte sie allerdings auch nicht. Vielleicht stopften die Reinigungskräfte sie abends zurück in den Spender.
Das 50-Cent-Stück verschwand in der Maschine. Kaffee mit Milch. Es blieb bei dem Wunsch, denn mit dem Drücken der Wahltaste erlosch die Betriebsanzeige des Gerätes. Fast gleichzeitig erlosch die Deckenbeleuchtung, eine weiße Rundleuchte mit 70er-Jahre-Charme, die ihn irgendwie an ein landendes Ufo erinnerte. Stromausfall! Irgendwann verklage ich die Bundesregierung. Die 50 Cent sind definitiv weg! Wenn der Strom in fünf Minuten wieder da ist, kann sich die Kaffeemaschine erfahrungsgemäß nicht mehr an meine Spende erinnern. Mein Schaden beläuft sich bestimmt schon auf fünf Euro, mindestens. So viel Pech muss man haben, ich stehe immer im falschen Moment vor der Kaffeemaschine.
Seine Bürokollegin Michaela schwor hingegen, sie habe noch keine Verluste durch die Stromausfälle beklagen müssen. Kein Kunststück, wenn man erst gegen Neun auftaucht, und die anderen die Falle bereits entschärft haben, dachte Markus dann immer.
Seit die Regierung die Energiewende forcierte, kam es häufiger zu kurzen Stromausfällen. Wenn die Belastung der Stromnetze schwankte, brachen sie häufig zusammen. Schwankungen der Windstärke, großflächige Verschattungen oder, oder, oder ... Markus unterstellte eine ganz andere Ursache: Wenn nämlich geschätzte 10.000 Büroangestellte gleichzeitig ihrem Wunsch nach Kaffee durch Druck auf die Starttaste ihres Automaten Ausdruck verliehen!
Sei’s drum, warten lohnte nicht. Das einzige 50-Cent-Stück, das eben noch in der Schreibtischschublade gelegen hatte, war futsch. Ergo fiel der Morgen-Kaffee heute aus.
Leicht genervt schlurfte Markus zurück in sein Büro. Auf dem Display des Radio-Weckers blinkten vier rote Nullen wie immer lustlos im Gleichschritt. Der Strom war wieder da. Hoppla, das ging aber fix heute, wunderte sich Markus.
Im nächsten Gedankengang haderte er mit der Technik in den Redaktionsräumen. Die neuen Büros waren gegen die Verschnaufpausen des Stromnetzes gewappnet. Alle hatten Notstromaggregate. Die Technik reagierte in Milli-Sekunden. Unmerklich übernahm eine Kombination aus Puffer-Akkus und gasbetriebenen Strom-Aggregaten die Versorgung. Kein Computer stürzte mehr ab. Die Kaffeemaschinen blubberten weiter vor sich hin, als wenn nichts wäre.
In dem renovierungsbedürftigen Altbau in der Ulmenstraße gab es keine solche Notstromversorgung. Dafür war wenigstens die Miete für die Bürogemeinschaft bezahlbar. Und dank seines Akkus lief Markus‘ Notebook auch ohne Notstromversorgung ungestört weiter.
Nicht aber der blinkende Wecker. Außen schwarzes Plastikgehäuse, innen vier große rot leuchtende LED-Ziffern. Mittig ein roter Doppelpunkt, der ebenfalls blinkte und die Stunden von den Minuten trennte. Das Relikt aus Jugendzeiten hatte Markus schon in seine Ehe „eingeschleppt”, wie es Claudia, seine Ex-Frau, einmal scherzhaft umschrieben hatte. Es hatte, dem Baujahr entsprechend, weder Schlummer-Funktion noch Alarmwiederholung, und gab lediglich einen Rundfunk-Empfang über Mittelwelle und UKW her. Dazu noch ein markerschütternd piependes Wecksignal, welches erst nach fünfzehn Minuten endete, so man es in der eigenen Morgentranigkeit nicht schaffte, den Störenfried per Hand zum Schweigen zu bringen. Markus nannte ihn Mad Max.
Claudia, seine Ex-Frau, hatte ihm vor Jahren erklärt, das heruntergekommene „Wecker-Wrack” mit der völlig abgegriffenen Typenbezeichnung strahle nicht nur Ungemütlichkeit aus, sondern auch erhebliche Mengen gefährlichen Elektrosmogs. Folglich flogen die unsichtbaren elektrischen und magnetischen Felder aus dem gemeinsamen Schlafzimmer und hatten seitdem in seinem Büro eine neue Bleibe gefunden.
Markus nahm den Wecker, aus dem Regal und stellte die Zeit neu ein: 06:59 Uhr. Seine Gedanken schweiften dabei zu seinen Kindern und seiner Ex-Frau ab. Nicht lange, dann nahm er pflichtbewusst das schnurlose Mobiltelefon aus der Ladestation auf seinem Schreibtisch und wählte die Nummer von Dorothea Mund, einer Redakteurin der Frankfurter Rundschau. Die Wahlsequenz ertönte, dann das Freizeichen ...
*
Frankfurt am Main, Europäische Zentralbank, 06:50 Uhr. Darius Dongi war seit über sieben Jahren Präsident der Europäischen Zentralbank. Groß gewachsen, brünetter Typ, maßgeschneiderter Zweireiher. Seine Manschettenknöpfe aus Weißgold, ein Geschenk seiner Frau zum Hochzeitstag im Mai letzten Jahres.
Bodentiefe Fenster erlaubten den Blick aus dem 200 Meter hohen Nordturm auf die Skyline von Frankfurt. Fantastisch! Dongi liebte diesen Blick aus seinem Büro. Sonnenaufgänge waren an sich schon beeindruckend. Aber Sonnenuntergänge hinter den Türmen der Frankfurter Banken, das wirkte von hier aus geradezu spektakulär. Der Architekt musste die Planung mehrmals anpassen, um diese ultimative Aussicht zu erreichen. Nun erstreckte sich das Büro des EZB-Präsidenten fast über eine halbe Etage des Nordturms. Damit ließ sich die Wichtigkeit des Amtes von niemandem mehr übersehen.
Seit die EZB 2014 ihren Sitz aus dem Eurotower im Zentrum in die neuen Gebäude im Frankfurter Ostend verlegt hatte, konnte Dongi diesen Blick genießen. Auch die anfänglichen Proteste in der Bevölkerung gegen den Neubau gerieten bald in Vergessenheit.
Dongi pflegte seine politischen Kontakte. Kritiker sagten ihm eine zu enge Beziehung zur Politik nach. In Wirklichkeit war die Europäische Zentralbank ohnehin nur noch auf dem Papier unabhängig. Die EZB musste die Politik unterstützen, als Geldmengensteuerer, als Staatsfinanzierer oder einfach als Konjunkturmotor. Bester Beweis für die enge Verknüpfung: der laufende Kauf von Staatsanleihen. Dongi unterstützte dieses schon mehrfach auf mittlerweile 2.000 Milliarden Euro aufgestockte Programm von Anfang an aktiv. Selbst die Idee dafür, so behauptete er, stamme von ihm.
„Herr Präsident, ihr Besuch”, kündigte die Assistentin ihrem Chef die Ankunft des Gastes an. Während Dr. Wieder das Büro mit schnellen Schritten betrat, schloss sie hinter ihm leise die Tür.
Die beiden wichtigsten Zentralbanker Europas, Dr. Jürgen Wieder, Präsident der Deutschen Bundesbank, und Darius Dongi, Präsident der Europäischen Zentralbank, trafen sich jeden ersten Montag im Monat. Was ursprünglich als spontanes und informelles Treffen in Krisensituationen begonnen hatte, entwickelte sich mit der Zeit zu einem Jour Fixe. Die Folgetermine, in den elektronischen Kalendern beider Herren als wiederkehrend eingetragen, verlängerten sich automatisch für das Folgejahr. Heute standen nur Routinethemen an.
„Was heißt, Sie wissen nicht, wie das passieren konnte?”
Dr. Wieder brüllte in den Telefonhörer. Er hatte sein Handy noch am Ohr, während er eintrat.
Dongi ärgerte sich, dass sein Kollege telefonierend wie ein Straßenflegel hereinkam. Ein absoluter Fauxpas! Doch aus Dr. Wieders rüdem Ton ließ sich leicht schließen, dass es wirklich absolut wichtig sein musste. Er konnte sich nicht erinnern, ihn jemals so wütend gesehen zu haben.
„Mir fehlt absolut jede Fantasie dafür, wie einem ein gutbewachter Werttransport mit drei Tonnen Gold mal so eben abhandenkommen kann!”
Dr. Wieder spuckte Speicheltropfen auf den Tisch von Dongi, so hatte er sich in Rage geschimpft.
„Wir sind hier nicht im Bermuda Dreieck, wir sind mitten in Frankfurt!” zeterte er. „Wann hatten Sie den letzten Kontakt zum Fahrzeug?”
„Sechs Uhr dreißig am ersten Kontrollpunkt”, kam es kleinlaut zurück, „um sechs Uhr vierunddreißig dann der abgebrochene Notruf.”
Nachdem Dr. Wieder die Information über die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kommentarlos entgegengenommen hatte, knallte er mit hochrotem Kopf das Handy auf den Tisch.
„Entschuldigung für den Wutausbruch, Darius.”
Er ging zum Fenster und atmete kurz durch, um seine Fassung wiederzufinden.
„Seit zwei Jahren haben wir unzählige Goldtransporte durchgeführt. Pannen? Keine! Ausfälle? Fehlanzeige! Und heute? Heute verschwindet ein gepanzerter Transporter. Zusammen mit dem ganzen Sicherheitsteam. Spurlos!”
Einen Moment herrschte Stille im Raum.
„Kann der Begleitschutz selbst dahinterstecken? Oder osteuropäische Gruppen?”, erkundigte sich Dongi rational und analytisch.
„Keine Ahnung, wir fangen gerade bei Punkt Null an. Sicher ist, das Fahrzeug lässt sich nicht von außen öffnen. Ohne Mithilfe der Transporter-Besatzung kommt niemand an das Gold heran.”
Darius Dongi blieb ruhig.
„Jürgen, ich dachte, ihr verfolgt die Position aller Goldtransporte lückenlos über GPS?”
„Das ist genau der nächste Knackpunkt, Darius! Die Leitwarte hat das GPS-Signal des Fahrzeugs die ganze Zeit über aufgezeichnet. Und zwar planmäßig. Das Signal endet um sechs Uhr vierunddreißig mitten in Neu-Isenburg! Es war schlagartig weg. Ebenso das Fahrzeug.”
Der Bundesbankchef hatte sich wieder einigermaßen unter Kontrolle und versuchte nun ebenfalls den Vorgang kriminalistisch abzuklopfen.
„Die von uns eingesetzte precise Positionsbestimmung ist angeblich auf fünf Meter genau. Alle Fahrzeuge hatten zusätzlich zum GPS-Empfänger einen GPS-Transponder, der die aktuelle Position an die Einsatzzentrale übermittelte. Wir wussten immer in Echtzeit Bescheid. Zumindest theoretisch.”
Nach einer kurzen Pause ergänzte er: „Die Notfallfrequenz wurde für einen kurzen Hilferuf um sechs Uhr vierunddreißig genutzt. Dann brach der Kontakt ab.”
„Wurde die Frequenz gestört? Oder hat der Begleitschutz nicht mehr versucht, Kontakt zu halten?”
„Wissen wir noch nicht.”
„Profis”, stellte der EZB-Präsident fest und runzelte die Stirn.
„Wie auch immer, der Vorfall kann äußerst unangenehme Folgen für uns haben. Wir dürfen uns auf keinen Fall eine weitere Panne leisten!”
Nach kurzem Schweigen fuhr Dongi fort: „Bis wir die Täter haben, sollten wir alle Werttransporte aussetzen. Und zwar in ganz Europa. Was meinst du?”
„Du hast Recht”, stimmte Dr. Wieder zu, resigniert und etwas geistesabwesend.
Zehn Minuten später ging eine verschlüsselte E-Mail in allen europäischen Hauptstädten ein.
GEHEIMHALTUNGSSTUFE II - STRENG GEHEIM
EZB-PRÄSIDIUM
SICHERHEITSWARNUNG!
IN FRANKFURT AM MAIN WURDE HEUTE EIN MIT VIER SOLDATEN BEWACHTER GOLDTRANSPORT DER DEUTSCHEN BUNDESBANK ÜBERFALLEN. ALLE BEGLEITPERSONEN WURDEN ENTFÜHRT.
ÜBER DIE HINTERGRÜNDE DER TAT IST DERZEIT NOCH NICHTS BEKANNT. AUCH DER VERBLEIB DES GOLDES IST UNGEKLÄRT. DER ABLAUF DES ÜBERFALLS ZEIGT EIN UNGEWÖHNLICH PROFESSIONELLES VORGEHEN. DIE HOHEN SICHERHEITSMAßNAHMEN WAREN WIRKUNGSLOS.
BIS ZUR AUFKLÄRUNG DER HINTERGRÜNDE WIRD EMPFOHLEN, KEINE GRÖßEREN WERTTRANSPORTE DURCHFÜHREN ZU LASSEN. DIE SICHERHEITSMAßNAHMEN FÜR ROUTINEMÄßIGE GELDLIEFERUNGEN AN GESCHÄFTSBANKEN SOLLTEN ERHÖHT WERDEN.
DER PRÄSIDENT
Europas Notenbanken und Regierungen waren informiert. Die Fahndung nach den Tätern lief an, koordiniert vom Krisenstab der Bundespolizei. Das Lagezentrum hatte man in den Räumen der Bundespolizeidirektion im Frankfurter Flughafen eingerichtet. Die Spezialkräfte des Bundes wurden von der Polizei der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern unterstützt. Den zeitlichen Vorsprung der Täter hatten Experten der Polizei mit vierzig Minuten berechnet.
Wie schnell konnte ein schweres Fahrzeug dieser Art verschwinden? Reichte ein Radius von dreißig Kilometern für die Fahndung aus? Zusätzlich war die Überwachung des Luftraumes angeordnet worden. Aktionismus sollte die allgemeine Ratlosigkeit überspielen.
*
Frankfurt am Main, Ulmenstraße, 07:30 Uhr. Nachdem der Morgenkaffee Blackout bedingt ausgefallen war, switchte Markus in den Arbeitsrhythmus. Auf seinem nicht mehr ganz taufrischen Notebook, Markus nannte es respektlos Oldbook, checkte er die neuesten E-Mails, las aktuelle Nachrichten und plante den Tag. Schließlich musste er heute noch die Reportage zum Goldtransport für die Hessische Neueste Presse schreiben.
In den E-Mails nichts Wichtiges. Ein paar Newsletters überfliegen, wie der von Meedia.de, den er berufsbedingt gerne las. Die Sportnachrichten.
+++ 2:1 für die Eintracht Frankfurt. Drei Punkte. Ist auch mal wieder Zeit geworden, dacht Markus, der sich nur am Rande für die Fußball-Bundesliga interessierte. Sein Herz schlug mehr für Basketball, das hatte er in seiner Jugend gespielt. Für eine Karriere hatte es allerdings nicht gereicht. Mit seinen 1,85 Metern war er zwar groß, aber für einen Basketballer reichte das dann doch nicht.
+++ 87:78. Seine Fraport Skyliners hatten den FC Bayern besiegt. „Jaahh!”, kommentierte er lautstark, als er das Ergebnis las. Besser als Fußball. Dort sind die Spiele immer sehr einseitig und schon fast langweilig. Im Basketball kann Frankfurt sogar die Bayern schlagen! Er wechselte zum Wetter.
+++ Morgens klar und um die 7°C kalt. Tagsüber sonnig und trocken mit Höchsttemperaturen bis zu 15°C. Ist okay für diese Jahreszeit, dachte Markus und wechselte zum Abschluss auf die Homepage der Hessischen Neuesten Presse.
+++ EILMELDUNG: Überfall auf einen Goldtransporter der Bundesbank.
Gerade in dem Moment, als er die Meldung durch einen Klick auf die Überschrift aufrufen wollte, klingelte sein Telefon.
„Markus Manx”, meldete er sich nach einer Schrecksekunde.
„Hallo Markus, passt es gerade?”
Ohne dass sich der Anrufer mit Namen gemeldet hätte, war klar, wer es war. An der tiefen und ruhigen Stimme erkannte Markus seinen Freund Jonathan Schreiber, Redakteur bei der Hessischen Neuesten Presse.
„Kannst du kurz den Überfall auf den Goldtransporter recherchieren? Ich brauche einen Beitrag sowohl für die Print-Ausgabe, als auch für Online. Die Reportage, die ich gestern bei dir in Auftrag gegeben habe, ist erstmal gecancelt. Maximal einhundert Zeilen für Online bis spätestens Mittag und hundertfünfzig Zeilen bis heute Abend für Print”, fuhr er nach einer kurzen Denkpause fort. „Schaffst du das?”
Die Frage war eher rhetorischer Art. Jonathan unterstellte, dass freie Journalisten grundsätzlich immer Zeit haben und jeden Auftrag brauchen. Womit er meistens richtig lag.
„Du sollst den Fall aber nicht komplett aufklären, sondern nur einen interessanten Dreispalter schreiben”, fügte er hinzu. „Der Überfall sieht für mich so aus, als ob eigene Leute mit den Tätern unter einer Decke stecken”, ließ er Markus seine Vermutung wissen. „Lieferst du mir den Artikel?”
In der Zwischenzeit hatte Markus den Link im Internet angeklickt, die Eilmeldung bestand aber nur aus der Information, dass die Bundesbank einen Transporter bei einem Überfall verloren hatte.
„Geht klar. Gibt es noch mehr Hintergrundinfos, außer der winzigen Meldung auf dem News Ticker?”
„Markus, das ist jetzt allein dein Job.”
Freizeichen. Jonathan Schreiber hatte mit dem letzten Wort aufgelegt.
Markus stand auf der Liste für freie Journalisten aller Frankfurter Zeitungen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kam bei wirtschaftlichen Themen gelegentlich auf ihn zurück. Die FAZ hatte damals fast eine ganze Sonderseite zur Einweihung der Gold-Pyramide und zu den wirtschaftlichen Hintergründen gebracht. Für diese Recherche hatte er viel Lob bekommen, was in der Branche eher selten war.
Am meisten sparte die Frankfurter Rundschau und hatte schon länger keine Geschichte mehr bei ihm bestellt. Genau deshalb hatte Markus vor gut einer halben Stunde versucht, die Redakteurin Dorothea Mund anzurufen, vergeblich.
Von der Hessischen Neuesten Presse dagegen bekam er regelmäßig Aufträge zu Boulevardthemen. Die HNP war weniger an wirtschaftlichen Hintergründen interessiert, eher an spannender Unterhaltung: Hier also Tat – Täter – Motiv, garniert mit einem spektakulären Bild. „Überfall auf Goldtransporter” war ein guter Aufhänger, das passte. In den letzten Jahren hatte Markus sich langsam mit Boulevardthemen angefreundet: spannend, unterhaltend, aktuell, aber leicht und ungefährlich.
Früher war ihm dieser Ansatz verhasst. Aber die Zeiten änderten sich. Und manchmal schneller, als einem lieb war.
*
Frankfurt am Main, Eschborner Dreieck, 07:30 Uhr. Lena Eck durchfuhr in ihrem roten Fiat 500 das Eschborner Dreieck Richtung Innenstadt. Like a Virgin, tönte es aus dem Radio. Munter sang sie den Madonna-Hit mit. Sie liebte den Song. „Touched for the very first time. Like a vir ir ir ir gin”, stimmte Lena lauthals mit ein. „With your heartbeat, next to mine.”
Machte das gute Laune für einen vielversprechenden Tag!
Lena, eine zierliche junge Frau mit moderner strenger Bob-Frisur. Ihre braunen Augen verschwanden fast unter dem scharf geschnittenen Pony, ihre dunklen Haare fielen seitlich bis zum Kinn. Seit sie vor 15 Jahren bei ihrer Mutter, von der sie den deutschen Nachnamen hatte, ausgezogen war, lebte sie in Frankfurt. Zu ihrem russischen Vater hatte sie nie eine Beziehung aufbauen können. Für ihn war Erziehung das Androhen von Strafen und auch deren Ausführung, wenn seine Tochter nicht gehorchte. Deshalb zog sich Lena schon sehr früh in eine virtuelle Welt zurück. Computer wurden ihr Leben, sie entwickelte sich zu einem richtigen Nerd. Zweifellos ein hübscher Nerd mit markanten slawischen Gesichtszügen.
Nach dem IT-Studium nahm sie einen Job in der IT-Abteilung einer Großbank an, den sie aber schnell abbrach. Überraschend schnell. Sie sprach nicht gern darüber. Ihr damaliger Abteilungsleiter war zudringlich geworden, dies sogar mehrfach, auch während der Arbeitszeit. Lena hatte die Sache der Frauenbeauftragten angezeigt, doch die Bank hatte ihr keinen Glauben geschenkt, sich sogar vor den Abteilungsleiter gestellt und ihr einen Wechsel nahegelegt.
Seit acht Jahren arbeitete sie nun als selbstständige IT-Expertin – Vorträge, Analysen von Sicherheitssystemen, Vorschläge für robuste Firewalls und dergleichen. Heute, im Rahmen des internationalen IT-Symposiums, ein Vortrag zum Thema IT-Sicherheit im deutschen Mittelstand. Frankfurter Messe, Congress Center, Beginn 09:00 Uhr. Mit dem Honorar, 1.200 Euro für einen 60-Minuten-Vortrag, konnte sie zufrieden sein. Auf dem Beifahrersitz lag alles, was sie dafür brauchte: Ihr Notebook und ihr Maskottchen, ein handgroßes weißes Plüschtier mit schwarzen Hängeohren.
„When you hug me, and your heart beats and you love me”, verkündete Madonna soeben, als auf Höhe Rödelheim plötzlich lauter Bremslichter wie rote Pilze vor Lena aus der Fahrbahn schossen. Mit dem Tritt aufs Bremspedal stoppte auch Lenas Euphorie.
Stillstand. Lena brachte Madonna zum Schweigen, zückte ihr Handy, um von ihrer Stau-App Details zu erfahren. Gut, dass ich genügend Puffer für die Fahrt zu meinem Vortrag eingeplant habe, dachte sie.
*
Frankfurt am Main, Ulmenstraße, 08:10 Uhr. Leicht genervt hievte Markus seine Füße auf den Schreibtisch und wählte zum vierten Mal dieselbe Nummer. „... Wir können ihren Anruf leider momentan nicht persönlich entgegennehmen ...”, höhnte es aus der Leitung.
Markus' Blick fiel auf zwei verschiedenfarbige Socken. Seit seiner Scheidung waren immer mehr einzelne Socken verschwunden. In der Zwischenzeit war es ihm völlig egal geworden, ob Socken möglicherweise zur Leibspeise seiner Waschmaschine gehörten oder ob Außerirdische ihm die Dinger klauten, um daraus Treibstoff zu zaubern. Er hatte schon lange aufgegeben, nach der Ursache zu suchen. Die einzelnen Socken blieben dauerhaft verschwunden. Jetzt trug er grundsätzlich immer zwei verschiedenartige Exemplare, nicht nur zu Jeans.
„Wir können ihren Anruf leider momentan nicht persönlich entgegennehmen”, hörte Markus bereits zum fünften Mal, bevor er dann doch endlich durchgestellt wurde.
„Guten Tag, Sie sprechen mit der Pressestelle der Deutschen Bundesbank, mein Name ist Rose de Jong, womit kann ich Ihnen helfen?” fragte eine freundliche Stimme.
Solch freundliche persönliche Ansprache nach dem vorangegangenen Warteschleifen-Frust überraschte Markus. Er brauchte einen kurzen Moment, um seine Gedanken zu ordnen, die Füße vom Schreibtisch zu nehmen und sich wieder aufrecht hinzusetzen.
„Markus Manx, ich bin freier Journalist. Und ich überfalle Sie gleich mal mit einer beruflichen Frage: Können Sie mir Hintergrundinformationen zu dem heutigen Überfall auf den Goldtransporter der Bundesbank geben?”
„Gern. Was möchten Sie genau wissen?”
Markus hatte sich Ansatzpunkte für Fragen grob auf einem Blatt notiert.
„Oh, da ist einiges zusammengekommen. Ich fange am besten einfach mal oben auf meiner Frageliste an. Also: Was war der konkrete Anlass für diesen Transport? Und von wo nach wohin sollte das Gold gebracht werden?”
Die Antwort konnte er sich in etwa denken. Trotzdem musste er sichergehen, dass es sich wirklich um den von ihm beim Beladen beobachteten Goldtransport handelte.
„Herr Manx, es handelt sich um einen Routinetransport aus unserer Lagerstelle in New York nach Frankfurt. Es gab keinen konkreten Anlass. Hintergrund ist die von der Bundesregierung beschlossene Rückführung aller Goldreserven nach Deutschland.”