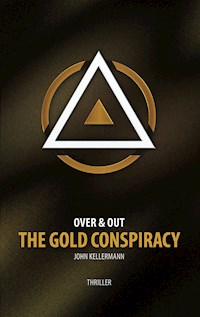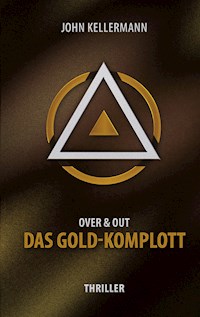Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Peking zieht Flotte im Süd-Chinesischen Meer zusammen. Shit!, brüllte Redman, griff sich die Presseschau und feuerte sie Richtung Tür. Die Russen bedrohten massiv das europäische Gleichgewicht, und die Islamisten wollten an das arabische Öl. Da fehlten ihm die Chinesen gerade noch! Amerika brauchte jetzt die europäischen Verbündeten! Verdammt! Peter Redman, CIA-Koordinator für Europa, schlug frustriert mit der Faust auf seinen Schreibtisch. Die Zeit lief ihnen davon. Es gab nur eine Lösung: Operation Snow White musste die Deutschen aus ihrer Lethargie reißen! In einem heiklen Aktionsdreieck zwischen rabiaten Attentätern, fanatischen Umweltaktivisten und der CIA entdecken der Reporter Markus Manx und die Hackerin Lena eine entscheidende Spur: Ein perfider Anschlag steht bevor, mitten ins politische Herz Berlins, eiskalt geplant und radikal ausgeführt. Ist die Katastrophe noch aufzuhalten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Von John Kellermann sind bereits folgende Titel erschienen:
Deutsche Ausgaben:
Das Gold-Komplott ISBN 978-3-7412-6167-1
Die Snow White Verschwörung ISBN 978-3-7504-1884-4
Englische Ausgaben:
The Gold Conspiracy ISBN 978-3-7412-2652-6
Operation Snow White ISBN 979-8-6070 6407-5
Videotrailer zum Buch:
https://www.youtube.com/watch?v=vwxRNfWH5Qw
Pressestimmen: Das Gold-Komplott
„… durchgehend spannend, genau recherchiert und systematisch zu Ende gedacht.”
Handelsblatt
„... ein beklemmend reales Bild ... kurzweilige Lektüre.”
€uro
„Rasant, verstrickt, verschwörerisch … In Manier eines Dan Brown treibt der Autor seinen Protagonisten durch die Bundesrepublik.”
Journal Frankfurt
„Ein Polit-Thriller, dem nie die Puste ausgeht.”
Huffington Post
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Weitere Informationen
Über den Autor
Vorrede
Berlin, 2019
Der Leser, der dieses Buch in den Händen hält, muss wissen, dass alles meiner Phantasie entsprungen ist. Ähnlichkeiten mit existierenden Personen und Sachverhalten können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aussagen über die Zukunft bleiben, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, immer Fiktion. Um Beteiligte und Informationsquellen zu schützen, habe ich die Personennamen geändert. Die meisten Orte sind real.
Das, was jetzt folgt, beginnt in naher Zukunft.
gez. John Kellermann
Sonntag
Alles ruhig in Deutschland. Auch in der übrigen Welt schien nichts Aufregendes passiert zu sein. Auf den ersten Blick sah es aus, als würde eine ereignislose Woche vor der Tür stehen.
Niemand, der an diesem Sonntag in Berlin unbesorgt unterwegs war, hätte geglaubt, dass sich sieben Tage später das ganze Land massiv verändert haben würde. Berlin in einem Zustand, als befänden wir uns wieder in einem Krieg? Absolut undenkbar!
Einer aber wusste, dass es mit dieser Ruhe bald vorbei sein würde, und zwar komplett. Peter Redman, CIA-Koordinator für Europa, saß mit geschlossenen Augen in der Amerikanischen Botschaft. Redman wusste genau, was geschehen würde.
In den 22-Uhr-Nachrichten brachten es alle Sender als Top-News: Altbundespräsident Matthias Röhler war heute im Kreise seiner Familie gestorben. Sein Tod kam für alle überraschend, hieß es.
Redman atmete tief durch. Endlich! Operation Snow White nimmt Fahrt auf!
*
Sonntag, Berlin-Dahlem. Zwei Stunden vorher. Der Anruf erreichte Dr. Klaus Schulz fünf Minuten vor acht. Schulz stand in seinen besten Jahren, beruflich und privat lief alles ausgezeichnet, die Arztpraxis florierte, und seine Erfolge wurden sogar von kritischen Kollegen anerkannt. Um sein Privatleben beneidete man ihn. Andrea, seine zwanzig Jahre jüngere Frau, hatte ihm zwei bezaubernde Kinder geschenkt, welche die Grundschule in Dahlem besuchten.
Ein klarer Herbstabend. Der Wind wehte Kühle aus dem Osten heran, um diese Jahreszeit in Berlin durchaus normal. Soeben hatte Dr. Schulz den dunklen Grunewald durchquert, seine LED-Stirnlampe leuchtete die entscheidenden Meter vor ihm aus, die nötig waren, um Hindernissen frühzeitig ausweichen zu können. Der Wendepunkt seiner kleinen Joggingrunde lag vor ihm. Er hatte die Havel erreicht.
Ein kurzer Blick auf seinen Fitness-Tracker zeigte ihm: Grundlagenausdauer. Puls 160. Zurückgelegte Entfernung 6,2 Kilometer. Das Training wirkte.
Sein Handy klingelte. Er verlangsamte das Lauftempo und blieb schließlich mit Blick auf die nachtschwarze Havel stehen. Es war seine VIP-Nummer, die nur wenige Patienten kannten. Anrufer unbekannt, zeigte das Display. Obwohl er keine ärztliche Rufbereitschaft hatte, meldete er sich sofort.
„Ja bitte?”
*
Die schmucke Villa am Rande von Dahlem war hell erleuchtet. Vom großen Saal aus hatte man am Tage einen phantastischen Blick auf den Hundekehlesee. Drinnen verströmte ein Kachelofen behagliche Strahlungswärme. Matthias Röhler, 78 Jahre alt, ehemaliger Präsident der Bundesrepublik Deutschland, genoss seinen Ruhestand.
Röhler nippte an einem Glas Chianti, er fühlte sich hervorragend. Geistig waren seine Frau und er noch top fit, das bewiesen sie nicht nur beim Schachspielen. Er lächelte in sich hinein. Gelegentlich versuchten seine beiden Enkel, ihm gemeinsam Paroli zu bieten. Sie hatten keine Chance, es sei denn, er ließ sie mit Absicht gewinnen, um ihnen den Spaß nicht zu verderben. „Schachmatt, Opa!”, riefen sie dann begeistert, sprangen im Zimmer herum, klatschten sich ab und fühlten sich dabei wie kleine Könige. Der Ex-Bundespräsident gönnte es ihnen.
Röhler und seine Frau liebten sich noch wie am ersten Tag, nach fast fünfzig Ehejahren eine tolle Bilanz. Liebevoll blickte er hinüber zu ihr. Sie hatte es sich mit der Schwiegertochter auf der beheizten Bank vor dem Kachelofen bequem gemacht.
Bettina Röhler schaute kurz auf und lächelte zurück, als sie den Blick ihres Mannes wahrnahm, bevor sie ihr Gespräch fortsetzte.
Eine tolle Frau, dachte er, und noch immer wunderschön.
Die Untersuchung gestern bei seinem Hausarzt hatte ihm bestätigt, dass alles in Ordnung war. „Tadellose Gesundheit, die Blutwerte ausnahmslos im grünen Bereich!”, lautete das Lob von Dr. Schulz.
Der Ruhestand tat Röhler gut. Vor zehn Jahren, gegen Ende seiner zweiten Amtszeit, hatte das ganz anders ausgesehen. Die vielen Reisen, der pralle Terminkalender, das Repräsentieren – der Stress hatte seinen Tribut gefordert. Auch ein Bundespräsident ist eben kein Übermensch. Zwei Herzinfarkte innerhalb eines Jahres hatten ihn fast das Leben gekostet. Aber gestern versicherte ihm Dr. Schulz mit Überzeugung, mit seiner gegenwärtigen Konstitution würde er noch die Neunzig schaffen. Mindestens! Wahrscheinlich sogar mehr. Mit Dr. Schulz hatte er seit Jahren einen Leibarzt an seiner Seite, dem er blind vertraute, wie man so schön zu sagen pflegt.
Die Haushälterin der Röhlers deckte den kleinen Saal für das Abendessen ein. Akribisch richtete sie die Bestecke auf der weißen Tischdecke aus. Dann ging sie in die Küche, holte den gusseisernen Bräter aus dem Ofen. Heute gab es, der Jahreszeit entsprechend, gemischten Schweinebraten mit Äpfeln, Zwiebeln und Kartoffeln. Sie öffnete den Deckel, der feine Geruch von Oregano und gebratenen Äpfeln stieg ihr in die Nase. In den vergangenen Jahren bei den Röhlers hatte sie viele prominente Freunde der Familie bekocht. Ihre Kochkunst galt als geradezu legendär.
Mühelos schnitt das scharfe Küchenmesser durch den saftigen Braten. Die Röhlers hatten sie immer gut behandelt, fast wie einen Teil ihrer Familie.
Ihr Handy vibrierte.
Rasch wischte sie sich die Hände ab und meldete sich. Sie hörte den Anrufer das vereinbarte Codewort sagen, daraufhin ging sie zum Medikamentenschrank. In der Küche pulverisierte sie die Tablette in einem Mörser aus Carrara-Marmor. Es war 20:35 Uhr.
*
Zwei Straßen entfernt wartete Dr. Schulz in seinem Auto auf einen Anruf, frisch geduscht und mit gepackter Arzttasche.
Der Notruf der Haushälterin erreichte ihn um 20:50 Uhr. Der Herr Bundespräsident hat plötzlich das Bewusstsein verloren. Vermutlich Herzinfarkt!
Zwei Minuten später erreichte Dr. Schulz die Villa. Ein Personenschützer nahm ihn in Empfang und führte ihn eilig hinein.
Der Altbundespräsident lag mitten in dem kleinen Saal auf dem Boden, um ihn herum, ängstlich und planlos, seine Familie und die Hausangestellten. Auf dem Tisch standen noch die Reste des Abendessens.
Dr. Schulz kniete nieder und öffnete seinen Arztkoffer. In fünf Minuten würde der Rettungswagen hier sein. Er schickte alle Anwesenden aus dem Raum. Als er mit dem Patienten allein war, schob er behutsam seinen Zeigefinger unter den rechten Augapfel und löste ihn etwas aus der Augenhöhle. Der Augapfel fühlte sich an wie eine warme, gelartige Masse und gab den Blick in die leere Augenhöhle frei, die Augenmuskeln und der Sehnerv waren gut zu erkennen.
Die Zeit war knapp. Dr. Schulz wusste, in wenigen Minuten würde die harmlose Tablette ihre Wirkung verlieren und der Bundespräsident erwachen. Während er das Auge mit der linken Hand vorsichtig hielt, nahm er mit der rechten eine fertig aufgezogene Spritze aus seinem Koffer. Es eilte, jede Sekunde konnte ein Mitglied der Familie hinzukommen.
Ohne zu zögern, führte er das aus, was er sich schon dutzende Male in Gedanken ausgemalt hatte. Die scharfe Nadel drang tief in den Sehnervkanal ein, die Durchtrittsstelle zwischen Augenhöhle und Gehirn. Der Kolben der Spritze schob sich langsam nach vorne. Der tödliche Inhalt der Spritze ergoss sich direkt in Röhlers Gehirn.
Dr. Schulz hörte die Sanitäter über den Flur eilen, das Geräusch der Fahrtrage, das Klackern des zusammenfaltbaren Aluminiumgestänges und das Rappeln der Hartgummirollen auf den Terrakottafliesen im Entree. Er zog die Kanüle heraus, mit einem Griff war der Augapfel wieder an seiner Stelle, alles ohne einen Tropfen Blut.
Die Tür flog auf, der Notarzt und zwei Sanitäter stürmten in den Raum. Dr. Schulz informierte sie schnell und präzise: Verdacht auf Herzinfarkt!
Ohne weitere Worte legten sie den Patienten behutsam auf die Trage. Die Schnellverschlüsse schnappten zu, und die Sicherungsgurte sorgten für festen Halt.
Der Bundespräsident atmete ruhig. In seinem rechten Auge bildete sich eine kleine Träne. Dr. Schulz wischte sie mit dem Zipfel seines Arztkittels vorsichtig weg, bevor der Notarzt die Sauerstoffmaske fixierte. Auf der Fahrt ins Krankenhaus würde er, bedauerlicherweise und trotz der schnellen Hilfe der anwesenden Ärzte, nur noch den Tod feststellen können.
*
Berlin, Siegessäule. Für Azad waren die letzten Tage unendlich lang gewesen. Er konnte nichts tun – außer warten, warten, warten.
Seine rechte Hand steckte in der Jackentasche und umklammerte sein Handy. Er zog die Hand kurz raus und warf, heute schon zum x-ten Mal, einen prüfenden Blick auf sein Telefon: Empfang und Ladezustand waren gut. Mühsam unterdrückte Azad ein Gähnen und rieb sich die juckenden Augen.
Heute war er mit Dilara, seiner Schwester, lange durch Berlin gestreift. Trotzdem verging die Zeit gefühlt nur im Zeitlupentempo.
Sie liefen immer direkt an der Spree entlang. Am Tage fuhren hier Touristenboote wie auf einer Schnur aufgereiht hin und her, duckten sich unter den flachen Brücken durch. In den letzten Stunden hatte Azad kein einziges Schiff mehr gesehen, die aufkommende Dämmerung schien alle verschluckt zu haben.
Sie liefen weiter. Das matte Licht der trapezförmigen Laternen spiegelte sich auf dem Wasser, tauchte den Fußweg vor ihnen in schummeriges Licht. Es hatte den Anschein, als zöge die beiden etwas magisch in Richtung Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten.
Bald darauf erhob sich vor ihnen die imposante frühklassizistische Fassade des weißen Schlosses aus dem dunklen Abendhimmel, angestrahlt vom Licht Dutzender Scheinwerfer. Die geradlinig geschnittene, majestätische Form des Schlosses beeindruckte Azad. Hier wohnte also Deutschlands Staatsoberhaupt!
Sie liefen am massiven, grau gestrichenen Metallgitter entlang, das nach wenigen Metern von einer Steinmauer abgelöst wurde. Einundfünfzig Vorsprünge hatte die Mauer, zählte Azad in Gedanken mit. Genau einundfünfzig waren es. Auch die versteckten Überwachungskameras und das elektronische Auge, das den toten Winkel hinter einer Mauerecke abdeckte, fielen ihm auf. Normalerweise entging ihm nichts. Er wusste aus Erfahrung wo er das fand, was er suchte.
Sie gingen weiter.
Mitten im Englischen Garten klingelte Azads Telefon. Endlich! Seine bleierne Müdigkeit war sofort wie weggeblasen. Seit zwei Wochen hatte er diesem Anruf entgegengefiebert. Jetzt hatte das Warten hoffentlich ein Ende. Es wurde Zeit zu handeln.
Abrupt blieb Azad stehen und hielt sich das linke Ohr fest zu. Er konnte den Anrufer kaum verstehen, denn die vier im Halbdunkel entgegenkommenden Jugendlichen grölten lauter als eine Horde volltrunkener Matrosen. Etwa drei Meter neben Azad nutzte einer von ihnen die Gelegenheit, sich ungeniert an einem Baum zu erleichtern, ohne seine lautstarke Unterhaltung auch nur für eine Minute zu unterbrechen. Angewidert drehte sich Azad zur Seite und drückte das Handy fester ans Ohr. Er durfte kein Wort verpassen, jedes entgangene Detail konnte den Plan gefährden.
Als der von seiner Last befreite Pinkler Azad entdeckte, entschuldigte er sich lautstark bei ihm, um dann lachend und grölend seiner Truppe hinterher zu laufen.
Nicht einmal eine Minute dauerte das Telefonat. Azad steckte das Handy in seine Jacke zurück und wandte sich wieder seiner Schwester zu. Aber sein Blick ging ins Leere.
Besorgt sah er sich nach allen Seiten um.
Dilara?
Er schaute nach links Richtung Siegessäule – niemand, kein einziger Spaziergänger weit und breit. Auch keine Dilara. Was jetzt? Den Weg zurückgehen? Die Jugendlichen waren hinter der nächsten Wegegabelung lärmend Richtung Spree verschwunden. Vielleicht hatten sie … Azad lief hinter ihnen her. Schnell holte er sie ein. Von Dilara keine Spur.
Verdammt, ich hätte sie keine Sekunde aus den Augen lassen dürfen! Vielleicht habe ich sie verloren, als ich zum Telefonieren stehengeblieben bin, oder vielleicht ist sie wegen dieser grölenden Meute geflüchtet. Aber wohin?
Er traute sich nicht, laut nach ihr zu rufen. Nur kein Aufsehen erregen. Azad drehte wieder um, von einer Ahnung getrieben, hastete er Richtung Siegessäule.
So geht das die ganze Zeit, dachte er bedrückt. Immer muss ich für uns beide denken. Aber ich kann doch nicht pausenlos auf dich aufpassen, Schwester! Tag und Nacht, von morgens bis abends, wie auf ein Kind. Seit ihrer Ankunft in Berlin waren gerade einmal zwei Wochen vergangen. Ihm erschienen sie wie zwei Monate. Dieses ständige Warten. Und immer die Angst um Dilara.
Azad blieb stehen und lauschte. Täuschte er sich, oder hörte er aufgeregtes Hupen von Autos? Ja, es wurde immer intensiver, schaukelte sich schließlich zu einem Hupkonzert hoch. Instinktiv sprintete er in die Richtung, aus welcher der Lärm kam. Sein Puls raste.
*
„Auf der mittleren Fahrbahn des Großen Sterns steht eine orientierungslose Person …”, meldete der Berliner Polizeifunk.
*
Irgendwie war das Mädchen aus dem irakischen Dorf in den vierspurigen Autokreisel rund um die Berliner Siegessäule geraten.
Doch Dilara spürte keine Angst.
Wenn sie sang, konnte ihr nichts passieren. Gar nichts. Ganz kindlich stand sie da, der kühle Ostwind trug die alte Melodie aus ihrer Heimat in die Berliner Nacht und wehte ihr die langen schwarzen Haare vors Gesicht.
Bremsen kreischten. Vollbremsung! Knapp hinter ihr kam ein Transporter zum Stehen. Wie von einem Stromschlag gelähmt, hockte der Fahrer in seinem Fahrzeug, starrte auf die junge Frau, die so urplötzlich vor seiner Windschutzscheibe aufgetaucht war. In der diffusen Tunke aus Dunkelheit und Autoscheinwerfern hatte er sie erst in allerletzter Sekunde wahrgenommen. Pures Glück, dass ich sie nicht erwischt habe, schoss es ihm durch den Kopf. Und wenn mir dann noch einer hinten reingerasselt wäre, Halleluja …
Dilara sang!
Ihre Eltern hatten immer gesagt, sing! Wenn du Angst hast: sing! Und das galt bis heute. Die hupenden Autos konnten ihr nichts anhaben. Sie schloss die Augen und sang noch lauter.
Ein Streifenwagen befand sich, alarmiert von einem besorgten Autofahrer, längst auf dem Weg zum großen Stern.
Dilara wusste nichts vom Berliner Polizeifunk. Sie war mit ihrem Bruder Azad spazieren gegangen. Und auf einmal war er verschwunden. Warum hatte er sie alleingelassen? Wie sollte sie ihn jetzt wiederfinden? … Sie war einfach weitergegangen, immer geradeaus.
Das langanhaltende brüllende Hupen eines Autos schreckte sie aus ihren Gedanken hoch. Sie drehte sich um und sah, dass der Transporter höchstens einen Meter hinter ihr zum Stehen gekommen war.
Die Autos um sie herum hupten wild. Mit aggressiven Gesten und Schmähworten machten die Fahrer ihrem Ärger über diese anscheinend verrückte Person, die dort auf der Fahrbahn umherirrte, tüchtig Luft.
Dort, wo sie gerade war, mitten in dem lautstarken Lindwurm aus Blech, Auspuffdämpfen und Reifen, der sie umgab, blieb das Mädchen stehen und sang.
Dilara sang.
So hatten sie es vereinbart. Ihr konnte nichts passieren. Einfach stehenbleiben und singen.
*
Mit jedem Meter, den Azad näherkam, schwoll der Lärm an. Verdammt! Er hetzte weiter, getrieben von einer Ahnung, die ihn in Panik versetzte. Der Kreisel! Vierspurig führte er um die Siegessäule herum. Wenn Dilara, naiv und unerfahren, wie sie war, … er mochte den Gedanken nicht weiterspinnen.
Und dann sah er sie, mitten auf dem runden Monster aus Fahrbahnen. Bewegungslos stand sie da und sang ein altes jesidisches Volkslied. Azad kannte das Lied. Jeder zuhause kannte es. Bei ihnen im Dorf wurde immer gesungen, zu jedem Anlass. Alte Familiengeschichten wurden nicht erzählt, sie wurden gesungen. Liebesgeschichten wurden gesungen. Die Überlieferung des Glaubens – gesungen. Alles wurde gesungen.
Und da stand sie, Dilara, zerbrechlich und zart, mitten auf der Straße in einem ihr wildfremden Land und sang.
Wild mit den Armen fuchtelnd, bahnte Azad sich mühsam eine Gasse durch die Autolawine.
Als er die mittlere Spur erreichte, ergriff er fest ihre Hand und zog sie an sich heran, eng und beschützend. Mit Dilara im Schlepp bahnte er sich den Weg zurück.
Dilara hörte sofort auf zu singen, als sie seine Hand spürte. Azad war endlich wieder da. Das Lied hatte ihn zurückgebracht. Ihre Eltern hatten Recht gehabt. Das Lied wirkte.
Zum Glück ist noch keine Polizei da, dachte Azad und zog sie weiter mit sich. Auf keinen Fall durften sie hier in Deutschland auffallen. Dann würde alles ins Wanken geraten.
Nach knapp einhundert Metern waren sie wieder im Englischen Garten, von der Straße aus nicht mehr zu sehen. Azad blieb für einen kurzen Moment stehen. Der Halbschatten des Bismarck-Denkmals gewährte ihnen Schutz. Er umarmte Dilara zärtlich. Sie zitterte am ganzen Körper.
Azad merkte, wie ihm eine Träne warm die Wange hinunterlief. Er verkniff sich mühsam das Schlucken und versuchte, ruhig zu atmen. Wie sollte es nur weitergehen? Hier in Berlin kannte er niemanden, der ihnen helfen konnte. Er allein war für Dilara verantwortlich. Sie hatte doch nur noch ihn. Und das machte sein Vorhaben noch gefährlicher, als es sowieso schon war.
Ihr Zittern ließ langsam nach. Azad nahm ihre zierliche Hand. „Schwester, komm.”
*
Berlin, Amerikanische Botschaft. Das Büro von Peter Redman war dunkel. Nichts deutete darauf hin, dass um diese Zeit noch jemand anwesend war. Doch dann zerfetzte sein gellender Fluch die abendliche Stille im Gebäude.
Die polnische Reinigungskraft, die gerade den Flur wischte, zuckte erschrocken zusammen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie sich gefangen hatte, dann hob sie den Schrubber wieder auf, der ihr vor Schreck auf den Boden gefallen war, und verdrückte sich in den nächsten Flur. Nur weg von hier! Ihr war der bullige Mann mit dem großporigen, immer etwas mürrischen Gesicht noch nie geheuer gewesen.
„BLOODY HELL!!!”, dröhnte es erneut aus dem Büro des Amerikaners, der wegen seiner cholerischen Ausfälle bekannt und gefürchtet war. Während der vergangenen Stunde hatte er bewegungslos dagesessen und die Wand angestarrt, das draußen in abendlicher Beleuchtung erstrahlende Berlin keines Blickes würdigend. Dann war er plötzlich aus seinem Bürostuhl hochgesprungen. Zwar hatte sein Bewegungsablauf nicht mehr die Geschmeidigkeit früherer Jahre, doch seine Explosivität hatte es immer noch in sich.
Redman drehte durch!
Als erstes musste die Bodenvase mit den Trockenblumen dran glauben. Von einem kräftigen Fußtritt in die Höhe beschleunigt, flog sie krachend gegen die Wand und zerschellte. Doch das war nur der Auftakt für einen Wutanfall, der in seiner Intensität einem texanischen Tornado nicht nachstand.
Wenige Minuten später: Redman schaltete die Deckenbeleuchtung an. Der alternde CIA-Crack kniff die Augen zusammen, blinzelte, bis er sich an die Helligkeit gewöhnt hatte und nahm emotionslos das Chaos zur Kenntnis, was er im Halbdunkel angerichtet hatte: Alle Gegenstände, die auf seinem Schreibtisch gelegen hatten, die Bilderrahmen, der Inhalt des Papierkorbs, alles lag im Raum verstreut, als sei soeben eine Herde Büffel im Blindflug hindurchgeprescht. Nur das handsignierte Filmplakat an der Wand hing nach wie vor an seinem Platz – Ein Mann sieht rot. Charles Bronson schien ihm wohlgefällig zuzunicken.
Schwer atmend wuchtete sich Redman wieder in seinen Bürostuhl. Seine Leute waren solche Stümper! Richtige Anfänger! Aber vielleicht konnte man wenigstens aus den Fehlern lernen. Schritt für Schritt ließ er die vergangene Woche Revue passieren, Tag für Tag und aus allen Perspektiven.
Stupid German Gold! ärgerte sich Redman. Aber warum muss gerade in dieser Woche alles hochkochen? Warum gerade jetzt? Jetzt, wo sich uns eine einmalige Chance für Operation Snow White bietet?
Dabei war in der Vergangenheit immer alles glatt gelaufen. Die Milliardenwerte der in den USA gelagerten alliierten Goldreserven hatten die ganzen letzten Jahrzehnte dazu gedient, den Geldbedarf der CIA am Kongress vorbei zu decken. Niemand konnte von der Agency verlangen, sich jede Geheimoperation mühsam durch den Kongress genehmigen lassen zu müssen. Aus Sicht der CIA dauerte das immer zu lange, es warf zu viele Fragen auf und führte zu unnötigen Mitwissern. Unter diesen Umständen zerschellten zahlreiche Operationen an der Bürokratie, bevor sie überhaupt begonnen hatten. Aber die Strategie mit dem Verkauf des fremden Goldes pufferte alles, und zwar unbürokratisch und geräuschlos. Die Echtheit der Goldreserven in den Tresoren der Fed konnte von den Medien-Fuzzis nie wirklich in Zweifel gezogen werden. Die von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Gerüchte entpuppten sich am Ende immer als ungefährlich für die Agency. Warum auch besorgt sein, die Amerikaner würden Deutschland niemals die Möglichkeit zur Kontrolle vor Ort geben, nicht mal stichprobenartig. Und dabei würde es auch bleiben.
Trotzdem war in dieser Woche der lange befürchtete GAU passiert: Deutschland hatte drei Tonnen seines bei der Fed, der Zentralbank der Vereinigten Staaten, in New York gelagerten Goldes, zurückgefordert. Eine Alibi-Aktion der Deutschen zur Beruhigung der Bevölkerung – seht her, unser Gold ist bei den Amerikanern in guten Händen. Nichts Aufregendes also, alles sah nach einer reinen Routinelieferung aus. Die Agency ließ die wertlosen Duplikate aus der Fed entnehmen und gleichzeitig identische echte Barren für die Lieferung produzieren. Aber statt die verdammten Duplikate zu entsorgen, liefern wir sie nach Deutschland! Und ausgerechnet dieser Transport geht durch einen Überfall verloren!
Redman hatte die für den Transport Verantwortlichen noch am selben Abend gefeuert. Den Rest ihrer Dienstzeit konnten sie seinetwegen in New Mexico bei vierzig Grad im Schatten Erdmännchen jagen. Ihm sollten sie besser nie wieder über den Weg laufen. Er schlug mit der flachen Hand im Takt der Silben auf die Lehne seines Bürostuhls. NIE-WIE-DER!
Trotzdem ließ sich der Fehler nicht mehr rückgängig machen und führte, vorsichtig formuliert, zu unschönen Ermittlungen von Polizei und Presse.
Vielleicht war es reiner Zufall? Egal! Dieser Journalist Manx und seine Freundin sind uns mit ihren Recherchen deutlich zu nahe gekommen. Aber statt sie aus dem Verkehr zu ziehen, haben unsere Vollidioten einen Unbeteiligten eliminiert. Was für eine Blamage! Redman schäumte innerlich. Wenn irgendetwas davon an die Öffentlichkeit durchsickert, ist hier die Hölle los, das war ihm völlig klar. Dabei waren wir heute Nachmittag ganz nah dran. Manx hatten wir verhaftet und diese Online-Schnüfflerin, diese Lena Eck, saß mäuschenklein vor unserer Nase in der Botschaft und war uns ausgeliefert.
Aber dann? Wie eine Amateur-Truppe hatte sich die Agency vorführen lassen. Redman ließ die Verhandlung, die er mit Manx und Eck geführt hatte, zum x-ten Mal auf seinem inneren Bildschirm ablaufen, in Zeitlupe.
„Lieber Himmel!”, murmelte er resigniert.
Hatte er die richtige Entscheidung getroffen? Würde die Drohung der CIA wirken? Er brauchte die Entscheidung genau zu dem Zeitpunkt. Er musste den Rücken frei haben für eine Aktion gegen die der Etikettenschwindel mit dem Gold wie ein Kinderstreich wirkte.
Dieser Manx und seine Hacker-Braut hängen an ihrem erbärmlichen Leben, beruhigte er sich selbst. Nein, sie werden nichts veröffentlichen, keine einzige Zeile! Und wir werden trotzdem jeden Schritt von ihnen lückenlos überwachen. Finden wir auch nur ein einziges Stichwort im Netz, sind sie für immer erledigt.
*
Kaum hatte Lena Eck am Nachmittag die Amerikanische Botschaft verlassen, ließ Redman den Countdown anlaufen. Erst die Telefonkonferenz mit dem CIA-Hauptquartier in Langley/Virginia, dann die Entscheidung. Kurz nach 18:00 Uhr stand fest: Grünes Licht für Operation Snow White! Redman gab sofort alle notwendigen Befehle.
Jetzt hieß es warten.
Den ganzen Sonntag hatte Redman in der Botschaft verbracht. Erschöpft von seinem Wutanfall ließ er sich zurück in seinen Bürostuhl fallen. Das weit geöffnete Hemd gab den Blick auf sein graues Brusthaar frei. Die perlmuttfarbigen Knöpfe hatten seinem Wutausbruch nicht standgehalten. Einen davon entdeckte Redman eine Handbreit neben dem Festnetztelefon. Ohne zu zögern griff er den kristallenen Briefbeschwerer, der auf dem Boden lag, und zerschmetterte das Zielobjekt mit einem wuchtigen Schlag.
Zufrieden lehnte er sich zurück.
Irgendwo im Raum schrie ein Handy nach seinem Besitzer. Sein Handy. Spiel mir das Lied vom Tod, jammerte eine Mundharmonika.
Redman wuchtete sich hoch, schob mit dem Fuß hektisch einige Überbleibsel seines Wutausbruchs zur Seite, bis er das Telefon aufgestöbert hatte. Er bückte sich und nahm den Anruf in der Hocke entgegen.
21:20 Uhr zeigte das Display.
Der Anrufer hatte soeben den Tod des ehemaligen Bundespräsidenten bestätigt. Redman richtete sich auf und schaltete den Computer ein.
In den 22-Uhr-Nachrichten brachten es alle Sender: Altbundespräsident Matthias Röhler war heute im Kreise seiner Familie überraschend gestorben.
*
Hamburg-Berlin. Verdammt nochmal! Warum fuhr der Zug nicht weiter? Warum hielt der ICE in Berlin-Spandau? Markus Manx rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her. Er war so nah am Ziel. Er musste unbedingt zur Botschaft der Amerikaner.
„Ausweiskontrolle!” Zwei Bundespolizisten betraten den Waggon. Auch das noch!
Der erste Beamte begann, die Personalausweise der Reisenden zu überprüfen, am Gürtel eine Pistole, Schlagstock und Handschellen. Der zweite Beamte, eine Maschinenpistole in den Händen, der Lauf zeigte locker Richtung Boden, sicherte seinen Kollegen. Aufmerksam schweifte sein Blick über die Fahrgäste. Zwischen beiden Polizisten ein mächtiger deutscher Schäferhund.
Noch zehn Minuten bis Berlin Hauptbahnhof! In Markus keimte Panik auf. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Mist, den hatte er total verdrängt! Er raffte seine Sachen zusammen, stopfte sie hastig in den Rucksack und schlich sich aus dem Abteil. Unauffällig spähte er in den nächsten Waggon. Keine Kontrollen. Er setzte sich in die Waggonmitte. Der zeitliche Vorsprung musste doch für die zehn Minuten bis zum Berliner Hauptbahnhof reichen ... Hoffentlich fuhr der Zug bald an!
Mit einem piepsenden Geräusch schlossen sich die Waggontüren. Na endlich! Aber der ICE bewegte sich keinen Millimeter. Markus beugte sich so nah an die getönte Scheibe, dass seine Nasenspitze fast das kühle Glas berührte. Mit einer Hand schirmte er die störenden Lichtreflexe ab, er wollte sehen, was draußen passierte. Bestürzt zuckte er zurück – an beiden Seiten des Bahnsteigs patrouillierten Polizisten mit Maschinenpistolen!
Jetzt erreichten die beiden Kontrolleure mit dem Hund seinen Großraumwagen und begannen mit der Ausweiskontrolle. Der Zug stand noch immer mit geschlossenen Türen in Spandau.
Markus wollte aufspringen, nur weg von den Polizisten. Aber auch von der anderen Seite näherte sich jetzt eine Kontrolle. Er saß in der Falle. Welche Möglichkeiten blieben ihm noch? Er musste doch dringend zur Amerikanischen Botschaft. Eine Verhaftung war das Schlimmste, was ihm jetzt passieren konnte. Er rutschte immer tiefer in den Sitz.
„Ausweiskontrolle!” Die Stimme des Polizisten klang korrekt aber kalt.
Auf Markus’ Stirn bildeten sich Schweißtropfen. Mühsam widerstand er dem Reflex, sie abzuwischen.
Der Polizist zog den Ausweis durch ein Kartenlesegerät, nicht größer als ein Taschenbuch, und wartete. Abwechselnd blickte er ruhig auf Markus und das Display. Das Warten, bis sich der Kartenleser mit einem kaum hörbaren Summen zurückmeldete, kam Markus wie eine Ewigkeit vor.
Der Polizist drehte sich zu seinem Kollegen um und wies mit einem auffordernden Kopfnicken auf Markus. Der stämmige Mann fasste seine Waffe fester, stellte sich breitbeinig in den Gang. Auch der Schäferhund hatte verstanden, spitzte die Ohren und wartete auf einen Befehl.
„Fass!”, brüllte der Bundespolizist. Mit wildem Knurren stürzte sich das mächtige Tier auf Markus …
Neeeeiiiin! Von Panik gepeinigt, wild um sich schlagend, fuhr Markus im Bett hoch. Es dauerte eine Weile, bis die Realität ihn wiederhatte. Kein Schäferhund in Sicht! Markus setzte sich auf die Bettkante. Ein Albtraum, zum Glück nur ein Albtraum! Trotzdem bedenklich, dieser Horrortrip, fand er. Jetzt verfolgen mich die Erlebnisse der letzten Tage schon bis in den Schlaf.
Irgendwie kein Wunder bei der verrückten Woche, die hinter ihnen lag. Aber nun wollte er Hektik und Gefahr hinter sich lassen, das hatte er Lena versprochen. Ihr Kingsize-Bett stand in einem über dreißig Quadratmeter großen, stilvoll eingerichteten Raum. Allenthalben hanseatisches Flair, schneeweiße Daunenbetten mit einem Duzend Kissen in weiß und beige. Sie waren in Hamburg, Hotel Atlantic, erkannte er mit einem Blick auf die Alster, auf der sich das Mondlicht und die Lichter der Laternen spiegelten.
Der Blick auf sein spindeldürres Journalistenbudget spiegelte etwas ganz anderes wider. Angesichts dessen fühlte sich Markus in diesem Superior-Zimmer irgendwie deplatziert. Aber versprochen ist versprochen. „Kleine Wiedergutmachungsaktion für heldenhafte Hackerinnen” hatte er Lena zärtlich ins Ohr geflüstert, als er ihr stolz den Buchungsbeleg für das Zimmer präsentierte.
Er blickte auf die Uhr – kurz vor Mitternacht. Er ließ sich zurück ins Bett fallen, drehte sich auf die Seite und betrachtete Lena. Sie schlief, Snoopy, ihr Plüschtier, fest im Arm haltend. Er streichelte ihr leicht die Wange, bedacht darauf, sie nicht aufzuwecken.
Aus der Gold-Geschichte sind wir raus, dachte er, bevor ihm die Augen wieder zufielen. Das ist auch gesünder, resümierte er galgenhumorig. Mit der CIA legt man sich besser nicht an. Wenn man Glück hat, kommt man mit üblen Träumen davon …
*
Berlin, Hellersdorf.Endlich ist es soweit, dachte Azad. Der Anrufer hatte ihm den nächsten Schritt genannt. Cottbusser Platz zeigte der Schriftzug an der Haltestelle. Er zog Dilara mit sich aus der U-Bahn.
In der U5 hatte Azad viele Sprachen gehört, auch Arabisch und Kurdisch, einige andere Gesprächsfetzen konnte er nicht einordnen. Deutsch wurde dagegen selten gesprochen.
Sie verließen die U-Bahnstation und folgten einem spärlich beleuchteten Fußweg. Nach wenigen hundert Metern wichen die ordentlichen, verputzten Plattenbauten unsanierten grauen Betonklötzen. Wie zahnlose Ungetüme standen sie da und verbreiteten eine trostlose Atmosphäre.
Eine ehemals als Sitzbank vorgesehene Konstruktion aus Stahl und massiver Douglasie, bis zur Unkenntlichkeit verkohlt, hatte offensichtlich Anwohnern als Lagerfeuer gedient. Ähnlich erbärmlich sah es unter dem kahlen Silber-Ahorn aus, der daneben stand. Zwei alte Fernseher, mehrere Autoreifen und ein zerschlissenes Stoffsofa teilten sich ihren letzten Ruheplatz.
Azad zog einen Schlüssel aus der Tasche. Sie waren angekommen.
Der Weg zu ihrer Wohnung im siebten Stock führte durch das finstere Treppenhaus, der Aufzug war defekt. Es stank. Bewohner, die es sich leisten konnten, hatten den Wohnblock schon vor Jahren verlassen. Wer aus Not geblieben war, sorgte sich nur noch um sich selbst. Aus anderer Perspektive betrachtet: das perfekte Versteck für jemanden, der triftige Gründe hat, menschliche Kontakte möglichst zu meiden.
Oben angekommen, verriegelte Azad die Wohnungstür von innen. Auf Augenhöhe ermöglichte ein fingerdickes Loch den unmittelbaren Blick ins Treppenhaus.
Abgespannt blieb Azad im kahlen Flur stehen. Dann ließ er sich langsam, den Rücken an der Wand, bis auf den Boden rutschen und atmete tief durch. Endlich ist das zermürbende Warten vorbei!
Kurz darauf galten seine Gedanken schon dem nächsten Schritt: Waffen und Sprengstoff besorgen.
Er hatte sich die Details aus dem Telefonat eingeprägt. Ganz deutlich sah er jetzt die Konstruktion aus Metall vor Augen: Die Querstreben, den Brückenboden, die stabilen Widerlager, auf denen die Brücke ruhte. In Gedanken konnte er beinahe die Umgebung riechen.
Aber wie an den Sprengstoff kommen? Fest stand bisher nur eines: Das Material sollte bei einer Brücke deponiert werden. Bei welcher, hatte der Anrufer nicht erwähnt. Zum Schutz, falls sie abgehört würden. Wenn die Meldung eintraf, wo genau es versteckt war, würde er es holen. Vielleicht schon morgen, vielleicht aber auch erst in einigen Tagen.
Azad zog die Knie an. Das ewige Warten hatte ihn unendlich ermüdet, aber schlafen konnte er seit Tagen nicht mehr richtig. Du musst aufmerksam bleiben, ermahnte er sich. Heute hatte er nochmal Glück gehabt.
Dilara beobachtete ihn. Ohne ihre Jacke auszuziehen, ging auch sie langsam in die Hocke und setzte sich neben ihn.
Azad starrte mit leerem Blick auf den Boden. Das Warten hat ein Ende, hallte es in seinem Kopf nach. Ohne hinzusehen spürte er, dass Dilara ihn mit ihren großen dunklen Augen von der Seite ansah.
„Gut, alles ist gut”, sagte er liebevoll und drehte sich zu ihr hin. „Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Von früher?”
Dilara sagte keinen Ton. Ein angedeutetes Blinzeln ihrer Augen reichte, und Azad fing langsam an zu erzählen. Geschichten, die er wohl schon hundert Mal erzählt hatte. Immer wieder. Immer die gleichen Geschichten. Wie es war, damals, zu Hause: Wie sie mit den Eltern Geburtstag feierten, mit Blumen in den Haaren. Wie sie mit ihren Freunden aus dem Dorf Fangen spielten. Von ihrem kleinen Haus. Azad erzählte. Das Erzählen beruhigte auch ihn. Mit jedem Satz wurde seine Stimme ruhiger, melodischer, fast singend.
Er spürte, wie sich ihr Kopf langsam auf seine Schulter senkte. Ihr Atem war kaum hörbar, sie schlief. Er erzählte ruhig weiter, während er sie ganz vorsichtig hochhob und im Nebenzimmer auf eine Matratze legte. Er war kräftig und sie leicht wie ein Kind. Viel zu dünn für ihre fast achtzehn Jahre. Er zog ihr die Schuhe aus und deckte sie mit einer Steppdecke zu.
Vor zwei Wochen hatte Azad diese Wohnung in demselben trostlosen Zustand übernommen, wie sie jetzt noch war: nackter Fußboden, ein paar Möbel aus Plastik, zwei Matratzen zum Schlafen, die Dusche defekt, an der Decke baumelten nackte Glühlampen.
Dem Kioskbesitzer am Berliner Hauptbahnhof hatte Azad nur seinen Namen genannt, der hatte ihm ohne ein Wort ganz unauffällig einen Briefumschlag über den Tresen geschoben. Als er den Umschlag später öffnete, hielt er Schlüssel und Adresse für diese Wohnung in der Hand. Das war es. Sein Auftrag: Warten!
Azad dachte an den nächsten Morgen.
Montag
Berlin, Hellersdorf. Ein Klang wie von einem winzigen Glöckchen, alle drei bis vier Sekunden. Azad lag wach auf dem Rücken und lauschte dem Geräusch, das seit Stunden in die Stille hineintröpfelte. Irgendwann hörte er, wie jemand auf der glatten Betontreppe ein Stockwerk tiefer über etwas stolperte und fluchend seinen Weg fortsetzte.
Azad schlug die Decke zurück und ging ins Bad. Er ließ kaltes Wasser in seine Handflächen laufen, schöpfte es sich ins Gesicht und genoss für einige Sekunden die wachmachende Kühle. Die Morgentoilette war damit erledigt.
Er ging in die Küche, ließ Wasser für den Tee in einen Topf laufen, stellte ihn auf den Herd und wartete, bis sich auf dem Topfboden kleine Luftblasen bildeten. Als sie größer wurden, sich lösten und nach oben sprudelten, goss er das Wasser in die verschrammte Teekanne.
Wenige Minuten nach ihm war auch Dilara aufgestanden und setzte sich auf den Plastikstuhl ihm gegenüber. Außer zwei mit heißem Tee gefüllten Gläsern lag eine aufgerissene Packung Butterkekse auf dem Tisch. Dilara beobachtete Azad. Nachdem dieser sich einen Keks genommen hatte, griff sie sich ebenfalls einen und begann, langsam die Ecken abzubeißen.
„Alles gut?” Azad sah sie aufmerksam an. Ihre nach vorn fallenden Haare verdeckten nur einen Teil der Narbe, die von ihrem rechten Auge fast bis zum Mundwinkel führte. Es hatte lange gedauert, bis der tiefe Schnitt angefangen hatte zu heilen. Azad meinte, an der Farbe der grübchenartig nach innen gezogenen Narbe ihren Gemütszustand erkennen zu können. Etwas stimmte nicht mit ihr, das erkannte er sofort.
Ohne ihren Kopf zu bewegen schaute Dilara zu ihm hoch und biss die letzte Keksecke ab.
„Dilara, was versteckst du?”
Ihre Hand schob sich noch etwas weiter unter den Tisch.
Auch diese Bewegung entging ihm nicht.
Keine Reaktion.
„Dilara, zeig mir deine linke Hand!” Azads Stimme wurde bestimmter. Fordernd streckte er ihr seine Hand entgegen: „Zeig her!”
Langsam zog sie ihre Hand unter dem Tisch hervor und bewegte sie widerwillig Richtung Tischmitte.
Vorsichtig entwand Azad ihren Fingern eine ausgeblichene Ansichtskarte und drehte sie langsam um. Dort klebte ein Bild, ein Kinderwagen, offenbar ausgeschnitten aus einem Prospekt.
„Woher hast du die Karte?”
Dilara drehte sich mit dem Oberkörper zur Wohnungstür und blickte runter auf die Türschwelle.
Azad hatte verstanden. Jemand musste die Karte soeben unter der Haustür durchgeschoben haben, denn als er in die Küche gegangen war, lag dort nichts, es wäre ihm sicher aufgefallen.
Azad stand auf, öffnete leise die Tür und lauschte für einige Sekunden ins Treppenhaus hinaus. Alles ruhig, weit und breit nichts zu hören.
Er schloss die Tür wieder, setzte sich zurück an den Tisch und betrachtete die Karte näher. Das altersgelbliche Motiv zeigte eine alte Fabrik, daneben eine Brücke, deren Stahlbögen sich über einen Fluss spannten. Azad brauchte nur wenige Minuten, um sich jedes Detail einzuprägen: Die stählernen Rundbögen, das Muster ihrer Verstrebungen, die Brückenköpfe, eingerahmt von zwei quadratischen Stein-Pylonen, der kuppelähnliche Abschluss der Pylone.
Charlottenburg – städtisches Elektrizitätswerk mit Siemenssteg erklärten fette Buchstaben in altdeutscher Schrift am unteren Kartenrand.
Eine deutliche Botschaft, dachte Azad. Diese Ansichtskarte ist das fehlende Puzzleteil. Plötzlich spürte er das Blut in seinen Adern pulsieren. Hier rumzusitzen ist jetzt keine Option mehr, du musst raus, drängelte es in ihm.
„Komm”, sagte er zu Dilara und stürzte den letzten Schluck Tee hinunter.
Azad hatte sich freiwillig für diese Aktion gemeldet. Die Zusage kam umgehend. Freiwillige gab es bei ihnen in der Einheit genug, aber was sie dringend brauchten, waren Techniker, Mechaniker – Kämpfer, die auch Bomben bauen konnten. Azad erfüllte diese Auswahlkriterien. Er besaß ein überdurchschnittliches technisches Verständnis, erwies sich während der Ausbildung als mit Abstand geschicktester und ideenreichster Bastler. Und er hatte Geduld bei allem was er tat, wurde selten nervös, geriet nie in Panik, fand immer eine Lösung. Ein weiterer, nicht weniger entscheidender Grund waren seine Sprachkenntnisse. Aufgrund seiner guten Schulbildung sprach er auch Englisch, und als einziger Deutsch.
Als sogenannter Schläfer sollte er nach Berlin gehen und dort warten. Solange warten, bis er einen konkreten Auftrag zugeteilt bekam. Das konnte Wochen dauern. Oder sogar Monate.