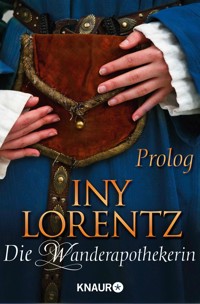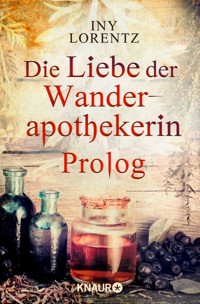Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Auswanderer-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein zerrissenes Land - Eine Frau zwischen zwei Männern - Ein liebendes Paar auf der Flucht: Der Beginn der großen historischen Auswanderersaga von der Erfolgsautorin Iny Lorentz! Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts: In der Schlacht von Waterloo rettet der junge Walther seinem Kommandeur das Leben. Zum Dank nimmt dieser sich des Waisenjungen an – ebenso wie der kleinen Gisela, deren Vater im Kampf fiel. Beide wachsen von nun an im Schoße der Grafenfamilie auf – sehr zum Unwillen des Grafensohnes, der sie aus tiefstem Herzen verachtet. Jahre später wird aus der Abneigung Hass, denn der Erbe des Grafen will die schöne Gisela für sich. Doch deren Herz schlägt schon lange für Walther – und er erwidert ihre Liebe. Am Ende scheint es für das Paar nur einen Ausweg zu geben …. Mit »Das goldene Ufer« beginnt Iny Lorentz eine große historische Roman-Reihe voller schicksalhafter Liebe und atemberaubender Abenteuer. »Iny Lorentz, das Autorenpaar, das Historie lebendig macht, haben mit DAS GOLDENE UFER ihre nächste Bestseller-Saga geschrieben. (...) Sehr spannend zu lesen und wieder voller lebendiger Details! Trotz der Fülle des Romans entsteht nie Langeweile.« denglers-buchkritik.de Die Auswanderer-Saga um Walther und seine geliebte Gisela geht weiter in: - Band 2 »Der weiße Stern« - Band 3 »Das wilde Land« - Band 4 »Der rote Himmel«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 50 min
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Iny Lorentz
Das goldene Ufer
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In der Schlacht von Waterloo rettet der junge Walther seinem Kommandeur Graf Renitz das Leben. Zum Dank nimmt dieser sich des verwaisten Jungen an – ebenso wie der kleinen Gisela, deren Vater im Kampf fiel und deren Mutter von einem Plünderer umgebracht wurde. Beide wachsen von nun an im Schoße der Familie Renitz auf – sehr zum Unwillen des Grafensohnes, der sie verachtet und Walther um den Ruhm beneidet, seinen Vater auf dem Schlachtfeld gerettet zu haben.
Jahre später wird aus der Abneigung Hass, vor allem als sich beide Jungen in die schöne Gisela verlieben und diese Walther erhört. Dem Paar bleibt nur noch die Flucht – nach Amerika …
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Großes Jubiläumsgewinnspiel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Siebter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Achter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Neunter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Anhang
Historischer Überblick
Die Personen
Glossar
Erster Teil
Der Schatten von Waterloo
1.
Endlich hatte der Regen aufgehört. Aber das war der einzige Lichtblick, fand Walther. Noch immer versank er bis über die Knie in dem Morast, den Tausende Pferdehufe und Soldatenstiefel aufgewühlt hatten. Die schmutzige Brühe rann in seine Stiefel und machte sie so schwer, dass er alle paar Schritte stehen bleiben, sie von den Füßen streifen und ausleeren musste. Am liebsten hätte er sie weggeworfen und wäre barfuß weitermarschiert. Doch neue Stiefel waren unerschwinglich. Er konnte auch nicht einem Gefallenen auf dem Schlachtfeld die Fußbekleidung abnehmen, denn dafür waren seine Füße noch zu klein. Auch brachten die Leichenfledderer, die von ihrer Ausbeute lebten, kurzerhand jeden um, der ihnen die Beute streitig machen wollte.
»Eins und eins und eins«, murmelte Reint Heurich, der Musketier, der neben Walther marschierte, und jede Eins bedeutete einen Schritt weiter auf die Heere der Franzosen zu.
Walther graute davor, erneut auf den Feind zu treffen. Erst vor zwei Tagen waren sie mit einem Teil von Napoleons Armee aneinandergeraten und vernichtend geschlagen worden. Ihm erschien es wie ein Wunder, dass es ihren Generälen gelungen war, die eigenen Truppen halbwegs geordnet vom Feind zu lösen und nach Norden zu führen. Dabei hatte ihr Regiment nur gegen das Korps des Marschalls Grouchy kämpfen müssen und nicht gegen den schier unbesiegbaren Kaiser der Franzosen selbst.
Walther wagte es kaum, an Napoleon zu denken, dessen Truppen seit mehr als zwei Jahrzehnten von Sieg zu Sieg eilten und der die Niederlage bei Leipzig ebenso überstanden hatte wie seine Absetzung und Verbannung nach Elba. Nun suchte der Kaiser der Franzosen mit frischen Truppen den entscheidenden Sieg.
»Glaubst du, wir werden ihn diesmal schlagen?«, fragte er seinen Kameraden.
Heurich beendete sein »eins und eins« und sah erstaunt auf ihn herab. »Wen meinst du?«
»Na ihn, den Korsen!«
Heurich schneuzte sich so laut, dass es wie ein Trompetenstoß klang, und zuckte mit den Achseln. »Bonaparte also! Wenn ich das wüsste, wäre ich der klügste Mann auf Erden. Ehrlich gesagt glaube ich nicht daran. Seine Soldaten haben uns vorgestern so verdroschen, dass uns jetzt noch die Arschbacken flattern. Als Nächstes wird er die Engländer verhauen. Sind keine guten Soldaten, die Engländer, sage ich dir. Halten es mehr mit dem Stehlen als mit dem Kämpfen. Wenn ihre Braunschweiger und Hannoveraner nicht wären, hätten sie sich längst auf ihre Insel verzogen und sich in wohlfeile Gebete geflüchtet, dass Bonaparte nicht auch zu ihnen vordringt. Und ausgerechnet denen sollen wir jetzt zu Hilfe kommen …
Aber jetzt los, Junge! Die anderen sind uns schon weit voraus. Du bist unser Trommelbub, und wir wollen dich trommeln hören. Wenn du andauernd zurückbleibst, marschieren wir auf dem Schlachtfeld womöglich noch in die falsche Richtung, nämlich vom Feind weg!«
Mit einem Lachen half Heurich dem Jungen, seine Stiefel aus einem Schlammloch zu ziehen. Das schmatzende Geräusch erinnerte sie an ihre hungrigen Mägen.
»Was gäbe ich jetzt alles für ein Stück Brot«, seufzte der Musketier und reichte Walther eine Schnur. »Hier, mein Junge, binde deine Stiefel zusammen und trage sie über der Schulter. Mit bloßen Füßen tust du dich hier leichter, als wenn du die Erde von halb Flandern in deinen Stiefeln mitschleppen musst.«
Nun musste auch Walther lachen. »Halb Flandern ist es nicht gerade. Aber die Stiefel sind durch den Matsch und das Wasser tatsächlich arg schwer geworden.«
Er befolgte Heurichs Rat und kam nun besser voran, auch wenn ihn die große Trommel nach wie vor behinderte. Schlimmer noch als dieses unhandliche Ding und die feuchte Kälte war der Hunger, der in seinen Eingeweiden wühlte. Seit sie bei Ligny von den Franzosen zurückgeschlagen worden waren, hatten sie keinen Fouragewagen mehr zu Gesicht bekommen. Das bisschen Brot in seinen Taschen war längst gegessen und, wie Reint Heurich es derb ausdrückte, auch schon verdaut.
»Warum marschieren wir wieder auf die Franzosen zu, wo sie uns doch vorgestern das Laufen gelehrt haben?«, wollte Walther von dem altgedienten Musketier wissen.
»Da musst du schon General Gneisenau fragen – oder den Marschall selbst. Ich weiß nur, dass wir uns mit jedem Schritt weiter von unseren Vorratsmagazinen entfernen. Aufzutreiben ist hier auch nichts, denn alles Essbare haben sich schon die Engländer oder die Franzosen unter den Nagel gerissen.« Heurich spie aus und bedachte sowohl den Feind wie auch die Verbündeten mit wüsten Flüchen.
Walther kämpfte noch immer mit seiner Trommel und hängte sich diese schließlich über die Schulter. Eigentlich hätte er den Marschtakt schlagen sollen. Aber wenn er die Trommel aus ihrem Lederüberzug nahm, würde er das Instrument hinterher mühsam von dem Deck säubern müssen, der ständig von Stiefeln und nackten Füßen hochspritzte. Die anderen Trommler ließen auch nichts von sich hören, und selbst die Flötenspieler waren verstummt.
Jeder war froh, überhaupt einen Fuß vor den anderen setzen zu können. Daher hatte sich die Truppe so weit auseinandergezogen, dass Walther den Oberst an der Spitze nicht mehr sehen konnte. Als er sich umdrehte, war auch die Nachhut außer Sicht. Wahrscheinlich würden etliche Soldaten die Gelegenheit nützen und sich in die Büsche schlagen. So war es schon bei Ligny gewesen, wo sie mehr Männer durch Desertieren als durch den Kampf verloren hatten.
»Die Weiber halten sich besser als die Mannsleut!«
Reint Heurichs Bemerkung riss Walther aus seinem Sinnieren, und er nahm nun erst wahr, dass Walburga Fürnagl, die Wachtmeisterin, wie sie ihres Mannes wegen genannt wurde, und deren Tochter Gisela sie eingeholt hatten. Beide kämpften sich mit verbissenen Mienen auf der schlammigen Straße vorwärts. Die Mutter trug einen gewaltigen Tornister auf dem Rücken und schleppte in der einen Hand noch einen großen Beutel. In der anderen Hand hielt sie einen Stock, auf den sie sich immer wieder stützte. Auch Gisela war so voll bepackt, dass Walther sich schämte, dass er die Trommel als zu schwer empfunden hatte. Immerhin zählte das Mädchen gerade mal zehn Jahre und war damit drei Jahre jünger als er.
Eben strauchelte Gisela und fiel in den Matsch. Die Mutter schien es nicht zu bemerken, denn sie marschierte unbeirrt weiter. Walther sah, wie das Mädchen sich verzweifelt aus dem Schlamm zu befreien suchte, und eilte kurz entschlossen zu ihr hin.
»Gib mir deine Hand!«, rief er Gisela zu.
Ihre Rechte war jedoch so voll Schlamm, dass Walther sie nicht richtig zu fassen vermochte und sie am Ärmel hochzerrte.
Nun bemerkte auch die Mutter, dass sie die Tochter verloren hatte, und blieb zwanzig Schritte weiter schwer atmend stehen. Einen Augenblick lang sah es so aus, als wolle sie zurückkommen, dann aber schüttelte sie den Kopf und sah zu, wie Walther dem Mädchen auf die Beine half und es bei den ersten Schritten stützte.
»Bist ein braver Junge, Walther«, lobte Walburga Fürnagl ihn, als er Gisela zu ihr brachte. »Die Heilige Jungfrau wird’s dir vergelten.«
Reint Heurich spie aus. »Lass uns mit deinen katholischen Heiligen und Jungfrauen in Frieden, Wachtmeisterin. Wir sind gute Lutheraner und wollen kein papistisches Zeug hören!«
»Sie hat es doch gut gemeint«, wandte Walther ein.
Obwohl Heurich sein Freund und Beschützer war, ärgerte er sich nun über den Mann. Zwar überwogen in ihrem Regiment die Soldaten aus protestantischen Gebieten, doch Oberst Graf Renitz hatte auch eine Kompanie aus einem aufgelösten bayerischen Bataillon in seine Dienste genommen, und diese Männer hatten sich als gute Soldaten erwiesen. Giselas Vater, Josef Fürnagl, führte als Wachtmeister die Vorhut an. Selbst bei Ligny hatte er die Übersicht behalten und die meisten seiner Männer zurückgebracht. Die Kompanie aber, zu der Walther und Reint Heurich gehörten, war auf ein Viertel ihrer ursprünglichen Zahl geschrumpft.
Da Heurich mit einem verächtlichen Schnauben weiterging, dauerte es ein wenig, bis Walther wieder zu ihm aufschließen konnte. »Was hast du eigentlich gegen diese Leute?«
»Heute hast du wohl den Fragewurm gefressen!«, knurrte der Musketier. »Ich mag halt keine Katholischen. Die beten zu allen möglichen Heiligen und vor allem zu ihrer Jungfrau Maria, wo doch jeder Mensch weiß, dass nur unser Heiland unsere Seelen retten kann. Halbe Heiden sind das!«
Damit war die Sache für ihn erledigt. Kurz darauf wies er nach vorne. »Wie es aussieht, holen wir auf! Oder haben die dort haltgemacht? Das erscheint mir auch vernünftig, sonst marschieren wir noch in die Franzosen hinein, ohne es zu merken.«
Da hörten sie in der Ferne ein Grollen wie von einem aufziehenden Gewitter.
»Das sind die französischen Kanonen!«, rief Heurich. »Die erkenne ich am Klang. Aber ich glaube nicht, dass die Engländer sich halten. Es wäre besser, wenn wir den Rückmarsch anträten. Vielleicht schließt der König Frieden mit Bonaparte, so dass wir nicht noch einmal unsere Knochen ins Feld tragen müssen.«
Walther hörte Heurich nur mit halbem Ohr zu, denn er vernahm nicht nur das Donnern der Kanonen, sondern auch einen anderen Ton, der zwar leiser war, aber giftiger klang. »Jetzt schießen sie ihre Musketen ab. Wie weit mögen sie von uns entfernt sein?«
»Zwei Stunden Marsch auf trockener Straße, schätze ich, und mindestens fünf auf diesem Schlammpfad. Wir sollten nicht zu schnell gehen, sonst geraten wir noch vor Anbruch der Nacht an die Franzosen. Weißt du, Junge, ich bin seit 1792 dabei, und mir ist mehr Blei um die Ohren geflogen, als ein Regiment in einem Jahr abfeuern kann. Meist haben wir Keile gekriegt, und die schlimmsten sogar, als wir mit Bonaparte verbündet waren und nach Russland gezogen sind. Tut mir leid, ich wollte nicht davon anfangen«, setzte Heurich hinzu, als er sah, dass Tränen aus den Augen des Jungen liefen.
»Ist schon gut«, antwortete Walther gepresst.
»Damals hat sogar der Korse merken müssen, dass er nicht die ganze Welt erobern kann. Schade, dass dein Vater dort hat dran glauben müssen. War ein prima Kerl, auch wenn er zu den Unteroffizieren zählte!«
»Ich habe meinen Vater nicht richtig kennengelernt.« Walther versuchte, sich an den hochgewachsenen, hageren Ehemann seiner Mutter zu erinnern, den er nur vier- oder fünfmal in seinem Leben für ein paar Tage oder Wochen gesehen hatte. Wahrscheinlich, dachte er, wäre sein Vater gerne länger bei ihnen geblieben, doch der Krieg war unerbittlich und riss jeden mit sich. Nachdem die Mutter aus Gram über den Tod des Vaters gestorben war, hatte Graf Renitz’ Verwalter ihn als Trommelbub zum Regiment geschickt.
Während ihres Gesprächs hatten sie zu den vor ihnen haltenden Soldaten aufgeschlossen und blieben ebenfalls stehen. Alle horchten auf den rollenden Klang des Gewitters aus Pulver und Eisen, das mit einem Mal erschütternd nah zu sein schien, und auf etlichen Gesichtern zeichnete sich Angst ab. Die Männer hatten nicht vergessen, dass Grouchys Soldaten vor zwei Tagen ihre Reihen zurückgeworfen und schließlich durchstoßen hatten. Andere wirkten eher trotzig, als wollten sie es an diesem Tag den Franzosen heimzahlen.
Nicht weit von Walther und Heurich entfernt beriet sich der Regimentskommandeur Oberst Graf Renitz mit seinen Offizieren und schickte schließlich zwei Leutnants auf Pferden los, um die Lage vor ihnen zu erkunden.
»Wie’s aussieht, haben wir erst einmal Ruhe«, erklärte Reint Heurich zufrieden. »Würden wir nun auch noch ein trockenes Plätzchen für uns finden, wäre es noch besser. Aber die Äcker und Wiesen hier sind ebenso grundlos wie die Straße, nachdem ganze Armeen durchgezogen sind.«
»Vielleicht ist es im Wald dort drüben trockener«, sagte Walther und wollte in die Richtung gehen.
Doch Heurich hielt ihn zurück. »Tu das nicht, Junge, sonst denken die Feldwebel, du willst ausrücken, und das nehmen sie arg übel. Ich habe erlebt, wie sie einen Kerl aufgehängt haben, nur weil er ein paar Schritte in den Wald hineingegangen ist, um in Ruhe scheißen zu können.«
»Wirklich?« Walther wusste nicht so recht, ob er seinem großen Freund glauben sollte. Gelegentlich gab Reint Heurich phantastische Geschichten zum Besten, die ihm ganz und gar unmöglich erschienen. Allerdings war er nun schon seit einigen Monaten beim Militär und hatte gelernt, dass hier wahrlich andere Regeln und Gesetze herrschten als im normalen Leben.
»Und ob es so war!« Heurich klopfte Walther auf die Schulter, verzog dann aber das Gesicht, als sich weiter vorne der junge Renitz, der als Fähnrich im Regiment diente, aus einer Gruppe von Offizieren löste, sein Pferd bestieg und auf sie zukam.
Dabei ritt der Sohn des Obersts so nahe an den Soldaten vorbei, dass diese von dem Schlamm bespritzt wurden, den die Hufe seines Pferdes hochwarfen. Walther bekam einen dicken Batzen Dreck ins Gesicht und wischte ihn mit dem Ärmel ab. Gisela und ihrer Mutter erging es noch schlechter, denn der Fähnrich lenkte seinen Gaul so, dass dieser die beiden Frauen streifte und in den Dreck warf.
»Was wollen die Weiber hier?«, fragte der junge Renitz dabei verärgert. »Die sollten doch beim Tross sein.«
Walburga Fürnagl kämpfte sich wieder auf die Beine und musterte den Fähnrich mit blitzenden Augen. »Könnt Ihr uns sagen, wo sich der Tross befindet? Seit Ligny wird der nämlich vermisst.«
Der Fähnrich versetzte der Frau einen heftigen Hieb mit seiner Reitpeitsche. »Dir werde ich deine Frechheiten schon austreiben, du papistisches Miststück!«
Walther ballte empört die Fäuste, und als Diebold von Renitz auch noch Gisela einen Hieb mit der Reitpeitsche überzog, musste Reint Heurich ihn festhalten.
»Mach keinen Unsinn, Kleiner! In der Armee kommt ein Offizier für unsereinen gleich hinter Gottvater persönlich, auch wenn es nur ein lumpiger Fähnrich ist! Der dort ist noch dazu der Sohn vom Oberst! Daher glaubt er, sich alles herausnehmen zu können.«
Mittlerweile ritt der junge von Renitz in die Richtung, aus der die Truppe gekommen war.
»Es passt dem Herrn wohl nicht, dass er sich auf die Suche nach Nachzüglern begeben muss«, warf ein anderer Soldat ein.
Besorgt trat Walther zu Gisela. »Tut es sehr weh?«
Das Mädchen schniefte, schüttelte dann aber den Kopf. »Es geht! Danke, dass du gefragt hast.«
»Bist ein braver Bursche, Walther Fichtner«, setzte die Wachtmeisterin hinzu.
Dann stupste sie Gisela an. »Komm mit! Dort hinten sind Marketenderinnen. Vielleicht wissen die etwas von den Trosswagen.«
Gisela folgte ihr, wandte sich nach ein paar Schritten aber noch einmal zu Walther um. »Danke, dass du mir vorhin aufgeholfen hast! Alleine hätte ich es wohl nicht geschafft, denn der Schlamm war einfach zu tief.«
»Aber das war doch nicht der Rede wert!«
Ein Ausruf von Reint Heurich übertönte Giselas scheue Antwort. »Jetzt könnte ich etwas zu essen vertragen! Mit leerem Magen kämpft es sich schlecht, und ich habe verdammt das Gefühl, dass wir heute oder spätestens morgen den Franzosen gegenüberstehen.«
Diese Bemerkung rief Walther wieder ihre Situation ins Gedächtnis, und er horchte besorgt auf den lauter werdenden Kanonendonner. »Kommen die auf uns zu?«
Sein großer Freund schüttelte mit verkniffener Miene den Kopf. »Der Wind hat gedreht, daher hören wir es deutlicher. Aber ich glaube, unser Oberst ist zu einem Entschluss gekommen. Im Zweifel ist er schlecht für uns, aber was soll’s? Krepieren muss jeder einmal.«
Heurich rückte seinen Tornister zurecht und putzte den Kolben seiner Muskete, auf die er sich während des Marsches gestützt hatte. Die anderen Soldaten taten es ihm gleich. Jeder von ihnen wusste, dass ein schussbereites Gewehr den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten konnte.
Walther holte seine Trommel heraus, legte die Umhüllung fein säuberlich zusammen und verstaute sie in seinem Tornister. Dann fettete er das Trommelfell ein, obwohl er das bereits vor der Schlacht bei Ligny getan hatte. Es half ihm, seine Nervosität im Zaum zu halten. Aber vor der Angst gab es keinen Schutz.
2.
Endlich kehrte einer der zur Erkundung ausgesandten Offiziere zurück und erstattete noch im Sattel dem Oberst Meldung. Walther konnte zwar nicht hören, was der Mann sagte, sah aber die Hauptleute und Leutnants umgehend zu ihren Kompanien eilen.
»Abmarsch!«, herrschte der Hauptmann ihrer Kompanie Reint Heurich und die anderen Soldaten an.
In ihrer Erschöpfung hatten sich einige Männer in den Matsch sinken lassen und wollten nicht aufstehen, doch die Unteroffiziere trieben sie mit Stockhieben und rüden Worten auf die Beine. Dabei tat sich der Wachtmeister ihrer Kompanie besonders hervor.
»Wollt ihr wohl, ihr Halunken? Wer bis drei nicht marschbereit ist, den erschieße ich eigenhändig!«
Und schon entriss er einem Soldaten das Gewehr und legte auf einen jungen Rekruten an, der nur wenige Jahre älter als Walther sein konnte und zitternd am Boden hockte.
»Wird’s bald?« Mit diesen Worten spannte der Wachtmeister den Hahn. Bevor er schießen konnte, packten zwei altgediente Soldaten den Burschen und zerrten ihn hoch.
»Keine Sorge! Um den kümmern wir uns schon«, sagte einer der beiden und versetzte dem Rekruten eine Ohrfeige.
»Das nächste Mal gehorchst du auf der Stelle, wenn unsere Unteroffiziere dir einen Befehl erteilen!«
»Jawohl!«, stammelte der junge Mann und versuchte, die schlammigen Hände an seiner noch dreckigeren Hose abzuwischen.
Reint Heurich schnaubte verächtlich. »Der Kerl ist keinen Schuss Pulver wert! Sobald der einen Franzosen sieht, fängt er an zu rennen.«
Walther empfand Mitleid mit dem Rekruten. Immerhin war dieser noch frischer im Regiment als er und hatte bis vor wenigen Wochen noch nie eine Muskete in der Hand gehalten. Dann aber schob er den Gedanken beiseite und sah sich nach Gisela um. Diese stand mit ihrer Mutter bei einigen Frauen, die unschlüssig schienen, ob sie mit dem Regiment aufbrechen oder warten sollten, wie sich die Schlacht entwickelte. Schließlich setzten auch sie sich in Bewegung und folgten den Soldaten in einigem Abstand.
Zu aller Überraschung führten die Offiziere sie auf den Wald zu. Einige Soldaten sahen sich um, als wollten sie die Gelegenheit nutzen und türmen. Doch die Offiziere und Unteroffiziere bewachten sie wie Hütehunde und brachten jeden mit Stockschlägen oder dem blanken Säbel dazu, diesen Vorsatz nach wenigen Schritten aufzugeben und sich wieder in die Marschkolonne einzureihen.
Der Schlachtenlärm wurde immer lauter, und diesmal war nicht der Wind daran schuld.
Reint Heurich starrte besorgt nach vorne. »Sieht aus, als kämen die Kerle auf uns zu! Wollen nicht hoffen, dass es zu viele sind. Die machen sonst Hackepeter aus uns.«
Stumm umklammerte Walther seine Trommelstöcke. Er hatte noch keinen Befehl erhalten zu trommeln, so als wollte der Oberst nicht, dass der Feind auf sie aufmerksam wurde. Dabei schienen ihm das Donnern der Kanonen und das Knattern der Musketensalven ohnehin so laut, dass es den Klang der Trommeln übertönen musste.
Endlich wurde Halt befohlen. Überall sanken Soldaten zu Boden, wurden aber von ihren Unteroffizieren sofort wieder auf die Beine getrieben.
Der Wachtmeister ihrer Kompanie baute sich breitbeinig vor ihnen auf. »Macht eure Musketen schussbereit! Jeder, dessen Muskete versagt, erhält zwanzig Rutenhiebe!«
Obwohl Heurich seine Waffe bereits gesäubert und geprüft hatte, tat er es noch einmal und lud sie sorgfältig. »Jetzt kann es nicht mehr lange dauern«, sagte er zu Walther, der seine Fußlappen auswrang, sie wieder um die Füße wickelte und in seine Stiefel schlüpfte.
»Wird es so enden wie bei Ligny?«, fragte der Junge bang.
Reint Heurich schüttelte den Kopf. »Gewiss nicht! Entweder wir gewinnen die Schlacht, oder die Franzosen schlagen uns so zusammen, dass keine zehn Leute pro Kompanie übrig bleiben.«
»Maul halten!« Fähnrich Diebold von Renitz war eben zum Regiment zurückgekehrt und zog Heurich im Vorbeireiten die Reitpeitsche über. Der kräftig gebaute Soldat nahm den Schlag hin, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber als der Sohn des Obersts vorbei war, schüttelte er sich und ballte die Faust.
»Dieser Hundsfott sollte mir nicht bei Nacht an einer abgelegenen Stelle begegnen, das sage ich dir. Aber das hast du nicht gehört! Verstanden?«
Ein warnender Blick traf Walther, der eifrig nickte. »Ich habe ganz bestimmt nichts gehört.«
»Das wird auch gut sein!« Heurich schnaubte und bleckte die Zähne. »Leider werden wir beide den Tag nicht mehr erleben, an dem so ein Adelsbürschchen uns nicht mehr wie einen Hund behandeln darf. Der Teufel soll sie alle holen! Die Franzosen haben anno zweiundneunzig richtig gehandelt, als sie dieses Gesindel einen Kopf kürzer gemacht haben.«
»Aber jetzt haben sie einen Kaiser und mehr Marschälle als wir Soldaten«, wandte Walther ein.
»Tja, offenbar wachsen zu rasch neue Köpfe nach, und die sind meist noch schlimmer.« Heurich verstummte, als Medard von Renitz auftauchte und sein Pferd vor den Marketenderinnen zügelte.
»Warum seid ihr nicht beim Tross?«, fragte der Oberst unwirsch.
Walburga Fürnagl hob in einer unbestimmten Geste die Arme. »Wenn wir wüssten, wo er sich befindet, wären wir schon dort. Doch seit vorgestern hat keine von uns den Tross gesehen.«
»Das ist unerfreulich.« Renitz’ Grimm galt weniger den Frauen als sich selbst, denn er hatte vor der letzten Schlacht seinem Tross befohlen, sich im Falle einer Niederlage nach Osten zurückzuziehen. Zu der Zeit hatte er nicht ahnen können, dass Blücher den Befehl ausgeben würde, nach Norden zu marschieren, um den Kontakt mit den englischen Verbündeten aufrechtzuerhalten. Jetzt waren seine Soldaten seit zwei Tagen ohne Verpflegung und sollten trotzdem auf dem Schlachtfeld ihren Mann stehen. Außerdem hatte er ein Dutzend Weiber am Hals, die nicht den Trosswagen, sondern den Soldaten gefolgt waren.
»Ihr bleibt in Deckung! Nicht, dass ihr die Männer beim Kämpfen behindert.« Mehr, sagte Graf Renitz sich, konnte er nicht für die Frauen tun. Mit einer heftigen Bewegung zog er sein Pferd herum und winkte seinen Sohn heran.
»Reite los und sieh zu, welche anderen Regimenter du findest. Es hat ja direkt den Anschein, als wären wir allein auf der Welt.«
Während der Fähnrich davonpreschte, spie Reint Heurich aus. »Würde mich freuen, wenn das feine Herrchen unterwegs auf ein paar französische Dragoner oder Ulanen treffen würde.«
Walther musterte ihn erstaunt. »Du wünschst einem anderen Menschen den Tod, nur weil er dich einmal geschlagen hat?«
»Ein Mal?«, antwortete Heurich mit einem bitteren Auflachen. »Das erste Mal hat er mich geschlagen, da war er kaum älter als du und gerade als Fähnrich zum Regiment gestoßen. Ich bin damals nicht schnell genug aufgestanden, als er vorbeikam. Beinahe jeder Soldat unseres Regiments hat mit dem jungen Renitz ein Hühnchen zu rupfen – bis auf die größten Arschkriecher halt, aber selbst die mögen ihn nicht.«
»Magst du überhaupt einen Offizier?«, fragte Walther.
»Ich mochte einen – unseren Hauptmann damals in Russland. Der hat sich für uns eingesetzt und ist oft genug vom Oberst deswegen zusammengestaucht worden. Leider ist er beim Übergang über die Beresina ertrunken. Schade um ihn! Er war ein Pfundskerl und hat uns trotz seiner adeligen Herkunft wie Menschen behandelt. Für den jungen Renitz und die meisten anderen Offiziere sind wir dressierte Affen und zu nichts anderem nütze, als in die Salven der Franzosen hineinzulaufen. Ich sage dir, wenn Fähnrich Renitz auf keine anderen Regimenter trifft, stehen wir allein einer halben Armee gegenüber. Was die mit uns machen, brauche ich dir nicht zu sagen.«
Walther hatte Reint Heurich noch nie so mutlos erlebt. Allerdings waren seine eigenen Erfahrungen im Krieg zu gering, um zu wissen, ob sein großer Freund die Lage richtig einschätzte. Er hatte vor zwei Tagen an seiner ersten Schlacht teilgenommen, und da war das eigene Regiment nicht bis ins Zentrum der Kämpfe vorgerückt, sondern hatte sich fast eine Meile entfernt mit Marschall Grouchys Bataillonen herumgeschlagen.
»Es wird schon gutgehen«, sagte er mit dem Optimismus der Jugend.
»Das wird es«, antwortete Heurich, ohne es zu glauben. Dafür war der Lärm der Schlachten zu laut, und er konnte bereits die Signalhörner der französischen Kavallerie hören.
3.
Eine Schlacht mochte schlimm sein, dachte Walther, doch noch schlimmer war das Warten darauf. Um nicht weiter an die Franzosen denken zu müssen, richtete er seine Gedanken auf Gisela, die zusammen mit ihrer Mutter und den anderen Frauen am Waldsaum kauerte. Welche Angst musste das arme Mädchen erleiden?
Giselas Vater Josef Fürnagl stand groß und scheinbar unerschütterlich bei der ersten Kompanie, die vom Oberst selbst in die Schlacht geführt werden würde. Während Fürnagls Weib und seine Tochter rabenschwarzes Haar hatten, war er blond. Auch trug er immer noch den blauen Uniformrock, die rote Weste und den Raupenhelm seines alten bayerischen Regiments anstelle des schlichten grauen Rocks der Renitzschen Musketiere, in dem Walther, Heurich und die meisten anderen Soldaten des Regiments steckten.
Vielleicht war das der Grund, warum Reint ihn nicht mochte, überlegte der Trommelbub. Theologische Spitzfindigkeiten lagen ihm noch fern, und im Grunde wusste er nicht mehr, als dass die Lutheraner, zu denen er selbst zählte, im Gegensatz zu den Katholiken keinen Papst hatten. Konfirmiert war er noch nicht, denn der Regimentsgeistliche kümmerte sich mehr um die Wein- und Schnapsvorräte des Regiments als um die Seelen seiner Schutzbefohlenen.
Selbst in dieser Stunde, in der er den Mut und den Kampfeswillen der Soldaten mit einer Ansprache hätte heben sollen, ratterte er nur ein paar salbungsvolle Worte herunter und wankte wieder nach hinten. Da es keinen Tross gab, gesellte er sich zu den Marketenderinnen und beschwerte sich lautstark, weil diese ihm nichts zu trinken geben konnten.
»Gleich geht’s los!« Reint Heurich strich über seine Muskete und versuchte zu grinsen. »Beten wir, dass vor uns nicht mehr Franzosen stehen, als wir selbst zählen. Ein paar weniger wären mir noch lieber.«
»Mir auch!«, rief ein anderer Soldat, während Walther seinen Freund erstaunt ansah.
»Woher weißt du, dass es gleich losgeht?«
»Nach dem jungen Renitz und den Leutnants ist auch Hauptmann Ramp zurückgekommen, und der hatte es sehr eilig. Das heißt, es gibt Befehle«, erklärte Heurich.
Da Walther zu den Frauen hinübergeschaut hatte, war ihm das Auftauchen der Offiziere entgangen. Aber er fragte nicht weiter danach, sondern interessierte sich für etwas anderes. »Wir hören doch die ganze Zeit, dass geschossen wird, sehen aber nichts von der Schlacht. Woher kommt das?«
»Das eigentliche Gefecht findet nicht weit vor uns statt, aber der Hügel dort vorne verhindert, dass wir auf das Schlachtfeld blicken können. Doch keine Sorge! Sobald wir den erklommen haben, bekommst du so viel Gemetzel mit, dass es für dein ganzes Leben reicht. Ich fürchte, eine härtere Schlacht wie diese gab es noch nie.«
Heurich hatte sich anhand des Kanonendonners und der Musketensalven ein Bild gemacht, und das gefiel ihm ganz und gar nicht. Trotzdem stellte er sich mit den anderen Soldaten der Kompanie zur Gefechtslinie auf, als die Unteroffiziere den Befehl dazu gaben. Vier Kompanien schlossen sich ihnen an, während die restlichen vier eine zweite Kampflinie fünf Schritte hinter ihnen bildeten.
Der Oberst sprengte auf seinem Hengst die Reihen entlang und schwang seinen Säbel. »Jetzt gilt es, Männer! Heute zahlen wir den Franzmännern heim, was sie uns und unserer Heimat angetan haben. Mit Gott für König und Vaterland!«
Die Soldaten blieben stumm. Die Veteranen unter ihnen hatten schon zu oft gejubelt und dann fürchterliche Hiebe einstecken müssen, und die Rekruten fürchteten sich so vor dem Kommenden, dass einige sich sogar in die Hosen gemacht hatten. Ein Zurück gab es jedoch nicht mehr.
»Trommler und Pfeifer zu mir!«, rief der Tambourmajor.
Walther lief zu ihm und richtete unterwegs seine Trommel, um sie sofort schlagen zu können.
»Achtung, im Gleichschritt marsch!« Die Unteroffiziere brüllten so laut, dass es nach Walthers Ansicht noch die Franzosen hören mussten. Dann erklang der Befehl, die Trommel zu rühren, und Walther schlug die ersten Takte.
Das Regiment Renitz rückte in langsamem, aber stetem Schritt vorwärts. Der Oberst führte es hoch zu Ross an. Auch der Hauptmann der Kompanie saß auf seinem Gaul, während die anderen Hauptleute abgestiegen waren und ihren Männern zu Fuß vorausgingen.
Auf halber Höhe des Hügels schickte Medard von Renitz seinen Sohn als Aufklärer vor. Der Fähnrich ritt nach oben, hielt dort sein Pferd an und starrte etliche Augenblicke über das Land. Dann wendete er den Gaul und winkte den Offizieren, die Truppen näher heranzubringen.
»Schneller, ihr Hunde!«, schrie der Feldwebel und hieb mit seinem Stock auf ein paar Soldaten ein, die einen Schritt hinter den anderen zurückgeblieben waren. Der Klang der Trommeln übertönte nun die Kampfgeräusche, und Walther konnte sogar die Flöten so laut vernehmen wie selten zuvor. Wie ein Rausch packte ihn die Hoffnung, das Ganze rasch hinter sich bringen zu können.
Kurz darauf hatten sie den Hügelkamm erreicht. Als Walther die unzähligen Leichen und Pferdekadaver sah, die starr und oft sonderbar verdreht auf dem blutgetränkten Boden lagen, verkrampfte sich alles in ihm vor Grauen, und er taumelte ein paar Schritte. Dann gelang es ihm, weiterzumarschieren.
Ein Stück weiter vorne feuerten Batterien auf ein Karree aus Soldaten in blauen Röcken, während zur Rechten preußische Regimenter im Sturmschritt vorrückten und die Franzosen vor sich hertrieben. Kavallerie und Infanterie hatten sich in blutigem Nahkampf verkeilt, und der Tod hielt immer noch reiche Ernte.
Für einige Augenblicke kämpfte Walther gegen die Vorstellung, am Abend ebenso starr und kalt dort vorne zu liegen. Dann aber holten ihn die Flüche, die die Soldaten um ihn herum ausstießen, in die Wirklichkeit zurück. Zuerst begriff er nicht, was los war. Dann aber entdeckte er die Franzosen, die sich anscheinend von den Engländern zurückzogen und dabei in ihre Richtung liefen. Es waren mehrere Bataillone, und ihnen standen nur die ausgedünnten Linien des Renitzschen Regiments gegenüber.
»Halt!«, befahlen die Unteroffiziere auf eine Handbewegung des Obersts.
Während Walther zu den Franzosen hinüberstarrte, fragte er sich, wo die Regimenter blieben, die vor und hinter ihnen marschiert waren. Dann fiel ihm ein, dass Gisela und die Frauen dem Feind schutzlos ausgeliefert sein würden, sobald dieser durchgebrochen war, und er wünschte sich tausend Arme und ebenso viele Musketen, um den Gegner aufzuhalten.
»Erstes Glied vortreten! Legt an! Gebt Feuer!«, befahlen die Unteroffiziere.
Eine in Walthers Ohren arg schwächliche Salve ertönte, und es fielen nur wenige der auf sie zurückenden Franzosen. Diese hatten mittlerweile erkannt, dass nur ein einzelnes, dezimiertes Regiment zwischen ihnen und dem rettenden Wald stand, und stürmten wild brüllend auf die Schlachtreihe der Renitzschen zu.
»Zweites Glied vortreten! Legt an! Gebt Feuer!«
Erneut klang eine Salve auf, aber diesmal schossen die Franzosen zurück.
Walther spürte, wie etwas an seinem linken Ohr zupfte, achtete aber nicht darauf, sondern starrte auf Hauptmann Ramp und etliche Dutzend Soldaten, die lautlos umfielen, als wären es Schachfiguren, die eben geschlagen worden waren.
»Standhalten!«, brüllte der Oberst, denn schon wollten die ersten Männer zurückweichen. Die Unteroffiziere hieben mit ihren Stöcken auf die Soldaten ein, um sie wieder auf ihre Posten zu treiben.
»Reihen schließen!« Das war Giselas Vater, der Wachtmeister. Auf seinen Befehl hin rückte die bereits ausgedünnte Linie zusammen, und ihre nächste Salve riss ein Loch in das Zentrum der heranmarschierenden Franzosen.
»Weiter so!« Oberst Renitz winkte dem zweiten Glied, aufzurücken und ebenfalls zu feuern.
Doch es war ein ungleicher Kampf. Die Franzosen waren in der Überzahl und wollten mit aller Kraft den schützenden Wald erreichen. Ihr Musketenfeuer hätte Graf Renitz’ Männer mit wenigen Salven hinwegfegen können, doch die meisten hatten ihr Pulver bei dem erbitterten Anrennen gegen die englischen Truppen verschossen. Dennoch rissen ihre Kugeln große Lücken in Walthers Regiment. Die Überlebenden rückten näher und näher zusammen. Nicht lange, da sah Walther Reint Heurich neben sich stehen. Dieser lud und feuerte, so schnell er konnte. Dabei fluchte er in einer so unflätigen Weise, dass dem Regimentspastor, der sich im Wald versteckt hatte, die Ohren klingen mussten.
Zu Walthers Verwunderung hielt ihr kleines, rasch dahinschmelzendes Häuflein immer noch stand. Nun waren die ersten Franzosen den hartnäckigen Widerstand leid und umgingen die Reste des Regiments. Ein Bataillon marschierte jedoch mit gefälltem Bajonett direkt auf sie zu. Noch immer krachten einzelne Schüsse. Walther sah, wie Reint Heurich eben den Ladestock aus dem Lauf nahm und wegstecken wollte. Da kippte der Soldat ohne einen Laut um und blieb regungslos vor ihm liegen. Gleichzeitig wieherte der Hengst des Obersts schmerzerfüllt auf und stürzte zu Boden. Das Tier wälzte sich im Todeskampf und begrub seinen Reiter unter sich.
Vor Entsetzen erstarrt, sah Walther einen französischen Grenadier mit gefälltem Bajonett vor Medard von Renitz auftauchen, der hilflos eingeklemmt unter dem Pferdekadaver lag.
Der Junge begriff, dass der feindliche Soldat den Oberst gleich aufspießen würde. Ohne nachzudenken, ließ er die Trommelstöcke fallen, packte Heurichs Muskete, richtete den Lauf auf den Franzosen und drückte ab.
Der Rückstoß der schweren Waffe warf ihn rücklings zu Boden. Dennoch konnte er das kleine, schwarze Loch auf der Brust des Mannes erkennen, das rasch von einem roten Ring gesäumt wurde. Dann brach der Franzose mit einem Gesichtsausdruck in sich zusammen, als könne er nicht glauben, was mit ihm geschah.
Es war der letzte Schuss, der aus einer Muskete des Regiments Renitz abgefeuert worden war, denn im nächsten Augenblick fegten preußische Dragoner heran und warfen die Franzosen zurück. Wer von den Renitzschen Soldaten noch am Leben war, sah untätig zu und versuchte zu begreifen, dass er noch lebte. Endlich rafften sich einige Soldaten auf und befreiten den Oberst aus seiner misslichen Lage.
Fähnrich Diebold von Renitz hatte das Gemetzel ebenfalls überstanden und stieg mit steifen Bewegungen von seinem Pferd. Statt zu seinem Vater zu eilen, der wie durch ein Wunder unverletzt geblieben war, sah er sich um. Nicht weit von ihm lag ein französischer Offizier. Rasch trat er zu dem Mann, stellte sein Pferd so, dass es ihn und den Toten verdeckte, und beugte sich über den Gefallenen. Kurz darauf hielt er dessen Geldbörse in der Hand. Sie war schwer, und als er sie schüttelte, vernahm er den verlockenden Klang gemünzten Goldes. Schnell steckte der Fähnrich die Börse ein und ging zu den anderen Offizieren hinüber, die sich um den Oberst versammelt hatten.
Verwundete schluchzten und schrien, doch es dauerte eine Weile, bis einige Soldaten ihre Erschöpfung überwanden und begannen, ihren Kameraden zu helfen. Ihnen blieb nicht viel Zeit, denn vom Osten her legten sich die Schatten der Dämmerung über das Land, und kurz darauf deckte die Nacht das Schlachtfeld mit ihrem schwarzen Leichentuch zu.
Walther meinte immer noch den Franzosen vor sich zu sehen, den er getötet hatte. Auch wenn dieser ein Feind gewesen war und seinen Oberst bedroht hatte, so hatte er doch einen Menschen umgebracht. Ihm grauste vor sich selbst, und er wünschte sich, einfach liegen bleiben zu können, bis er tot war. Doch ein Soldat stellte ihn kurzerhand auf die Beine, wies auf das Lager, das gerade errichtet wurde, und sagte etwas, was Walther nicht verstand.
Fackeln wurden entzündet und Holz fürs Lagerfeuer herbeigeschleppt. Ein paar Soldaten warfen sogar verbogene Musketen in die Flammen, bis ein Unteroffizier energisch einschritt: »Ihr Narren! Was meint ihr, was passiert, wenn eine der Waffen geladen ist? Wollt ihr jetzt noch krepieren, nachdem ihr die Schlacht überlebt habt?«
Die Worte brachten Walther dazu, auf die Wärme des Feuers zu verzichten und in die Dunkelheit zurückzuweichen. Da vernahm er auf einmal eine Stimme.
»Kleiner, bist du es?«
»Reint, du lebst? Was bin ich froh!« Walther eilte in die Richtung, in der er Heurich vermutete, und fand schließlich seinen Freund.
»Warte, ich hole eine Fackel«, sagte er und wollte zum Feuer laufen.
»Bleib! Ich habe nicht mehr viel Zeit.« Heurichs Stimme klang matt und fremd. Mit Tränen in den Augen beugte Walther sich über ihn.
»Sag so etwas nicht. Du wirst gesund werden, ganz gewiss.«
»Ich weiß, wann ich am Ende bin, Junge. Du kannst mir noch einen Gefallen tun. Frage einen der Offiziere, wie das Dorf heißt, das wir in der Ferne gesehen haben. Ich will wissen, an welchem Ort ich sterbe.«
Verstört stand Walther auf und sah in der Nähe den Oberst im Schein einer Fackel stehen. Rasch eilte er hin und tat etwas, was er bisher noch nie gewagt hatte: Er sprach Medard von Renitz an.
»Herr Oberst, mein Freund Reint Heurich würde gerne wissen, wie der Ort heißt, in dessen Nähe wir gekämpft haben.«
Renitz wechselte einen kurzen Blick mit einem Dragoneroffizier, der als Verbindungsmann beim Regiment geblieben war, und gab dann die Antwort:
»Waterloo!«
4.
Ein süßlicher Geruch lag über dem Schlachtfeld, vermischt mit kaltem Pulverdampf und dem Gestank nach Schweiß und Exkrementen. Das Lagerfeuer und die Fackeln schafften es kaum, den Dunst zu durchdringen, der vom Boden aufstieg und alles in gespenstisches Grau hüllte. Niemand hätte zu sagen vermocht, wie viele Männer und Pferde hier ihr Ende gefunden hatten. Den Überlebenden des Regiments Renitz gelang es ja nicht einmal, die eigenen Verluste zu erfassen. Noch immer schrien Verwundete um Hilfe.
Oberst Renitz hatte etliche Soldaten ausgesandt, ihre Kameraden zu suchen. Aber schon bald darauf stapfte einer der Abkommandierten auf ihn zu.
»Wir kommen fast immer zu spät zu unseren Kameraden, Herr Oberst. Die Plünderer aus dem englischen Lager und die Leute aus der Gegend sind einfach schneller. Sie bringen die Verwundeten um und fleddern die Leichen.«
Medard von Renitz starrte den Soldaten zunächst nur hilflos an. Auf dem Marsch von Ligny nach Waterloo hatte er kaum mehr zu essen bekommen als seine Männer, und die Sorge um sein Regiment hatte ihn ebenso erschöpft wie das zwar kurze, aber heftige Gefecht. Nun saß er hungrig und müde am Feuer und wünschte sich nur noch, schlafen zu können. Doch er durfte sich nicht der Verantwortung für seine Männer entziehen.
»Stellt Posten auf und schießt jeden nieder, der plündern will. Der Feldwebel der ersten Kompanie soll das übernehmen«, befahl er mit matter Stimme.
»Verzeihung, Herr Oberst, aber Wachtmeister Fürnagl wird vermisst«, meldete der Soldat.
»Dann trag es einem anderen Unteroffizier auf. Sag ihm, du kommst von mir!«
Für Medard von Renitz war die Sache damit erledigt. Aber der Soldat, der selbst zum Umfallen müde war, musste suchen, bis er einen Unteroffizier fand, der bereit war, die Feldwachen zu bestimmen und zu kontrollieren.
Der Feldwebel, der die Aufgabe übernahm, wusste genau, dass den entkräfteten Männern schon bald die Augen zufallen würden. Daher mahnte er die von ihm eingeteilten Wachen eindringlich: »Passt auf, dass euch der junge Renitz nicht beim Schlafen erwischt. Der lässt euch sofort am nächsten Baum aufhängen!«
Im nächsten Moment fluchte er, weil sich jemand in seiner Nähe mit einer Fackel in der Hand über einen Toten beugte. »Verdammte Weiber! Verschwindet, sonst lasse ich euch auspeitschen«, schrie er die beiden Gestalten an.
Da hielt die Größere die Fackel so, dass er sie erkennen konnte. Es handelte sich um Waltraud Fürnagl, deren Gesicht von Angst und Sorge verzerrt war. »Ich suche meinen Mann! Er ist nicht bei den anderen Soldaten!«
»Der Wachtmeister wird vermisst – wie so viele, die mit uns gezogen sind. Sobald es hell wird, können wir ihn suchen«, erklärte der Feldwebel.
Die Frau schüttelte den Kopf. »So lange will ich nicht warten! Vielleicht ist mein Mann verletzt und braucht Hilfe. Komm, Gisela, wir suchen weiter!« Damit ging sie, die Fackel in der einen und die Tochter an der anderen Hand zum nächsten Toten und leuchtete auch diesem ins Gesicht.
»Der ist es auch nicht«, murmelte sie und zerrte das Mädchen hinter sich her.
Gisela starrte in die Nacht hinein, die von Hunderten tanzenden Lichtpunkten erfüllt war. Jeder dieser Lichtpunkte war eine Fackel, in deren Schein jemand das Schlachtfeld absuchte.
»Schau mal, Mama, die suchen auch nach ihren Verwundeten«, sagte das Kind.
Die Wachtmeisterin sah sich um und stieß die Luft durch die Zähne. »Nein, mein Kind, das sind Plünderer. Möge die Heilige Jungfrau geben, dass wir deinen Vater finden, bevor es einer von denen tut.«
Mit diesen Worten ging Walburga Fürnagl weiter und leuchtete den nächsten Toten an. Zu ihrer Enttäuschung war es ein Franzose. Als sie an ihm vorbeigehen wollte, verlegte ihr ein totes Pferd den Weg, das die Beine grotesk verdreht in die Höhe streckte. Direkt daneben lag ein Mann, der durch ein Schrapnell förmlich in Stücke gerissen worden war. Sie schob ihre Tochter zurück, um ihr diesen Anblick zu ersparen.
»Komm weiter!«, befahl sie ihr und ging in die andere Richtung.
Gisela klopfte das Herz in der Kehle, und Tränen rannen ihr über die Wangen. Sie betete, wie sie noch nie zuvor gebetet hatte, dass sie ihren Vater lebend finden würden.
Nach einer Weile bemerkte Walburga, dass um sie herum nur noch tote und verwundete Soldaten in französischen und englischen Uniformen lagen. Ein junger Bursche, dessen Bein von mehreren Musketenkugeln durchlöchert war, streckte ihr verzweifelt die Hand entgegen.
»Help me! I’m thirsty!«
Obwohl weder die Frau noch das Mädchen Englisch verstanden, erahnten sie den Sinn der Worte. Gisela verspürte Mitleid und überlegte, was sie für den Verwundeten tun konnte. Walburga Fürnagl dachte jedoch nur an ihren Mann und schob das Kind vor sich her.
»Aber Mama, der Mann ist verletzt«, protestierte Gisela.
»Wir haben keine Zeit, uns um andere zu kümmern«, herrschte die Mutter sie an. Da hier keine Toten ihres Regiments mehr lagen, schlug sie eine andere Richtung ein, dabei fiel ihr auf, wie sich mehrere Fackeln näherten.
»Beeile dich, Kind!« Am liebsten hätte Walburga Fürnagl Gisela losgelassen, um schneller vorwärtszukommen, doch angesichts der Plünderer, die immer mehr zu werden schienen, wagte sie es nicht.
Endlich sah sie wieder einen Mann im grauen Rock der Renitzschen Musketiere vor sich liegen. Sie kannte ihn und hatte ihm schon so manche Flasche Wein und andere Dinge verkauft. Nun hatte der schwarze Schnitter ihn geholt.
»Heilige Muttergottes, bitte für uns arme Sünder«, murmelte sie und richtete ihre Fackel auf den nächsten Leichnam. Seinen Abzeichen nach hatte er zur ersten Kompanie gehört. Damit konnte ihr Mann nicht mehr weit sein.
»Ich glaube, gleich finden wir ihn«, sagte sie zu Gisela. Diese sah sich um und wies auf den Lichtschein einer Fackel, die ein Mann keine zehn Schritte von ihnen entfernt in der Linken hielt, während er mit der anderen Hand einen Toten abfingerte.
»Schau, Mama!«
Während Gisela nur auf den Plünderer hinweisen wollte, erkannte Walburga die bayrische Uniform und stieß einen Schrei aus. »Lässt du meinen Mann in Ruhe!«
Der Plünderer drehte sich zu ihr um und sagte etwas auf Englisch.
Nun ließ die Wachtmeisterin ihre Tochter los und eilte auf den Gefallenen zu. Im Schein ihrer Fackel sah sie ihren Mann so starr liegen, dass kein Zweifel mehr blieb. Wachtmeister Josef Fürnagl, der mehr als zwanzig Jahre alle Schlachten durchgestanden hatte, ohne sich mehr als eine Schramme zuzuziehen, war tot.
Walburgas haltloser Zorn richtete sich gegen den dürren Engländer, der sich von der Plünderung der Leiche ihres Mannes nicht weiter ablenken ließ.
»Lass ihn in Ruhe, sage ich dir!«
Der Ausdruck, mit dem er antwortete, hörte sich nicht gerade vornehm an, und er machte ungerührt weiter.
Gisela sah, wie ihre Mutter den Kerl am Ärmel packte und wegzerren wollte. Zuerst versetzte er ihr eine Ohrfeige, doch Walburga gab nicht nach. Bevor das Mädchen begriff, was geschah, hatte der Soldat ein Messer gezogen und zugestochen. Ein Schrei gellte durch die Nacht, in dem sich die Stimmen von Mutter und Tochter mischten, dann sank Walburga Fürnagl nieder und brach über dem Leichnam ihres Mannes zusammen. Der Engländer stieß ein Knurren aus und begann nun, auch sie zu durchsuchen. Gisela wollte ihn daran hindern, doch ihre Beine versagten ihr den Dienst, und sie sank zu Boden.
5.
Während Gisela und ihre Mutter nach Wachtmeister Fürnagl suchten, saß Walther neben Reint Heurich, hielt dessen schlaff gewordene Hand und ließ seinen Tränen freien Lauf. Der Soldat war von dem Tag an, an dem er als Trommelbub ins Regiment gesteckt worden war, sein Freund und Beschützer gewesen. Nun stand er wieder so allein da wie nach dem Tod der Mutter und wusste nicht, was ihm der nächste Tag bringen würde.
Der dienstälteste Feldwebel legte ihm die Hand auf die Schulter. »Komm mit, Junge! Der arme Kerl ist doch längst tot. Unser Oberst will dich sehen. Betrag dich aber manierlich und nimm deinen Tschako ab, wenn er mit dir spricht.«
Mit müden Bewegungen stand Walther auf und folgte dem Mann zu dem Lagerfeuer, um das sich die überlebenden Offiziere des Regiments und mehrere andere Kommandeure versammelt hatten. Einer von ihnen erklärte gerade, dass Feldmarschall Blücher beabsichtige, die Schlacht nach dem Ort Belle-Alliance zu nennen.
»Es war ein überwältigender Sieg für uns«, setzte er mit grimmiger Zufriedenheit hinzu. »Das müssen auch die Engländer einsehen. Wären wir nicht rechtzeitig erschienen, hätte Napoleon sie in Stücke gehauen und in der Pfeife geraucht.«
»Soviel ich gehört habe, will der Herzog von Wellington der Schlacht einen eigenen Namen geben, nämlich nach dem Dorf Waterloo«, wandte ein anderer Offizier ein.
»Pah, wollen kann er viel! Aber wir Preußen haben das erste Anrecht, den Namen zu bestimmen!« Der Sprecher wollte noch mehr sagen, doch da entdeckte Oberst Renitz Walther und winkte dem Jungen, näher zu treten.
»Komm her!«
Walther gehorchte und nahm den Tschako ab.
»Du bist doch der Sohn meines Försters Fichtner!«, fuhr der Oberst fort.
»Ja, das schon, aber dann war er Wachtmeister hier im Regiment«, antwortete Walther.
»Ein guter Mann! Hätte ihn gerne zum Offizier befördert. Ging aber nicht, da er nicht von Adel war. Schade, dass er in Russland gefallen ist.« Graf Renitz seufzte und nahm einen Schluck aus einem Becher, den ihm sein Bursche reichte.
Als Walther ihn trinken sah, meldeten sich sein Durst, sein Hunger und seine Erschöpfung mit einem Mal so stark, dass er taumelte.
Der Graf hielt ihn fest. »Es war etwas zu viel für einen Jungen wie dich, nicht wahr?« Er reichte ihm seinen Becher. »Trink! Das hast du dir verdient. Deine Mutter ist auch tot, habe ich gehört.«
Der abrupte Themenwechsel verwirrte Walther. Er trank und merkte dann erst, dass der Becher mit Wein gefüllt war.
Der Oberst sah ihn nachdenklich an. »Zuerst müssen wir diesen Krieg zu Ende bringen, und so lange bleibst du als Trommelbub in meinem Regiment. Danach werden wir sehen, was wir mit dir machen. Ich werde dich ausbilden lassen! Das bin ich dir schuldig. Ohne dich hätte der Franzose mich mit seinem Bajonett aufgespießt, und das werde ich dir nicht vergessen, Junge. Diebold, sorge dafür, dass er etwas zu essen bekommt!«
Der letzte Satz galt seinem Sohn, der Walther mit missmutiger Miene musterte.
Es passte Diebold von Renitz überhaupt nicht, dass sein Vater solche Umstände mit einem lumpigen Trommelbuben machte. Gleichzeitig ärgerte er sich, dass er nicht den rettenden Schuss abgegeben hatte, denn dann wäre er nun ein Held. So aber behandelte sein Vater ihn weiterhin wie einen Laufburschen.
Er gehorchte jedoch und befahl Walther mitzukommen. Nach wenigen Schritten schob er den Jungen an einen Feldwebel ab, der Walther schließlich zu einem Karren brachte, bei dem der Quartiermeister des Regiments gerade Käselaibe und Würste von zwei Soldaten zählen ließ und die Menge in sein Buch eintrug.
»Ein Geschenk der Franzosen«, meinte Walthers Begleiter und wandte sich an den eifrig schreibenden Mann. »Gib uns ein Stück Käse und eine Wurst. Es brauchen nicht die kleinsten zu sein.«
Der Quartiermeister legte die Feder beiseite und blickte auf. »Ich kann noch nichts ausgeben. Erst muss ich alles sorgfältig eintragen und bestimmen, wie es verteilt wird.«
»Es ist der Befehl unseres Obersts, Walther etwas zu essen zu geben. Der Junge hat ihm das Leben gerettet. War übrigens ein Mordsschuss, den du abgegeben hast, Kleiner. Hätte es nicht besser gekonnt.« Der Feldwebel klopfte Walther anerkennend auf die Schulter.
Der Quartiermeister lächelte und schob Walther einen kleinen Käse und eine halbe Wurst hin. »Eine halbe Portion für eine halbe Portion!«, sagte er dabei.
»Ist das nicht etwas wenig für einen hungrigen Jungen?«, fragte der Feldwebel knurrig. »Außerdem könntest du mir auch etwas Wurst und Käse zukommen lassen.«
Für einen Augenblick sah es so aus, als wolle der Quartiermeister ihm eine patzige Antwort geben. Dann aber reichte er dem Unteroffizier noch einmal so viel, wie er Walther gegeben hatte. »Ich will ja nicht so sein. Aber dafür habe ich etwas bei dir gut, verstanden?«
»Klar!« Der Feldwebel trat ein paar Schritte beiseite und begann gierig zu essen.
Auch Walther biss von dem Käse und von der Wurst ab. Beides schmeckte scharf, und er wünschte sich einen Schluck Wasser, um seinen Schlund zu kühlen. Doch es gab nichts zu trinken, und einen Bach zu suchen, wagte er nicht aus Angst, das Wasser könnte vom Blut rot gefärbt sein. Während er kaute und den Bissen dabei kaum einspeicheln konnte, hörte er auf einmal einen wütenden Schrei.
»Lässt du meinen Mann in Ruhe!«
Das war die Wachtmeisterin. Dann vernahm er Giselas Stimme, die in einem Entsetzensschrei endete.
Walther sprang auf, schnappte sich eine Fackel und rannte los. Das Käsestück, das er halb aufgegessen hatte, flog zu Boden, und es gelang ihm gerade noch, die angebissene Wurst in eine Tasche seines Uniformrocks zu stecken.
Mehrere Kameraden folgten ihm. Auch wenn Reint Heurich und einige andere Walburga Fürnagl und deren Mann wegen ihres katholischen Glaubens gemieden hatten, so gehörte die Familie doch zu ihrem Regiment.
Giselas Schrei schien noch lauter und gellender zu werden. Der Junge rannte trotz des aufgewühlten Bodens so schnell, wie er noch nie in seinem Leben gelaufen war, und erreichte als Erster das Mädchen. Eine Fackel steckte im Boden und erhellte eine gespenstische Szenerie. Ein Mann in einem roten Uniformrock mit pulvergeschwärztem Gesicht hatte sich über den toten Wachtmeister gebeugt und plünderte ihn aus. Daneben lag die Wachtmeisterin in ihrem Blut, während Gisela entsetzensstarr daneben kniete.
Als der Engländer Walthers Schritte hörte, fuhr er hoch. Zuerst packte er seinen Dolch, an dem noch das Blut der ermordeten Frau klebte, dann aber bemerkte er die Soldaten, die Walther folgten, und rannte los. Doch da war Walther schon heran und warf sich mit einem wütenden Ruf auf ihn. Der Dolch zuckte auf ihn zu, doch der Junge wich geschickt aus, packte den Arm des Mannes und biss ihn mit aller Kraft ins Handgelenk.
Mit einem Schmerzensruf ließ der Engländer den Dolch fallen, schlug aber gleichzeitig mit der anderen Hand zu. Walther musste einige derbe Hiebe einstecken, doch dann waren seine Kameraden da und rangen den Plünderer nieder.
Walther brauchte einen Augenblick, bis er sich von den Schlägen des Engländers erholt hatte. Dann kniete er neben der Wachtmeisterin nieder. »Sie ist tot«, sagte er fassungslos.
»Der da hat sie umgebracht!«, flüsterte Gisela mit ersterbender Stimme.
Da hob ihre Mutter mit einem Mal den Kopf und sah sie an. »Meine Kleine, der Vater ruft mich! Ich muss dich allein lassen.«
»Nein!« Das Mädchen wollte zu ihr laufen, doch einer der Soldaten fing sie auf und drückte sie Walther in die Arme.
»Kümmere dich um sie! Wir bringen die Frau zum Lager. Vielleicht kann der Regimentschirurg noch etwas für sie tun!«
Zwei Männer bastelten aus vier Musketen und zwei Uniformröcken eine Trage und legten die Wachtmeisterin darauf, während zwei weitere den Plünderer fesselten und mitschleppten.
Im Lager war man bereits auf den Zwischenfall aufmerksam geworden, und viele kamen neugierig herbei.
Der Oberst blickte düster auf die schwerverletzte Frau, während der Regimentschirurg sie untersuchte. Dieser winkte schon nach wenigen Augenblicken ab. »Da ist nichts mehr zu machen, Herr Oberst. Es ist ein Wunder, dass die Frau überhaupt noch lebt!«
»Es geschieht aus Gnade der Heiligen Jungfrau«, flüsterte die Verletzte. »Sie will, dass ich mein Kind noch einmal segnen kann. Gisela ist jetzt allein, und es gibt niemand, der sich um sie kümmern wird. Das bricht mir das Herz.«
»Ich werde es tun!« Die Worte kamen Walther über die Lippen, ehe er darüber nachgedacht hatte. Er sah einige altgediente Soldaten den Kopf schütteln und begriff selbst, dass dies nicht in seiner Macht stand.
Daher trat er zu Graf Renitz und nahm vor ihm Haltung an. »Herr Oberst, erlaubt mir zu sprechen.«
»Gewährt!«, antwortete der Graf.
»Ihr habt mir vorhin gesagt, Ihr werdet es mir nicht vergessen, dass ich heute den Franzosen erschossen habe, der Euch niederstechen wollte. Nun möchte ich Euch bitten, dass Ihr stattdessen Gisela helft. Ich komme schon irgendwie durch.«
Renitz war sichtlich überrascht, und unter den Soldaten erhob sich Gemurmel. Dann erklangen einige zustimmende Ausrufe, und der Wachtmeister seiner Kompanie klopfte Walther auf die Schulter. »Bist ein braver Junge! Wirst es noch weit bringen im Leben.«
»Deine Bitte ist edel, Walther Fichtner. Ich werde zusehen, was ich für das Mädchen tun kann«, erklärte der Oberst nach kurzem Nachdenken.
»Ich danke Euch, Herr Oberst.«
»Ich Euch auch«, flüsterte Giselas Mutter mit letzter Kraft. »Ich bitte Euch nur noch um eines: Zwingt mein Kind nicht, ihrem katholischen Glauben abzuschwören und lutherisch zu werden.«
Um Renitz’ Mund erschien ein abweisender Zug. Auf seinem Besitz gab es keinen einzigen Katholiken, und man musste schon bis in die nächste größere Stadt fahren, um einen papistischen Priester zu finden. Da er es jedoch nicht wagte, die Bitte einer Sterbenden abzuschlagen, nickte er.
»Es wird so geschehen, wie du es willst, Wachtmeisterin. Ich werde dafür Sorge tragen, dass deine Tochter nach den Lehren der katholischen Kirche erzogen wird.«
»Ich danke Euch!« Es waren die letzten Worte, welche Walburga Fürnagl über die Lippen kamen. Als ihre Tochter sich über sie beugte, blickte sie in das Gesicht einer Toten.
6.
Die Schlacht von Waterloo war geschlagen. Wie blutig sie gewesen war, wurde den Beteiligten erst im Lauf des nächsten Tages bewusst. Hatten Renitz’ Soldaten bisher geglaubt, den höchsten Blutzoll gezahlt zu haben, wurden sie bald eines Besseren belehrt. Kaum hatte der Morgennebel sich gelichtet, sahen sie das Land bedeckt von starren Gestalten in roten und blauen Uniformröcken. Dort, wo die Schlacht am härtesten getobt hatte, bei den Gehöften von La Haye Sainte und Hougoumont, lagen die Leichen zu Haufen übereinandergestapelt. Selbst die Plünderer, die in der Nacht die Toten wie die Verwundeten ausgeraubt hatten, waren nicht in der Lage gewesen, diese Leichenhügel abzutragen.
Für Walther war der Anblick ein Schock. Niemals hätte er sich vorstellen können, dass Krieg so schrecklich sein könnte. Doch hier hatten sich zwei Heere Stunden um Stunden ineinander verkrallt, bis die preußischen Regimenter im Rücken der Franzosen aufgetaucht waren und die Entscheidung herbeigeführt hatten.
Soldaten und Trossknechte machten sich daran, die Leichen einzusammeln und in Massengräbern zu bestatten. Auch die toten Pferde wurden beiseitegeschleppt. Bei vielen fehlten bereits große Stücke Fleisch, die den Weg zu den Kochfeuern einzelner Truppenteile gefunden hatten. Als Walther zum Regiment zurückkehrte, erhielt auch er ein Stück gebratenes Pferdefleisch und musste sich trotz seines Hungers zwingen, es zu essen.
Gisela kniete betend neben den Gräbern, in denen die Männer der ersten Kompanie den Wachtmeister Josef Fürnagl und seine Frau zur ewigen Ruhe gebettet hatten. Als Walther zu ihr trat und ihr etwas Fleisch reichen wollte, schüttelte sie den Kopf.
»Ich wollte, ich wäre tot und bei ihnen im Himmel!«
»So etwas darfst du nicht sagen. Das Leben geht weiter, auch wenn man allein auf der Welt ist und es einem schier das Herz abdrückt.«
»Entschuldige, ich vergaß! Du hast ja auch deine Eltern verloren!«
Mitleid färbte Giselas Stimme, und unwillkürlich ärgerte Walther sich drüber. »Meinen Vater habe ich kaum gekannt. Er war bereits Soldat, als ich zur Welt kam, und hat bis zu seinem Tod nur wenige Wochen zu Hause verbracht. Als ich hörte, er sei gefallen, war mir fast, als würde man über einen Fremden sprechen. Schlimm wurde es erst, als Mutter starb. Sie war alles, was ich hatte.«
»Da ging es mir besser, denn ich war immer mit meinen Eltern zusammen bei einem Heer. Es ist so entsetzlich, dass ich beide am gleichen Tag verlieren musste!« Wieder kamen Gisela die Tränen, und sie verwandelte sich in ein schluchzendes Bündel Elend.
Walther spürte, dass Worte ihr keinen Trost spenden konnten. Daher begnügte er sich damit, stumm neben ihr zu sitzen und ihr über den schwarzen Haarschopf zu streichen. Ähnlich wie sie hatte er sich nach dem Ableben seiner Mutter gefühlt, und nun lag ihm Reint Heurichs Tod auf der Seele.
Viel Zeit zu trauern blieb ihnen nicht, denn der neue Wachtmeister der ersten Kompanie kam heran. »Los, aufstehen! Der Oberst will euch sehen. Es geht um den Engländer, den wir gestern gefangen haben. Schätze, es gibt eine kleine Gerichtsverhandlung, und dann baumelt der Kerl an einem kräftigen Ast, wie es sich für seinesgleichen gehört.«
Walther stand auf und zog Gisela hoch. »Komm! Wir müssen dem Befehl des Herrn Oberst folgen.«
Das Mädchen nickte stumm und kam immer noch weinend mit ihm zu Renitz. Dort mussten sie ein wenig warten, da soeben mehrere Kuriere erschienen waren, um dem Oberst Informationen und Befehle zu überbringen.
»Die ersten preußischen Korps sind bereits abgerückt, um die fliehenden Franzosen zu verfolgen. Wir müssen verhindern, dass der Feind sich wieder sammelt und weiterhin Widerstand leisten kann. Noch einmal halten weder wir noch die Engländer eine Schlacht wie diese durch«, erklärte gerade einer der Offiziere.
»Wolle Gott, dass dieser Krieg endlich vorbei ist und wir in unsere Heimat zurückkehren können!« Graf Renitz atmete tief durch und schien von einer Zukunft zu träumen, in der nicht Tausende von Leichen und Pferdekadavern den Boden bedeckten, sondern sich das Korn sanft im Winde wiegte und auf grünen Wiesen gescheckte Kühe weideten. Rasch kehrte er in die Gegenwart zurück und nickte den Kurieren zu.
»Überbringt Seiner Exzellenz meine aufrichtigsten Glückwünsche zum Sieg und meldet ihm, dass ich mich mit meinem Regiment wie befohlen morgen früh in Marsch setzen werde. Ich hoffe, zur rechten Zeit in Paris einzutreffen.«
»Das hoffen wir alle. Damit Gott befohlen, Oberst Renitz!« Der Kurier salutierte, stieg auf sein Pferd und ritt weiter. Auch die anderen Kuriere machten sich auf den Weg, und so war Medard von Renitz endlich in der Lage, sich um Walther und Gisela zu kümmern.
»Ich hoffe, euch geht es gut. Hat man euch etwas zu essen gegeben?«
Gisela hatte bis jetzt nichts essen können, und auch Walther war der Appetit vergangen. Trotzdem nickten beide. »Ein bisschen Durst habe ich«, sagte das Mädchen, dem es ebenfalls vor dem Wasser in den Teichen und Bächen der Umgebung grauste.
»Dem kann abgeholfen werden!« Oberst Renitz befahl seinem Burschen, zwei Becher mit Wein zu bringen, und wartete, bis Gisela und Walther daraus getrunken hatten.
Dann winkte er seinen Sohn zu sich. »Bring diesen elenden Mörder her, damit er seine gerechte Strafe erhält.«
»Jawohl, Herr Oberst!« Diebold von Renitz kochte innerlich vor Wut, weil sein Vater ihn schon wieder wie einen Laufburschen behandelte. Missmutig stiefelte er zu dem gefesselten Engländer.
»Hebt ihn auf und bringt ihn zu meinem Vater, dem Oberst. Er will über ihn richten.«
»Das könnt ihr nicht!«, rief der Gefangene in schlechtem Deutsch.