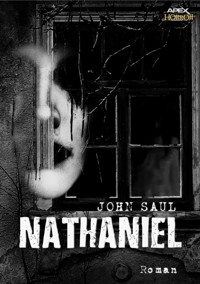7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Etwas Merkwürdiges geschieht mit den Kindern in Eastbury, Massachusetts: Plötzlich findet man scheinbar gesunde Babies tot in ihren Bettchen. Eine kalte Furcht ergreift die Herzen aller Eltern in der Stadt, denn etwas Unerklärliches holt sich ein Kind nach dem anderen...
Sally Montgomery hat gerade ihre kleine Tochter verloren. Lucy und Jim Corliss finden nach einem erbitterten Scheidungskrieg wieder zusammen, als ihr kleiner Sohn plötzlich verschwindet. Voller Panik wartet die ganze Bevölkerung von Eastbury auf das nächste Opfer, und jeder stellt sich die Frage nach dem Grund des Terrors.
Doch niemand ahnt etwas vom Gott-Projekt...
Der Roman Das Gott-Projekt von Bestseller-Autor John Saul erschien erstmals im Jahr 1982 und gilt als Klassiker der modernen Horror-Literatur.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine Neuausgabe des Romans in seiner Reihe APEX HORROR.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
John Saul
DAS GOTT-PROJEKT
Roman
Apex Horror, Band 52
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DAS GOTT PROJEKT
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Epilog - Drei Jahre später
Das Buch
Etwas Merkwürdiges geschieht mit den Kindern in Eastbury, Massachusetts: Plötzlich findet man scheinbar gesunde Babies tot in ihren Bettchen. Eine kalte Furcht ergreift die Herzen aller Eltern in der Stadt, denn etwas Unerklärliches holt sich ein Kind nach dem anderen...
Sally Montgomery hat gerade ihre kleine Tochter verloren. Lucy und Jim Corliss finden nach einem erbitterten Scheidungskrieg wieder zusammen, als ihr kleiner Sohn plötzlich verschwindet. Voller Panik wartet die ganze Bevölkerung von Eastbury auf das nächste Opfer, und jeder stellt sich die Frage nach dem Grund des Terrors.
Doch niemand ahnt etwas vom Gott-Projekt...
Der Roman Das Gott-Projekt von Bestseller-Autor John Saul erschien erstmals im Jahr 1982 und gilt als Klassiker der modernen Horror-Literatur.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine Neuausgabe des Romans in seiner Reihe APEX HORROR.
DAS GOTT PROJEKT
Erstes Kapitel
Sally Montgomery beugte sich herunter, um ihre kleine Tochter zu küssen. Sie zog die rosa gemusterte Bettdecke - ein wenig geschmackvolles Geschenk von Großmutter - gerade. Julie, sechs Monate alt, räkelte sich im Halbschlaf.
»Bist du mein kleiner Engel?« Sally streichelte dem Baby die Nase. Das Kind genoss die Liebkosung, etwas Speichel floss aus dem Mund und rann das winzige Kinn hinunter. Sally wischte die nasse Spur ab, gab Julie noch einen Kuss und verließ das Zimmer.
Der Raum sah ganz und gar nicht aus wie ein Kinderzimmer - das konnte man wirklich nicht sagen. Zwar hatte Sally ursprünglich beabsichtigt, das Zimmer auf jene Art und Weise einzurichten, wie es die anderen Familien für ihre Kinder taten. Vor acht Jahren jedoch, als Jason, ihr erstes Kind, zur Welt kam, hatte sie mit ihrem Mann Steve eine völlig neue Einrichtung geplant. Sie hatten sogar frische Tapeten ausgesucht und die Vorhänge ausgemessen. Aber dabei war es auch geblieben. Sally Montgomery war nicht die Frau, die alle paar Jahre die Wohnung auf den Kopf stellte. Sie hatte mit Steve nie darüber gesprochen, aber die Vorstellung, einen Raum für die besonderen Bedürfnisse eines kleinen Kindes herzurichten, schien ihr albern und kaum naheliegend. Wenn man das tat, dann musste man das Zimmer immer wieder umräumen, gemäß dem fortschreitenden Alter des Kindes.
Der Lichtkegel der Nachttischlampe ließ den Raum behaglich und gemütlich erscheinen. Sallys Blick blieb an den Vorhängen haften. Ich hatte Recht damit, nicht alles zu verändern, ging es ihr durch den Kopf. Die Vorhänge waren frisch gewaschen, erstrahlten in dem fröhlichen Hellblau, das sie so liebte. Die Wände waren weiß, so wie sie vor neun Jahren gewesen waren, als Steve das Haus kaufte. Eine Reihe von Drucken und Bildern hingen an der Wand, auch ein Mickey- Maus-Poster. Sie lächelte. Das Zimmer war in der Tat so, dass ein Baby sich darin wohl fühlen konnte. Sehr schön das Mobile, das über der Wiege hing. Der Verkäufer im Geschäft hatte die günstigen Auswirkungen ausgemalt, die solche abstrakten Gebilde auf die Vorstellungskraft des Babys haben würden, und Sally hatte sich das eher skeptisch angehört. Inzwischen mochte sie die seltsamen Formen ausgesprochen gern. Wenn die Kinder erst einmal groß waren, würde sie das Mobile und die Bilder abnehmen. Alles würde unter Jason und Julie aufgeteilt werden, die beiden konnten diese Dinge dann für ihre eigenen Kinder verwenden.
Wie praktisch veranlagt ich doch bin! Sie lächelte selbstzufrieden. Vielleicht sogar zu praktisch. Sally verließ den Raum, zog die Tür hinter sich zu und machte sich auf den Weg zum Erdgeschoss. Sie kam an ihrem Schlafzimmer vorbei. Steves leises Schnarchen war zu hören. Sie blieb stehen. Am liebsten wäre sie jetzt zu ihm ins Bett geschlüpft. Sie verwarf den Einfall.
Sie öffnete die Tür des Arbeitszimmers und trat an den Schreibtisch. Es war wohl das Beste, wenn sie die Arbeit, die sie sich vorgenommen hatte, noch heute Abend erledigen würde. Wenn Steve morgen früh ins Arbeitszimmer kam und den Tisch voller Papiere vorfand, würde es zweifellos Ärger geben. Sie schüttelte den Kopf. Schon vor Jahren hatte sie es aufgegeben, Steve von ihren Vorstellungen zu überzeugen. Er hielt beharrlich an der Idee fest, dass es sein Schreibtisch war. Überhaupt hatte Steve ziemlich eng umrissene Anschauungen über mein und dein. Die Küche zum Beispiel hatte er zu ihrer Küche erklärt, dieser Raum gehörte Sally. Bad und Toiletten gehörten ebenfalls Sally. Das Wohnzimmer war, seinem unerforschlichen Ratschluss zufolge, sein Wohnzimmer. Das Schlafzimmer wiederum, wo sie sich beide überaus gern aufhielten, gehörte keineswegs beiden, sondern nur ihr. Die Garage schließlich, die sowohl ihm als auch ihr ziemlich gleichgültig war, erklärte er zu seiner Garage.
Was den Hof anging, so war man mit der Zeit übereingekommen, dass er gemeinschaftliches Eigentum darstellte. Die Sache hatte allerdings einen Haken: Wenn es Sally nicht passte, dass im Hof ein Durcheinander herrschte, musste sie ihn aufräumen.
Sie war in der Küche angekommen und stellte den Wasserkessel auf den Herd. Alles in allem - so resümierte sie - funktionierte die Aufteilung der Verantwortungsbereiche in Haus und Hof erstaunlich gut. Wie überhaupt in ihrer Ehe alles in ein ruhiges Fahrwasser eingemündet war.
Sie starrte auf den Kessel. Ob es tatsächlich zutraf, dass das Wasser nicht zu kochen begann, während man den Kessel betrachtete?
Um sich die Zeit zu vertreiben, nahm sie den Block, der neben dem Telefon lag, und notierte ein paar Zahlen. Setzte man die Wassermenge und die eingespeiste Energie des Herdes zueinander in Beziehung, so errechnete sie, dann musste das Wasser innerhalb von acht Minuten - plus minus fünfzehn Sekunden - zu kochen beginnen. Ob sie den Topf nun ansah oder nicht.
Acht Minuten waren vergangen, als das Wasser zu brodeln begann. Sie nickte. Es hatte durchaus seine Vorteile, wenn man einen mathematisch geschulten Verstand besaß. Sie nahm den Kessel von der Flamme und goss das siedende Wasser über die Teebeutel in der Kanne. Dann trug sie die volle Kanne und eine Tasse ins Arbeitszimmer. Ein Stapel Computer-Programme lag auf dem Schreibtisch. Sallys Arbeit bestand in der Analyse der Ergebnisse, die jeweils am unteren Rand der Formulare ausgeworfen waren. Es gab einen Fehler: einen Zahlendreher in den Ausdrucken. Sally hatte den Auftrag erhalten, den Fehler ausfindig zu machen. Das Sekretariat der High School war der Auftraggeber. Dem Direktor der Schule war aufgefallen, dass gemäß der Daten kein einziger Schüler den notwendigen Notendurchschnitt für das Herbstsemester erreicht hatte. Sally hatte sich die Bemerkung erlaubt, dass die Daten möglicherweise ganz in Ordnung wären, dass es vielleicht an den miserablen schulischen Leistungen der Aspiranten lag, wenn der Notendurchschnitt derart schlecht ausfiel. Der Leiter des Aufnahme-Gremiums hatte die Bemerkung nicht besonders lustig gefunden. Er hatte Sally die Ausdrucke und das dazugehörige Computerprogramm in die Hand gedrückt und sie gebeten, das Problem bis Montag früh aus der Welt zu schaffen.
Sie zweifelte nicht einen Augenblick lang daran, dass sie den Fehler finden würde. Und die Chancen standen gut. Sally Montgomery war nicht nur eine äußerst attraktive Frau. Sie hatte auch Verstand. Vielleicht zu viel Verstand für eine Frau. Das jedenfalls war die Meinung ihrer Mutter. Sally stellte sich vor, was Mutter sagen würde, wenn sie sie in diesem Moment sähe. Es gehörte sich nicht, dass eine Frau am späten Abend noch am Schreibtisch saß und arbeitete. Eine Frau gehörte ins Bett, zu ihrem Mann.
Phyllis Paine hatte ihrer Tochter wieder und wieder den Kopf gewaschen, ohne je auf Verständnis zu stoßen. »Eine Frau gehört in die Küche und ins Schlafzimmer, sie hat sich um ihren Mann und um die Kinder zu kümmern. Es ist nicht richtig, dass du nebenher einen Beruf ausübst.«
»Warum habe ich dann das College besucht?«, hatte Sally erwidert.
»Jedenfalls nicht, um dich zu einem As in Mathematik zu mausern. Ich habe immer gehofft, du würdest deine musikalischen Talente vertiefen. Musik ist gut für den Charakter einer Frau. Besonders Klaviermusik. Zu meiner Zeit spielten die Frauen Klavier.«
So war das jahrelang hin und her gegangen. Irgendwann hatte Sally es aufgegeben, ihrer Mutter zu erklären, dass sich die Zeiten geändert hatten. Sie hatte mit Steve von Anfang an vereinbart, dass sie berufstätig sein würde. Ihre Karriere war genauso wichtig wie seine. Aber ihre Mutter wollte das nicht verstehen. Sie ließ keine Gelegenheit aus, Sally zu kritisieren. Der Platz einer Frau, darauf lief alles hinaus, war in ihren eigenen vier Wänden. »In New York ist das etwas anderes, Sally, aber in Eastbury, Massachusetts, geht man nicht arbeiten als verheiratete Frau, es schickt sich einfach nicht.«
Sally hatte den Fehler in den Ausdrucken gefunden. Sie begann die Korrektur. Vielleicht hat Mutter sogar Recht, dachte sie. Vielleicht hätten wir letztes Jahr, als Steve das Angebot bekam, wegziehen sollen. Ich hätte in Phoenix einen besseren Job gefunden als hier. Vor allem hätte mir niemand mehr Vorwürfe gemacht, dass ich berufstätig bin. Aber sie waren hier geblieben. Solange Sally die Arbeit am College Spaß machte und solange der Boom in der Elektro-Industrie anhielt, würden sie in Eastbury ausharren.
Bis vor wenigen Jahren noch war Eastbury einer jener Orte gewesen, an dem die älteren Bürger über die guten alten Zeiten sprachen, während die jungen Leute sich den Kopf darüber zerbrachen, wie sie am schnellsten aus dem Ort fortkommen könnten. Aber dann, vor fünf Jahren, war die große Wende eingeläutet worden: Die Stadtväter hatten sich massive Steuer-Erleichterungen für die Firmen einfallen lassen, die sich in Eastbury ansiedeln würden. Und dieser Trick hatte funktioniert. Neues Leben erfüllte die Fabrikhallen und Bürogebäude, die ungezählte Jahre lang leer gestanden hatten. Die Menschen hatten Arbeit. Keine Jobs, wo sie nur mit Sonderschichten zu einem menschenwürdigen Einkommen kamen. Jetzt gab es gleitende Arbeitszeit in Eastbury. Es gab Firmen, die ihren Beschäftigten Gewinnbeteiligungen und Prämien zahlten. Die Elektro-Industrie hatte der Gegend ein neues Gesicht gegeben.
Das Bild der Innenstadt indes hatte sich nicht besonders verändert. Eastbury war nach wie vor eine Kleinstadt. Die einzige Auflockerung in der Reihe der wohlbekannten Gebäude war ein neues Bürgerzentrum, über dessen Architektur recht geteilte Meinungen herrschten. Ein Zwischending zwischen Bankgebäude und Herrenhaus im Kolonialstil, fanden manche. Ähnlich unglücklich war das Problem des kleinen Parks in der Stadtmitte gelöst worden. Man hatte die Grünfläche von allen vier Seiten mit einem erdrückenden schmiedeeisernen Gitter eingezäunt. Andererseits, Eastbury war eine Stadt, in der Recht und Ordnung herrschten. Es gab keine Überfälle und kaum Einbrüche. Die Stadt war so klein, so überschaubar, dass Sally Montgomery und ihr Mann eigentlich jeden Einwohner von Angesicht zu Angesicht kannten. Und doch groß genug, um sich ein richtiges College leisten zu können. Eben jene Schule, an der Sally Arbeit gefunden hatte.
Sie goss sich nach; der Tee war kalt geworden. Sally warf einen Blick auf die Uhr. Eine Stunde war vergangen. Immerhin, die Arbeit war erledigt. Morgen früh würde Sally dem Leiter des Aufnahme-Gremiums die korrigierten Ausdrucke übergeben. Der Schulbetrieb am Eastbury College konnte weitergehen.
Sie begann den Schreibtisch aufzuräumen. Steve liebte peinliche Sauberkeit. Ganze Vormittage verbrachte er am Schreibtisch. Gewöhnlich begann der Tag für ihn mit einer wahren Lawine von Anrufen. Es gab Hunderte von Kontakten, die Steve in Geschäfte umzuwandeln wusste. Sally musste es ihm neidlos zugestehen, er war ein begnadeter Vermittler. Es war ihm gelungen, Eastbury in seine ganz private Goldmine zu verwandeln. So hatte es sich mit der Zeit ergeben, dass er den Vormittag daheim im Arbeitszimmer verbrachte und die Nachmittage in seinem Büro im Ortszentrum. Nicht selten begab er sich in den Athletic-Club, dessen Mitbegründer er war. Dort verkehrten die leitenden Angestellten der Computerfirmen. Steve hatte eine ebenso einfache wie wirksame Philosophie entwickelt. Er beschaffte den Leuten, was sie brauchten. Im Austausch erhielt er von den Leuten alles, was er brauchte. Und das war immer das gleiche: eine kleine Beteiligung an der neuen Handelsfirma, an dem Dienstleistungsunternehmen, an der Agentur, die mit Hilfe der von Steve geschaffenen Kontakte gegründet wurde. Fragte man ihn nach seinem Beruf, so gab Steve Montgomery Unternehmer an. Was eigentlich nich den Kern der Sache traf. Steve war Vermittler. Er brachte die Leute zusammen und kassierte. Recht ordentlich war das all die Jahre gelaufen. Nicht nur Steves Bankkonto, das ganze Städtchen hatte profitiert. Unter anderem war es Steves Fürsprache zu verdanken, dass die Firma Inter-Technics der Stadtverwaltung einen Zentralcomputer vermacht hatte, der die Informationen der einzelnen Dienststellen speichern und auswerten konnte. Wobei offenblieb, ob das überhaupt wichtig war. Sally war keineswegs überzeugt, dass Steve der Stadt damit einen Dienst erwiesen hatte.
Inzwischen hatte Steve an dem täglichen Einerlei, mit dem er ihren gemeinsamen Wohlstand begründete, die Lust verloren. Er hatte eine neue Idee entwickelt und mit Sally durchgesprochen. Der Plan sah vor, dass sie sich selbständig machte. Sally würde den Firmen und öffentlichen Auftraggebern ihre Beratung bei Computerprogrammen verkaufen. Steve würde dafür sorgen, dass sie genügend Aufträge bekam.
Wenn Mutter davon erfuhr, sie würde Steve als Zuhälter bezeichnen. Sally zuckte die Schultern, stand vom Schreibtisch auf und ging in die Küche. Sie hatte begonnen, den restlichen Tee in den Ausguss zu kippen, als sie sich eines anderen besann. Sie füllte den Rest in den Kessel, um ihn noch einmal anzuwärmen. Die Arbeit war erledigt, und sie fühlte sich keineswegs müde. Steve und die Kinder schliefen. Sie würde völlig ungestört sein, wenn sie über Steves Plan nachdachte.
In vielerlei Hinsicht war die Idee verlockend. Sie würden Hand in Hand arbeiten, konnten sich die Bälle zuspielen. Selbstverständlich bedeutete das auch, dass sie Tag und Nacht zusammen waren. Sally war nicht sicher, ob ihr das gefallen würde.
Es gab Bindungen, die an zu großer Nähe zerbrachen. Ihre Ehe jedoch lief hervorragend. Sally hatte nicht vor, das Ergebnis aufs Spiel zu setzen. Tief in ihrem Herzen spürte sie die Ahnung, dass ihre Ehe von Glück gesegnet war, weil sie beide sich immer dieses Mindestmaß an Eigenleben bewahrt hatten, das notwendig war. Beide hatten sie Interessen, die über die Ehe hinausgingen. Wenn Geschäft und Ehe ineinanderflossen, würde das verlorengehen. Und das war schlecht.
Sie goss sich heißen Tee nach. Erneut wog sie die Vor- und Nachteile ab, die sich bei der neuen Konstellation ergaben. Im Geiste sah sie Steve vor sich, wie er ihr die Vorzüge seines Plans schilderte. Er strahlte sie an. »Man weiß es eigentlich erst dann genau, wenn man's ausprobiert hat«, hörte sie ihn sagen. Sie saß mutterseelenallein in der Küche und lächelte. Ich werde es probieren, dachte sie. Wenn es nicht so lief, wie sie beide hofften, konnte man das Steuer immer noch herumreißen. Sie trank die Tasse aus, stellte sie in den Ausguss und ging die Treppe hinauf.
Vor der Tür des Schlafzimmers angekommen, blieb sie stehen und lauschte.
Nichts.
Im Haus herrschte völlige Ruhe. Sie trat ins Zimmer und begann sich auszukleiden. Nur langsam gewöhnten sich ihre Augen an das Dunkel. Der Schein der Straßenbeleuchtung zeichnete sich an der Decke als blasser Schimmer ab, die Laterne stand einen halben Häuserblock entfernt.
Sie schlüpfte ins Bett, kuschelte sich an ihren Mann. Er regte sich im Halbschlaf, schlang seine Arme um sie. Sally schmiegte ihren Kopf an seine Schulter. Ihre Fingerspitzen spielten an seiner behaarten Brust.
Sie spürte, wie der Druck seiner Arme fester wurde. Alles war gut. Sie schloss die Augen und wartete auf den Schlaf. Eigentlich ist alles so, wie ich es mir immer gewünscht habe, dachte sie. Dann fielen ihr die Worte ihrer Mutter ein. Sie verdrängte den Gedanken. Es war nicht wichtig, was Mutter sagte. Es war ihr Leben, nicht das Leben ihrer Mutter.
Sie fuhr aus ihren Gedanken hoch. Plötzlich war sie hellwach.
War da nicht eben ein Geräusch gewesen?
Vielleicht sollte ich Steve wecken.
Besser nicht. Es war schließlich nicht seine Schuld, dass sie nicht einschlafen konnte.
Sie entwand sich seiner Umarmung, stand auf und zog sich den leichten Morgenmantel über. Sie ging auf den Flur hinaus und lauschte.
Ob sie die Haustür verriegelt hatte?
Nach einigem Nachdenken fiel ihr ein, dass sie den Schlüssel herumgedreht hatte. Es war vor zwei oder drei Stunden gewesen, als Steve sich schlafenlegte. Sie hatte die Runde durch das Haus gemacht, hatte die Fenster geschlossen und die Riegel vorgeschoben. Eine Maßnahme, die sie aus Steves Vertreterzeit übernommen hatte. Damals hatte sie viele Nächte allein verbringen müssen, allein mit dem kleinen Jason.
Die Stille um sie war beängstigend. Sally hörte ihr Herz schlagen.
Warum?
Wenn es keine ungewohnten Geräusche gab, wovor hatte sie dann Angst?
Wie töricht ich doch bin, dachte sie. Sie ging zurück ins Schlafzimmer.
Das unheimliche Gefühl blieb.
Ich werde nach den Kindern sehen, beschloss sie.
Auf Zehenspitzen schlich sie den Flur entlang und öffnete die Tür zu Jasons Zimmer. Er lag in seinem Bett und schlief. Die Decke hatte sich um seine Beine gewickelt. Er hielt seinen Teddybär im Arm. Sally zog ihm die Decke hoch. Er räkelte sich im Schlaf, legte sich auf die andere Seite. In dem schwachen Schein, der durch das Fenster fiel, betrachtete sie sein Gesicht. Steves Ebenbild. Blondes Haar, kantiges Kinn, Grübchen. Steve sah sexy aus, fand Sally. Und sein Sohn würde einmal ein gutaussehender junger Mann werden. Ein Herzensbrecher. Sie beugte sich hinab und küsste ihn.
Er schlug die Augen auf. »Ach, du bist es, Mom.«
Sally gab sich Mühe, streng zu erscheinen. »Ich dachte, du schläfst schon.«
»Ist was, dass du noch mal kommst?«
»Ich komme, um dir gute Nacht zu sagen, wie es sich gehört.«
»Ich mag das nicht, du küsst mich so oft.«
Sally beugte sich über ihn, um ihm einen weiteren Kuss zu geben. »Sei froh, dass du eine Mutter hast, die dich küsst. Nicht jedes Kind kann das von sich sagen.« Sie richtete sich auf.
»Strample dich nicht wieder frei«, ermahnte sie ihn, schon fast an der Tür. »Du wirst dir noch eine Lungenentzündung holen.« Sie zog die Tür hinter sich zu. Natürlich würde er sich wieder freistrampeln. Und natürlich würde er sich keine Lungenentzündung holen. Sie musste lächeln. Wenn Julie genauso gesund heranwuchs wie Jason, dann konnte sie von Glück sagen. Ich habe ein unheimliches Glück, dachte sie. Die Kinder sind eigentlich noch nie richtig krank gewesen.
Sie öffnete die Tür zu Julies Zimmer.
Im gleichen Augenblick war die Angst wieder da.
Sie trat vor das Bettchen. Wie verschieden die beiden Kinder doch waren. Das Baby hatte - wie Sally - schwarze Haare. Die Augen waren dunkel, der Körper, selbst für ein Kind dieses Alters, zierlich. Wie eine Puppe, dachte Sally. Das Gesicht sah bleich aus, fast weiß. Den Bruchteil einer Sekunde lang erinnerte sie der Anblick an eine Kinder-Mumie. Aber es musste wohl alles in Ordnung sein. Die Decke lag noch so um die Schultern der Kleinen, wie sie es verlassen hatte.
Sally wurde nachdenklich.
Es war ungewöhnlich, dass Julie länger als fünf Minuten stille lag. Wie es schien, hatte sich das Kind seit einer Stunde nicht bewegt.
Sie tastete nach Julies Stirn.
Die Stirn fühlte sich so kalt an, wie sie aussah.
Als Sally Montgomery ihre kleine Tochter aufnahm, brach eine Welt für sie zusammen.
Es konnte ganz einfach nicht wahr sein.
Alles war in bester Ordnung.
Das Kind fror, das war alles. Nur die Kälte. Sie müsste die Kleine einfach nur in ihre Arme zu nehmen und zu wärmen, dann war alles wieder gut.
Sally Montgomerys Schmerz brach sich Bahn in einem furchtbaren Schrei, der die Stille der Nacht zerschnitt wie ein Messer.
Steve Montgomery kam ins Zimmer gestürzt. »Sally! Mein Gott, Sally! Was ist denn los?« Mit vorsichtigen Schritten kam er auf sie zu. Sie stand von der Tür abgewandt, starrte hinaus auf die nächtliche Straße und wiegte das Baby in ihren Armen. Er versuchte ihr das Kleine aus den Armen zu nehmen, aber Sally gab den kalten Körper nicht frei. Ihre Blicke trafen sich.
»Ruf sofort das Krankenhaus an!«, flüsterte sie. In ihren Augen stand Verzweiflung. »Julie ist krank, Steve. Sie ist sehr krank.«
Er berührte die Stirn des Babys und hatte das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Nein! Sie darf nicht tot sein! Er rannte zur Tür und blieb vor Jason stehen, der auf der Schwelle stand. Jason sah neugierig aus.
»Was ist?« Er sah seinem Vater in die Augen. Schließlich legte er den Kopf zur Seite und musterte seine Mutter. »Ist Julie was passiert?«
»Sie ist... krank«, brachte Steve stockend hervor. Er sagte es, als könnte er damit ihren Tod ungeschehen machen. »Julie ist krank, wir müssen den Arzt rufen. Komm!« Er zog Jason hinter sich her, ging ins Nebenzimmer und wählte die Nummer des Krankenhauses. Es klingelte - zweimal, dreimal. Steve zog seinen Sohn an sich. Der machte sich von ihm frei.
»Ist sie tot?«, fragte er. »Ist Julie tot?«
Steve nickte. Schließlich war die Vermittlung des Krankenhauses am Apparat. Während er den Notarztwagen anforderte, hielt er seinen Blick auf den Jungen gerichtet. Jason verzog keine Miene. Nach einer Weile machte er auf dem Absatz kehrt und ließ seinen Vater allein im Schlafzimmer zurück.
Zweites Kapitel
Das Eastbury Community Hospital war kein Gemeinde-Krankenhaus, sondern eine Privatklinik. Es war Dr. Arthur Wiseman gewesen, der die Klinik vor dreißig Jahren gegründet hatte. Inzwischen war die Einwohnerzahl des Ortes gewachsen. Es gab mehr Arbeit. Dr. Wiseman hatte sich sechs Ärzte als Teilhaber genommen. Ein neues Gebäude war errichtet worden. Die Teilhaber waren Ärzte, die neben dem Dienst im Krankenhaus ihre eigene Praxis im Ort betrieben. Das Krankenhaus verfügte über eine Intensivstation und über einen nach modernsten Maßstäben ausgestatteten Operationssaal. Mit der Zeit war das Eastbury Community Hospital zu einer weithin anerkannten Institution geworden. Wer krank wurde, fühlte sich hier gut aufgehoben. Dem einweisenden Arzt standen im Bedarfsfall nicht weniger als sechs Kollegen der verschiedenen Fachrichtungen zur Seite. Doch das änderte nichts daran, dass es sich um ein kleines Krankenhaus mit beschränkten Möglichkeiten handelte.
Dr. Mark Malone stand im OP. Er war zweiundvierzig. Noch immer nannte man ihn den jungen Dr. Malone. Er musste lächeln, wenn er daran dachte. Er betrachtete das Kind, das auf dem OP-Tisch lag. Die Zehnjährige war mit einer akuten Blinddarmentzündung eingeliefert worden. Die Operation war beendet. Er gab der OP-Schwester ein Zeichen, dann schnitt er ein Stückchen von dem herausoperierten Wurmfortsatz ab. Die Schwester fing das Präparat in einer kleinen Schale auf.
»Die üblichen Tests«, ordnete er an. Er warf dem Anästhesisten einen fragenden Blick zu. Der nickte. Alles in Ordnung. Dr. Malone verließ den OP, streifte die Handschuhe ab und wusch sich die Hände. Sein Blick war auf die Wanduhr gerichtet. Wie kam es wohl, dass so viele Blinddarmentzündungen ausgerechnet in den frühen Morgenstunden in ihr kritisches Stadium traten? Noch ehe er dem Gedanken weiter nachhängen konnte, ertönte sein Name im Lautsprecher.
»Dr. Malone, bitte. Dr. Malone.«
Er trocknete sich die Hände ab und griff nach dem Telefon. »Hier Dr. Malone.«
»Kommen Sie bitte sofort zur Nachtaufnahme.«
»Verflucht!« Dr. Malone versuchte sich an den Namen des Kollegen zu erinnern, der in dieser Nacht für den Dienst auf der Intensivstation eingeteilt war.
Das Mädchen in der Vermittlung kam seiner Frage zuvor. »Ich rufe Sie, weil es einer Ihrer Patienten ist, Herr Dr. Malone.«
Er beendete das kurze Gespräch mit einem undefinierbaren Grunzen. Dann zog er sich den grünen OP-Kittel aus, streifte sich einen weißen Kittel über und machte sich auf den Weg zur Nachtaufnahme. Er glaubte zu wissen, was ihn dort erwartete.
Der diensthabende Arzt hatte den Patienten behandelt. Der Patient war verstorben. Da es sich um einen von Dr. Malones Patienten handelte, fiel ihm die undankbare Aufgabe zu, die Angehörigen zu benachrichtigen. Er seufzte. Den Menschen zu sagen, dass alle Bemühungen umsonst gewesen waren, war eigentlich das Schlimmste am Arztberuf.
Vor der Nachtaufnahme traf er auf die diensthabende Schwester. Sie war so bleich wie die Wand. »Was ist denn passiert?«, erkundigte er sich.
»Ein totes Baby ist eingeliefert worden.« Ihre Stimme zitterte. Sie deutete auf die Tür. »Die Mutter ist bei dem Kind.«
»Wer?«
»Es ist die kleine Julie Montgomery. Sally will das Kind nicht hergeben. Sie sagt, das Baby hat sich nur erkältet. Sie will es wärmen, verstehen Sie...« Sie schlug den Blick nieder. »Ich... ich habe Dr. Wiseman angerufen.«
Dr. Malone nickte. Recht so. Die kleine Julie, sie war bei ihm in Behandlung gewesen. Aber die Mutter des Kindes war Patientin von Dr. Wiseman. »Und hat er gesagt, er kommt?«
»Er müsste jeden Augenblick hier sein.« Sie hatte den Satz kaum beendet, als Dr. Malone die vertraute Gestalt seines Kollegen vom Parkplatz her auf das gläserne Portal zugehen sah.
Sally Montgomery saß auf einem Stuhl. Sie hielt Julie an sich gepresst. Als Dr. Wiseman zu ihr trat, sah sie auf. Ihre Augen waren weit aufgerissen, der Blick merkwürdig leer.
Schock, dachte Dr. Wiseman. Sie steht unter Schock. Er nickte ihr zu und versuchte ihr die Leiche des Babys aus dem Arm zu nehmen. Sally machte eine Seitwärtsbewegung.
»Sie friert, Herr Doktor«, flüsterte sie. »Sie friert ganz fürchterlich. Ich muss sie wärmen.«
»Ich weiß, dass sie friert«, sagte er gütig. »Deshalb sind Sie ja mit dem Baby zu uns gekommen. Möchten Sie denn nicht, dass wir uns um die Kleine kümmern?«
Sie starrte ihn eine Weile an. Schließlich nickte sie. »Doch. Sie können das Kind wärmen, Dr. Wiseman. Sie ist nicht krank, wirklich nicht. Sie ist nur so kalt...« Ihre Stimme erstarb. Sie reichte ihm das Baby und brach in Tränen aus. Dr. Wiseman legte die Kleine Dr. Malone in die Arme.
»Versuchen müssen wir's wohl«, sagte er leise.
Sally blieb in der Obhut Dr. Wisemans zurück. Dr. Malone war, den Leichnam des Kindes auf den Armen, in die Ambulanz geeilt. Er legte die Kleine auf den Behandlungstisch. Er wusste, dass es keine Chance mehr gab, das Kind wiederzubeleben. Trotzdem versuchte er es. Er blickte auf, als sich ein Schatten an der Wand abzeichnete. Dr. Wiseman stand hinter ihm.
»Nichts zu machen, wie?«
Dr. Malone nickte. »Wir können dem Kind nicht mehr helfen«, sagte er. »Die Kleine ist schon mindestens eine Stunde tot.«
Dr. Wiseman seufzte. »Vermutliche Todesursache?«
»Ich bin mir nicht sicher. Sieht ganz so aus wie ein Fall von plötzlichem Kindstod.«
Dr. Wiseman schloss die Augen. Er wischte sich das Haar aus der Stirn. Warum?, dachte er. Warum sterben uns die Kinder weg? Warum?
»Ist der Vater des Kindes im Warteraum?«, hörte er Dr. Malone fragen.
»Er ist gerade beim Telefonieren, glaube ich. Er sagt, er will seine Schwiegermutter bitten, dass sie der Tochter zur Seite steht. Ich habe Sally Montgomery etwas Valium injizieren lassen.«
»Gut. Möchten Sie, dass ich mit Steve spreche?«
Dr. Wisemans Blick war auf den kleinen weißen Leichnam geheftet. »Das übernehme ich«, sagte er nach kurzem Nachdenken. »Ich kenne Steve recht gut. Fast so gut wie Sally.« Er hielt inne. »Werden Sie eine Autopsie durchführen lassen?«
»Das werde ich«, gab Dr. Malone zur Antwort. »Ich fürchte allerdings, dass uns das keinerlei Aufschluss bringen wird. Julie Montgomery war eines der gesündesten Babys, das mir in meiner Zeit als Arzt untergekommen ist. Ich habe sie erst vor zwei Tagen zur Vorsorge auf dem Tisch liegen gehabt. Ohne Befund. Das Kind war kerngesund. Verdammte Scheiße!«
Dr. Malone sah in das bleiche Antlitz der Kleinen. Julie schien zu schlafen. Keine Spur von Gewaltanwendung. Kein Anzeichen einer Krankheit. Nur diese geisterhafte Blässe.
Der Tod.
»Ich bring' sie runter in die Leichenhalle«, sagte Dr. Malone.
Er wandte sich ab. Dr. Wiseman sah ihm nach, bis er um die Ecke verschwunden war. Dann kehrte, er ins Wartezimmer zurück, wo er Steve Montgomery neben seiner Frau sitzend antraf.
Dr. Wiseman schüttelte traurig den Kopf. Er ergriff Steve am Arm. »Es ist alles umsonst gewesen«, sagte er. »Wir haben nichts mehr für die Kleine tun können. Rein gar nichts!«
»Aber an was ist sie denn gestorben?« brachte Steve hervor. »Das Kind war doch völlig gesund.«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Dr. Wiseman. »Wir müssen die Autopsie abwarten. Ich habe allerdings nur wenig Hoffnung, dass wir irgendetwas finden.«
»Was sagen Sie da?« Sallys, Gesicht war schmerzverzerrt. Sie schien den Schock überwunden zu haben. Was sich jetzt in den Gedanken dieser Frau abspielte, war schlimmer als jene Lähmung der Gefühle, die vorher zu beobachten gewesen war. Sie wird darüber hinwegkommen, dachte er. Es wird nicht leicht für sie sein, aber sie wird darüber hinwegkommen.
»Es wird am besten sein, wenn Sie jetzt beide nach Hause fahren«, sagte er, mit einer Geste zu Steve Montgomery. »Ich schlage vor, dass wir das weitere dann morgen früh in meiner Praxis besprechen. In Ordnung?«
Sally war aufgestanden. Sie hielt den Arm ihres Mannes umklammert. »Was ist denn passiert?«, fragte sie. »Ein Kind stirbt doch nicht einfach so, oder?«
Dr. Wiseman betrachtete sie aus den Augenwinkeln. Bei einer anderen Frau hätte er bis morgen gewartet. Aber diese Patientin kannte er seit Jahren. Sie war hart im Nehmen. Außerdem hatte ihr die Schwester eine Valium-Spritze gegeben. Sie würde wohl kaum noch Schwierigkeiten machen heute Nacht.
»Manchmal doch«, sagte er und lauschte dem Klang seiner Stimme nach. »Manchmal sterben Kinder einfach so. Wir nennen das SIDS. Plötzlicher Kindstod. Dr. Malone vermutet, dass sie daran gestorben ist.«
»Oh, mein Gott!«, entfuhr es Steve Montgomery. In seiner Vorstellung entstand Julies kleines Gesicht, ihre munter blitzenden Äuglein, ihre winzigen Fingerchen, die sich um seinen Daumen legten, ihr Lachen, wenn er sie am Hals kitzelte.
Vorbei.
Die Tränen rannen ihm über die Wangen. Er ließ seinem Schmerz freien Lauf.
Die Dämmerung war heraufgezogen. Morgennebel hüllte Eastbury ein. Steve Montgomery erhob sich aus seinem Sessel und trat ans Fenster. Sie hatten den Rest der Nacht im Wohnzimmer verbracht. Weder Sally noch er hatten schlafen können nach dem, was passiert war. In den Schatten der Nacht verbargen sich Gedanken, die sie in Furcht versetzten. Aber jetzt waren die Schatten vom Schein des nahenden Tages verdrängt worden. Steve ging zum Lichtschalter und knipste die Lampen aus.
»Nicht«, flüsterte Sally, »bitte nicht.«
Er verstand. Er knipste das Licht wieder an, dann setzte er sich zu ihr. Schweigend hielten sie sich umschlungen. Plötzlich waren Schritte auf der Treppe zu hören. Die Tür ging auf. Sallys Mutter betrat den Raum. Als sie ihre Tochter auf dem Sofa erblickte, lief sie auf sie zu und zog sie in die Arme.
»Mein armes Baby«, sagte sie. »Mein liebes armes Baby! Sag mir bloß, wie ist das passiert?«
Es war, als hätten ihre Worte den Riegel von der Schleuse fortgestoßen, hinter der sich Sallys Tränen stauten. Schluchzend lehnte sie sich an ihre Mutter. Phyllis Paine umfing sie tröstend. Schließlich hob sie den Blick.
»Woran ist das Kind gestorben, Steve?« Sie sprach über Sallys Schulter hinweg.
Ich muss jetzt stark sein, dachte Steve. Das schulde ich Sally. Ich muss stark sein. Ich muss die Fragen der Freunde beantworten. Ich muss ihrer Mutter Rede und Antwort stehen. Ich muss mich um Sally kümmern. Um sie - und um meinen Sohn. Dann schoss ein furchtbarer Gedanke durch seinen Kopf. Ich habe die Kraft nicht. Ich werde an dieser Prüfung zerbrechen. Oh, Gott, warum hast du Julie von uns genommen? Sie war doch nur ein Baby!
Wie gern hätte er geweint, hätte seinen Kopf am Busen seiner Frau geborgen. Er wusste, das war nicht möglich. Nicht jetzt. Vielleicht würde es nie möglich sein. Er sah seiner Schwiegermutter in die Augen.
»Wenn du meinst, das Kind hat einen Unfall gehabt, so war es das nicht«, sagte er. Er zwang sich zur Ruhe. »Sie ist gestorben, einfach so. Die Ärzte nennen es den SIDS-Faktor. Plötzlicher Kindstod.«
Phyllis Paine kniff die Augen zusammen. »Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe«, sagte sie. »Das heißt doch im Klartext, die Ärzte wissen nicht, an welcher Krankheit das Kind gestorben ist. Ich möchte wissen, was dahintersteckt.«
Sally hatte sich von ihrer Mutter losgemacht. »Wie meinst du das?« Ihre Frage kam kühl und schneidend.
Phyllis dachte nach, suchte nach den richtigen Worten. Jawohl, es gab jemanden, der am Tod des Kindes die Schuld trug, aber sie würde zu diesem Zeitpunkt keine Beschuldigung aussprechen. Dazu war es noch zu früh. Wenn Sally über den Berg war, würde sie mit ihr unter vier Äugen reden. Zunächst einmal musste sie ihrer Tochter beistehen. So wie ihre Tochter der kleinen Julie hätte beistehen müssen.
»Ich sage nur, dass jeder Tod eine Ursache hat, Sally. Bei den Ärzten vertuscht einer die Fehler des anderen. Kinder sterben nicht einfach so. Wenn die Ärzte zu faul sind, den wahren Grund herauszufinden, lassen sie sich einen geheimnisvollen Namen einfallen. SIDS!« Ihr Blick wanderte zwischen der Tochter und dem Schwiegersohn hin und her. Schließlich legte sie Sally den Arm um die Schulter. Als sie weitersprach, schwang Güte in ihrer Stimme mit. »Ich werde ein paar Tage bei euch bleiben. Ich kümmere mich um Jason und um die Arbeit im Haus. Ihr beide habt jetzt genug um den Kopf.«
»Danke, Phyl«, sagte Steve. »Ich danke dir von Herzen.«
Phyllis Paine zuckte die Schultern. »Wozu wären Mütter denn da, wenn sie sich nicht um ihre Kinder kümmerten.« Ihr Blick blieb auf Sally haften. Sie sahen ihr nach, wie sie zur Treppe ging, die zu den Schlafzimmern hinaufführte.
Wenig später war Jasons Stimme zu hören. Er bestürmte seine Großmutter mit Fragen. Sally hielt den Blick gesenkt. Einige Herzschläge lang saßen sie still nebeneinander. Dann brach sie das Schweigen.
»Sie glaubt, ich bin schuld an Julies Tod«, sagte sie schleppend. »Sie glaubt, ich habe nicht gut genug aufgepasst.«
Wie hoffnungslos, wie verloren ihre Stimme klang! Steve tastete nach ihrer Hand, versuchte sie zu trösten. »Das glaubt sie auf gar keinen Fall«, widersprach er ihr. »Aber du kennst doch Phyllis. Sie spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Das ist einfach ihre Art.«
Sally nickte. Ich kenne meine Mutter, dachte sie. Aber kennt meine Mutter mich? Sie fuhr aus dem Grübeln hoch, als Jason die Treppe heruntergepoltert kam. Er blieb mitten im Zimmer stehen. Er war noch im Schlafanzug.
»Was ist mit Julie passiert?«, fragte er.
Steve biss sich auf die Lippen. Was konnte er ihm antworten? Wie konnte er einem Achtjährigen den Tod erklären, wenn nicht einmal die Erwachsenen den Tod verstanden? »Julie ist tot«, sagte er. »Wir wissen nicht, woran sie gestorben ist. Sie ist einfach von uns genommen worden.«
Jason schwieg. Er schien nachzudenken. »Muss ich heute in die Schule gehen?«, fragte er.
Was als unschuldige Frage gemeint war, klang in Sallys Ohren wie eine gezielte Gefühllosigkeit. Sie brach in Tränen aus. »Natürlich musst du heute in die Schule gehen«, schrie sie. »Glaubst du, ich kann mich an einem solchen Tag um dich kümmern? Glaubst du eigentlich, ich bin aus Eisen? Glaubst du...« Sie brach auf dem Sofa zusammen. Ihr schlanker Körper wurde von Schluchzen geschüttelt.
Ihre Mutter kam die Treppe heruntergeeilt, Jason stand da, wusste nicht, was er sagen sollte.
Phyllis Paine zog den Jungen an sich. »Ist schon gut, mein Kleiner«, sagte sie. »Natürlich brauchst du heute nicht zur Schule zu gehen. Geh' rauf und zieh dich an. Ich mach dir inzwischen ein Frühstück, okay?« Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange, dann gab sie ihn frei.
»Einverstanden, Grandma«, sagte Jason leise. Er warf seinen Eltern einen neugierigen Blick zu, dann lief er die Stufen hinauf.
Als er verschwunden war, legte Steve den Arm um seine Frau. »Geh' ins Bett, Liebling«, sagte er. »Du hast jetzt Ruhe nötig. Phyllis wird sich um alles kümmern. Das ist am besten so. Ruh dich erst einmal aus, mir zuliebe!«
Sally war zu erschöpft, um ihm zu widersprechen. Sie ließ sich von ihm ins Schlafzimmer führen, ließ es zu, dass er sie entkleidete und ins Bett legte. Er beugte sich zu ihr und küsste sie, dann ging er hinaus.
Der ersehnte Schlaf wollte nicht kommen. Die Worte ihrer Mutter klangen Sally in den Ohren. Wozu waren Mütter denn da, wenn sie sich nicht um ihre Kinder kümmern. Es war als Anschuldigung gemeint, die Bemerkung war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Tief in ihrem Inneren wusste sie, dass es keine Antwort gab, mit der sie die Beschuldigung entkräften konnte. Wie hätte sie nachweisen können, dass sie wirklich auf das Kind aufgepasst hatte? Vielleicht war sie wirklich schuld an Julies rätselhaftem Tod.
Hatte sie nicht einst mit dem Gedanken gespielt, Julie abzutreiben? Wochenlang war eine mögliche Abtreibung das Hauptgesprächsthema zwischen Sally und Steve gewesen. Eigentlich wollten sie kein zweites Kind. Sie hatten das Problem in langen Gesprächen hin und her gewälzt, bis es zu spät war.
Immerhin, als Julie dann geboren war, hatten sie dem Kind ihre ganze Liebe angedeihen lassen. Sie mochten Julie ebenso gern wie Jason, vielleicht sogar mehr.
Oder war das alles nur Einbildung gewesen?
Vielleicht bildete man es sich nur ein, dass man ein solches Kind liebte. Man war schließlich die Mutter. Du sollst deine Kinder lieben.
Vielleicht habe ich Julie nicht genug geliebt, dachte sie. Vielleicht habe ich das Kind spüren lassen, dass es kein Wunschkind ist.
Sie sah die anklagenden Augen ihrer Mutter vor sich, während ihre Gedanken die Grenze vom Wachen zum Traum passierten.
Meine Tochter ist tot. Vielleicht bin ich daran schuld. Jedenfalls kann ich meine Unschuld nicht beweisen. Ich werde Mutter nie im Leben überzeugen können, dass ich schuldlos bin. Nicht einmal mich selbst werde ich überzeugen können.
Die Schuld hatte Einzug gehalten in Sally Montgomerys Seele, ein Gefühl so tödlich für die Gedanken eines Menschen wie Krebs für den Körper.
Glück und Tod.
In einer einzigen Nacht war alles anders geworden.
Drittes Kapitel
Lustlos stocherte Randy Corliss in seiner Schale mit Maisflocken herum. Er war insgeheim entschlossen, die Portion nicht aufzuessen.
Nur noch fünf Minuten, dann würde seine Mutter das Haus verlassen.
Dann konnte er das Essen in den Mülleimer kippen, eine Nougat-Stange aus dem Vorratsschrank mitgehen lassen und sich auf den Schulweg machen. Sehnsüchtig starrte er auf den großen Zeiger der Küchenuhr. Er war nicht sicher, ob sich der Zeiger überhaupt bewegte. In der Schule war das anders. Da sah man, wie der Zeiger von einer Minute zur anderen sprang. Wie schön wäre es doch, wenn Mutter auch eine solche Uhr kaufen würde. Aber er wusste, diese Chance war gleich null. Er beschloss, am nächsten Wochenende mit seinem Vater zu sprechen. Vielleicht konnte er Dad zu dem Kauf zu überreden.
Er hing dem Gedanken nach, während seine Mutter ihn ermahnte, unmittelbar nach der Schule nach Hause zu kommen, die Wohnungstür nur für Besucher, die er kannte, zu öffnen - und sich vor allem bei Mrs. Willis, der Nachbarin, zu melden, wenn er von der Schule zurückkehrte. Schließlich nahm sie ihn in die Arme, drückte ihm einen Kuss auf die Wange und verschwand in der Garage, die unmittelbar neben der Küche lag. Er hörte, wie sie den Wagen anließ. Erst als das Motorengeräusch in der Ferne erstarb, stand er auf und schüttelte den Rest des Essens in den Mülleimer.
Es war fünf nach acht, als Randy Corliss - neun Jahre alt - in den wunderbaren Frühlingsmorgen hinaustrat. Sein Schulweg war lang, und er würde ihn bei Jason Montgomery vorbeiführen. Unterwegs traf er die anderen Kinder. Sie gingen zu zweit oder zu dritt, unterhielten sich, flüsterten und kicherten. Jeder Junge, so schien es, hatte eine ganze Reihe von Freunden.
Jeder - außer Randy Corliss.
Randy wusste nicht, woran es lag, dass er so wenige Freunde hatte. Vor Jahren - er war damals sechs - hatte er auch viele Freunde gehabt. Aber die hatten sich verflüchtigt, einer nach dem anderen.
Warum eigentlich? Er war schließlich nicht der einzige, dessen Eltern geschieden waren. Es gab eine Menge Jungs, die bei ihrer Mutter lebten. Einige waren sogar ihrem Vater zugesprochen worden. Dies waren die Jungs, die Randy nach Kräften beneidete. Er entschied, am kommenden Wochenende mit seinem Vater darüber zu sprechen. Vielleicht kriegte er ihn diesmal soweit, dass er ihn zu sich nahm. Seit einem Jahr schon sehnte sich Randy danach, bei seinem Vater zu leben.
Letzten Sommer war er seiner Mutter weggelaufen. Der Sommer war ganz besonders langweilig gewesen. Niemand hatte mit ihm gespielt. Der erste Ferienmonat war mit Zuschauen dahingegangen: Randy hatte dagestanden und zugeschaut, wie die anderen Jungs sich vergnügten. Er hatte darauf gehofft, der eine oder der andere werde ihn zum Ballspiel einladen, zum Schwimmen oder auf eine Fahrradtour.
Aber diese Hoffnung hatte sich nicht erfüllt. Schließlich hatte er Billy Semple, seinen letzten Freund, ganz offen gefragt, was eigentlich los war. Billy hatte ihn nur lange angestarrt. Dann hatte er auf sein Gipsbein gedeutet und die Schultern gezuckt. Gesagt hatte er kein Wort.
Dennoch hatte Randy verstanden. Das Gipsbein. Er und Billy hatten in Semples Hinterhof gespielt. Und Randy hatte die Idee gehabt, vom Dach zu springen. Zunächst vom Garagendach, das war recht leicht. Randy war als erster gesprungen, und er war weich im Komposthaufen gelandet. Billy folgte.
Dann hatte Randy vorgeschlagen, sie sollten das gleiche vom Hausdach aus versuchen. Billy hatte es mit der Angst zu tun bekommen. Um nicht als Feigling dazustehen, machte er trotzdem mit. Die beiden hatten eine Leiter herangeschleppt, an die Traufe gelehnt und waren hinaufgeklettert. Oben hatten sie eine Weile auf den Schindeln gehockt und hinabgesehen. Wieder war es Randy, der als erster sprang.
Ein Schmerz durchzuckte ihn, als er auf dem Boden aufkam. Aber als er sich aufrichtete, war der Schmerz wie weggeblasen. Er grinste zu Billy hinauf.
»Los doch!«, schrie er. »Es ist kinderleicht.« Billy hatte gezögert, und Randy hatte ihn als Feigling verspottet. Schließlich hatte sich Billy doch noch zum Sprung entschlossen. Seine Mutter kam gerade rechtzeitig auf den Hof, um zu sehen, wie er sich das Bein brach. Sie war außer sich und hatte Randy verboten, je wieder das Grundstück zu betreten. Noch am gleichen Abend hatte sie Randys Mutter angerufen. Der Sohn solle sich nie wieder bei ihr sehen lassen.
Zu viel wäre eben zu viel. Sie hätte nicht gehofft, dass es soweit kommen würde, aber nach dem Vorgefallenen sei sie gezwungen, sich den Nachbarn anzuschließen und ihrem Sohn das Spielen mit Randy Corliss zu verbieten.
Dass es ein Unfall war, davon wollte sie nichts hören. Randy war der Teufel in Menschengestalt. Schlechter Umgang für ihren Sohn.
Der Sommer war quälend langsam verstrichen. Randy war sich selbst überlassen gewesen. Er hatte sich dabei so einsam gefühlt wie noch nie. Er war dann viel in den Wäldern, von denen Eastbury umgeben war, herumgestromert. Er hatte darüber nachgegrübelt, was eigentlich an ihm war, dass ihn die anderen Jungs mieden wie die Pest.
Und dann hatte er Jason Montgomery kennengelernt. Obwohl Jason ein Jahr jünger war, hatten sie sich sofort gemocht. Jason was anders als die Jungs in der Schule. Die Mitschüler, das waren alles Feiglinge. Nicht so Jason. Schon einen Tag später waren sie dicke Freunde. Randy machte es sich zur Regel, auf dem Schulweg bei Jason vorbeizugehen.
Er war vor dem Haus der Familie Montgomery angekommen. Er betrat das Grundstück und ging in den Hof.
»Jason!« Die Hintertür wurde geöffnet. Jasons Großmutter erschien im Türrahmen. »Kommt Jason nicht?«, fragte er.
»Der geht heute nicht zur Schule«, wurde ihm gesagt. Sie wollte die Tür schließen, als Jason plötzlich hinter ihr erschien. Er schlüpfte an ihr vorbei in den Hof.
»Tag«, sagte Jason.
Randy betrachtete seinen Freund voller Neugier. »Bist du krank?«, erkundigte er sich.
»Nein.« Er hob den Blick. »Vergangene Nacht ist meine kleine Schwester gestorben, deshalb darf ich heute zu Hause bleiben.«
Randy ließ die Mitteilung in sein Bewusstsein einsickern. Er wusste nicht recht, was er seinem Freund antworten sollte. Er hatte Jasons Schwesterchen nur ein einziges Mal zu sehen bekommen. Ein Baby, das sich in nichts von anderen Babys unterschied. Wie Jason damals gesagt hatte, plärrte das Kind den ganzen Tag, dauernd musste man ihm die Windeln wechseln. »Deine kleine Schwester ist gestorben? Wie ist das denn passiert?« brachte er schließlich hervor.
Jason zögerte. »Keine Ahnung. Mein Vater sagt, sie ist einfach so gestorben. Jedenfalls brauche ich heute nicht zur Schule zu gehen.«
»Wie schön für dich«, sagte Randy. Ein fragender Blick. »Hast du der Kleinen was getan? Sag's mir ehrlich.«
»Warum sollte ich meiner Schwester etwas tun?«, entgegnete Jason.
Randy trat ungemütlich von einem Bein aufs andere. »Weiß nicht. War nur so eine Idee. Billy Semples Mutter meint nämlich...« Er verstummte. Vielleicht war es nicht gut, wenn er so offen mit seinem Freund sprach. Billys Mutter gab Jason die Schuld an dem Unfall ihres Sohnes. Sie behauptete, Jason hätte ihren Jungen vom Dach gestoßen.
»Hast du's getan?«
»Was?«
»Hast du Billy vom Dach geschubst?«
»Nein.«
»Siehst du. Genauso ist es mit mir und Julie. Ich hab' ihr auch nichts getan. Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich ihr was getan habe...«
Bevor er den Gedanken weiter ausführen konnte, ging die Tür wieder auf. Jason wurde von seiner Großmutter ins Haus zurückbeordert. Randy starrte ihm nach, bis er in der Düsternis des Hausinneren verschwunden war. Dann ging er auf die Straße zurück und setzte seinen Schulweg fort.
Er hatte wirklich keine Lust, heute zum Unterricht zu erscheinen. Der Schulweg mit Jason war die einzige Abwechslung. Wenn Jason ausfiel, erwartete ihn die gleiche Langeweile wie vergangenen Sommer. Warten und Hoffen. Warten, dass einer der anderen Jungs mit ihm spielte.
Warten ist schwer, wenn man erst neun ist. Randy vertrieb sich die Zeit, indem er zu stehlen begann. Keine großen Sachen. Was sich so mitnehmen ließ, wenn man durch den Kramladen an der Ecke schlenderte.
Es konnte nicht gutgehen. Eines Tages ertappte ihn Mr. Higgins, der Ladenbesitzer, auf frischer Tat.
Randy würde den Augenblick nie mehr vergessen. Er war schon fast wieder draußen, als er spürte, wie sich eine Hand auf seine Schulter legte. Er fuhr herum. Da stand Mr. Higgins. »Und jetzt leerst du deine Taschen aus, mein Junge.«
Das Jojo-Spiel hatte kein Preisschildchen mehr. Aber Randy wusste, es war sinnlos, das Ding als sein Eigentum auszugeben. Er war bleich geworden, die Tränen schossen ihm in die Augen. Er stammelte eine Entschuldigung. Ich will es nie mehr wieder tun, versprach er.
Aber Mr. Higgins ließ es damit nicht gut sein. Er hatte die Polizeistation in Eastbury angerufen. Nein, er wollte keine Anzeige erstatten wegen des Diebstahls. Aber dem Jungen gehörten die Leviten gelesen. »Ich will, dass Sie diesem Randy Corliss einmal klarmachen, was Stehlen bedeutet.« Randy stand dabei, wie der Ladeninhaber telefonierte. »Jawohl, Sie sollen ihm Angst einjagen, damit er wieder auf den rechten Weg kommt.« Ein Polizeiwagen fuhr vor. Randy wurde zur Polizeiwache gebracht. Der Officer zeigte ihm eine der Arrestzellen. Möglicherweise, verkündete dieser, werde Randy die Nacht in der Zelle verbringen müssen. Dann hatten die Beamten seine Fingerabdrücke abgenommen und ein Foto von ihm gemacht. Erkennungsdienstliche Behandlung, hatte der Officer das genannt. Wenn er, Randy, sich je wieder etwas zuschulden kommen ließ, würde er mit Sicherheit hinter Gittern landen.
Schließlich hatten sie ihn gehen lassen. Randy zitterte vor Furcht, als er nach Hause kam. An jenem Abend hatte er den Entschluss gefasst, wegzulaufen.
Niemand mochte ihn, seine Mutter hatte keine Zeit für ihn. Blieb sein Vater. Randy kam zu dem Schluss, dass die Rettung bei seinem Vater lag. Er hatte ihn dann angerufen, hatte seinen Vater angefleht, ihn zu sich zu nehmen. Aber Jim Corliss hatte seinen Sohn vertröstet. Später einmal könnte er zu ihm ziehen. Schließlich hatte er Randys Mutter zu sprechen verlangt. Randy war Zeuge des Gesprächs der beiden geworden. Nein, sie würde Randy nie hergeben, hatte Mutter gesagt. Jim Corliss sollte gar nicht erst versuchen, ihr den Jungen wegzunehmen. Dann, als die beiden sich zu Ende gezankt hatten, durfte Randy noch einmal an den Apparat.
»Ich will sehen, was sich machen lässt«, hatte sein Vater ihm versprochen. »Aber es gibt Gesetze, Randy, die dabei zu beachten sind. Ich kann nicht einfach dort vorfahren und dich im Auto mitnehmen. Das wäre illegal. Verstehst du das?«
Randy verstand das keineswegs. Er hasste Eastbury. Er hasste seine Mutter und er hasste die Freunde, die keine Freunde mehr waren. Er wünschte sich inständig, er könnte mit seinem Vater Zusammenleben. Und dann kam ihm die Idee, wie er das Problem lösen konnte. Es war illegal, wenn sein Vater ihn holen kam. Nun gut. Aber es war sicher nicht illegal, wenn er zu seinem Vater flüchtete.
Nach zwei Tagen des Nachdenkens stand sein Entschluss fest. Er wartete, bis es dunkel wurde. Als seine Mutter eingeschlafen war, zog er sich an und stahl sich aus dem Haus. Er wusste ja, wo sein Vater wohnte. Fünf Meilen von Eastbury, wenn man quer durch den Wald ging. Randy kannte die Gegend, hier war er aufgewachsen. Er veranschlagte zwei Stunden für die Strecke bis zu seinem Vater.
Aber er hatte seine Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Wald sah nachts vollkommen anders aus als bei Tage. Zunächst war er zügig vorangekommen. Er ließ den Kegel der Taschenlampe über die düster rauschenden Baumkronen tanzen. Dann aber gabelte sich der Weg.
Was konnte er jetzt tun? Bei Tag wäre das alles kein Problem gewesen. Aber in dieser Finsternis erkannte er keines der Wahrzeichen mehr wieder, an denen er sich sonst immer orientiert hatte.
Er wählte schließlich den Weg, der am Fluss entlangführte, redete sich ein, dass ihm nichts passieren konnte. Aber es gelang ihm nicht, die aufkommenden Zweifel zu verdrängen.
Wenig später kam er an eine zweite Wegkreuzung. Dieses Mal war er wirklich ratlos. Er blieb stehen, lauschte den Geräuschen der Nacht. So verstrich eine Viertelstunde. Er beschloss aufzugeben. Es war wohl keine gute Idee, mitten in der Nacht quer durch den Wald zu marschieren. Er machte kehrt.
Als er nach fünf Minuten an eine Weggabelung geriet, spürte er, wie die Verzweiflung an ihm hochkroch. Er erinnerte sich nicht an diese Abzweigung. War er auf dem Hinweg wirklich hier vorbeigekommen?
Die Geräusche des Waldes hatten eine andere Färbung bekommen. Ihm schien, als würde er aus leuchtenden Augen beobachtet. Das Wesen verbarg sich hinter dem Blattwerk des Unterholzes, so dass er es mit dem Strahl seiner Taschenlampe nicht erreichen konnte.
Dann glitzerten Lichter zwischen den Zweigen. Er rannte darauf zu. Die Lichter verloschen. Randy lief weiter. Als zwischen den Baumstämmen der Nachthimmel sichtbar wurde, atmete er auf. Dort musste eine Straße verlaufen. Aber welche Straße? Er hatte jede Orientierung verloren.
Er blieb in der Hocke und dachte nach. Was jetzt? Ja, er würde nach Hause zurückkehren. Aber in welcher Richtung lag das Haus? Er fühlte, wie die Kälte an seinen Beinen hochwanderte. Er entschloss sich zur Flucht nach vorn. Er zwängte sich durch die Sträucher, gelangte auf die Straße und wandte sich nach links. Die Taschenlampe in der Faust marschierte er am Straßenrand entlang.
Das Geräusch eines Autos. Das Geräusch kam näher, erstarb ganz plötzlich. Der Wagen hatte angehalten. Ein Streifenwagen mit der Aufschrift Eastbury Police.
»Wo willst du denn hin?«, fragte der Polizist, der am Steuer saß.
»Nach Hause«, stotterte Randy.
»Wo wohnst du denn?«
»In Eastbury.«
»Dann gehst du aber in die falsche Richtung.« Der Polizist lehnte sich quer über den Sitz und öffnete die Beifahrertür. »Komm rein.«
Vor Randys Augen erstanden die Gitterstäbe der Zelle, die ihm gezeigt worden war. »Bin ich verhaftet?«, fragte er kleinlaut.
Der Polizist musterte ihn interessiert. Ein Lächeln stand in seinen Mundwinkeln. »Bist du ein Verbrecher?«
Randy riss die Augen auf. Sein Herz schlug wie wild. »Ähm... nein. Ich wollte nur meinen Vater besuchen.«
»Vorhin hast du gesagt, du wolltest nach Hause.«
Randy wand sich auf dem Sitz. »Das ist dasselbe. Ich will nach Haus - zu meinem Vater.«
»Du wohnst aber gar nicht bei deinem Vater, stimmt's? Bist du von zu Hause weggelaufen?«
Randy starrte aus dem Fenster. Er war jetzt sicher, dass der Streifenpolizist ihn ins Gefängnis einliefern würde. »Ja.«
»Ist es so schlimm bei dir zu Hause?«
Randy sah auf. Der Polizist lächelte ihm zu. Vielleicht lässt er Gnade vor Recht ergehen, dachte Randy. Er beantwortete die Frage mit einem Nicken.
Der Polizist machte dann ein finsteres Gesicht, aber Randy hatte keine Angst mehr vor ihm. Als er dann zu sprechen begann, waren alle Sorgen verflogen. »Ich bin Sergeant Bronski«, hörte er ihn sagen. »Ich werd' dich jetzt zu einer Coke einladen, und dann sprechen wir alles in Ruhe durch.«
»Wo fahren wir denn hin?«, wollte Randy wissen.
»Hier in der Nähe gibt's ein Diner, das die ganze Nacht offen hat.« Sergeant Bronski wendete auf der Straße und schlug die Richtung nach Eastbury ein. »Soll ich nicht besser deine Mutter anrufen?«
»Bitte nicht.«
»Und deinen Vater?«
»Würden Sie das tun?«
»Aber ja.« Sergeant Bronski verlangsamte das Tempo und bog auf den Parkplatz des Restaurants ein. Er bestellte Randy ein Glas Coke und für sich einen Becher Kaffee. Und dann erzählte Randy von dem Zwist zwischen seinen Eltern, von dem Gezänk am Telefon. Als er fertig war, musterte ihn der Polizist aus zusammengekniffenen Augen.
»Ich glaube, es ist besser, wenn wir deine Mutter anrufen, Randy«, sagte er.
»Warum ist das besser?«
»Weil du bei deiner Mutter wohnst, darum. Wenn wir deinen Vater anrufen, muss er deine Mutter benachrichtigen, und dann kommt sie vielleicht noch auf die Idee, er hätte das alles so eingefädelt. Dann verbietet sie dir, deinen Vater überhaupt noch zu treffen. verstehst du das?«
»Ich glaube schon«, sagte Randy unsicher. Sergeant Bronski war aufgestanden und ans Telefon gegangen. Er hatte Randys Mutter verständigt, und dann hatte er ihn heimgefahren.
Seine Mutter hatte ein Donnerwetter auf ihn niedergehen lassen. Es sei schon schwierig genug mit ihm, da müsse er sie nicht noch in Angst und Schrecken versetzen, indem er nachts weglief. Schließlich war Randy ins Bett geschickt worden. Er hatte lange wachgelegen und nachgedacht.
Seitdem war alles in der Schwebe geblieben. Randy zermarterte sich den Kopf, was künftig sein würde. Immer wenn er sich mit seinem Dad traf, bestürmte er ihn, er wollte fort von Mom. Dad sagte nie nein. Aber er sagte auch nie wirklich ja. Du musst abwarten, Randy, das war der Tenor. Kommt Zeit, kommt Rat.
Monate waren vergangen, ohne dass sich eine Wende zum Besseren abzeichnete. Es war Frühling geworden. Der Sommer würde fürchterlich werden. Randy würde wie Falschgeld herumlaufen und nach Spielgefährten suchen, die es nicht gab, würde all den Jungs nachsehen, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Was jetzt im Hause der Familie Montgomery passiert war, machte die Sache nicht besser. Nachdem Jasons kleine Schwester gestorben war, würden die Eltern Jason den Umgang mit Randy untersagen. Er würde wieder allein sein. Allein wie schon immer.
Das Hupen eines Autos riss ihn aus seinen Träumen. Er sah, dass er allein auf dem Bürgersteig ging. Die anderen Kinder waren wohl vorausgelaufen. Er schaute auf die Armbanduhr, die ihm Dad zum neunten Geburtstag geschenkt hatte. Es war halb neure Wenn er sich nicht beeilte, kam er noch zu spät zur Schule. Plötzlich hörte er seinen Namen.
»Randy! Randy Corliss!«
Kurz vor der Einmündung der nächsten Querstraße war ein blaues Auto zum Stehen gekommen. Er kannte den Wagen nicht. 'Eine Frau saß am Steuer. Er kam näher. Die Frau lächelte ihm zu. Zögernd ging er weiter.
»Tag, Randy«, sagte die Frau.
»Wer sind Sie?« Randy hielt sein Schulbrot umklammert. Er war stehengeblieben. Als die Frau sich zur Seite neigte, trat er einen Schritt zurück. Die Ermahnungen seiner Mutter schossen ihm durch den Kopf. Sie hatte ihm strikt verboten, mit Fremden zu sprechen.
»Ich bin Miss Bown. Louise Bown. Ich soll dich abholen.«
»Mich abholen? Wohin denn?«
»Zu deinem Vater«, sagte die Frau, und Randys Herz begann schneller zu schlagen. Zu seinem Vater? Kam diese Frau wirklich von seinem Vater? Würde er endlich bei Dad leben dürfen? »Dein Vater wollte, dass ich dich zu Hause abhole«, hörte er die Frau sagen. »Aber ich habe mich verspätet. Es tut mir leid.«
»Das macht doch nichts«, sagte Randy. Er trat an das heruntergekurbelte Fenster des Wagens. »Fahren wir gleich zu meinem Vater?«
Die Frau hatte die Wagentür geöffnet. »Etwas später«, versprach sie. »Steig ein.«
Randy wusste, dass er nicht einsteigen durfte. Seit er denken konnte, warnte ihn seine Mutter vor Fremden, die einen zu einer Fahrt in ihrem Auto einluden.
Aber hier lag die Sache anders. Es handelte sich um eine Frau, die mit seinem Vater befreundet war. Ganz sicher sogar. Die Frau wusste sogar von Dads Plan, ihn seiner Mutter wegzunehmen. Und dann waren es auch immer Männer gewesen, vor denen ihnen seine Mutter gewarnt hatte. Nie Frauen. Er sah ihr in die Augen. Sie lächelte. Plötzlich hatte er das Gefühl, mit dieser Frau ein Geheimnis zu teilen. Er stieg ein und zog die Tür hinter sich zu. Die Frau startete den Wagen und fädelte sich in den Verkehr ein.
»Wohin fahren wir?«, fragte Randy.
Louise Bown betrachtete den Jungen von der Seite. Kein Zweifel. Das war der gutaussehende Junge, den man ihr auf Fotos gezeigt hatte. Grüne Augen, dunkles, leicht gewelltes Haar, Stupsnase. Großgewachsen für sein Alter. So stark, dass sich selbst eine Frau wie sie bei ihm geborgen fühlte. Er schien überhaupt keine Angst vor ihr zu haben, obwohl sie für ihn doch eine Fremde war. Instinktiv hatte sie Randy Corliss liebgewonnen.
»Wir fahren zu deiner neuen Schule, Randy.«
Randy dachte nach. Eine neue Schule? Wenn sein Vater ihn in eine neue Schule stecken wollte, warum hatte er nie davon gesprochen? Die Frau schien seine Frage erraten zu haben.
»Du wirst deinen Vater bald zu sehen bekommen«, sagte sie. »Aber er braucht noch ein paar Tage, bis er die Dinge mit deiner Mutter geregelt hat. Diese Zeit wirst du in der Schule verbringen. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Es ist eine ganz besondere Schule. Speziell für Jungs wie dich. Du wirst viele neue Freunde kennenlernen. Na, was sagst du dazu?«
Randy nickte. Inzwischen fragte er sich jedoch, ob es klug gewesen war, zu der Frau in den Wagen zu steigen. Aber dann, als er über ihre Worte nachdachte, wurde ihm klar, dass die Frau wohl die Wahrheit sagen musste. Sein Vater hätte ja auch gesagt, dass es Probleme geben würde, wenn er von Mutter wegzog. Es war klar, dass er auf eine neue Schule gehen musste, wenn er nicht mehr bei Mutter wohnte. Heute... bot sich die Gelegenheit.