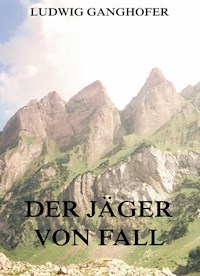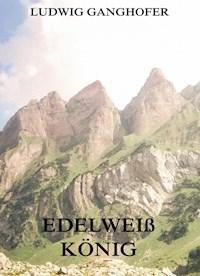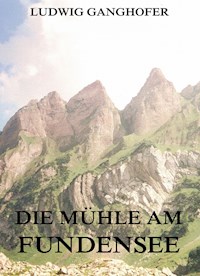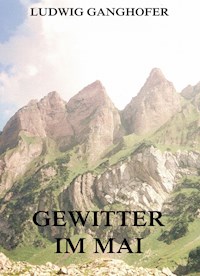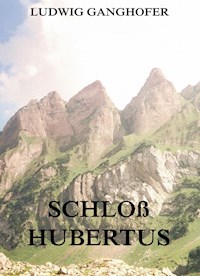Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ludwig Ganghofers Erzählung »Das große Jagen« handelt von Ganghofers bayrischer Heimat, ist aber sicher kein klassischer Heimatroman. Ganghofer erzählt von Geschichte, Glauben, und Politik. In »Das große Jagen« stellt er die Zeit der Gegenreformation im 18. Jahrhundert dar, als die katholische Kirche zehntausende von Protestanten und Juden zwang, das Berchtesgadener Land zu verlassen. »Das große Jagen« des Romantitels ist eine Menschenjagd. Ludwig Ganghofer selbst stammte mütterlicherseits von französischen Hugenotten ab. Schon deshalb tritt er in »Das große Jagen« für ein tolerantes Miteinander unterschiedlicher Glaubensrichtungen ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das große Jagen
Titelseite1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.ImpressumLudwig Ganghofer
Das große Jagen
Erzählung aus der Zeit der Gegenreformation in Bayern
1.
Am zweiten Februar des Jahres 1733, am Lichtmessabend, peitschte der stürmische Westwind ein dick wirbelndes Schneetreiben durch die Gassen von Berchtesgaden. An den Häusern waren alle Flurtüren versperrt, alle Fensterläden geschlossen. Obwohl die Polizeistunde noch nicht geschlagen hatte, war auf der Marktgasse kein Mensch mehr zu sehen.
Das dunkle Häuserschweigen in dem weißen Gewirbel hatte trotz allem Lärm des Sturmwindes etwas Friedliches. Dieser Friede erzählte von sorglosen Menschen in gemütlichen Stuben. Eine grauenvolle Lüge! In Erregung, in Zorn und Sehnsucht pochten hinter den verriegelten Türen Hunderte von verstörten Herzen. Zwischen den stillen Wänden wohnte die Ratlosigkeit neben Hass und Angst, feiges Misstrauen neben dem Mut, duldende Stärke neben der hämischen Bosheit, nicht immer geschieden durch Tür und Mauer. Kampf und Erbitterung schwelte, wie zwischen Nachbar und Nachbar, auch zwischen Mann und Weib, zwischen Bruder und Schwester, zwischen Vater und Sohn.
An allem Fürchterlichen, das sich einsperrte in die Stuben, brauste der wirbelnde Schnee vorüber.
Auf den Türmen des Stiftes und der Franziskanerkirche schlugen die Glocken im Sturm die neunte Stunde. Unter dem Rauschen des Windes war es ein milder Hall. Wie eine warme Gottesstimme sprach er zu dem frierenden Leben, das nur lauschte auf den eigenen Zorn und die eigene Sehnsucht. Dann wieder die stumme Gassentrauer unter dem wehenden Flockenfall.
Aus dem Häusergewinkel, das die nördliche Stiftsmauer umzog, kämpfte sich ein schwarz gekleideter Mensch heraus, den Kopf mit der Pelzkappe gegen den Wind geschoben, die Arme unter dem Radmantel. Immer dicht an den Häusern hin und rasch in eine Gasse. Ein Pfiff, wie der Schlag einer Amsel. An einem schmalen Steingebäude, das sich von den Nachbarhäusern auffällig unterschied, öffnete sich die Tür ein bisschen und eine greise Stimme fragte im Hausdunkel: »Hochwürden?«
»Komm!« Auch diese Stimme klang nimmer jung.
Eine kleine Mannsgestalt in zottigem Fuchspelz mit dicker Kapuze huschte aus dem Haus und schloss die Türe, die von innen verriegelt wurde. Wortlos, der Kleine neben dem anderen, der groß und hager war, schritten die beiden quer über das Ende der Marktgasse, vorüber am neuen Pflegeramt, vorüber an den Stallungen des alten Leuthauses. In der halb bebauten Straße, die zur Franziskanerkirche führte, traten sie in einen mit hohen Bretterplanken umzäunten Garten. Auch hier öffnete sich die Haustür wie von selbst. Aus der Finsternis des Flures sprach eine Mädchenstimme: »Gelobt sei Jesus Christus und die heilige Mutter Maria!«
Der Kleine im Fuchspelz antwortete zaghaft: »Von nun an bis in Ewigkeit, Amen!« Und der andere sagte, als er in das Dunkel hinein trat: »Schau nur, Luisa, wie gut Du den Bekenntnisgruß zu brauchen weißt!« Seine Stimme hatte einen heiteren Ton. »Jetzt hast Du wieder dreißig Wochen Ablass gut! Tust Du denn in Deinem jungen Leben des Bösen so viel, dass Du Deine künftige Fegfeuerzeit so fleißig verkürzen musst?«
»Hochwürden, ich mag das nit, wenn Ihr so redet!« Das junge Mädchen verriegelte die Haustür. »Ein geweihter Priester sollt ernst nehmen, was heilig ist.«
»Luisichen! Oft wohnt von allem Ernst der tiefste hinter einem hilfreichen Lachen.«
Der Kleine hatte den Pelz abgelegt. Jetzt nahm auch der Geistliche den Mantel herunter, und da quoll ein Lichtschein auf, als hätte Luisa die Blechmaske an einer Blendlaterne gehoben. Der helle Strahl überglänzte die beiden Männer. Der Kleine trug das berchtesgadnische Bürgerkleid mit der Bundhose über den weißen Strümpfen und mit dem braunen Faltenkittel, über dessen Kragen sich die weiße Hemdkrause herauslegte. Ein scharf geschnittener Judenkopf mit blassem Gesicht. Der Spitzbart so weiß wie die hohe Stirn. Unter dem Lederkäppchen quollen graue Locken heraus. Zwei stille, heiß glänzende Augen. Das war der aus Salzburg nach Berchtesgaden zugesiedelte Arzt und Handelsmann Simeon Lewitter, der vor fünfzehn Jahren bei einem Judenkrawall das Weib und seine zwei Kinder verloren und in der Verstörtheit dieser Gräuelnacht die Taufe empfangen hatte. Für die Bauern galt er noch immer als der Jud, genoss aber als Leibarzt des Fürstpropstes zu Berchtesgaden leidliche Sicherheit. Nur die Trauer seiner Augen erzählte von den Schmerzen einer vergangene Zeit. Der schmale Mund unter dem weißen Bart hatte das Lächeln einer Stein gewordenen Geduld.
Neben diesem scheuen Greis sah der katholische Priester, der seit sieben Jahren emeritierte Stiftspfarrer Ludwig, fast wie heitere Jugend aus, die sich als Alter vermummte. Schon ein bisschen gebeugt, war doch in seinem sehnigen Körper noch lebhafte Beweglichkeit. Er machte auch eine gute Figur in dem geflügelten Schwarzrock mit den weißen Bäffchen, in der seidenen Bundhose mit Strümpfen und Schnallenschuhen. Den geschnörkelten Lockenbau, der bei den Herren Mode geworden, verschmähte er. Glattsträhnig hingen die aschfarbenen Haare um das rasierte Gesicht, in dessen Fältchen ein Spiel von freundlicher Spottlust zwinkerte. Er hatte zwei braune haarborstige Warzen, die halb entstellend wirkten und halb wie eine drollige Parodie auf die Schönheitspflästerchen der vornehmen Damen waren: Eine kleine auf dem linken Nasenflügel, auf der rechten Wange eine große, die sich sonderbar verschob, so oft der Pfarrer lachte. Wenn er ernst war, bekam sein Gesicht durch diese Warzen etwas Grausames und Hexenmeisterhaftes. Das verschwand aber gleich, sobald seine Augen heiter wurden, diese hellblauen Augen, die im Gesicht des Siebzigjährigen noch wie die Augen eines lebensgläubigen Jünglings glänzten.
»Luisichen?«, fragte er munter. »Warum beleuchtest Du mich so scharf? Magst Du nit lieber Dich selber illuminieren? Zum Erquicken unserer müden Männerseelen?« Lachend nahm er die Blendlaterne aus Luisas Hand und richtete den Lichtkegel auf ihr Gesicht.
Eine Achtzehnjährige von herber Schönheit, über ihr Alter gereift in einer Zeit, in der die Redlichen ein härteres Leben hatten als die Gewissenlosen. Braunblonde Zöpfe lagen gleich einem schweren Seilgeflecht um die Stirn. Der Mund war wie ein strenges Siegel dieses jungen, schon geprüften Lebens und zeigte doch das Rot einer Kirsche, die reifen will. In den dunklen Augen war ein fast ekstatischer Glanz. Oder kam das vom Widerschein des blendenden Lichtstrahls? Der zeigte auch das rote, mit Silberblumen bestickte Mieder, aus dem sich die weißen Glocken der Spitzenärmel herausbauschten. Eine zarte Gestalt, in der sich das junge Weib zu formen begann.
Auf der Wange des Pfarrers hüpfte die große Warze. »Luisischen? Hast Du Dich für uns zwei Alten so wohlgefällig gemacht? Oder hat Dein schmucker Abend einem Jüngeren gegolten?«
In Unmut zog das Mädchen die Brauen zusammen: »Ob jung oder alt, das frag ich nit. Mir gilt: Getreu oder schlecht, Christ oder Gottesfeind. Und heut am Morgen hab ich den heiligen Leib genossen. Da trag ich mein bestes Gewand, bis ich schlafen geh. Man muss sich innen und außen unterscheiden von den Gottlosen.«
Der Pfarrer blieb stumm. Aus seinen Augen sprach Erbarmen mit dieser freudlosen, von aller Härte der Zeit gegeißelten Mädchenseele.
Droben ein Schritt. Licht fiel über die Stiege herunter. »Seid ihr's?«, fragte eine erregte Stimme. »Ich hab schon geforchten, ihr könntet ausbleiben, wegen des schiechen Wetters.«
»Meister, da kennt Ihr uns schlecht.« Der Pfarrer lachte, nicht ganz so froh, wie eine Minute früher. »Wir kommen zu unserem lieben Abend, da kann es schneien oder lenzen, Mistgabeln oder Kapuziner regnen.«
Die beiden wurden droben von einem Fünfundvierzigjährigen empfangen, der ähnlich gekleidet war wie Lewitter. Ein mähniger Kopf mit langem Bart, dessen helles Braun schon Silberstriche hatte. Unter den Brauenbogen fieberten zwei dunkle Augen mit dem Trauerblick einer gequälten Menschenseele. Es waren die gleichen Augen, wie die Tochter sie hatte, das einzige Kind des Bildhauers Nikolaus Zechmeister. Die Nähe der Gäste ließ den Hausherrn aufatmen, als käme jetzt eine bessere Stunde seines Lebens. Und es war ein seltsamer Gruß, den die drei einander zuflüsterten: »Mensch bleiben!« Den Händedruck musste Meister Niklaus mit der Linken erledigen. Vor siebzehn Jahren hatte man ihm zu Hallein die Schwurhand auf dem Block vom Arm geschlagen, weil er gegen seinen Untertaneneid zwei evangelischen Inkulpaten, hinter denen die Soldaten Gottes her waren, zur Flucht verholfen hatte. Sein Weib war gestorben vom Schreck. Und das Kind hatte man dem der Irrlehre Verdächtigen weggenommen und zu gutchristlicher Erziehung in ein Kloster gegeben. Erst seit dem verwichenen Herbst war Luisa wieder daheim – als Wächterin des Vaters, um ihn zu behüten vor einem Rückfall in den evangelischen Wahn.
Am rechten Arm trug Meister Niklaus in braunem Lederhandschuh eine künstliche Holzhand, die er durch einen sinnreichen Mechanismus zur Mithilfe bei seiner Arbeit belebt hatte. Zwölf Jahre lang, bis die linke Hand sich zu schulen begann, war er seinem Beruf entzogen. Um Arbeit zu haben, hatte er in dieser Zeit für die Schnitzereien der berchtesgadnischen Heimarbeiter ein Verlegergeschäft begründet, bei dem er, ein wohlhabender Mann, für die Notstillung seiner Dienstgesellen oft mehr verbrauchte, als er von ihrer Ware für sich selbst gewann. Seit fünf Jahren gehörte Meister Niklaus wieder seiner Werkstätte, in der sich Kunst und Handwerk miteinander verschwisterten. Aber so fröhlich, wie er als junger Mann gewesen, wurde er nimmer. Und seit der Heimkehr seiner Tochter schien er ernster, als er es je in der Zeit seines Leidens war.
Während Lewitter in die helle Stube trat, rief Niklaus über das Stiegengeländer hinunter: »Gelt, Luisa, bring uns nur gleich den warmen Trunk!«
»Wohl, Vater!«
Der Meister blieb über das Geländer gebeugt, als hätte er Sehnsucht, noch ein Wort seines Kindes zu hören. Da legte ihm Pfarrer Ludwig die Hand auf die Schulter: »Niklaus? Wird's besser mit Euch beiden?«
Der andere schüttelte den Kopf. »Sie glaubt nit, dass ich glaub.«
Der Pfarrer bekam das grausame Gesicht. »Viel Ding im Leben hab ich verstanden. Eins versteh ich nimmer: Wie der Herrgott es dulden kann, dass man in seinem Namen die Seelen der Menschen frieren macht? Kann sein, dass Gott sein heißt: In alle Ewigkeit für uns Menschen ein Rätsel bleiben.«
Ein bitteres Lächeln zuckte um den Mund des Meisters: »Hätt mein Mädel das gehört, so tät sie nach dem Klosterbüchl ausrechnen, wie viel Jahrhundert Fegfeuer das wieder kostet.«
Die beiden traten in die Stube. Als die Tür geschlossen war, legte Pfarrer Ludwig herzlich den Arm um die Schultern des Hausherrn: »Du?« Wenn die drei allein waren, duzten sie einander. »Glaubst Du, dass ich die Menschen kenn?«
»Aus dem Beichtstuhl hast Du tief hinuntergeschaut in ihre Seelen.«
»Noch tiefer in der Sonn, die ich außerhalb der Kirch gefunden. Und ich sag Dir das voraus: In Deinem Mädel wird das rechte Leben noch blühen, wie am Johannistag die Rosen in Deinem Garten.«
»Gott soll's geben!«
»Was für einer?« Die große Warze tänzelte. »Der meinige, der Deinige, der seinige?« Bei diesem letzten Wort deutete Pfarrer Ludwig auf Lewitter, der die Brust an den warmen Kachelofen presste und dieses Kunstwerk des hilfreichen Menschengeistes mit den Armen umschlang, schauernd vom Gassenfrost, frierend in der Kälte seines alten, einfachen Lebens.
Unter dem reich besteckten Kerzenrad stand auf rundem Tisch ein Schachbrett und daneben ein Körbchen mit den geschnitzten Beinfiguren. Während der Meister das Spiel zu stellen begann, warf er lauschend einen Blick zur Tür und fragte flüsternd: »Hast Du Botschaft aus Salzburg?«
Der Pfarrer nickte. »Seit das große Jagen begonnen hat, sind's nach der letzten Zählung dreißigtausend und siebenhundert, die man aus dem Land getrieben.«
»Ist das nit Irrsinn?«, stammelte Niklaus.
»Nein, Bruder!« Die große Warze kam in Bewegung. »Wie mehr man die Zahl der Fresser mindert in einem Land, um so fetter werden die Erben. Das ist die fromme Rechnung unserer Zeit. Wie länger ich das mit anseh, um so lustiger macht es mich.«
»Mensch! Wie kann man das heiter nehmen?«
»Anders tät man den üblen Brocken nit schlucken. Die Zeit ist so schaudervoll, dass man sie nur als eine Narretei des Lebens beschauen kann. Wollt einer sie ernst nehmen, so müsst er an der Menschheit verzweifeln. Wie mehr man lacht über ein böses Ding, um so ungefährlicher wird es.«
»Still!«, mahnte Lewitter. »Das liebe Mädel kommt.« In seiner Art, zu sprechen, war kein jüdischer Klang. Er sprach, wie Herren reden, die unter Bauern wohnen. Hastig trat er auf den Tisch zu, stellte die letzten Schachfiguren und sagte: »Heut seid ihr beide am Spiel. Da hab ich für Euch einen Anfang ausgesonnen –«
Luisa trat in die Stube. Auf einer Zinnplatte brachte sie drei Becher, in denen der Würzwein dampfte.
»So! Und so!«, sagte Lewitter. Er machte von jeder Seite des Spiels fünf Züge. »Wie gefällt Euch das?«
Meister Niklaus, seine Erregung verbergend, nickte: »Das ist neu.«
»Aber schön!« Der Pfarrer ließ sich lachend auf den Sessel nieder. »Was man nit allweil behaupten kann von Dingen, die neu sind.«
Luisa hatte die Becher ausgeteilt. »Gott soll's den Herren gesegnen.«
Lewitter antwortete: »Gott soll Dir's danken, lieb Kind.« Und der Pfarrer redete fröhlich weiter: »Wie fein das duftet! Hast Du das im Kloster gelernt?«
Ein Zornblick. »Die frommen Schwestern haben Wasser getrunken.«
»Wenn Du dabei gewesen bist. Was haben sie geschluckt, wenn Du's nit gesehen hast?«
Niklaus, der ein strenges Wort seiner Tochter zu befürchten schien, sagte rasch: »Ich dank Dir, Kind! Weiter brauchen wir nichts. Tu Dich schlafen legen!«
»Ich muss noch schaffen.« Sie maß den Vater mit einem Sorgenblick. »Auch beten muss ich. Heut mehr als sonst.« Ihre Augen glitten über die beiden anderen hin. Dann ging sie.
Lewitter flüsterte: »Sie hat Misstrauen gegen uns.«
»So? Meinst Du?« Der Pfarrer schmunzelte. »Dann hat sie ein Näsl, das so fein ist wie nett.«
Ein bisschen unwillig sagte der Meister: »Warum tust Du sie auch allweil reizen?«
»Weil's hilfreich ist. Wie soll ein stilles Wässerlein sich bewegen, wenn man keinen Stein hineinwirft? Aber komm, da steht ein schöner Gedanke auf dem Schachbrett. Wir wollen uns freuen dran! Was Leben und Welt heißt, soll uns weit sein bis um Mitternacht.« Der Pfarrer fasste den Becher. »Her da! Wärmt den Herzfleck! Lasst uns anstoßen als treue Bundesbrüder des duldsamen Glaubens! Auf alles Gesunde in den Menschen! Aller dürstenden Hoffnung zum Trost! Auf den Glauben an die gute Zeit! Auf das totgeschlagene und noch allweil nit wiedergeborene Deutschland! Auf das kommende Reich, das neu und schön sein wird!«
Die drei Becher klirrten über den Schachfiguren gegen einander und Niklaus sagte: »Wann wird das kommen, dass unser Volk und Reich den ersten Schrei seines neuen Lebens tut?«
Simeon verlor das steinerne Lächeln. »Am Erlösungsmorgen nach einer harten, tiefen und gewaltigen Not.«
Der Meister nickte. »Dann haben wir Hoffnung, dass wir es noch erleben. Härter und tiefer ist nie eine Not gewesen als die von heut!«
»Hart und tief!« Die Warze im Gesicht des Pfarrers bewegte sich munter. »Bloß das Gewaltige fehlt. Wohin man schaut, alles läppisch und erbärmlich. Das neue Reich erleben wir nimmer. Komm, lass uns Freud haben am schönen Spiel der Stunde! Du, Nicki, mit den Weißen hast den ersten Zug!«
Niklaus rückte eine Figur. »So, mein' ich, wär's am besten.«
Die beiden vertieften sich in das Bild des Schachbrettes. Und Simeon verfolgte aufmerksam die Züge. Als Pfarrer Ludwig eine Wendung fand, die den Sieg zu seinen Gunsten vorbereitete, nickte Simeon und erhob sich. Beim Geschirrkasten füllte er zwei langstielige Tonpfeifen mit Tabak, brannte sie an einer Kerze an und brachte sie den beiden Spielern. Er selber rauchte nicht. Um außerhalb des Qualmes zu bleiben, den die beiden Spieler hinbliesen über die Schachfiguren, rückte er ein Stück vom Tisch weg. Und als das Spiel dem Ende zuging, streifte er einen Schuh herunter und zog unter der eingelegten Filzsohle ein dünnes, eng beschriebenes Blatt hervor.
»Was Gutes?«, fragte der Pfarrer.
»Seit langem hab ich Tieferes nit gelesen. Ich hab mir auch schon überlegt, wie ich's für Euch übersetzen muss.«
»Hebräisch? Aus Deinem Talmud?«
»Was Besseres.«
»Wenn Du das sagst, so muss es eine neue Offenbarung sein.« Pfarrer Ludwig schob das Schachbrett beiseite.
»Neu? Was in dem Brief da steht, ist bald an die hundert Jahr alt. Mir ist's neu gewesen. Das Gute in der Welt hat einen langsamen Weg.«
»Wer hat's geschrieben?«
»Erst musst Du es hören. Man soll nit den Namen vor das Werk setzen, sondern das Werk vor den Namen.« Lewitter begann mit leiser Stimme zu lesen, während auch Meister Niklaus etwas Heimliches aus dem Unterfutter seines Kittels herausholte. Nach einer Weile schlug die alte Kastenuhr die zehnte Stunde. Sie hatte einen tiefen, dröhnenden Ton. Dabei überhörten die drei, dass an der Haustür jemand pochte, nicht laut, doch ungeduldig.
Luisa und die Magd, beim Spinnen in der Küche drunten, vernahmen das Pochen.
Die Magd erschrak. Es war ein dreißigjähriges, weißblondes Mädel, das einen wohlgeformten Körper und träumende Augen hatte, doch kein frohes Gesicht. Mit dreizehn Jahren, bei Luisas Geburt, war die Sus als Kindsmädel in des Meisters Haus gekommen. Nach dem Tod seiner Frau, als ihm die Tochter um des reinen Glaubens willen genommen wurde, hatte die Sus getreu bei dem Einsamen ausgehalten und hatte um seinetwillen ihre Jugend versäumt, sich zerschlagen mit Eltern und Geschwistern, die es ihr nie verziehen, dass sie atmete unter dem Dach eines Verdächtigen.
Beim Hall der pochenden Schläge war sie bleich geworden und hatte vor Schreck das Spinnrädl umgeworfen.
»Bleib, Sus! Ich geh schon!«, sagte Luisa. »In Dir ist Angst, in mir ist Gott. Drum hab ich nit Ursach, mich zu fürchten.«
Der da draußen musste die Stimme des Mädchens vernommen haben. Das ungeduldige Pochen wurde still.
»Jesus!«, stammelte Sus. »Ob's nit die Schergen sind?«
»Die kommen zu schlechten Menschen, nit zu uns.« Luisa entzündete die Blendlaterne. »Mag sein, man holt den Lewitter zum gnädigsten Herrn. Dem ist zuweilen in der Nacht nit gut. Die ihn verleumden, sagen: Vom vielen Wein. Ich sag: Von seiner schlaflosen Sorg um den reinen Glauben.« Sie ging zur Haustür und schob den Riegel zurück.
Der da draußen wollte hastig eintreten. Weil die Tür noch an einer Kette hing, öffnete sie sich nur um einen schmalen Spalt. Während die Schneeflocken hereinwehten, flüsterte in der Nacht eine erregte Jünglingsstimme: »Lieb Mädel! So tu doch auf!«
Obwohl sie die Stimme gleich erkannte, fragte sie: »Wer pocht so spät in der Nacht an meines Vaters Haus?« Es klang wie Zorn aus ihren leisen Worten.
»Einer, der es gut mit Deinem Vater meint.«
»Mein Vater kann bauen auf Gottes Hilf. Menschenhilf braucht er nit.«
Der da draußen schien die Geduld zu verlieren. »Sei doch verständig, Mädel! Ich will Deinen Vater warnen.«
»Der ist kein Treuloser und Unsichtbarer.«
»Bei Christi Leiden! Da steh ich in der Nacht und spiel um mein Leben, weil er Dein Vater ist!«
»Kannst Du spielen um Dein Leben, so wird es so viel nit wert sein.«
Ein zerbissener Laut der Sorge. Dann ein wunderlich wehes Auflachen. »Tust Du Dich fürchten? Vor mir?«
»Fürchten? Weil auf heiligen Kirchgang Deine Augen mich beschimpft haben? So bist Du. Fürchten tu ich Dich nit.« Die Türkette klirrte, und Luisa trat in die Nacht hinaus. Mit der Linken hielt sie die Türe fest, damit der Schnee nicht hineinwehen möchte in den Flur, mit der Rechten hob sie die Laterne.
Das Licht umglänzte einen Sechsundzwanzigjährigen in verschneiter Jägertracht. Ein junger blonder Bart umkrauste das feste, kühne Gesicht, das so braun von der Sommersonne war, dass drei Wintermonate diese Wangen nicht hatten bleichen können. Wie hundert kleine silberne Mücken flogen die beglänzten Schneeflocken um sein im Winde wehendes Haar und um die weit geöffneten Augen, in denen Sorge und Sehnsucht brannten.
Die beiden schwiegen eine Sekunde lang. Dann die strenge Mädchenstimme: »Du bist das Licht nit wert. Es hilft Dir lügen und macht Dich anders als Du bist! Man hat mir gesagt, Du wärst ein Unsichtbarer, wenn die Sonn am Himmel scheint. Da bleib Du auch unsichtbar in der Finsternis!«
Das Licht erlosch. Nur noch ein schwarzer Schatten stand in dem weißen Gestöber, und die ernste Jünglingsstimme klagte: »Bist du ein lebiges Ding mit warmem Blut? Du bist wie zur Winterszeit ein kalter Stein in Deiner Kirch!« Ohne zu antworten, wollte Luisa zurücktreten in den Flur. Da sprang er auf sie zu, umklammerte mit seiner Stahlfaust ihren Arm, hielt sie fest, wie heftig sie sich auch wehrte, zog sie so dicht an seine Brust heran, dass sie seinen heißen Atem empfand, und flüsterte: »Willst du Deinem Vater die Hausruh wahren, so sag ihm: ›Es ist ein heilig Ding, da wird ein Messer durchgestoßen, noch heut in der Nacht!‹« Er drehte das Gesicht, als hätte er ein Geräusch gehört. Da draußen, im Dunkel, beim Leuthaus drüben, glomm es wie ein matter, gaukelnder Lichtschein auf. Kaum erkennbar war es. Doch die Nacht gewohnten Augen des Jägers erkannten, was da kam. »Hinauf! Zu Deinem Vater!« Mit Sätzen, wie ein gehetzter Hirsch sie macht, verschwand er.
Luisa stand im weißen Gewirbel. Nun war die Sus bei ihr und zog sie in den Flur zurück, verriegelte die Tür, gebärdete sich wie eine Verstörte und bettelte: »Tu nit Zeit verlieren! Das musst Du dem guten Herren sagen! Und tust Du's nit, so spring ich selber hinauf –«
Die Stimme der Magd war so laut geworden, dass man sie droben vernommen hatte. Niklaus kam aus der Tür gesprungen und rief über das Geländer: »Was ist da drunten?«
»Ich komm, Vater!« Luisa huschte über die Treppe hinauf. »Einer hat gepocht an der Haustür –« Ein kurzes Zögern. »Ich mein', es ist von den Söhnen des Mälzmeisters Raurisser der Älteste gewesen, der Leupolt.«
»Sag's doch!«, klang die angstvolle Stimme der Magd. »So sag's doch dem guten Herrn!«
Der Name, den Luisa genannt hatte, und die Mahnworte der Magd schienen den Meister in Sorge zu versetzen. Er zog die Tochter über die Stubenschwelle und verschloss die Tür. Auch im Blick der beiden andern war Unruh. »So red doch, Kind! Was ist mit dem Leupolt?«
»Das ist ein sündhafter und schlechter Mensch.«
»Der Leupolt?«, fragte Pfarrer Ludwig verwundert. »Den prächtigen Buben kenn ich seit den Kinderschuhen.«
»Er hat gottferne Augen und hat unsittig zu mir geredet.«
Niklaus wurde ungeduldig. »Red doch, Kind! Was hat er gesagt?« Er meinte: Jetzt, an der Haustür.
Luisa dachte an den sündhaft gewordenen Dreikönigstag. »Auf heiligem Kirchgang hat er zu mir gesagt: Ich tät ihm gefallen.«
Aus Simeons Gesicht verschwand die Ängstlichkeit, und Pfarrer Ludwig begann zu lachen. »Was für eine Zeit ist das! Ein junges Mädel! Und hält es für gottwidrig, wenn sie einem festen Buben gefällt! Alle Natur verdreht sich in Unvernunft. Jedes Wörtl wird überspreizt. Keiner redet mehr, wie es menschlich wär und wie Herz und Blut es begehren müssten. Alles wird aufgeblasen. Jeder lustige Erdenfloh muss sich verwandeln in einen Höllendrachen.«
Auch Meister Niklaus schien aufzuatmen. »Und da ist der junge Raurisser zur Haustür gekommen? Weil er gern mit Dir einen Heimgart gehalten hätt?«
Ein Zornblick funkelte in Luisas Augen. »Das nit. Ich hätt es ihm auch nit verstattet. Er hat sich frech und unnütz aufgespielt. Du bist, wie Du bist, Vater! Da braucht nit einer warnen. Und braucht nit sagen: ›Für Deinen Vater spiel ich um mein Leben.‹ Und muss nit sagen: ›Es ist ein heilig Ding, da wird ein Messer durchgestoßen, noch heut in der Nacht.‹«
Über die Stirn des Meisters ging ein Erblassen, und Lewitter machte eine erschrockene Handbewegung gegen das Schachbrett hin, während Niklaus stammelte: »Kind! Warum hast Du denn das nit gleich gesagt?«
Luisas Stimme bekam einen fremden Klang. »Vater? Ist Dein Gewissen nit rein vor Gott?«
Zur Antwort blieb dem Meister keine Zeit mehr. Lärmende Rufe im Sturm der Nacht, dröhnende Schläge an der Haustür, ein dumpfes Krachen, Gesplitter von Holz und das gellende Angstgeschrei der Magd. Als der Meister die Stubentür aufriss, hörte man im Flur befehlen: »Ein Vigilant zur Haustür! Einer in loco jujus vor das Kuchlmensch! Einer hat Vigilanz bei der Stieg! Die drei anderen mit mir! Citissime!«
Heiter tätschelte Pfarrer Ludwig die Schulter des vor Schreck wie zu Stein geworden Mädchens: »Fein, Luisichen! Kindlich über alle Maßen! Den Vater ins Rattenloch bringen! So hat's Dein heiliger Gott den Kindern befohlen! Viertes Gebot!«
Mit erwürgtem Aufschrei jagte Luisa zur Stubentür. Kaum hatte sie dem Tisch den Rücken gewandt, da riss Lewitter unter dem Schachbrett das hebräisch beschriebene Blatt und ein anderes hervor, das zwischen enger Schrift einen Holzschnitt zeigte – ein Blatt aus dem Nürnberger Sendschreiben des vor achtundvierzig Jahren aus Berchtesgaden ausgetriebenen evangelischen Bergmannes Josef Schaitberger. Hurtig quetschte Simeon die Blätter in zwei kleine Knäuel zusammen, die er verschlingen wollte.
»Halt, Bruderherz!« Pfarrer Ludwig riss ihm die Knäuel vom Mund weg. »Papier ist untauglich für einen Menschenmagen. Gib her! Ich hab ein gutkatholisches Versteck.« Während die große Warze tanzte, zerrte der Pfarrer die Bäffchen vom mageren Hals weg und ließ hinter ihnen die zwei Papierknäuel verschwinden. »So! Gleich mit dem ersten Ruck ist Dein Spinoza und des Niklaus Schaitbergischer Sendbrief hinuntergerutscht bis in die Magengrub. Außerhalb der Gedärm ist's weniger ungesund.«
Zu diesem heiteren Flüsterworten klangen vom Stiegenflur die aufgeregten Fragen des Meisters, das Weinen der Magd, die Stimmen und das Schrittgetrampel der Soldaten Gottes.
2.
Der Feldwebel des Pflegeramtes, Nikodemus Muckenfüßl, war ein wohlgenährter, gutmütig dreinschauender Mensch, der seiner biersanften Natur die Unerbittlichkeit des Polizeitones immer gewaltsam abringen musste. Als er, den dünn ausgezogenen Schnurrbart um den Finger kräuselnd, mit Meister Niklaus und den drei boshaft umherspähenden Musketieren lärmvoll in die Stube trat, saß Pfarrer Ludwig mit Simeon Lewitter beim Schachspiel und sagte: »Ich weiß nit, warum das Schachbrett allweil wackelt? Es steht doch kerzengrad auf dem blanken Tisch?« Er hob das Brett in die Höhe und guckte drunter. Niklaus verstand diesen Wink und atmete erleichtert auf. Und während Luisa sich verstört an die getäfelte Stubenmauer presste, fragte der Pfarrer sehr erstaunt: »Mein lieber Feldwebel? Seid Ihr so ein leidenschaftlicher Freund des Schachspiels, dass Ihr aus Ungeduld, ein gutes Spiel zu sehen, gleich die Haustür eines redlichen Mannes einschlagt?«
Nikodemus Muckenfüßl machte verdutzte Augen. Das Bild, das er in der Stube vorfand, schien seinen Erwartungen nicht zu entsprechen. Seine obrigkeitliche Geistesgegenwart versagte für einige Sekunden. Nun fand er die strenge Dienstmiene und sagte in dem Polizeideutsch, an das er sich in der Pflegerkanzlei gewöhnt hatte: »Vor Reverende prästiere ich in christschuldigem respecto. Aber Spaßettibus wider die von Gott instituierte Obrigkeit sind denen Subjekten nit permittiert. Ich inquirirre sub loco hujus in amtibus.«
»Muckenfüßl«, staunte der Pfarrer, »Ihr redet beinah so gut Latein, wie der Kirchenvater Augustinus.«
»Silentium!«, brüllte der Feldwebel gereizt. Der Scherz des Pfarrers bekehrte ihn nicht zu einer reinlichern Sprache. In diesem Punkte gehorchte er nur seiner Frau, die zuhause, wenn ihr Nikodämerl so unverständlich kanzleielte, immer sagte: »Red deutsch, Du Rindvieh!« In dem Schweigen, das sein Befehl erzeugt hatte, erklärte er würdevoll: »Es ist der wachsamen Obrigkeit ad aures arriviert, dass in loco hujus des in specie verdächtigen Nikolaus Zechmeister verbotene conventicula stattfindlich sind, mit abuso ketzerischer libellis und pamphletica. Ich bin von Amtibus ordiniert, die Namen der Präsenten ad notam zu rapportieren, in quasi eine Orts- und Leibesvisitationem legaliter fürzunehmen.«
Pfarrer Ludwig erhob sich. »So viel Arbeit? Weil wir drei einen Becher Würzwein schlucken und Schach spielen: Meister Niklaus unter seinem eigenen Dach, als Hausgäste der Leibmedikus Seiner Hochfürstlichen Gnaden und ich, von dem ihr wissen solltet, dass ich ein gutkatholischer Priester bin?«
»Der Erzschelm Luther«, rief einer von den Soldaten Gottes, »ist ehnder auch einmal ein katholischer Klosterbruder gewesen.«
»Riebeißel«, gebot der Feldwebel, »Du tuast das Maul tenieren. Der Öberste, der kommandiert, bin ego ipsus.«
»Also?«, fragte der Pfarrer. »Muss ich vorn aufknöpfen oder hinten die Hos herunterlassen?«
Muckenfüßl überhörte zartfühlend diesen derben Scherz. »Reverende steht sub geistlicher judicatura. Ich hab mich nur zu occupieren mit denen weltlichen Personibus.«
Da rief ein schwarzbärtiger Musketier, der keinen Blick von der Haustochter verwandt hatte: »Vor allem müsst man die Weibsleut visitieren. Die sind am flinksten mit dem Verstecken und haben die Plätz dazu, wo leicht zum suchen, aber hart zum finden ist.« Er streckte schon die Fäuste, um Luisa zu fassen.
Hatte sie bei der wachsamen Obrigkeit einen treu besorgten Schutzengel? Der Feldwebel befahl mit gedämpfter Strenge: »Lasst die frommgläubige Jungfer in Fried! Visitieret die Mannsleut!«
Luisa stammelte: »Ich bürg mit Seel und Leben für den Vater. Auch für die Sus.«
»Für uns zwei nit?«, fragte der Pfarrer lachend und wandte sich zu Lewitter, von dem ein Musketier den Kittel herunterschälte. »Das müsst Ihr leiden, guter Simeon Lewitter! Jeden Kranken untersucht Ihr bis auf die Nieren. Da dürft Ihr nit Klagen, wen's vice-versa Euch selber einmal geschieht.« Er guckte zur Tür hinüber. »Luisichen! Jetzt wirst Du aus der Stub gehen müssen. Sonst könnten Deine frommen Augen einen unheiligen Anblick haben. Ein getaufter alter Jud ist als nackichter Adam auch nit schöner, als ein alter, katholisch geborener Christ. Und schau, Luisichen, Du könntest uns zur Begütigung des Schrecks noch einen Becher Würzwein kochen? Oder gleich ein Dutzend! Die tapferen Soldaten Gottes sind wohl auch in der kalten Winternacht einen heißen Schluck nit abhold.«
Er brachte, während Luisa stumm aus der Stube ging, sein Pfeiflein wieder in Brand, ließ sich auf den Sessel nieder und begleitete die ernste Amtshandlung mit freundlichen Reden, die spöttisch unterfüttert waren.
Zwei Soldaten entkleideten und visitierten den Hausherrn und den fürstlichen Leibarzt. Der Musketier, der sich sehr misstrauisch mit Simeon beschäftigte, fand auch in den Schuhen die eingelegten Filzsohlen, lüftete sie und stocherte mit dem Finger drunter.
»Ja, Mensch«, sagte der Pfarrer, »das musst Du genau nehmen! Wer weiß, ob unter dem Pantoffelfilz nit ein Eimerfässl ketzerischen Seelenweins verborgen ist.«
Während der Visitation der beiden Männer schnüffelten Muckenfüssl und Riebeißl in der Stube nach verbotenen Schriften. Sie öffneten jeden Kasten und jede Truhe, rissen jede Schublade heraus und drehten das Unterste zu oberst. Auf den Knien rutschten sie über die Dielen, klopften die Bretter ab und fühlten nach verdächtigen Fugen. Der Pfarrer guckte ihnen lustig zu. Plötzlich scheuerte er heftig seine Nabelgegend und sagte lachend: »Feldwebel, Ihr müsst einen hungrigen Kanzleifloh mitgebracht haben! Der ist hergehupft auf mich, und jetzt beißt er mich in der Magengrub.«
Muckenfüßl brummte was Unverständliches und begann die braune Vertäfelung der Mauer nach Geheimfächern abzuklopfen. Die drei Männer – der eine im schwarzen Priesterkleid und die beiden anderen, die irdisch enthäutet in der Stube standen – sahen nicht nach der Mauerstelle hin, die der Feldwebel mit besonderer Sorgfalt abhämmerte. Aber während sie ruhig miteinander redeten, funkelte ein gespanntes Lauschen in ihren Augen, und alle drei tauschten einen frohen Blick, als Muckenfüßl seine obrigkeitliche, den reinen Gottesglauben behütende Tätigkeit weiter gegen die Tür hin verschob.
Die zwei gründlich Visitierten durften wieder in ihre Kleider schlüpfen.
Luisa und die weißblonde Magd, die einen verzweifelten Sorgenblick auf den Meister heftete, brachten die sieben dampfenden Würzweinbecher. Muckenfüßls Amtsmiene milderte sich beträchtlich. Doch bevor er sich völlig zurückverwandelte in ein wohlwollendes Menschenkind, musste er noch die wirksamste seiner Künste zur Anwendung bringen und sagte mit inquisitorischem Ton: »Gelobt sei Jesus Christus und seine heilige Mutter Maria?«
Meister Niklaus, der Pfarrer, Simeon, Sus und Luisa antworteten: »Von nun an bis in Ewigkeit, Amen.«
Jetzt nickte Muckenfüßl. »Alles in ordine befunden. Will's der Obrigkeit ad notam rapportieren, dass der Angeber ein füreiliges rhinozerum gewesen ist.« Lachend griff er nach einem Würzweinbecher. »Zur Salutation, ihr ehrenwerten Monsiörs!«
Man stieß miteinander an und schwatzte heiter, als wäre nicht das Geringste geschehen in dieser Stunde, die mit der Freiheit dreier Männer gespielt hatte und vorüberging wie eine Fastnachtsposse.
Als der Feldwebel und die Soldaten Gottes ihre Becher geleert hatten, sagte Niklaus zu den beiden Mädchen: »Sind die Leut aus dem Haus, so müsst ihr die beschädigte Tür verstopfen, dass der Schnee nit hereinweht. Dann legt Euch schlafen.«
Wortlos umklammerte Luisa den Arm des Vaters. Dann verließ sie mit jagendem Schritt die Stube. Und Muckenfüßl sagte: »Ich muss die Herren noch specialiter monieren in respecto der Polizeistund.«
»Ja, lieber Feldwebel!«, lachte der Pfarrer. »Da macht nur, dass Ihr Euren christlichen Gottesstreitern flink in die Federn kommt! Ihr seid die einzigen, die sich gegen das obrigkeitliche Gebot versündigen. Meister Niklaus ist in seinem eigenen Haus, ich als Kapitelfähiger des Stiftes steh außerhalb des Polizeigesetzes, und Lewitter als Medikus hat Freipass bei Tag und Nacht.«
»Als Medikus! Ich observier aber mit, dass einer von den Monsiöribus marod ist?«
»Doch! Mir bremselt's in den unteren Gründen. Da hab ich den Medikus nötig. Oder wollt Ihr mich davon erlösen?«
»So ein alter Senior! Und allweil Spaßettibus!« Den Kopf schüttelnd, ging Muckenfüßl zur Türe. »Dass die Menschheit doch nie zu Verstand arriviert.«
Während die Schritte der Musketiere über die Stiege hinunterpolterten, standen die drei Männer ernst um den Tisch herum. Als wäre in jedem der gleiche Gedanke, reichten sie einander die Hände. Und Niklaus murmelte durch die Zähne: »Wär man kein Rebell, sie täten einen machen dazu!«
»Ist schon wahr«, nickte der Pfarrer, »einen Aufruhr hat nie das Volk gemacht. Allweil fabriziert ihn die Obrigkeit. Jedes sinnlose Polizeiverbot ist Mist für den Acker, auf dem was Widerspenstiges aufgeht.«
Simeon schwieg. Meister Niklaus nahm den Kopf zwischen die Hände: »Was für eine Zeit ist das! Sie stellt die Lumpen als Wächter vor jedes Ding, das wahr und heilig ist.« Er lauschte. Im Haus kein fremder Laut mehr. Nur ein Brettergerappel drunten im Flur.
Pfarrer Ludwigs braune Warze tanzte zwischen seinen Wangenfalten. »So! Jetzt können die heimlichen Gewissensflöh wieder aushupfen.« Er löste die Knieschnalle und schlenkerte das Bein. Ein Papierknäuel rutschte aus der seidenen Finsternis heraus. »Guck! Einer ist schon da. Allweil sag ich's: Der ewige Menschendrang zum Licht!« Er dröselte das Knäuel auseinander. »Wo bleibt der hebräische Philosoph? Das ist der evangelische Dorfapostel Josef Schaitberger. Ein Ketzer.« Lachend hob er das Blatt zum Kerzenreif hinauf. Niklaus machte eine Bewegung, als möchte er hindern, was der Pfarrer tat. Da züngelte schon die rasche Flamme. »Lass brennen, Herzbruder! Dein Haus wird ärmer um eine Gefahr.« Die Papierflamme war klein geworden, war herab gebrannt bis zu den Fingerspitzen des Pfarrers. Nun blies er kräftig. In vielen Flocken, von denen ein paar noch glühten, schwamm die Asche in die Luft hinaus. Wieder schüttelte Pfarrer Ludwig die schwarze Seide seiner Hose. »Guck, Simmi! Ist auch schon da! Dein neufärbiger Philosoph! Ein gefährliches Mannsbild! Weil er am tiefsten ist in seiner Weisheit. Gelesen haben wir sie. Mich rührt's nit an. Dem Niklaus ist sie gleichgiltig. Du, Simmi, hast sie im Köpfl. Besser, wir lassen das Amsterdamer Tulpenknöspel verschwinden. ›Feuer ist allweil hilfreich!‹, sagten vor anno Towack die Hexenrichter, wenn sie die alten Weiblen verbronnen haben.« Wieder eine Flamme. Wieder das Auseinanderschwimmen der Asche.
Nun saßen die drei am Tisch. Der Pfarrer fasste Lewitters Hand. »Erzähl uns von ihm! Wann ist er gestorben?«
»Vor 56 Jahren, an der Schwindsucht.«
»Weisheit, die Tausende begnaden kann, verbrennt die Seelen, in denen sie wächst.«
»Er hat den Tod in der Werkstatt eingesogen, als Glasschleifer. Die jüdische Synagoge von Amsterdam hat ihn ausgestoßen als Verfluchten. Und er ist von den wärmsten Menschen einer gewesen, ein Erdenkind mit dem ewigen Gottesfunken in der Seel, mit dem Durst nach Wahrheit in Blut und Gehirn.«
Die Augen glänzend von einem kummervollen Träumen, sah Niklaus ins Leere. »Wann wird das kommen, dass jeder leben darf nach seiner Farb? Die Zeit, wo jeder spürt, dass er mit gleichen Rechten ein Bruder des andern ist? Mensch neben Mensch?«
Die alte Kastenuhr mit den tiefen Glockentönen schlug Mitternacht. Pfarrer Ludwig erhob sich. »Die Zeit geht auf den Morgen zu. Lasset uns beten als Brüder, die dem Licht entgegenharren.«
Die beiden anderen standen schweigend auf, und Meister Niklaus ging der Wandstelle zu, die der Feldwebel des Pflegeramtes mit erhöhter Aufmerksamkeit abgepocht hatte. Er drückte auf einen Nagelstift, der verborgen in der Täfelung saß. Die mit einer dicken Gipsmasse unterlegte Wandverschalung öffnete sich doppeltürig und zeigte in der Mauergrotte ein geschnitztes Bild, das einer mittelalterlichen Weihnachtskrippe glich und von kleinen farbigen Lämpchen mystisch erleuchtet war – ein Werk, in dem sich innige Kunst und kindliche Einfalt miteinander verwoben.
Eine plastische, durch Farben belebte Berglandschaft unter blauem Himmel. Der höchste Gipfel hatte die gebrochene Zahngestalt des Wazmann. Auf den Höhen noch der Winter, im Tal der Frühling mit Blumen, mit grünen Wiesen und belaubten Wäldchen. Kleine Dörfer mit zierlichen Hütten, in deren aus Glassplittern gebildeten Fenstern das Licht der bunten Ämpelchen schimmerte, als wär's ein Morgen um die Stunde, in der die Sonne kommt. Die Herden auf der Weide. Viele winzige Menschenfigürchen dazwischen: Bauern und Sennleute, Köhler und Holzfäller, ein Jäger mit Büchse und Hifthorn, ein Floß mit Flößern auf den Glasbuckeln des Baches, am Ufer des Wassers ein Fischer mit der Angelrute, auf der Straße ein Trupp Musketiere im Marsch. Über grüner Anhöhe ein Kirchlein, aus dessen Tor eine Prozession mit vielen Fahnen heraus schreitet. Ganz vorn zur Linken ein Häuschen, in dessen Stube man hineinsieht. Es ist die Werkstätte eines Spielzeugschnitzers, der mit seinem Weib und vielen Kindern bei der Heimarbeit am Tisch sitzt. Und zur Rechten eine offene Scheune, in welcher alte und junge Leute andächtig um einen Greis herumknien, der aus einem Buch vorliest. Zwischen diesen Gruppen ist die Erde geöffnet, und man sieht hinunter in die Schachttiefen des Salzbergwerkes, sieht die Salzhauer bei der Arbeit, sieht die Förderung mit den rollenden Hunden.
Dieses Kleine, Feine und Zierliche war nur ein Rahmen für den größeren Mittelpunkt des Bildes. Da stand auf blumigem Hügel ein Kreuz errichtet, mit der Gestalt des leidenden Erlösers. Unter dem Kreuz beugt die Heilandsmutter, gestützt von den Armen des Johannes, sich zärtlich nieder und umschützt mit ihrem blauen, sternbestickten Mantel drei kleinere Figürchen: Einen katholischen Priester mit der Stola, den Moses mit den Gesetztafeln und einen evangelischen Prediger mit dem Kelch.
Ein leises Knistern war in den Ampelflämmchen, und der dünne Rauch, der sich in der Grotte gesammelt hatte, quoll wie Nebel um die Schneegipfel der Berge und begann hinaufzuströmen gegen die Stubendecke.
Stumm, die Herzen erfüllt von träumender Inbrunst, standen die drei Männer vor dem Bild, das so ergreifend wie kindlich, so tiefsinnig wie voll Einfalt war. Und dieses Schweigen war das verbrüderte Gebet ihres duldsamen Glaubens, war das ungesungene Lied ihrer gemeinsamen Hoffnung auf einen Menschenmorgen, von dem sie wussten, dass er kommen muss – bald, meinte der eine; nach Jahrzehnten, glaubte der andere; nach Jahrhunderten, hoffte der dritte. Und nicht die Farben und Figürchen, nicht die Lichter und Dämmerungen des Bildes weckten die Andacht in ihren Herzen. Ihr andächtiger Glaube war es, der ihnen das tote Gestaltengewimmel belebte und seine flimmernde Enge weitete zum Licht durchfluteten Bild einer werdenden Welt.
Da hob der Pfarrer lauschend den Kopf. »Niklaus! Ich hör was.«
Der Meister tat einen schweren Atemzug. »Hinter der Mauer ist meines Mädels Kammer. Da liegt der arme Klosterspatz auf den Knien und litaneit in Höllenangst um unsere drei verlorenen Seelen.«
War der Sturm erloschen? Außerhalb der Wände kein Rauschen und Sausen mehr. Draußen die stumm gewordene Nacht. Auch Stille im Haus. Nur immer dieser eine gleiche Laut, diese stammelnde Mädchenstimme.
Eine weiße Kammer, freundlich anzusehen. Man merkte an ihrem Gerät, wie zärtlich dieser Raum bereitet war von der Liebe eines Vaters, der sein Kind in Sehnsucht erwartet hatte nach Jahren des Leidens.
Die Kerze flackerte auf dem Gesims des von schweren Läden verschlossenen Fenster, neben dem weiß verhangenen Kastenbett. Schon entkleidet, lag Luisa auf den Knien vor einer Truhe, die ineinander gekrampften Hände hingerückt gegen ein Altärchen, das zwischen Leuchtern und künstlichen Blumen unter schimmerndem Glassturz eine von Goldflittern glitzernde Madonna mit dem wächsernen Jesuskind zeigte. Fünf Ave Maria, immer mit der gleichen bebenden Stimme, die wie ein leises Schreien aus angstvoller Seele klang. Und so lange betete Luisa, bis der Glaube an die Hilfe wieder leuchtend in ihrem Herzen war. Sie bekreuzte die Stirn, den Mund und die knospende Brust, beugte sich vor und küsste das kalte Glas, das sich behauchte von ihrem Atem. Dann trat sie auf den nackten Sohlen zum Kastenbett und begann die braunblonden Flechten zu lösen. Gleich einem schimmernden Mantel fiel ihr das Haar um Nacken und Schultern. Mit der Linken streifte sie die linde Woge über den rechten Arm zurück und wollte die Hände heben, um das Haar zu knüpfen. Da weiteten sich ihre Augen. Regungslos betrachtete sie den weißen Arm. Der hatte zwischen Schulter und Ellenbogen vier blaue, strichförmige Male. Lange verstand sie das nicht. Nun eine Schreckbewegung, ein Erstarren ihres Gesichtes. Es waren die Denkzeichen jener stählernen Jägerfaust, die bei der Haustür im Schneegestöber ihren Arm umklammert hatte. Und ihr war, als klänge wieder die erregte Jünglingsstimme: »Es ist ein heilig Ding, da wird ein Messer durchgestoßen, noch heut in der Nacht!« Wie eine Sinnlose sprang sie auf das kupferne Weihwasserkesselchen zu, tauchte die ganze Hand hinein und wusch die blauen Male, immer fröstelnd, als berühre sie etwas Hässliches. Dann blies sie die Kerze aus und betete in der Finsternis mit flehendem Laut: »Hilf mir, heilige Mutter Marie! Tu mich reinigen an Leib und Seel!«
Das Kastenbett krachte ein bisschen, als es die leichte Last einer zarten Jugend empfing.
Luisa lag unbeweglich. Ihr Atem ging schwer. Hatte ihr Arm eine Wunde? Von der Stelle der blauen Male rann es ihr wie Feuer ins Blut. Und immer sah sie ein Bild in der Finsternis: Wehendes Blondhaar, eine braune Stirn und zwei stahlblaue, sehnsüchtige Jünglingsaugen, die von hundert silbernen Mücken umflogen waren.
Die Hände über der Brust verflechtend, fing sie zu beten an. Das unheilige Bild verschwand nicht. Sie setzte sich in den Kissen auf und hob die gefalteten Hände. Die Heiligen, die sie herbei schrie, halfen nicht und wollten das unreine Bild nicht auslöschen, wollten den Unsichtbaren, der sich sichtbar machte, nicht zurückstoßen in die Finsternis.
Mit klagendem Wehlaut hob Luisa sich auf die Knie, beugte sich über das Fußgestell des Bettes und riss die Tür auf, die in die anstoßende Kammer führte. »Gute Sus? Du tust noch allweil nit schlafen gelt?«
Eine müde Stimme: »Mögen tät ich. Mein Schlaf ist, ich weiß nit, wo.«
»Ich tu Dich bitten, komm ein bissl zu mir!«
»Kind, was ist Dir?« Etwas Graues huschte lautlos aus dem Dunkel heraus. »Du bist doch nit krank?«
»Krank nit. Ich tu mich sorgen, dass ich sündig bin, weil ich höllische Gespenster seh!«
»Geh, Du Närrle!«
»Tu mich halsen, Sus! Noch fester! Jetzt ist mir wohl. Und alles ist wieder schwarz. Komm, Sus, tu beten mit mir.«
Leis erwiderte das Mädel: »Beten kann ich nit. Allweil muss ich an die Soldaten Gottes denken, und was dem guten Herren hätt drohen können.«
Es wurde laut im Haus. Eine Türe ging. Schritte und Stimmen, am deutlichsten die Stimme des Meisters.
Da tauchte plötzlich die Sus das Gesicht gegen den Schoß der Haustochter und brach in erwürgtes Schluchzen aus.
»Sus? Du Liebe! Was hast Du denn?«
»Mir ist so weh, ich kann's nit sagen. Es bringt mich noch um.«
»Das sind die Soldaten nit. Das ist der Vater, den der Himmel jetzt erlöst – von den anderen zwei, die ich nit leiden mag. Gott tut mich warnen vor ihnen. Die bet ich noch fort aus unserem Haus. Sei still, liebe Sus! Da must Du nit Angst haben.«
»Es ist nit Angst. Es ist die Zeit. Die liegt auf jedem als wie ein Stein.«
»Die Zeit muss keiner fürchten, der gläubig ist. Komm, Sus, Du frierst. Ich spür, wie Du zitterst. Lass Dich zudecken! Einen Menschen haben, ist gut.«
Die drei Männer, die draußen hinunter gingen über die Stiege, hatten eine Weile im Flur zu schaffen, bis sie die mit Brettern und Holzscheiten verbarrikadierte Türe frei bekamen.
Durch die Klüfte der zerschlagenen Haustür wehte kein Schnee mehr herein. Das Gestöber war versiegt. Draußen eine schweigsame Winternacht, durch deren ziehendes Gewölk der Vollmond herunterglänzte.
Während Meister Niklaus im Flur die Barrikade wieder baute, schritten Pfarrer Ludwig und Simeon Lewitter lautlos durch den Schnee.
Hunde schlugen an, bald nah, bald fern, mit Stimmen, die halb erloschen im Rauschen der Ache.
Simeon flüsterte: »Die Nacht ist wieder ohne Ruh.«
»Es wandern die Unsichtbaren.«
Die beiden folgten der Straße. Da fasste der Pfarrer den Arm des Freundes und deutete über eine verschneite Wiese hinaus. »Dort! Siehst Du's?«
Etwas Wunderliches war zu sehen: Ein im Mondschein gleitender Menschenschatten, ohne dass man einen Menschen sah.
Rasch watete Pfarrer Ludwig in die Wiese hinaus und stand vor einer Gestalt, die bis zu den Füßen in Leinwand gekleidet war, so weiß wie der Schnee, über dem Kopf eine Kapuze mit Löchern für die Augen, in denen es funkelte gleich geschliffenen Gläsern. »Wer bist Du?« Keine Antwort. Der Pfarrer lacht eine bisschen. »Ich bin nit gefährlich. Nur neugierig wie Kinder und alte Leut. Gehst Du zum Toten Mann? Oder kommst du von ihm?« Keine Antwort. Nur das Strömen eines schweren Atems. »Leupolt? Bist Du's?«
»Wohl.«
»Was suchst Du noch?«
»In Sorg bin ich gewesen. Um den Meister. Jetzt weiß ich, wer bei ihm gewesen ist. Da bin ich ledig aller Sorg.«
»Heut hast du ihm viel zulieb getan. Wie hast Du wissen können, dass die Soldaten Gottes bei ihm einkehren?«
»Der Vater hat's heimgebracht vom Pflegeramt und hat mit der Mutter geredet. Ich hab's gehört.«
»So? Und da bist Du weg gesprungen über Vater und Mutter! Und hast dem anderen geholfen? Warum?«
»Weil ich's tun hab müssen.«
»Als sein Bruder in Gott? Gelt, ja? Und sonst aus keinem anderen Grund!« Wieder lachte der Pfarrer. »Geh schlafen, lieber Bub! Die Gefahr ist vorbei. Steig nur nit gar zu fleißig auf den Toten Mann! Dir vergönn ich ein lebendiges Glück. Will auch helfen dazu, so gut ich's versteh. Zwei Herrgötter sollen Dich hüten, der Deine und der meine. Doppelt genäht hält allweil besser.« Der Pfarrer stapfte durch den Schnee zur Straße zurück. Als er das Gesicht wandte, sah er keine Gestalt mehr, nur noch den unbeweglichen Menschenschatten.
3.
In den Schneekristallen funkelte der Mondschein mit farbigen Blitzen.
Lewitter stellte keine Frage, als der Pfarrer wieder an seiner Seite war. Wortlos wanderten die beiden gegen den Markt hinüber und kamen an einem neuen, zierlichen Bau vorbei, der hinter hoher Mauer in einem Garten stand. Ein feiner, zirpender Spinettklang war zu vernehmen. »Hörst Du?«, flüsterte Pfarrer Ludwig. »Die Allergnädigste ist noch munter.«
Simeon schwieg.
Als sie an der Mauer vorüber waren, murrte der Pfarrer: »Hast Du beim Tor die frischen Fußstapfen im Schnee gesehen? Süße Mitternachtsfährten! Und der Allergenädigste trägt die Unkosten. Maîtresse en titre heißen sie das in der fürnehmen Welt. Es gibt keine Ferkelei, für die man jetzt nit einen parisischen Namen findet, der allen Lebensdreck in eine höfische Finess verwandelt. Wer's von den Herren nit mitmacht, glaubt nit Fürst zu sein. Er wär ein Minderwertiger unter seinen Standesbrüdern, wenn er dem französischen Hof nit alles nachschustert: Die Sittenverderbnis, das Schuldenmachen, die Karossen und Läufer, die Peruckenfasnacht, die gestutzte Gärtnerei, den ganzen Jägerschwindel à la mode und das ›Große Jagen‹ auf die haufenweis zusammen gehetzte Kreatur – Mensch oder Vieh!« Der Pfarrer verstummte nicht, obwohl ihn Simeon beschwichtigend am Mantel zupfte. »Ach, Bruder, die Zeit ist ein übles Kehrichtfass voll Heuchelei und Sinnbrodel, voll Grausamkeit und verwesenden Dingen. Man sollt die ganze Schweinerei verbrennen, um aus der Asche was Neues wachsen zu lassen. Ob der Mann schon geboren ist, der das fertig bringt auf dem deutschen Acker?«
Lewitter atmete auf, weil der andere schwieg, und machte flinkere Schritte.
Ein bisschen lachend, zürnte der Pfarrer: »Allweil bist Du wie eine Maus. So scheu, so flink, so lautlos.«
Simeons Stimme war wie ein Hauch. »Der Schnee verschärft jeden Laut. Und wie stiller eine Mauer ist, um so offener sind ihre Ohren.«
»Recht hast Du! Siebzig Jahr! Und noch allweil bin ich der gleiche Hammelskopf, der sich die Hörner nit abgestoßen hat.«
Sie gingen in der Marktgasse schweigend an der Häuserzeile entlang, die im schwarzen Mondschatten lag. Außerhalb des Dunkels funkelte der Schnee im bleichen Licht, und die weißen Mauern der anderen Häuserseite sahen unter den dicken Winterkappen aus wie blasse Riesengesichter mit vielen finsteren Augen. Bei der Gasse, wo die Wege der beiden sich schieden, reichten sie einander die Hände. Jeder flüsterte die zwei gleichen Worte: »Mensch bleiben!« Dann der Pfarrer: »Das wird mich nit schlafen lassen heut.«
»Die Sorg um den Niklaus?«
»Auch. Und was Du uns fürgelesen hast.«
Nun lächelte Lewitter. »Du hast doch gesagt, Dich rührt's nit an.«
»Ob das allweil so ist? Bei den neuen, tiefen Gedanken? Es ist wie ein Funken, den man nit fallen spürt in sich. Und gählings wärmt er und wird ein Feuer, das leuchtet! – Ich will mir's heut in der Nacht noch aufschreiben. Guten Morgen, mein Simmi!« Lautlos ging der Pfarrer durch den funkelnden Schnee davon. Lewitter zappelte in die enge Gasse hinein, in der nur die Giebel noch Mondschein hatten. Nun schrak das Männchen heftig zusammen, weil es auf der Steinschwelle seiner Haustür ein zusammen gekrümmtes Mannsbild sitzen sah. »Wer bist Du? Gelobt sei Jesus Christus und die heilige Mutter Maria!«
Der junge Bauer antwortete, vor Frost mit den Zähnen schnatternd: »Von nun an bis in Ewigkeit, Amen! Der Christl Haynacher bin ich.«
Lewitter schien aufzuatmen. »Kommst du wegen Deines Weibes?«
»Wohl, Herr! Tut mir die Lieb und kommt zu meiner Martle! Ich bin beim Feldscher gewesen. Der hat nit raus mögen aus dem warmen Bett. Aber das Weibl kreistet, es ist zum Erbarmen.«
»Ich komme gleich.« Als Lewitter sich gegen die Schwelle wandte, pfiff er leis, und die Tür öffnete sich. Er trat in einen finsteren Flur, in dem ein angenehmer Duft war, wie gemischt aus den Gerüchen einer Apotheke und eines Gewürzlagers. Hinter ihm wurde die Tür verriegelt. »Eil Dich, Lena«, flüsterte Simeon in das Dunkel, »hol mir die braune Tasch!« Während er über eine steile Stiege hinaufhastete, glänzte ein matter Lichtschimmer im Hausflur. Vor einer Türe schob Lewitter die Füße in zwei große Filzpantoffel, um den Schnee nicht hineinzutragen in diese Stube, die das Heiligtum seines einsam gewordenen Lebens war.
Ein großer Raum mit vielen Teppichen. Die zwei Fenster mit dicken Innenläden verschlossen, durch Eisenstangen verwahrt. Von der Decke hing eine alte Silberampel herunter, deren Licht von einer roten Glastulpe umhüllt war. Zierliche Stühlchen und ein Tisch, an dem die eingelegte Perlmutter wie Rubine funkelte. Allerlei Frauengerät, Haubenstöcke und Kochgeschirr, ein Spinnrädchen und ein Garnhaspel, ein kleiner Webstuhl und ein Gewürzmörser. An den Wänden waren hohe Gestelle mit Spielzeug in solcher Menge angeräumt, dass die Stube fast aussah wie ein Kramladen der Kinderfreude.
Während Lewitter in dem roten Lampenlicht huschend umherging und alles Nahe mit zärtlicher Hand berührte, brannte in seinen Augen eine dürstende Sehnsucht. Sein Gesicht hatte die steinerne Glätte verloren und war durchwühlt von einer schmerzenden Erschütterung. So oft er diese Stube betrat, seit fünfzehn Jahren, immer war es so. Immer wurde das Glück in ihm lebendig, das er verloren hatte, und immer musste er jener grauenvollen Stunde denken, in der er wie ein Irrsinniger an den Leichen seines Weibes und seiner Kinder vorübergetaumelt war und unter den Fäusten wahnwitziger Menschen geschrieen hatte: »Ich glaube, ich glaube, ich lass mich taufen!«
Müd und zitternd, fiel er auf eines der kleinen Stühlchen hin, bedeckte das Gesicht mit den Händen, saß unbeweglich und fuhr erschrocken auf, wie geweckt und gerüttelt von einer Pflicht seines Lebens. Seufzend ließ er die Augen hingleiten über das verstaubte Spielzeug, hatte wieder das steinerne Gesicht, das geduldige Lächeln, murmelte ein Segenswort seines unverlorenen Väterglaubens und verließ die Stube. Als er die Treppe hinunter stieg, erlosch das Licht im Flur. »Hast Du die braune Tasch?« Er fühlte sie vor seinen Händen und trat in den Schnee hinaus. »Komm, Christl!«
»Der Himmel soll's Euch lohnen, guter Herr!«
Simeon lächelte: »Heut sagst Du: ›Guter Herr!‹ Am Weihnachtsabend, wie ich auf vereistem Weg an Dich angestoßen bin, da hast Du ›Saujud‹ gesagt.«
Verlegen stammelte der junge Bauer: »Ein Mensch im Ärger ist dumm. Mein armes Weibl wird's nit entgelten müssen. Selbigs Mal, am heiligen Abend, hab ich einen schiechen Verdruss hinunterschlucken müssen. Ein Mensch, der Unrecht leidet, wird allweil ein Lümmel.«
Die beiden überschritten den Marktplatz, um hinunterzuwandern ins Tal der Ache. Das Bauernlehen des Haynacher lag da drunten, hinter der Saline Frauenreuth. Vor dem Tor des Stiftes sprang ihnen die Schildwach entgegen. Die beiden mussten ihre Namen nennen, ehe sie weiter durften. Der junge Bauer, ärgerlich über den Aufenthalt, knirschte zornig vor sich hin: »Gescheiter, er tät den Unsichtbaren nach springen, eh dass er einem Gutgläubigen den Weg verstellt. Wie ich herauf gelaufen bin, ist überall die Nacht lebendig gewesen. Die im Stift da droben haben noch allweil blinde Augen.«
»Die brauchst Du ihnen nit zu öffnen, Christl! Sag mir lieber, was ist mit Deinem Weib? An Weihnachten hab ich gesehen, dass sie gesegnet ist. Wär's an der Zeit mit ihr? Hat Dich die Hebmutter geschickt?«
Der junge Bauer schüttelte den Kopf. »Ich bin selber gelaufen, aber ich weiß nimmer, was das ist. Die Hasenknopfin –«
Lewitter wiederholte rasch: »Die Hasenknopfin?«
Zögernd sagte der junge Bauer: »Wohl! Die Hebmutter von Unterstein.«
»Dein Lehen gehört zum Markt. Warum musst du die Hebmutter von Unterstein haben?«
»Die vom Markt«, erwiderte Christl scheu, »die mag mein Weib nit. Es ist ein Kreuz, Herr!«
Mehr brauchte Simeon nicht zu hören. Nun wusste er, dass die Haynacherin eine Unsichtbare war, die ihren Leib von einer katholischen Wehmutter nicht berühren ließ. »Dein Weib muss leiden?«
»Heut nach der zehnten Stund, da hat sie zu schreien angehoben und ist wie unsinnig gewesen.«
»Ein natürlich Ding, Christl!«
Wieder schüttelte der junge Haynacher den Kopf. »Vor anderthalb Jahren hat mir meine Martle ein Bübl geboren. Sie sagt, da wär's anders gewesen. Und die Hasenknopfin kennt sich nimmer aus. Sie meint, es wär schon drei Wochen über die Zeit. In mir ist eine Angst –«
»Die Hasenknopfin wird falsch gerechnet haben. Hast du Feuer daheim?«
»Der Ofen ist warm, der Herd ist kalt.«
»So spring voraus, mach Feuer auf dem Herd, dass Du kochendes Wasser hast, bis ich komme.«
Der Bauer fing zu rennen an, dass ihm der schnellste Läufer des Fürstenpropstes nicht nachgekommen wäre. Diese straffe, gesunde Gestalt, die noch was Jünglingshaftes hatte, schien Sehnen von Stahl zu besitzen. Der graue Lodenmantel wehte dem Christl vom Hals weg, und das harte Gesicht mit dem kurzen Braunbart war nach vorne gestreckt. So rannte er durch den Mondschein wie ein vom Tod Gehetzter. Der gutgläubige Christl Haynacher musste seine Martle, obwohl sie eine Unsichtbare war, von Herzen lieb haben. Er rannte keuchend durch die Dampfwolken, die das Frauenreuter Salinenhaus umdunsteten. Über eine Holzbrücke hinüber, durch ein kleines Gärtl und in das niedere Haus. »Tu Dich getrösten, Martle!«, rief er atemlos in die Schlafkammer, in der das stöhnende Weib die Hände nach ihm streckte. »Gleich kommt der Jud. Der ist geschickter als der Feldscher. Jetzt muss ich zum Herd. Der Jud will haben, dass ich Wasser sied.« Er sprang zur Küche.
Bei allen Schmerzen wurde das junge Weib von der Sorge geplagt, dass der Mann eine falsche Pfanne nehmen könnte. Angstvoll schrie sie ihm nach: »Nit das neue Kupferpfändl. Das müssen wir aufheben fürs Kind. Nimm den alten Blechhafen!«
Christl dachte: ›Sie sieht nit, was ich nimm.‹ Er hasste das kommende Kind, das sein Weib so schreien machte in Schmerzen, und für seine Martele war ihm die neue Kupferpfanne gerade gut genug. Wär' eine silberne im Haus gewesen, der Christl hätte sie genommen. Eine Minute, und das Feuer züngelte auf dem offenen Herd, die Kupferpfanne hing darüber und rauchte. Jetzt konnte Christl zum Bett seines Weibes springen. Am Türpfosten zwischen den beiden Wohnräumen hing eine qualmende Specklampe und beleuchtete die Stube und die Kammer. In der Stube stand neben dem warmen Feuersteinofen die Wiege, in der das Bübchen schlief. Es hatte rote Wangen und schien den braunen Krausbart des Vaters als Perücke zu tragen. Christl warf einen zärtlichen Blick auf das klein Bürschl, das er jetzt doppelt lieb hatte, weil es vor seinem ersten Tag die Mutter nicht so grausam geplagt hatte, wie dieses neue kommende Leidwesen, das er hasste. Als er hineinsprang in die kleine Kammer, die nicht viel größer war als das plumpe Doppelbett, kam er gerade recht, um dem jungen Weib, das sich in Schmerzen wand, die verkrampften Hände zu lösen. Seine Nähe schien sie ruhiger zu machen. Er lag vor dem Bett auf den Knien, und Martle, ihre Pein verbeißend, umklammerte seine braunen Fäuste. Ihr hübsches Gesicht war entstellt, und das wirre Blondhaar hing um die von Schweiß überglitzerten Wangen. Kaum verständlich stöhnte sie: »Mann, ach Mann, ich tu nit gebären, ich glaub, dass ich sterben muss.«
Er bettelte: »Herzweibl, magst Du nit ein bissl christliche Besinnung haben? Magst Du nit einen frommen Notschrei tun zu den vierzehn ewigen Helfern?«
Heftig wehrte das Weib: »Sterben, wenn's sein muss. Nit lügen! Täten die Soldaten Gottes kommen, jetzt tät ich es sagen, dass ich eine Unsichtbare bin.«
Er klagte in Gram und Zorn: »Der Himmel tut Dich büßen. Not und Elend will kommen über uns, weil Du weit bist von meinem Herrgott und Dich versündigst am rechten Glauben.«
»Elend und Not kommt über mich, weil Du fern bist von meiner Seligkeit. Du bist so weit von mir – schier sehen Dich meine Augen nimmer.« Nach diesen Worten ein gellender Schrei ihrer Qual.
Nicht dieser Schrei erschütterte ihn. Was ihm das Herz bedrückte, war der Blick der Liebe, der nach ihm dürstete aus ihren verstörten Augen. Wie ein Wahnwitziger keuchte er: »Schick mich den Höllenweg! Ich tu's, Martle, nur dass ich Dich nimmer leiden seh! Soll ich Dir einen holen von den Deinigen? Dass er Dich tröstet?«
Sie zog seine Hände an ihren Hals. »Mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, haben mich verstoßen. Von den anderen, die meine Geschwister sind in Gott, därf ich keinen beim Namen nennen. Magst du mir was zulieb tun, so hol mir mein Paradisgärtl und tu mir's unter das Kissen legen. Dann ist mir leichter.«
Christl sagte wie ein Gefesselter: »Ich tu mich versündigen für alle Ewigkeit. Wo hast du das Büchl?«
Sie spähte gegen die Stubentür und lauschte. Dann zog sie ihn an sich und flüsterte an seinem Ohr: »In der Milchkammer steht die Kleienkist. Tief musst du unter die Klei hinunter greifen. Ganz unten ist das Mehlsäckl versteckt. Im Mehl, da findest du einen Pack. Sieben Lodenflech sind drum gewickelt.« Ihre Augen begannen zu glänzen. »Da drinnen ist das heilige Büchl.«
»Martle, ich muss es bringen.« Er sah ihr in die glücklichen Augen. So hatte sie ihn angesehen vor drei Jahren, am Hochzeitstag, als er nach dem Kirchenritt die junge Frau heruntergehoben hatte vom rot gesattelten Brautschimmel. Und während er hinaustaumelte durch die Stube, raunte er wie ein Verzweifelter: »Im Mehlsäckl! Jetzt hat sie's im Mehlsäckl. Und hundertmal hab ich das ganze Haus schon ausgesucht nach dem gottverfluchten Teufelsgut!«
Als er das Buch – das evangelische Paradiesgärtlein des Johann Arndt – gefunden und aus den mehligen Lappen herausgewickelt hatte, musste er draufspeien in seinem frommen Christenzorn. Erschrocken wischte er den Speichel wieder fort und hatte, als er in die Schlafkammer trat und sein Weib in Freude die Hände strecken sah, das quälende Gefühl: Dass er nicht hätte beschimpfen sollen, was seinem Weib heilig war. Sie selber schob das Buch unter das vom Schweiß ihrer Schmerzen durchnässte Kissen. Nun streckte sie sich aus, faltete die Hände und sprach mit lächelnder Innigkeit die leisen Worte: »Vergelts Gott, Du Lieber! So viel wohl ist mir jetzt. Gott verlasst die Seinen nit, die zu ihm stehen in Treu und Redlichkeit.« Während Christl stumm sein lächelndes Weib betrachtete, als geschähe an ihr ein Wunder, klang ein hartes Pochen durch das stille Haus: Lewitter klopfte an der Schwelle den Schnee von den Schuhen. In Freude stammelte der junge Bauer: »Martle! Die Hilf ist da!« Er rannte in den Flur und wollte fast verzweifeln, weil Lewitter so lange brauchte, um sich aus dem Pelz herauszuschälen und auf dem Herd die Hände in heißem Wasser zu waschen.
Mit der braunen Tasche ging Simeon in die Kammer und zündete, während er freundlich zu der Leidenden redete, eine hell brennende Kerze an. Dann schloss er die Türe. Christl musste in der Stube bleiben. In qualvoller Erwartung saß er auf der Ofenbank. Um einen Trost für sein hämmerndes Herz zu haben, nahm er sein Büberl aus der Wiege und sang mit erwürgter Stimme ein Schlummerlied, obwohl der Kleine aus dem festen Kinderschlaf gar nicht erwacht war. Zwischen den Strophen des Lieds stammelte er seine Stoßgebete, immer eines, mit dem er die Heiligen um Hilfe anbettelte für sein leidendes Weib, dann eines, mit dem er Gott um Verzeihung bat für die Todsünde, die er durch Förderung der Gottwidrigkeit einer Unsichtbaren begangen hatte. Da öffnete Lewitter die Kammertür. Er schien erregt zu sein. »Ich hab Deinem Weib was geben können, was die Schmerzen lindert. Aber man muss die Hasenknopfin holen. Allein möcht ich auch nicht bleiben. Kannst Du nit einen Nachbar drum anreden, dass er zur Wehmutter geht?«
»Wohl!« Christl presste die Wange an das schlafheiße Gesicht seines Bübchens und legte das Kind in die Wiege. »Ich spring, was ich springen kann.« Durch den Schnee und über den Zaun hinüber. In dem Haus, an dem er pochte, wollte niemand erwachen. Oder war niemand daheim? Waren das auch solche, die sich unsichtbar machen in der Schneenacht? Über die Straße zum nächsten Haus. Hier wurde der alte Bauer wach und murrte in der Fensterlucke: »Aus dem Markt will ich die Hebmutter holen. Der Hasenknopfin geh ich nit ums Leben ins Haus.«
»Jesus, Jesus, ich brauch aber die Hasenknopfin.«
»So musst Du selber nach Unterstein. Gelobt sei Jesus Christus und die heilige Mutter Marie.« Der alte Bauer schloss das Fenster und sagte in der Stube zu seinem Weib: »Jetzt muss der Haynacher auch nimmer rechtgläubig sein. Er hat den Fegfeuergruß versagt.« Christl hatte der gutkatholischen Antwort nur aus Schreck vergessen. Und während er sich besann, zu welchem Haus er nun rennen sollte, sah er von der Saline her einen Menschen durch die Mondhelle kommen. Im Schneelicht erkannte Christl den Jäger Leupolt Raurisser, mit der Feuersteinflinte unter dem Radmantel. »Jesus, Christbruder, was hast Du für einen Weg?«
»Zum Königssee.«
»Gott sei Lob und Dank. Da musst du durch Unterstein. Magst Du nit der Hasenknopfin ausrichten, sie soll zur Haynacherin kommen, gleich! Magst Du es tun?«
»Gern, Bauer!«
»Vergelts Gott tausend Mal!« Das sagte Christl, während er schon davon sprang. Dann fiel ihm ein, dass er den Ablassgruß vergessen hatte. Im Springen schrie er über die Schulter: »Gelobt sie Jesus Christus und die heilige Mutter Marie!«
Leupolt gab keine Antwort. Rasch, mit federnden Schritten, wanderte er durch den Mondschein, aufwärts an der Ache. Der Schnee knirschte unter seinen eisenbeschlagenen Schuhen. Als er den Wald erreichte, fuhr ein Wildschweinrudel, das von den Untersteiner Sümpfen kam, an ihm vorüber und brach mit Knacken und Rauschen durch den Wald. Nun kam er wieder zu offenem Feld, kam zu den ersten Häusern von Unterstein. Das Haus der Hasenknopfin lag mitten im Dorf, an der Straße. Leupolt pochte. Es rührte sich was in der Stube, das Fenster wurde geöffnet, und eine leise Mädchenstimme fragte: »Was willst Du?«
»Die Hasenknopfin soll zur Haynacherin kommen.«
Ein misstrauisches Zögern. »Die Mutter ist auswärts.«
»Ich will zu ihr hinlaufen. Wo ist sie?«
Das Mädel schwieg, weil es den Jäger im dunklen Mondschatten nicht erkannte. Da beugte Leupolt sich vor und flüsterte: »Es ist ein heilig Ding. Ist Deins und meins. Tu reden, Schwester!«
»Die Mutter ist bei der Kripp, in der das heilige Kindl hat liegen müssen.«
Leupolt sprang über die Straße, hastete den verschneiten Wiesenhang hinauf und erreichte den Wald. Im schwarzen Schatten unter den Bäumen nahm er den Mantel ab, zog aus dem Bergsack ein weißes Leinenbündel heraus, schlüpfte in das Schneekleid der Unsichtbaren und verwahrte den Sack, das Hütl und die Flinte in den Stauden. Durch den Wald emporsteigend, kam er zu einer Lichtung. Zwischen den letzten Bäumen vernahm er das Schnalzen eines Eichhörnchens – das Wächterzeichen. Leupolt antwortete mit dem gleichen Laut. Wie hier, so war es in dieser weißen Nacht an vielen Orten des Berchtesgadnischen Landes, auf der Gern, zu Bischofswiesen und Ilsank, auf dem Toten Mann, in der Ramsau, am Taubensee und auf dem Schwarzeneck. Überall wanderten die Unsichtbaren, um Gottes Wort zu hören.
Die geschulter Jägerei des Stiftes zählte in ihren Bezirken jedes hauende Schwein, jeden jagdbaren Hirsch und jede Gemse, doch unter den fürstpröpstlichen Jägern wusste nur Leupolt Raurisser, wie viele Eichhörnchen in den Berchtesgadnischen Wäldern schnalzten.
4.
Auf der Waldlichtung lag ein Bauerngehöft, still, mit schwarzen Balkenmauern unter dem weißen Schnee. Kein Laut, keine Spur von Leben. Viele Schrittfährten waren durch den frisch gefallenen Schnee getreten, gegen das Gehöft hin. Leupolt klopfte an der Haustür, dreimal und einmal. Die Tür wurde lautlos aufgetan. Eine Hand fasste im finsteren Flur den Jäger am Arm und zog ihn durch ein enges Gängelchen. Warmer Stallgeruch quoll ihm entgegen, und als er die feuchte Holztür öffnete, war ihm ein Dunst vor den Augen, als träte er in eine Waschküche mit dampfendem Kessel. Das matte Licht einer trüben Laterne. Damit auch von dieser schwachen Helle kein Schimmer hinausfiele ins Freie, waren die zwei kleinen Fenster dick angestopft mit Heu. Die Henne glucksten leise in ihrer Steige, zwei Ferkelchen quieksten in einer Bretterkiste, und drei Kühe und zwei Kälber, die eng gedrängt an der Futterkrippe standen, rasselten mit ihren Ketten, drehten die Köpfe hin und her und schnaubten. Aller übrige Raum des Stalles war Schulter an Schulter angefüllt mit Leuten, die entlang der Mauer standen oder auf Strohgarben saßen. Alle waren in das gleich weiße Schneekleid eingehüllt, wie es Leupolt trug, alle hatten die Kapuzen mit den dunklen Augenlöchern über den Köpfen. Inmitten des heiß atmenden Menschenknäuels saß auf dem Melkschemel eine gebeugte Mannsgestalt, unter deren Kapuze ein weißgrauer Bart heraus quoll. Das war der Fürsager, der Älteste der versammelten Gemeinde, die noch nie einen Prediger ihres Glaubens gehört hatte. Auf den Knien hielt der Alte das heilige Buch, das der Erwecker ihrer Seelen war, die Quelle ihrer Sehnsucht und die Stillung ihres Zweifels.
Bei Leupolts Eintritt war Schweigen im Stall. Nur die Raschelgeräusche der Tiere. Und alle dunklen Augenlöcher der weißen Kapuzen drehten sich gegen den Jäger hin. »'s Gotts Willkommen!«, grüßte der Fürsager, als die Tür wieder geschlossen war. »Bringst Du Botschaft, Bruder?«
Leupolt erhob die Hand. »Ist eine unter Euch, die man nötig hat zwischen Wehbett und Wieg? Sie muss zur Schwester Martle kommen, gleich.«