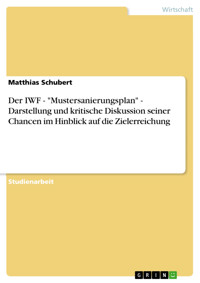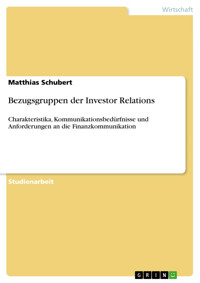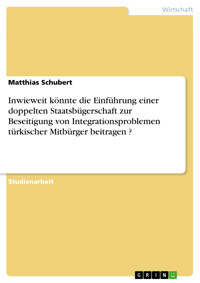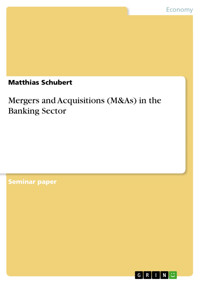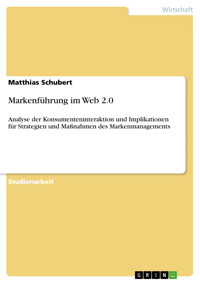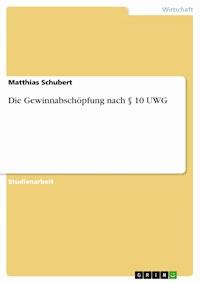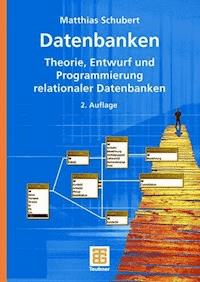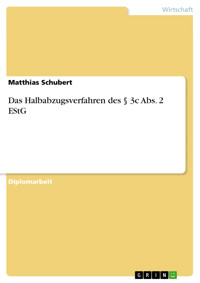
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,3, Technische Universität Chemnitz, Sprache: Deutsch, Abstract: Nach geltendem Steuerrecht unterliegen natürliche Personen der Einkommensteuer (§ 1 EStG), die in § 1 Abs. 1 KStG aufgezählten Körperschaften, darunter Kapitalgesellschaften, der Körperschaftsteuer. Während die Einkünfte des Personenunternehmers nur der Einkommensteuer unterworfen sind, werden die von der Körperschaft erwirtschafteten Gewinne zunächst der Körperschaftsteuer und bei Ausschüttung an den Anteilseigner der Einkommensteuer unterworfen. Aus Sicht des Anteilseigners stellt die Körperschaftsteuer damit wirtschaftlich eine Vorbelastung dar. Mit dem ehemaligen Vollanrechnungssystem wurde diese Doppelbelastung bei Gewinnausschüttungen in nahezu perfekter Weise beseitigt, indem der Anteilseigner die von der Kapitalgesellschaft geschuldete Körperschaftsteuer wie eigene Vorauszahlungen auf seine Einkommensteuerschuld anrechnen konnte. Auf Empfehlung der „Kommission zur Reform der Unternehmensbesteuerung“ („Brühler Kommission“) ersetzte der Gesetzgeber das Anrechnungssystem durch das sog. Halbeinkünfteverfahren. Die Körperschaft versteuert alle Gewinne definitiv mit 25 v. H. (§ 23 Abs. 1 KStG). Eine Anrechnung der Körperschaftsteuer auf die Einkommensteuerschuld entfällt, dafür werden die einkommensteuerpflichtigen Einnahmen nach § 3 Nr. 40 EStG zur Hälfte steuerfrei gestellt. Das sog. Halbabzugsverfahren des § 3c Abs. 2 EStG regelt als Komplementärregelung hierzu den Ausgabenabzug. Die Ausgaben dürfen unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum sie anfallen, bei der Ermittlung der Einkünfte nur zur Hälfte abgezogen werden, wenn sie mit den Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (§ 3c Abs. 2 S. 1 EStG), was auch für nicht gewinnausschüttungsbedingte Wertminderungen des Anteils an einer Organgesellschaft gilt (§ 3c Abs. 2 S. 2 EStG). Für einbringungsgeborene Anteile wurde eine Sonderregelung aufgenommen (§ 3c Abs. 2 S. 3 und 4 EStG). In der Arbeit werden die Regelungen des Halbabzugsverfahrens zunächst auf ihre steuersystematische Folgerichtigkeit im Rahmen des Halbeinkünfteverfahrens und - darauf aufbauend - auf ihre Vereinbarkeit mit Verfassungs- und Europarecht untersucht. Abschließend erfolgt eine kurze Darstellung von Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen der Halbabzug vermieden werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Technische Universität Chemnitz Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
BWL I - Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung
Eingereicht von:
Matthias Schubert
5. Semester
Abgabetermin: 12.02.2007
Page 6
Abkürzungsverzeichnis
a. A. andere Ansicht a. a. O. am angegebenen Ort Abs. Absatz a. E. am Ende a. F. alte Fassung AG Aktiengesellschaft AktG Aktiengesetz Anm. Anmerkung AO Abgabenordnung Art. Artikel Aufl. Auflage Az. Aktenzeichen BB Betriebs-Berater (Zeitschrift) Bd. Band Bearb. Bearbeiter BFH Bundesfinanzhof BFHE Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
BFH/NV
BGB Bürgerliches Gesetzbuch BGBl. Bundesgesetzblatt BMF Bundesministerium für Finanzen BR Bundesrat BR-Drucks. Bundesrats-Drucksache BStBI. Bundessteuerblatt BT Bundestag BT-Drucks. Bundestags-Drucksache BVerfG Bundesverfassungsgericht BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bzw. beziehungsweise DB Der Betrieb (Zeitschrift) ders. derselbe d. h. das heißt
Page 7
dies. dieselbe Drucks. Drucksache DStJG Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) EFG Entscheidungen der Finanzgerichte
EG
EGV
Einf. Einführung EStB Der Ertrag-Steuer-Berater (Zeitschrift) EStG Einkommensteuergesetz EU Europäische Union, Vertrag über die Europäische Union EuGH Europäischer Gerichtshof EU-Kommission Kommission der Europäischen Gemeinschaften f., ff. folgende FG Finanzgericht Fn. Fußnote FR Finanz-Rundschau (Zeitschrift) GenG Genossenschaftsgesetz GewSt Gewerbesteuer GewStG Gewerbesteuergesetz GG Grundgesetz GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbHG Gesetz betreffend die GmbH GmbHR GmbH-Rundschau (Zeitschrift)
GmbH & Co. KG Kommanditgesellschaft mit GmbH als Komplementär GrS Großer Senat h. M. herrschende Meinung Hrsg. Herausgeber Hs. Halbsatz HStR Handbuch des Staatsrechts i. d. F. in der Fassung i. d. R. in der Regel i. E. im Einzelnen i. e. S. im engeren Sinne
Page 8
IStR Internationales Steuerrecht (Zeitschrift) i. V. m. in Verbindung mit IWB Internationale Wirtschaftsbriefe (Zeitschrift) KG Kommanditgesellschaft KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien KÖStDI Kölner Steuerdialog (Zeitschrift) krit. kritisch KSt Körperschaftsteuer KStG Körperschaftsteuergesetz lat. lateinisch Lfg. Lieferung lit. lat. littera (Buchstabe) m. a. W. mit anderen Worten m. E. meines Erachtens m. w. N. mit weiteren Nachweisen n. F. neue Fassung N. N. nomen nescio NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR
Nr. Nummer Rn. Randnummer Rspr. Rechtsprechung Rz. Randziffer s., s. o. siehe, siehe oben S. Satz, Seite
Slg.
Sp. Spalte sog. so genannte(/r, /s) str. umstritten st. Rspr. ständige Rechtsprechung StB Der Steuerberater (Zeitschrift) Stbg Die Steuerberatung (Zeitschrift) StbJb Steuerberater-Jahrbuch
Page 9
StuB Steuern und Bilanzen (Zeitschrift) StuW Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift) StSenkG Steuersenkungsgesetz StSenkErgG Steuersenkungsergänzungsgesetz Tz. Textziffer u. a. und andere, unter anderem UmwG Umwandlungsgesetz UmwStG Umwandlungssteuergesetz UntStFG Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz u. U. unter Umständen v. von(/m) Verf. Verfasser vgl. vergleiche v. H. vom Hundert VZ Veranlagungszeitraum WPg Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift) z. B. zum Beispiel Ziff. Ziffer zit. zitiert zzgl. zuzüglich
Page 1
I. Einleitung
Nach geltendem Steuerrecht unterliegen natürliche Personen der Einkommensteuer (§ 1 EStG1), die in § 1 Abs. 1 KStG2aufgezählten Körperschaften, darunter Kapitalgesellschaften3, der Körperschaftsteuer. Während die Einkünfte des Personenunternehmers nur der Einkommensteuer unterworfen sind, werden die von der Körperschaft erwirtschafteten Gewinne zunächst der Körperschaftsteuer und bei Ausschüttung an den Anteilseigner der Einkommensteuer unterworfen. Aus Sicht des Anteilseigners stellt die Körperschaftsteuer damit wirtschaftlich eine Vorbelastung dar.4Mit dem ehemaligen Vollanrechnungssystem wurde diese Doppelbelastung bei Gewinnausschüttungen in nahezu perfekter Weise beseitigt, indem der Anteilseigner die von der Kapitalgesellschaft geschuldete Körperschaftsteuer wie eigene Vorauszahlungen auf seine Einkommensteuerschuld anrechnen konnte.5
Auf Empfehlung der „Kommission zur Reform der Unternehmensbesteuerung“ („Brühler Kommission“) ersetzte der Gesetzgeber das Anrechnungssystem durch das sog. Halbeinkünfteverfahren.6Die Körperschaft versteuert alle Gewinne definitiv mit 25 v. H. (§ 23 Abs. 1 KStG). Eine Anrechnung der Körperschaftsteuer auf die Einkommensteuerschuld entfällt, dafür werden die einkommensteuerpflichtigen Einnahmen7nach § 3 Nr. 40 EStG zur Hälfte steuerfrei gestellt. Das sog. Halbabzugsverfahren des § 3c Abs. 2 EStG regelt als Komplementärregelung hierzu den Ausgabenabzug8. Die Ausgaben dürfen unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum sie anfallen, bei der Ermittlung der Einkünfte nur zur Hälfte abgezogen werden, wenn sie mit den Einnahmen in wirtschaftlichem Zu-1Einkommensteuergesetz(EStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 19.10.2002 (BGBl. I S. 4210), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 5 Gesetz vom 05.12.2006 (BGBl. I S. 2748).
2Körperschaftsteuergesetz (KStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4144), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (BGBl. I S. 2782).
3Im Folgenden wird „Kapitalgesellschaft“ oder „Körperschaft“ für die in § 1 Abs. 1 KStG genannten Körperschaften verwendet.
4Vgl. Birk, D., Leistungsfähigkeitsprinzip (StuW 2000), S. 333; Dickescheid, T., Unternehmenssteuerreform (StuW 2002), S. 127.
5Vgl. Schiffers, J., Besteuerung (GmbHR 2000), S. 205.
6Vgl. BT-Drucks. 14/2683, S. 92, 94 ff.; zur zeitlichen Anwendung vgl. Heinicke, W., in: Schmidt, L. (Hrsg.), EStG (2006), § 3 Stichwort „Halbeinkünfteverfahren“.
7„Einnahmen“ wird im Folgenden untechnisch für alle von § 3 Nr. 40 EStG erfassten Einnahmen, Bezüge usw. verwendet; zu diesen vgl. Heinicke, W., in: Schmidt, L. (Hrsg.), EStG (2006), § 3 Stichwort „Halbeinkünfteverfahren“.
8„Ausgaben“ wird im Folgenden untechnisch für alle von § 3c Abs. 2 EStG erfassten Werbungskosten, Be- triebsausgaben usw. verwendet; zu diesen vgl. Heinicke, W., in: Schmidt, L. (Hrsg.), EStG (2006), § 3c Rn. 30.
Page 2
sammenhang stehen (§ 3c Abs. 2 S. 1 EStG), was auch für nicht gewinnausschüttungsbedingte Wertminderungen des Anteils an einer Organgesellschaft gilt (§ 3c Abs. 2 S. 2 EStG). Für einbringungsgeborene Anteile wurde eine Sonderregelung aufgenommen (§ 3c Abs. 2 S. 3 und 4 EStG).
Im Folgenden sollen die Regelungen des Halbabzugsverfahrens zunächst auf ihre steuersystematische Folgerichtigkeit im Rahmen des Halbeinkünfteverfahrens und - darauf aufbauend - auf ihre Vereinbarkeit mit Verfassungs- und Europarecht untersucht werden. Abschließend erfolgt eine kurze Darstellung von Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen der Halbabzug vermieden werden kann.
II. Folgerichtigkeit im Rahmen des Halbeinkünfteverfahrens
A. Ausgangspunkt der Systemkritik
Zunächst erscheint es plausibel, Aufwendungen nur zur Hälfte zum Abzug zuzulassen, wenn auch die entsprechenden Erträge nur zur Hälfte besteuert werden.9In der Sache stellt sich der Gesetzgeber wohl vor, dass eine Parallelität zwischen der Besteuerung der halben Einnahmen und der Geltendmachung auch nur der halben Ausgaben bestehen soll.10
1. Unvereinbarkeit mit der Grundentscheidung
Nach überwiegender Auffassung in der Literatur11stellt die Regelung jedoch gleichwohl einen Systembruch dar, wobei grundsätzlich wie folgt argumentiert wird: Der Halbabzug nach § 3c Abs. 2 EStG ließe sich systematisch nur rechtfertigen, wenn die Einnahmen nach
9Vgl. von Beckerath, H. J., in: Kirchhof, P. (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar (2006), § 3c Rn. 29; Heuermann, B., Halbeinkünfteverfahren (DB 2005), S. 2708; van Lishaut, I., Gesellschaftersicht (StuW 2000), S. 194; Sigloch, J., Analyse (StuW 2000), S. 166.
10Vgl. Crezelius, G., Grundstrukturen (DB 2001), S. 227.
11Vgl. zum Folgenden etwa Bareis, P., Probleme (BB 2003), S. 2316 f.; Crezelius, G., Grundstrukturen (DB 2001), S. 227; Riotte, M., in: Erle, B. /Sauter, T. (Hrsg.), Reform (2000), S. 65; Freshfield Bruckhaus Deringer, Unternehmenssteuerreform (NJW 2000, Beilage zu Heft 51), S. 30; Haep, G./Nacke, A., in: Herrmann, C./Heuer, G./Raupach, A. (Hrsg.), Steuerreform I (Stand: August 2001), § 3c EStG Anm. R 3; Herzig, N., Entwicklungen (DB 2003), S. 1459; Heuermann, B., Halbeinkünfteverfahren (DB 2005), S. 2708; Hundsdoerfer, J., Beteiligungsaufwendungen (BB 2001), S. 2245; von Beckerath, H. J., in: Kirchhof, P. (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar (2006), § 3c Rn. 29; Münch, M., Finanzierungskosten (2006), S. 206 ff.; Ottermann, T., Betriebsausgaben (2001), S. 10; Pezzer, H.-J., Kritik (StuW 2000), S. 150; Piltz, D. J., Zinsabzug (StbJb 2001/2002), S. 112; Hötzel, O., in: Schaumburg, H./Rödder, T. (Hrsg.), Unternehmenssteuerreform 2001 (2000), S. 249; Heinicke, W., in: Schmidt, L. (Hrsg.), EStG (2006), § 3c Rn. 25, § 17 Rn. 191; Löhr, D., Implikationen (BB 2002), S. 2363; Schön, W., Abzugsschranken (FR 2001), S. 386 f., Schön, W., Steuersenkungsgesetz (StuW 2000), S. 154; Sigloch, J., Analyse (StuW 2000), S. 166; Thömmes, O., Abzugsbeschränkungen (IStR 2005), S. 688;a. A.etwa Bolik, A. S., Halbabzug (BB 2001), S. 813; van Lishaut, I., Gesellschaftersicht (StuW 2000), S. 195.
Page 3
§ 3 Nr. 40 EStG auch nur zur Hälfte steuerlich belastet seien. Tatsächlich seien die Einnahmen aber nicht steuerfrei, sondern würden steuertechnisch nur zur Hälfte erfasst, da nach dem Willen des Gesetzgebers die Gewinnbesteuerung im Ergebnis auf Kapitalgesellschaft und Anteilseigner aufgeteilt werden und unter Berücksichtigung der körperschaftsteuerlichen Vorbelastung eine Ertragssteuerbelastung von Dividenden erfolgen soll, die typisierend der anderer Einkünfte entspreche. Wenn der Gesetzgeber aber gerade eine Einmalbelastung der Dividende herstellen wollte, lasse sich die Besteuerung auf Körperschaftsebene als eine bloße „Vorwegbesteuerung“ der Einnahmen des Anteilseigners oder weitergehend bereits als „Einstieg in eine partiell nachgelagerte Besteuerung von Unternehmensgewinnen“12ansehen. Bei anderen Einkunftsarten seien die damit zusammenhängenden Ausgaben jedoch voll abziehbar. Wegen des Trennungsprinzips hätten zudem Aufwendungen auf Ebene des Anteilseigners die Bemessungsgrundlage der Kapitalgesellschaft nicht gemindert; die Aufwendungen seien nicht „vorentlastet“13. Dies und die Berücksichtigung der Gesamtsteuerbelastung müssten dann zum Vollabzug führen. Der nur hälftige Abzug ignoriere die kumulativ wirkende Körperschaftsteuerbelastung und stelle den Anteilseigner im Hinblick auf seine steuerliche Gesamtbelastung deutlich schlechter. Er verstoße somit gegen die gesetzgeberische Konzeption.
2. Weitere systematische Bedenken
Systemwidrig soll weiter sein, dass es keine Abstimmung mit speziellen Verlustausgleichs-begrenzungsnormen (z. B. §§ 17 Abs. 2 S. 4, 23 Abs. 3 S. 8 und 9 EStG) gäbe.14Diese Begrenzungen lassen sich jedoch über das Merkmal des „wirtschaftlichen Zusammenhanges“ erfassen.15Auch soll die fehlende Halbierung der Werbungskostenpauschbeträge (§ 9a Nr. 2 und 3 EStG), Freibeträge (§§ 20 Abs. 4, 17 Abs. 3, 16 Abs. 4 und 13 Abs. 3 EStG) sowie Freigrenzen (§ 23 Abs. 3 S. 6 EStG) nach § 3c Abs. 2 EStG systemwidrig sein.16Der Ver-
12Lang,J., Prinzipien (DStJG 24 [2001]), S. 89; vgl. Dorenkamp, C., Unternehmenssteuerreform (StuW 2000), S. 122 f., 129.
13Hundsdoerfer, J., Beteiligungsaufwendungen (BB 2001), S. 2245.
14Vgl. Crezelius, G., Grundstrukturen (DB 2001), S. 227.
15Vgl. von Beckerath, H. J., in: Kirchhof, P./Söhn, H./Mellinghoff, R. (Hrsg.), EStG (Stand: Juni 2006), § 3c Rn. C 6.
16Vgl. Nacke, A., in: Herrmann, C./Heuer, G./Raupach, A. (Hrsg.), Steuerreform I (Stand: August 2001), § 3c EStG Anm. R 25.
Page 4
einfachungszweck spricht jedoch gegen eine derartige Halbierung.17Diese Bedenken greifen damit nicht durch, so dass nur die Kritik zur Grundentscheidung aufzugreifen ist.
B. Steuersystematischer Maßstab
Systematisch folgerichtig ist das Halbabzugsverbot dann, wenn es sich widerspruchsfrei in das (inhaltliche) System18der Steuerrechtsordnung einfügt. Nicht entscheidend für die Frage der Systemwidrigkeit ist dagegen, ob das Halbeinkünfteverfahren einen angemessenen Ersatz für das Anrechnungsverfahren bildet.19Der Systemkritik liegt eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde20, deren Annahme zunächst der Rechtfertigung bedarf, da sie für die steuersystematische Entscheidung des Gesetzgebers nicht zwingend21ist. Die hälftige Nichtabzugsfähigkeit der Ausgaben ist grundsätzlich nämlich dann gerechtfertigt, wenn die Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren auf Anteilseignerebene isoliert und nicht als Bestandteil eines Gesamtsystems der Besteuerung von Kapitalgesellschaft und Anteilseigner verstanden wird.22Ausgangspunkt ist, dass die Weitergabe von Gewinnen einer Kapitalgesellschaft an ihre Anteilseigner einer wirtschaftlichen23und einer rechtlichen24Betrachtungsweise zugänglich ist. Rechtliche oder wirtschaftliche Systeme müssen dabei nicht in Reinform verwirklicht sein.25Alternativ kann auch nach soziologischen Typen differenziert werden.26Zunächst ist folglich zu prüfen, welche Betrachtungsweise sich