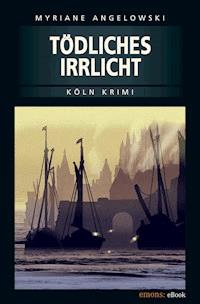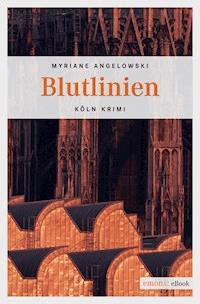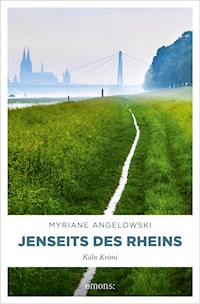Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maline Brass und Lou Vanheydens
- Sprache: Deutsch
Der Mord an einer Musiklehrerin führt Lou Vanheyden und Maline Brass zu einer Familie, die abgeschottet am Rande des Königsforsts lebt. Sohn Levi war Schüler der Toten. Doch während das Verbrechen schnell aufklärt ist, unterschätzen Vanheyden und Brass die explosive Situation innerhalb der Familie: Levi und seine Schwester hüten ein Geheimnis von enormer Brisanz. Und sie sind dabei, einen Plan zu schmieden, der katastrophale Folgen haben wird...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Myriane Angelowski, geboren 1963 in Köln, studierte Sozialarbeit. Nach mehreren Jahren als Referentin für Gewaltfragen folgte die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit als Coach. Sie lebt und arbeitet in Köln. www.angelowski.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/Steffz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Hilla Czinczoll eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-579-2 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Maren
Köln-Rath, Am Gieselbach
Freitagmorgens postierte er sich neben dem Ginsterbusch und richtete seinen stummen Vorwurf gegen die Fassade. Wie ein Mahnmal harrte er vor ihrer Villa aus, bei Wind und Wetter. Und seine lautlosen Schreie zeigten Wirkung. Seinetwegen ließ sie freitags die Rollläden vorerst unten und geisterte durch halbdunkle Räume.
Rendel Sukowa hätte die Polizei rufen können. Auch ein Gespräch mit seinen Eltern hatte sie erwogen. Aber die Konsequenzen, die das nach sich gezogen hätte, wollte sie ihm ersparen. Schließlich stand er nur da, und wenn sie es ganz genau nahm, schuldete sie ihm ein paar Antworten. Schon vor Wochen hatte sie ihm ihre Unterstützung zugesagt und sich auch tatsächlich um die Angelegenheit gekümmert. Nur, das Ergebnis ihrer Recherchen gefiel ihm sicher nicht. Deshalb drückte sie sich davor, mit ihm zu sprechen. Deshalb und weil sie eigene Sorgen hatte und ihn nicht weiter unterstützen konnte. Seine Eltern waren gefragt. Aber genau da lag der Hase im Pfeffer, seine Familienverhältnisse waren schwierig, allerdings nicht im klassischen Sinne. Rendel Sukowa wich dem ganzen Thema aus und tilgte ihn aus ihrem Gedächtnis, wenn er dann verschwand. Bis zum nächsten Freitag.
In der Nacht hatte es geschneit, das konnte sie durch das milchige Glas im Badezimmer erkennen. Ein kleiner Schneeberg ruhte außen auf dem Fenstersims. Dieser Winter machte ihr Leben noch komplizierter.
Nachdem sie wegen einer Grippe über eine Woche das Bett gehütet hatte, war sie noch schwach auf den Beinen und später aufgestanden als geplant. Eigentlich wollte sie längst unterwegs sein. Obwohl sie im Verzug war, griff sie nach der Bürste und strich seelenruhig und ausgiebig ihre Haare glatt, ohne dabei in den Spiegel zu schauen. Für sie war es nicht von Bedeutung, ob sie pünktlich zum Arzttermin erschien. Der Doktor nahm sie so oder so an die Reihe.
Sie spritzte Wasser in Falten, die ihre Augen wie Strahlen umgaben, tastete nach ihrer Brille, schluckte die morgendliche Ration Tabletten und freute sich auf eine Tasse Bohnenkaffee, die erste nach verordneten Teetagen.
Für ihre Verhältnisse schritt sie zügig die Stufen zum Erdgeschoss hinab, die rechte Hand immer am Holzgeländer. Ihre ausgetretenen Lederpantoffeln boten den Füßen kaum Halt. Schwach drang erstes Morgenlicht durch bernsteinfarbene Butzenscheiben, die oberhalb der rustikalen Eingangstür eingefasst waren, und streifte die Stiegen. Gegen ihren Willen musste sie lächeln, als ihr klar wurde, welchen Anblick sie bot. Das Gespenst von Canterville schreitet ins Parterre. Klein, zierlich, gekämmt zwar, aber halbherzig gewaschen. Der dünn gesteppte Bademantel schützte wenig gegen die frostige Temperatur, die im Treppenhaus herrschte. Rendel stutzte. Die Villa war nicht gut isoliert, aber diese Kälte konnte sie sich beim besten Willen nicht erklären.
Die Türschelle zerriss jäh die Stille.
Augenblicklich vergaß Rendel die Irritation um die eisige Luft, verlor einen Hausschuh und wäre beinahe über die letzte Stufe gestolpert. Kurzzeitig stand sie wie erfroren. Lediglich ihre Augen huschten zwischen Tür und dem Schlappen, der wenige Meter über die Steinfliesen geschliddert war. Beim zweiten Klingeln zuckte sie vom Scheitel bis zu den Zehen, löste sich dann aus der Erstarrung, angelte umständlich nach ihrem ausgerissenen Pantoffel, entriegelte und öffnete eine Handbreit.
Levi. Durchzug fuhr unter ihr Nachthemd und blähte den Bademantel auf. Beim Anblick des Jungen wich sie zurück. So nah hatte sie ihn lange nicht gesehen. Seine Locken waren einem kahl rasierten Schädel gewichen. Dadurch stachen die Augen hervor, wirkten dunkler, verlorener. Offensichtlich war er noch weiter gewachsen, sein Kreuz schien breiter, die Statur stämmiger. Wie immer trug er hellblaues Leinen, auch die dünnen Stoffturnschuhe waren dem Wetter nicht angemessen. Hemd und Hose wiesen vom Schnee feuchte Stellen auf. Allein durch seinen Aufzug zog er Blicke und Gespött auf sich, da genügte Rendel ihr gesunder Menschenverstand. Wie konnten ihn seine Eltern so herumlaufen lassen?
Mit gesenktem Kopf stand Levi im Wind, wie ein Stier, der jeden Moment zum Angriff übergeht. Jetzt sah er sie direkt an. Durchsichtiger Schleim rann ihm aus der Nase. Jugendliche Mundwinkel zuckten mürrisch.
Mitleid überschwemmte Rendel. »Komm«, sagte sie nur und trat zur Seite, weil ihr schlagartig klar wurde, dass sie ihn nicht immer weiter ignorieren konnte.
Auf zittrigen Beinen ging sie ins Musikzimmer vor und stolperte über zwei persische Läufer. Sie machte Licht, bot ihm einen Platz an, schlurfte zu einem der bodentiefen Fenster, hängte sich mit all ihrer Kraft in die Schlaufe, um den dämmernden Morgen hereinzulassen, zog die Jalousie aber nur halb nach oben, mehr Kraft brachte sie nicht auf. »Im Grunde bin ich ganz froh, dass du geklingelt hast. Wenngleich ich …« Ihre Stimme versagte, als sie sich zu ihm umdrehte.
Levi saß auf dem Klavierhocker, seine Hände schwebten über den Tasten des Pianos. Aber ohne ihre ausdrückliche Genehmigung wagte er nicht, sie zu berühren. Solche Grenzen überschritt er nicht. Sie fiel ihm gegenüber in einen Sessel, betrachtete ihn aufmerksam. Das Kissen mit feinem Fasanenmotiv nahm er komplett ein. Die filigran geschwungenen Füße des Bänkchens wölbten sich unter seinem Gewicht leicht nach innen.
An der Wand über dem Piano hing eine überdimensional große Kopie von François Bouchers Porträt der Madame de Pompadour, erdrückend gerahmt. Gegenüber der mit Goldfäden durchzogenen Chaiselongue verstaubten zwei Gitarren in Ständern vor drei handelsüblichen Metallnotenständern nebst Fußbänkchen. Rendel registrierte das Ticken der Wanduhr und suchte Augenkontakt zu Levi, ohne ihn zu finden, und ließ ihm Zeit. Mit Worten war der Junge immer sparsam.
In all den Jahren, in denen Rendel ihn unterrichtete, hatte sich ihre Kommunikation auf das Nötigste beschränkt. Wenn sie sprachen, dann über Musik. Diese Leidenschaft konnten sie teilen, andere Themen hatte auch Rendel geflissentlich gemieden. Nun wartete sie, bemüht, die Augen offen zu halten, obwohl Müdigkeit sie zu überrollen drohte. Eine Nebenwirkung dieser grässlichen Tabletten und Folge der vergangenen Krankheitstage.
»Eine Ewigkeit ist vergangen«, flüsterte Levi schließlich, ohne sie anzusehen. »Sie wollten jemanden schicken, einen Dozenten von der Hochschule, irgendjemanden, der meine Mutter … überzeugt … Aber niemand ist gekommen.«
Im Laufe ihrer Berufsjahre hatte sie viele Schüler kommen und gehen sehen. Aber niemals war ihr eine solche Begabung untergekommen. Damals hatte Rendel Sukowa Levis Eltern einen Besuch abgestattet und ihnen empfohlen, ihren Sohn als Jungstudent für die Rheinische Musikhochschule anzumelden, damit sein Talent adäquat gefördert werden konnte. Aber Marietta und André Fischblut hatten sich unbeeindruckt gezeigt.
»Hör mir zu, Levi, ich habe mit Verantwortlichen der Musikhochschule gesprochen, rein theoretisch kannst du eine Aufnahmeprüfung machen, es gibt die Möglichkeit, öffentlich vorzuspielen.«
Er strahlte, sein Lachen reichte bis zu den Ohren. »Wirklich? Wann?«
»Der nächste Termin ist im Frühjahr. Und am besten wäre es, wenn du Stunden bei einem der Professoren nimmst, das würde deine Chancen erhöhen.«
Augenblicklich ließ Levi die Schultern hängen. Seine Fingernägel kratzten in das weiche Holz des Pianobänkchens, die Euphorie schien verflogen. »Dafür bekomme ich keine Erlaubnis. Niemals!«
»Aber du musst unbedingt Unterricht nehmen und deine Eltern von der Wichtigkeit überzeugen. Am besten belegst du auch einen Meisterkurs bei einem erfolgreichen Pianisten …«
Levi zog die Augenbrauen fragend zusammen.
»In solchen kostspieligen Kursen unterweist ein Virtuose seine Schüler«, erklärte Rendel. »Allein kannst du es ansonsten einfach nicht schaffen, egal, wie begabt du bist! Darüber hinaus musst du spielen, jeden Tag mehrere Stunden, um einer der Besten zu werden und damit du ein Stipendium bekommst.«
»Geld haben wir genug«, stieß Levi hervor.
Rendel lehnt sich vor. »Ich bewundere deine Beharrlichkeit, aber bei aller Liebe, deine Bedingungen müssen sich verbessern. Du musst üben, üben und noch mal üben, ansonsten verschleuderst du dein Talent. Allein aus Mitleid nimmt dich die Hochschule nicht auf. Es ist an der Zeit, sich von allem zu befreien, was dich hindert, deinen Traum zu leben.«
Tränen liefen Levi über die markanten Wangenknochen.
Sofort bereute Rendel ihre Worte. Sie erkannte, dass sie ihm die Hoffnung nahm. Schon immer hatte sie ihn schonen wollen, aber irgendwann musste er gewissen Tatsachen ins Auge sehen, oder nicht? Rendel Sukowa kamen noch mehr Zweifel, als er wie ein angeschossener Wolf aufheulte und mit offenem Mund hemmungslos weinte. Speichel tropfte auf Rendels Teppich.
Unerwartet sprang er vom Hocker und stieß ihn nach hinten. Seine Halsschlagader schwoll an, die Gesichtsfarbe wechselte von Blass zu Dunkelrot. Einen Moment schien er unschlüssig, dann drehte er sich um die eigene Achse, machte einen Satz nach vorn, verpasste den Notenständern einen Tritt, dass sie nacheinander umfielen und eine der Gitarren schwankte.
Rendel drückte sich in ihren Sessel. Levis Wutausbruch überraschte und überforderte sie gleichermaßen. So eine heftige Reaktion hatte sie ihm nicht zugetraut. Er bedachte sie mit einem verächtlichen Blick und rannte aus der Tür.
Sie war einen Moment wie versteinert, nahm dann die Brille von der Nase und rieb sich die Augen. Als sie in der Diele ein lautes Poltern vernahm, glitt ihr die Sehhilfe aus der Hand. Sitzend tastete sie nach ihr, ohne sie zu fassen zu bekommen. Und weil ihre Füße nicht gleich in die Pantoffeln fanden, erhob sich Rendel Sukowa barfuß.
Mit unsicherem Schritt und konturenhaft sehend, erreichte sie den Flur. »Levi? Komm, lass uns in Ruhe reden!«
Rendel vernahm ein leises Klirren. Merkwürdigerweise kam es aus dem Obergeschoss. Sie blinzelte am Geländer entlang nach oben. Schemenhaft erfasste sie eine Gestalt, die mit Tempo die Treppe hinunterschoss und direkt auf sie zukam.
Beinahe gleichzeitig fuhr ein Schmerz in Rendels Brust, der ihr die Luft zum Atmen nahm. Sie schrie, verlor das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Enge umklammerte ihr Herz wie ein Stahlkorsett. Rendel versuchte, tiefer und ruhiger zu atmen, aber sie hechelte stoßweise, hyperventilierte mit weit aufgerissen Augen.
Blut sickerte aus einer Wunde, die sie nicht sehen konnte, rann den Bauch hinab und sammelte sich unter ihrem Rücken, bildete eine Lache, noch bevor Rendel Sukowa ihren letzten Atemzug getan hatte.
Brühl, Ausbildungseinrichtung der Polizei LAFP
Lou verließ den Polizeibus als Letzte und trottete hinter Maline und den anderen her. Sie unterhielten sich lautstark und steuerten dabei geradewegs auf die Sporthalle des Trainingszentrums zu. Mit einem Kloß im Hals blickte Lou zur Aschebahn, die in grellem Flutlicht erstrahlte. Sie wurde von einer dünnen Schneeschicht bedeckt, junge Kollegen in Joggingoutfits liefen sich bereits warm.
»Kommst du?« Maline hielt Lou die Tür zur Halle auf, deshalb legte sie einen Zahn zu und betrat das Gebäude. Die Turnschuhe der Kommissarinnen hinterließen nasse Minipfützen auf dem Linoleum.
»Ich glaub, ich pack das nicht«, sagte Lou.
»Quatsch, mach dich doch nicht so verrückt!«
»Warum habe ich bloß mit dem Joggen aufgehört? Noch vor einem Jahr war ich richtig gut in Form. In letzter Zeit habe ich meinen Schweinehund einfach nicht mehr im Griff. Und bei der Frage joggen oder noch einmal umdrehen gewinnt jeden Morgen mein Bedürfnis nach Schlaf.«
»Das geht uns doch allen so«, sagte Maline.
»Nur mit dem Unterschied, dass du fit bist und mehr als zwei Hosen hast, in die du noch hineinpasst.« Lou endete mit einem Seufzer, der aus tiefster Seele kam.
Laut Erlass des Innenministeriums wurde die körperliche Fitness sämtlicher Polizeibeamter einmal im Jahr gecheckt, und zwar in den Disziplinen Schwimmen und Joggen. Strecken und Zeiten waren nach Alter gestaffelt. Lou musste in ihrer Kategorie zwölf Minuten laufen und dabei mindestens eintausendachthundert Meter zurücklegen. Danach standen vierhundert Meter Schwimmen an, die sie in sieben Minuten zurücklegen sollte. Im Wasser war sie unschlagbar. Die Vorgaben zum Joggen brachten sie hingegen mittlerweile an ihre Leistungsgrenze. Deshalb lag ihr dieser Termin seit Wochen im Magen.
Lou hatte trainieren wollen und sich eigentlich ein Netz mit doppeltem Boden geschaffen. Wenn sie morgens nicht rechtzeitig aus dem Bett fand, wartete die gepackte Sporttasche griffbereit in ihrem Büroschrank. Jede Mittagspause hatte sie im Trainingsraum des Präsidiums verbringen wollen, immer war ihr etwas dazwischengekommen. Und auch die Aussicht auf acht geschenkte Überstunden, die einem laut Erlass gutgeschrieben wurden, hatte sie diesmal nicht motivieren können.
»Hier ist es schweinekalt«, stellte Maline fest, als sie den verwaisten Umkleideraum betraten.
Lou sank auf eine der Holzbänke, während Maline mit einer Zugstange das Oberlicht schloss und anschließend eine silberne Thermoskanne aus ihrer Umhängetasche zauberte. »Zitronentee?«
»Vielleicht später.«
»Jetzt mach nicht so ein Gesicht.« Maline schob ihre Tasche unter die Bank. »Wir joggen ganz langsam zusammen los, und wenn du dann ein bisschen eingelaufen bist, geben wir Gas. Ich ziehe dich schon ins Ziel!«
Lou winkte ab.
»Was ist denn los mit dir? Geht es hier wirklich nur um das Sportabzeichen, oder hängst du gedanklich schon wieder bei Clemens?« Maline holte Luft. »Mensch, er hat dich nachweislich belogen. Da ist es kein Wunder –«
»Quatsch, um ihn geht es gar nicht.« Lou wollte jetzt weder an ihren Verflossenen noch an diesen schrecklichen Fall denken, der mit ihm im Zusammenhang stand. »Frieda fliegt nun doch schon vor Weihnachten nach Kanada.«
»Ich dachte, es geht erst im Januar los«, sagte Maline.
»Anfang des Jahres ist die Infoveranstaltung der Organisation ›Work@World‹, bevor Frieda dann durchs Land reist und arbeitet. Aber vorher möchte sie unbedingt zwei Freundinnen meiner Mutter besuchen, die in Niagara-on-the-Lake leben.« Lou nahm ihre Wollmütze vom Kopf. »Die Vorstellung, ohne meine Kleine Weihnachten zu feiern, finde ich gerade unerträglich.«
»Deine Kleine wird flügge und macht Nägel mit Köpfen«, antwortete Maline lächelnd. »Erst hat sie Wilson verlassen, und nun verschwindet sie über den Teich. Ihr beide habt ganz offensichtlich gute Arbeit geleistet.«
Lou seufzte erneut. Richtig, das Lob musste sie sich fairerweise mit Henry teilen. Ihr Exmann hatte einige Fehler, aber in Sachen Frieda hatte er seine Sache grundsätzlich richtig gemacht und darüber hinaus zugunsten seiner Tochter auf seine Karriere verzichtet, die er durchaus hätte machen können. Nach wie vor war er als Sicherheitsberater in der Verkehrsdirektion der Polizei Köln tätig. Lou machte in der Regel keine große Sache aus Henrys »Opfer«, aus ihrer Sicht taten ungezählte Frauen das Gleiche, ohne jemals dafür einen Funken Anerkennung zu bekommen.
»Mir geht alles auf einmal zu schnell«, sagte Lou und nahm die Joggingschuhe aus der Sporttasche. »Helene ist auch völlig fertig. Sie ruft fast jeden Tag an oder steht vor der Tür.«
»Deine Mutter hängt eben an ihrer Enkelin.«
Lou schnürte die Laufschuhe. »Friedas Flieger geht in elf Tagen, einundzwanzig Stunden und zwei Minuten.«
Maline stemmte die Hände in die Hüften. »So kenne ich dich ja gar nicht!«
»Ich weiß. Im Augenblick entdecke ich auch ganz neue Seiten an mir. Es ist nur … Ich denke, es wird sehr still im Haus werden, ohne Frieda. Du bist ja auch auf und davon.«
Maline wich zurück, nur minimal, aber Lou entging es nicht. Sofort ärgerte sie sich über ihre Bemerkung. Sie wollte Maline kein schlechtes Gewissen machen.
»Entschuldige bitte«, sagte sie schnell. »Es war immer klar, dass du nur vorübergehend bei mir wohnst und … Alles okay, wirklich.« Innerlich war sie allerdings nicht überzeugt. Vor ein paar Wochen war Malines Suspendierung aufgehoben worden. Der finale Schuss auf einen Mörder hatte zu Zwangsurlaub geführt. In dieser Zeit hatte sie einen Camper erstanden, ihre Sachen gepackt und war aus Lous Reihenhaus ausgezogen. Angeblich brauchte sie Freiheit.
»Es ist ein irres Wohngefühl«, schwärmte Maline jetzt zum x-ten Mal, vielleicht auch, um das Thema zu wechseln. »Heute Nacht habe ich den Camper am Rheinufer direkt an der Zoobrücke abgestellt und beim Aufwachen den Morgennebel mit Blick auf den Rhein genossen.«
»Unter der Zoobrücke? Ich könnte mir vorstellen, dass du die ganze Nacht Autolärm hörst. Darfst du denn überhaupt da stehen?«
»Ich bin mir nicht sicher, aber im Moment ist es mir auch egal. Es ist einfach herrlich, so unabhängig zu sein und …«
»… ohne festen Wohnsitz«, brummte Lou. »Suchst du eigentlich noch nach einer Wohnung?«
»Klar, ich habe heute einen Termin im Kölner Süden.«
Als sie endlich losjoggten, bekam Lou schon nach ein paar Metern Seitenstechen. Ihre Waden fühlten sich an, als zöge sie Bleikugeln hinter sich her. Die Kollegen, die gleichzeitig mit ihnen gestartet waren, liefen bereits in einiger Entfernung.
Lou fluchte, kämpfte unauffällig weiter gegen ihre Schmerzen, die sich nicht wegatmen ließen. Sie hielt nur unter größter Kraftanstrengung mit Maline Schritt, die leichtfüßig zu laufen schien und keine Anzeichen von Anstrengung zeigte. So dermaßen in Form war sie, seitdem sie mit dem Rauchen aufgehört hatte. Zu allem Überfluss begannen nun auch wieder diese verflixten Knieschmerzen.
»Wir werden immer langsamer«, stellte Maline fest.
»Sehr aufbauend.« Lou stieß die Worte zwischen zwei Atemzügen hervor, biss die Zähne noch ein Stück zusammen und stoppte dann abrupt, die Hände auf die Knie stützend. »Los, lauf allein weiter, ansonsten schaffst du die Strecke nicht in der vorgegebenen Zeit.«
»Ich lass dich nicht zurück.« Maline war stehen geblieben.
»Red keinen Unsinn! Ich habe tierische Schmerzen in der Seite und bin völlig fertig.« Lous Ton war heftiger als beabsichtigt.
Maline spurtete davon. Sie würde die verlorene Zeit spielend aufholen, davon war Lou überzeugt und nahm sich vor, von nun an jeden zweiten Tag zu joggen oder die Mittagspausen im Fitnessraum des Präsidiums zu verbringen. Schluss mit Ausflüchten. Der innere Schweinehund konnte sich warm anziehen.
In der Schwimmhalle vermied Lou Blickkontakte mit Kollegen. Sie fühlte sich in die sechste Klasse zurückversetzt, als sie bei den Bundesjugendspielen weder den Anforderungen beim Weitsprung noch beim Tausend-Meter-Lauf gerecht geworden war. Ihre Klassenkameradinnen hatten damals mit klaren Worten nicht gegeizt. »Louisa wollen wir nicht im Team haben.« Kindheitserinnerungen, manche stachen noch nach Jahren wie kleine Nadeln.
Wegen des frühzeitigen Ausscheidens aus ihrem Lauf musste Lou nicht ins Wasser. Die Regeln zur Feststellung der körperlichen Fitness waren an diesem Punkt eindeutig. Jogging abgebrochen bedeutete: für heute nicht bestanden.
»Du kannst auch einfach eine Stunde powerwalken, medizinballweitwerfen und tausend Meter schwimmen«, hatte der junge dynamische Trainer augenzwinkernd erklärt.
Altersbonus. Hilfestellung für Übergewichtige. Nein, danke! Lou wäre dem Schnösel am liebsten an die Gurgel gesprungen. Stattdessen hatte sie demonstrativ verkündet, dass sie in vier Wochen die Lauf- und Schwimmprüfung in der vorgegebenen Zeit ablegen würde. Diesem gestählten Muskelpaket wollte sie es zeigen!
Jetzt sah sie zu, wie die Kollegen Bahnen kraulten, und verfolgte Malines Endspurt auf der Innenbahn. Parallel ging sie in Gedanken eine Liste mit Sachen durch, die Frieda für ihren Auslandsaufenthalt brauchte. Irgendwie musste sie es in den nächsten Tagen schaffen, mit ihrer Tochter in die Stadt zu fahren. Trekkingrucksack, ein neues Tablet. Friedas Must-have-Liste wurde immer länger.
Clemens schlich sich in ihre Überlegungen. Maline hatte recht. Diese Geschichte nagte tatsächlich an ihr.
Seit Monaten versuchte Lou, Kontakt mit ihm aufzunehmen, aber er beantwortete weder Briefe, noch reagierte er auf SMS oder Anrufe. Lou seufzte und winkte Maline, die ihre Zeit geschafft hatte.
Sie verschränkte die Arme vor dem Bauch. Vielleicht war es viel wichtiger, dass sie sich endlich klarmachte, dass Clemens sie durch sein Verhalten extrem verunsichert hatte. Für die Konsequenzen, die sich aus seinem Handeln ergeben hatten, war er ergo selbst verantwortlich. Schluss. Ende. Lou setzte sich kerzengerade. Sie musste sich diese Affäre und alle Konsequenzen, die sie nach sich gezogen hatte, verzeihen.
Als ihr Smartphone klingelte, nahm sie das Gespräch mit ihrem Chef an und schleuderte sich endgültig aus den Schuldgefühlen und der damit verbundenen Gedankenspirale um Clemens Kohlmann.
Königsforst
Levi trat mit voller Wucht gegen das Gatter, das den Eingang zum Königsforst an der Rösrather Straße markierte, und lief in den Wald hinein. Mit beiden Händen packte er die erstbeste kniehohe Tanne an den Zweigen und versuchte, sie mit aller Kraft aus dem Boden zu reißen. Die Stiche der Nadeln spürte er nicht. Dem fragenden Blick einer Joggerin wich er aus, dem Spaziergänger im Lodenmantel, der kurz darauf vorbeikam und ihn neugierig musterte, schrie er seine Wut entgegen. »Was gibt es denn da zu glotzen?«
Der Mann verschwand mit eiligem Schritt hinter einer Ladung gefällter Kiefern, während Levi schluchzend auf den Waldboden sank. Erst jetzt bemerkte er die Flecken auf Hemd und Hose. Blut. Es klebte auch an seinen Händen. Er raffte Schnee zusammen und rieb ihn über seine Finger, bis sie vor Kälte knallrot wurden. Eine Amsel flog heran, legte den Kopf schräg und zwitscherte. Levi griff einen Tannenzapfen und warf damit nach dem Vogel, der aufgeregt flatternd verschwand. Unter der dünnen Schneedecke vermoderte Laub, die Fasern seiner Hose saugten sich voll Nässe. Die eisigen Temperaturen erreichten Levis Bewusstsein, und gleichzeitig klangen die ersten Akkorde von Franz Liszts »Totentanz« in seinem Kopf an.
Kompositionen überschwemmten ihn regelmäßig, verscheuchten seine Gedanken, nahmen von ihm Besitz. Levi drehte sie laut oder auch leise, meist aber waren sie ohrenbetäubend. So entfloh er der Gegenwart, katapultierte sich aus unangenehmen Situationen und bekam nicht mit, wenn ihn Fremde musterten oder hässliche Kommentare abgaben. Blicken konnte er ausweichen. Worten nur, wenn die Melodien in seinem Kopf alles übertönten.
Levi hastete los, mied Wege, lief im Takt der Musik querfeldein, sprang über verschneite Äste, stolperte durch Senken, fiel hin, raffte sich wieder auf und kämpfte sich durch dichtes Geäst. Menschen sah er kaum, bis er die Wassertretstelle am Giesbach erreichte. Hier stand eine Gruppe Huskybesitzer beieinander, lamentierte und blockierte den Zugang zum Wasser. Levi stoppte den »Totentanz«. Einer der Hunde zog aufgeregt an der Leine, seine Besitzerin konnte ihn kaum halten.
Levi duckte sich hinter aufgestapelten Stämmen, lugte an der Seite vorbei. Die Vierbeiner bellten nun durcheinander und zerrten an ihren Geschirren. Schon näherte sich ein Mann mit zwei aufgebrachten Tieren. Als er nur noch wenige Meter entfernt war, stürmte Levi davon. Er hörte Rufe und das Lärmen der Hunde.
Weg. Bloß weg.
Levi holte Liszt zurück. Noch lauter, noch ungestümer. Seine Beine rasten mit der Musik um die Wette. Trotzdem schafften es Gedanken, in sein Bewusstsein zu dringen. Längst war er überfällig. Aber er konnte nicht nach Hause. Die Stille, die ihn dort erwartete, ertrug er heute nicht. Zudem wollte er sich Rica nicht aussetzen, die ihn sonst mit Blicken durchbohrte.
Levi lief, bis der »Totentanz« in seinem Kopf zu Ende getanzt war. Jetzt hörte er die Fahrzeuge auf der nahen Autobahn, blieb stehen und gönnte sich eine Verschnaufpause. Er holte tief Luft und rannte weiter, als Schneeregen einsetzte. Sein Ziel hatte er nun klar vor Augen.
Köln-Rath, Am Gieselbach
Maline stellte den Streifenwagen direkt vor einem Rettungsfahrzeug ab, das mitten auf der Straße des Wohnviertels parkte. Die Auffahrt der kleinen Stadtvilla, die hell erleuchtet hinter schulterhohen Hecken thronte, versperrten insgesamt drei Dienstwagen. Blaulichter rotierten geräuschlos, Schnee reflektierte ihr kaltes Licht.
Lou deutete mit dem Kinn auf einige ältere Herrschaften. Sie drängelten sich hinter rot-weißem Absperrband, machten lange Hälse und beobachteten die Kollegen von der Spurensicherung, die in Overalls umherliefen. Noch fehlten am Tatort die nötige Ruhe und routinierte Gelassenheit.
Maline entdeckte Ben Stollberg, der heute seine erste Mordkommission leitete, gerade mit einem Pressevertreter sprach und gleichzeitig einen Schutzpolizisten heranwinkte.
Gemeinsam stiegen sie aus dem Wagen. Sofort steuerte Ben auf sie zu, schlug den Kragen seines Mantels hoch, rückte seine Nickelbrille zurecht, lächelte zur Begrüßung und machte sie mit den ersten Fakten vertraut.
»Bei der Toten handelt es sich um die siebzig Jahre alte Rendel Sukowa. Sie liegt erstochen im Treppenhaus, wir warten auf den Rechtsmediziner.«
»Wer hat sie gefunden?«, fragte Lou.
»Constantin und Alea Sukowa, Sohn und Enkelin der Toten.« Ben deutete auf einen übergewichtigen Mann in heller Daunenjacke, der im Fond des Rettungswagens saß und ein Kind an sich drückte. Jemand hatte eine Decke um die Schultern der beiden gelegt.
Maline atmete durch. »Ich spreche mit ihnen.«
»Dann schaue ich mich zuerst im Haus um«, sagte Lou und schritt über einen größtenteils verschneiten Steinplattenweg zur Villa hinauf, während Ben auf ein Fernsehteam zueilte, das gerade aus einem Bully stieg.
Maline ging auf das Rettungsfahrzeug zu. Dabei hatte sie Vater und Tochter im Blick, zog ihren Dienstausweis aus der Jackentasche und beschränkte sich bei der Begrüßung auf das Notwendigste.
»Es ist so kalt«, flüsterte Constantin Sukowa. »Wie lange müssen wir denn noch hier bleiben?«
Seine Augen waren gerötet, der dunkle Oberlippenbart ließ sein Gesicht noch fahler erscheinen. Die Wollmütze hatte er bis zu den Augenbrauen heruntergezogen. Ein flächendeckendes Tattoo zierte seinen Hals, kein Tuch, wie Maline aus der Ferne irrtümlich angenommen hatte. In Zeige- und Ringfinger seiner rechten Hand hatte er sich Engelflügel stechen lassen. Sukowas Jacke wies am Bund des rechten Ärmels hässliche rotbraune Flecken auf.
Das Mädchen zitterte am ganzen Körper, Tränen kullerten, und aus ihrer Nase lief gelber Rotz.
»Es gibt da ein paar Dinge, die ich Sie fragen muss«, sagte Maline.
»Aber ich habe doch schon alles gesagt, eben, dieser Polizistin und ihrem Kollegen.«
»Ich weiß, aber ich bin von der Kripo, wir brauchen Informationen aus erster Hand.«
Sukowa holte Luft. »Wir wollten meine Mutter besuchen und sind heute Morgen schon früh zu Hause losgefahren.«
»Wo wohnen Sie denn?«
»In Heiligenhaus, das ist ein kleiner Ort im Bergischen, keine zwanzig Kilometer entfernt.«
»Wann sind Sie hier eingetroffen?«
»So gegen halb neun.«
»Haben Sie heute frei? Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Barpianist in einem Hotel in der Innenstadt und fange meist erst um achtzehn Uhr an zu arbeiten.«
Maline stutzte. Sie hatte Schwierigkeiten, sich Constantin Sukowa in einer Hotellounge vorzustellen, wo er Evergreens klimperte. »Ich brauche die Daten Ihres Arbeitgebers, reine Routine.«
»Okay.«
»Hat Ihre Mutter Sie erwartet?«
»Wir wollten sie überraschen, sie hat gestern am Telefon so deprimiert geklungen, da dachte ich, sie könnte eine kleine Aufmunterung vertragen.«
»Warum ging es ihr denn nicht gut?«
»Ach, es gab keinen besonderen Grund. Ihr ist ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Die Influenza hatte sie niedergestreckt, und dazu plagten sie noch andere Sorgen. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand war nicht der beste.«
»Und wenn sie nicht zu Hause gewesen wäre?«
»Wo sollte sie so früh am Morgen sein? Außerdem besitze ich einen Schlüssel. Ich habe also geöffnet, Alea hat die Tür aufgestoßen und losgeschrien …« Behutsam legte er einen Arm um seine Tochter und küsste sie auf die dicke Strickmütze. »Du meine Güte, sie ist doch erst fünf Jahre alt.«
Er drehte sich zur Seite und sprach leise in Malines Richtung. »Sie hat ihre Oma da liegen sehen, in einer Blutlache. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich meine, wer rechnet denn auch mit so etwas?«
Es begann erneut zu schneien. Maline lächelte Alea zu und streckte eine Hand aus. Flöckchen schmolzen auf ihrer Haut. Das Kind vergrub daraufhin ihr Gesicht in der Jacke ihres Vaters.
»Magst du süßen Zitronentee?«, fragte Maline die Kleine dennoch, winkte gleichzeitig einen Schutzpolizisten herbei und wandte sich dann an Constantin Sukowa. »Es wäre gut, wenn wir einen Moment ungestört reden könnten.«
Es dauerte eine Weile, bis Alea neben dem jungen Beamten im Streifenwagen saß. Nur an der Hand ihres Vaters hatte sie die wenigen Schritte zum Einsatzfahrzeug gemacht. Jetzt hielt sie einen Becher Zitronentee aus Malines Thermoskanne in den Händen und hielt Blickkontakt mit ihrem Vater, der bei offener Tür neben Maline in einem der Rettungsfahrzeuge saß.
»Ist Ihnen beim Betreten des Hauses etwas aufgefallen?«, nahm Maline den Faden wieder auf.
»Nein.«
»Haben Sie jemanden auf dem Weg zum Haus oder im Garten gesehen?«
Sukowa atmete scharf aus und trommelte mit den Fingern gegen das Armaturenbrett. Vielleicht verlor er langsam die Geduld. Maline hatte durchaus Verständnis, aber sie konnte ihn noch nicht entlassen. »Haben Sie Ihre Mutter angefasst?«
»Gott bewahre! Nein. Ich bin mit meiner Tochter in die Küche und habe die Polizei gerufen!«
»Und wie kommen dann die Blutflecken auf Ihre Jacke, wenn Sie die Tote nicht berührt haben?« Maline deutete auf einen Ärmel.
Er drehte den Arm nach außen, anscheinend hatte er die Flecken noch nicht bemerkt. »Keine Ahnung …«
»Überlegen Sie noch einmal. Sie sind hinter Ihrer Tochter ins Haus, sie hat geschrien, und Sie haben das Kind weggerissen.«
Sukowa zog ein Papiertaschentuch aus der Jacke und wischte sich über die Stirn. »Ich habe Alea an den Küchentisch gesetzt und die Tür geschlossen.« Seine Stimme zitterte jetzt. »Dann bin ich in den Flur zurück. Ich dachte, ich wusste ja nicht … Ich hatte die Hoffnung, dass sie noch lebt, und habe ihren Puls gefühlt. Aber da war nichts … kein Leben … Dann habe ich die Polizei gerufen.«
Tränen. Er versuchte nicht, sie zurückzuhalten.
Schneeflocken fielen jetzt dichter. Alea klebte mit großen Augen hinter der Scheibe des Streifenwagens.
»Hatte Ihre Mutter Ärger? War sie in Streitigkeiten verwickelt? Gibt es etwas, das wir wissen sollten?«
»Sie hortete einiges an Bargeld und auch Schmuck.« Sukowa sah Maline direkt an. »Alles ist weg, ich habe nachgesehen, nachdem ich den Notruf abgesetzt hatte. Jemand hat die Zimmer im Obergeschoss durchwühlt. Vielleicht waren es Trickbetrüger, die Nachrichten sind doch voll von solchen gemeinen Überfällen! Diese Gegend ist eigentlich friedlich. Ich meine, Einbrüche in Pkws kommen auch hier vor. Auf den Parkplätzen rund um den Königsforst sollte man keine Wertgegenstände liegen lassen. Gerade in letzter Zeit kam es vermehrt zu Diebstählen. Aber Mord … Das ist doch … da fehlen mir wirklich die Worte!«
»Erzählen Sie mir ein bisschen, wie war Ihre Mutter?«
»Ein Schlaganfall zwang sie letzten Sommer, ihren Beruf endgültig aufzugeben. Bis zu dem Zeitpunkt hat sie immer noch Musikstunden gegeben. Gitarre und Klavier. Aber Schüler, die ihren Tagesablauf diktierten, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten klingelten, das ging einfach nicht mehr. Die Umstellung ist ihr schwergefallen. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen die Nummer von Mutters Hausarzt.«
Maline nickte, legte ihre Hände locker aufs Lenkrad und ließ Constantin Sukowa Zeit.
»Ich wollte mit Alea herziehen«, fuhr er schließlich fort. »Gleich nach Weihnachten, damit ich mich besser um sie kümmern kann.«
»Haben Sie sich gut verstanden?«
Er hob die Augenbrauen. »Wieso?«
»Ich muss diese Frage stellen.«
»Komischerweise hat uns gerade ihre Krankheit zusammengebracht«, antwortete er zögernd. »Nach dem Schlaganfall konnte sie ihren linken Arm nicht mehr richtig bewegen, deshalb musste sie meine Hilfe annehmen. Ich habe mich endlich gebraucht gefühlt und hatte einen festen Platz in ihrem Leben. Das war nicht immer so, und ich habe es irgendwie genossen.«
»Gibt es jemanden, der nach Ihrer Mutter gesehen hat? Pflegedienst oder auch Nachbarn?«
»Ja, natürlich.« Constantin Sukowa schien sich zu entspannen. »Ich schreibe die Namen auf. Können wir dann gehen?«
»Hatte noch jemand einen Schlüssel zu ihrem Haus außer Ihnen?«
»Ihr Nachbar Halberstein, er wohnt gleich da vorn.« Sukowa zeigte auf ein Haus, das neben der Villa stand. »Ich würde Alea gern nach Hause bringen.«
»Dann lassen Sie bitte Ihre Personalien und die Anschrift bei meinen Kollegen von der Schutzpolizei. Und erstellen Sie uns bitte die Liste mit den Bezugspersonen Ihrer Mutter.«
Sukowa zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch.
»Wir brauchen auch die Namen ihrer ehemaligen Schüler, können Sie uns da einen Überblick verschaffen?«
»In diesen Dingen war meine Mutter sehr ordentlich. Sie hat Namen, Termine und Einnahmen akribisch in einem Notizbuch festgehalten. Es liegt mit Sicherheit auf ihrem Sekretär im Arbeitszimmer.«
»Wir schauen nach.«
»Ich möchte natürlich so schnell wie möglich ins Haus, es gibt ja auch eine Menge zu regeln, jetzt, wo meine Mutter …«
»Es kann dauern, bis die Arbeit des Erkennungsdienstes abgeschlossen ist. Stellen Sie sich am besten auf ein bis zwei Tage ein.«
»Okay.« Sukowa stieg zusammen mit Maline aus, machte die wenigen Schritte zum Streifenwagen und öffnete die Tür.
Alea schlang ihre Arme um seinen Hals. »Wer kümmert sich denn jetzt um die Kaninchen?«, fragte das Kind mit weinerlicher Stimme.
Sukowa drückte seine Tochter an sich. »Wir füttern die beiden noch schnell.«
»Jetzt können Sie nicht in den Garten«, sagte Maline. »Und eine Frage habe ich noch. Wohnen Sie allein?«
»Nein, ich lebe mit meiner Freundin und deren Kindern zusammen.«
Maline stutzte. »Und trotzdem wollten Sie nach Weihnachten zusammen mit Ihrer Tochter herziehen?«
Sukowa strich sich über den Oberlippenbart. »Ja, ich habe den Gedanken erwogen, auch wenn Veronika nicht begeistert war. Es sollte ja kein Dauerzustand werden.«
»Okay, dann brauchen wir auch die Daten Ihrer Freundin.«
Malines Handy vibrierte in der Innentasche ihrer Lederjacke, als sie sich Stichpunkte zu ihrem Gespräch auf einem Block notiert hatte.
Die Stimme der Stationsschwester des Pflegeheims, in dem ihr Vater wohnte, klang aufgeregt. »Ich versuche Sie seit einer halben Stunde zu erreichen, aber irgendwie hatten Sie keinen Empfang. Sie sollten sich beeilen, wenn Sie sich noch von Ihrem Vater verabschieden wollen! Es geht ihm sehr schlecht.«
Königsforst
Nach einer gefühlten Ewigkeit schälten sich die Umrisse der Blockhütte aus dem Wald. Hütte war leicht untertrieben, dieser Klotz war größer als die meisten Einfamilienhäuser, die Levi kannte. Mit Sicherheit konnten sich nur stinkreiche Leute so ein Wochenenddomizil leisten.
Regelmäßig suchte Levi hier Zuflucht, in diesem Schlupfwinkel fand er Ruhe. Nur selten verirrten sich die Besitzer her. In den vergangenen Jahren hatte er sie zweimal gesehen, draußen auf dem Weg, und zugehört, als sie einige Worte mit einem Paar wechselten. Demnach waren die Schmitts seit dem Ruhestand oft auf Reisen, besaßen ein Haus in St. Peter Ording und hielten sich vorzugsweise in Spanien auf.
Beherzt sprang Levi auf die niedrige Mauer und checkte das Areal. Einsamkeit gähnte ihm entgegen, vor dem Gebäude schlief der Tag. Lediglich die Geräusche der nahen Bundesstraße waren hörbar.
Reifenspuren, Kaminrauch, Licht, Fußabdrücke im Schnee. Nichts davon war zu sehen. Er eilte an einem leeren Zwinger vorbei, in dem eine altersschwache Hundehütte verrottete. Die Witterung hatte ordentlich an der roten Lackfarbe genagt. Der Maschendrahtzaun, der den Zwinger umgab, war rostig, ansonsten aber unversehrt.
Unbeobachtet erreichte Levi die Hintertür, die in einen flachen Anbau führte. Den Bewegungsmelder hatte er schon vor Monaten vorsorglich mit einem der Ziegelsteine zertrümmert, die neben der Hundehütte lagerten. Auch wenn sich Levi nicht vorstellen konnte, wem der Melder verdächtige Bewegungen anzeigen sollte. Das nächste bewohnte Haus stand mindestens zwei Kilometer entfernt. Und der alte Mann, der offenbar beauftragt war, hier nach dem Rechten zu sehen, kam seinen Aufgaben nur schlampig nach. Levi hatte ihn bisher ein einziges Mal um das Gebäude schlurfen sehen.
Zügig öffnete er die unscheinbare Tür, die niemals verschlossen wurde. Dahinter verbarg sich ein kleiner Vorraum mit einer reduzierten Auswahl an Arbeitsgerät, einer stets aufgeräumten Werkbank und einem Brennholzvorrat, der anscheinend nie zur Neige ging. Levi schritt an einem Satz abgefahrener Sommerreifen vorbei zu einer weiteren Tür, die zweimal gesichert war. Zum einen mit einem soliden Zylinderschloss, das nicht so leicht zu knacken war. Aber was nützte das beste Schloss, wenn der dazugehörige Schlüssel unter einem umgedrehten Blumentopf verwahrt wurde? Zum anderen sollte ein ganz normales Vorhängeschloss eine Barriere bilden. Zugegebenermaßen ein besonders rustikales Exemplar, aber der Schlüssel befand sich stets auf der oberen Kante des Türrahmens. Ein ebenso fahrlässiges Versteck, zumal sich im Haus ziemliche Werte befanden.
Levi sperrte auf und gelangte über eine schmale Treppe ins geräumige Wohnzimmer hinauf. Obwohl die Räume nicht beheizt wurden, empfing ihn eine angenehme Temperatur, das luxuriöse Vollholzhaus war gut isoliert. Trotzdem schaltete Levi die Heizung ein.
Er zog das Messer aus seinem Hosenbund und schaute sich suchend um. Du verdammter Idiot! Warum hast du es überhaupt mitgenommen! Levi lief von Zimmer zu Zimmer, stöberte und suchte lange, bis er ein Versteck erspähte, das er vorerst für geeignet hielt. Später würde er einen besseren Platz finden. Er riss sich die Klamotten vom Leib und sprang unter die Dusche.
Wasser direkt aus der Leitung. Levi schloss die Augen. Meisterkurse. Musikstunden bei einem Professor. Aufnahmeprüfung. Rendel Sukowa war doch einfach nicht bei Trost. Wie sollte er diese Hürden nehmen? Ihre Worte hatten wie Hohn geklungen. Du musst üben, ansonsten verschleuderst du dein Talent.
Rendel Sukowa hatte ja keine Ahnung! Levi drehte das Wasser noch heißer. Bilder tauchten auf, die ihn wehmütig werden ließen.
Sein halbes Leben hatte die Familie ein ganz normales Leben geführt. Einfamilienhaus. Neubaugebiet. Bankschulden. Geräumige Kinderzimmer. Ein Klavier. Hightechküche und Pelletöfen. Zwei Autos. Urlaubsreisen an die Nordsee. Kindergeburtstage. Vorbei, diese Familie gab es nicht mehr. Als Kind folgst du deinen Eltern, egal, wohin sie gehen.
Inzwischen war er erwachsen. Eigentlich konnte er abhauen, Pianist werden, sich Vorschriften und Bevormundung entziehen. Aber so einfach lagen die Dinge nicht. Seufzend schnappte er sich ein Handtuch und ging ins Schlafzimmer.
Der Luxus, der in diesem Haus sogar in Details zu finden war, fing ihn ein und besänftigte ihn. Markennamen prangten an sämtlichem Inventar. Sein Vater hatte solche Labels angebetet, bevor die Familie in ein altersschwaches Fachwerkhaus gezogen war. Levi zog Hose sowie Rollkragenpullover des Eigentümers aus dessen Schrank und betrat das Wohnzimmer.
Hier bogen sich Regale unter der Last von Büchern, fast ausnahmslos gebundene Werke. Überwiegend Enzyklopädien mit medizinischen Inhalten. Levi mochte die Vorstellung, dass die Bände das Wissen der Schmitts festhielten. Vielleicht hatten sie sich das Wochenendhaus sogar als Bleibe für ihre Wälzer angeschafft. Ein Haus im Wald für die Lektüren eines alternden Paares. Der Gedanke ließ ihn lächeln.
An einem Regentag hatte sich Levi mal einige Akten angesehen. Die Ordner mit den vergilbten Unterlagen standen im Vorraum, unten neben dem Regal mit Sauerkrautdosen, Wurstgläsern und Fruchtsäften in Tetra-Pak-Kartons. Beim Rausziehen der Dokumente hatte Levi damals auch eine Packung Rattengift gefunden, die offenbar vom oberen Regalboden, auf dem Lackfarben und Pflanzenschutzmittel verwahrt wurden, eine Etage tiefer gerutscht war. Jedenfalls hatte er die Papiere von Dr. Johanna Schmitt und Professor Gerold Schmitt genau studiert. Sie hatte als Psychologin gearbeitet, er als Kinderchirurg. Laut der ewig alten Steuerunterlagen hatte das Ehepaar zusammen ein ordentliches Sümmchen verdient, jedenfalls in den siebziger und achtziger Jahren. Neuere Bescheide hatte Levi nicht entdeckt.
Er trat an das Fenster. Da das Blockhaus auf Stelzen gebaut war, ragte es ungefähr zwei Meter über dem Boden in den Wald und ließ den direkten Blick auf schneebedeckte Zweige einer Tannengruppe zu. Dahinter erstreckte sich der Königsforst, ein zweitausendfünfhundert Hektar großes Naturschutzgebiet, das mit seinen Ausmaßen über dreitausend Fußballfeldern entsprach. Naherholungsgebiet für gestresste Kölner, eingerahmt von den Autobahnen A 3 und A 4. Der private Garten der Familie Fischblut, wie sein Vater scherzhaft zu sagen pflegte. Levi konnte diesen Spruch nicht mehr hören.
Er näherte sich dem Wandschrank. Ein Sony-Plattenspieler glänzte neben diversen Hi-Fi-Geräten und einem schnurlosen Telefon. Levi ging in die Hocke und zog gezielt Albinonis »Adagio in g-Moll« heraus. Diese Aufnahme war eine seltene Klavierversion des Stückes, welches ansonsten meist von einem ganzen Orchester gespielt wurde. Beinahe ehrfürchtig legte Levi die Schallplatte auf den Teller und schaltete das Gerät ein.
Keine Minute später lag er auf dem Designersofa. Die Komposition hörte er über extrem gute Kopfhörer, die er erst bei einem seiner letzten Besuche im Schrank unter dem Flachbildschirm entdeckt hatte. Levi zog eine Kamelhaardecke über seine Beine, entspannte bei der Musik völlig und vergaß die Schmitts, Rendel Sukowa und die Welt außerhalb des Wochenendhauses.
Köln-Rath, Am Gieselbach
Lou schlüpfte in den Spurensicherungsoverall, streifte Schuhüberzieher sowie Latexhandschuhe über und verschaffte sich einen ersten Eindruck. Kollegen vom Erkennungsdienst setzten Spurentafeln, begannen die Leiche zu entkleiden, damit sie erste Untersuchungen durchführen und den Körper mit Folien abkleben konnten. Zuvor hatten sie Auffindesituation, Fundort sowie Lage fotografiert.
Lou schätzte die Tote auf höchstens einen Meter sechzig, graue Haare reichten ihr bis zu den Schultern. Sie waren gekämmt, ordentlich gescheitelt, wie gerade erst zurechtgemacht. Der geblümte Bademantel war zusammen mit dem Nachthemd bis zu den Oberschenkeln hochgerutscht. Die knochigen Beine waren nach innen gedreht, die Knie berührten sich fast. Ihre Arme lagen im rechten Winkel vom Körper abgespreizt, so als wollte sie die Muskeln spielen lassen.
Die Villa war groß, allein das Treppenhaus beeindruckend. Ein gigantischer Kristallleuchter baumelte von einer Decke, die Lou auf mindestens sieben Meter Höhe schätzte.
Im Erdgeschoss zählte sie vier Türen. Hinter der ersten befand sich die Küche, gefolgt vom Esszimmer. In beiden Räumen waren die Rollläden heruntergelassen. Lou drehte an altertümlichen Lichtschaltern.
Über knarzende Dielen erreichte sie das Wohnzimmer. In einem Regal stand ein in die Jahre gekommener Farbfernseher, darüber Stereoanlage mit CD-Player. Den Zimmern haftete der Charme vergangener Zeiten an. Teewagen, Kommoden mit Marmorplatten, Erker mit schweren Gardinen, antike Möbel und teure Teppiche. Alles wirkte ordentlich und aufgeräumt. Und auch wenn das Inventar die besten Zeiten hinter sich hatte, so wehte doch ein Hauch vergangenen Wohlstands durch die Räume.
Hinter der nächsten Tür verbarg sich ein Musikzimmer. In der Mitte des Raums glänzte ein weißer Bechstein-Flügel mit sichtbaren Gebrauchsspuren, daneben standen zwei Gitarren. Lou fielen die Notenständer ins Auge, die durcheinander auf dem Boden lagen. Sie warf einen Blick auf das einzige Fenster, bei dem der Rollladen halb hochgezogen war. Sorgfältig untersuchte sie den Rahmen auf Einbruchsspuren und fand nichts. Dafür bemerkte sie Spuren im Schnee. Soweit sie erkennen konnte, führten einige zum Fenster, um sich dann an der Wand zur Garage zu verlieren.
Lou rief Ben und zwei Kollegen vom Erkennungsdienst, gemeinsam gingen sie in den Garten hinaus. Die meisten Schuhspuren waren verwischt, allerdings fanden sie auch brauchbare Exemplare, die von allen Seiten fotografiert wurden. Anschließend sicherte ein Kollege vom Erkennungsdienst die Eindrücke mit roten Plastikmanschetten und sprühte zur Stabilisierung der Spuren vorsichtig mehrfach Flüssigwachs auf, bis sich eine zusammenhängende Schicht bildete. Der zweite Experte rührte Gips zum Abbinden in kaltem Wasser an und verteilte die zähe Masse zügig mit Hilfe eines Spachtels.
Lou und Ben erhofften sich von dieser Maßnahme neben Informationen zu Profil, Größe und Art des Schuhwerks auch aufschlussreiche Erkenntnisse über das Gangbild, Fußanomalien und vielleicht sogar die Anzahl der Personen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen konnten. Da es wieder zu schneien begann, deckten die Kollegen die Spuren ab.
Lou ließ sie in Ruhe arbeiten und setzte ihren Rundgang drinnen im Musikzimmer fort. Ihr Blick schweifte erneut durch den Raum. Dabei registrierte sie die Brille, die neben ledernen Hausschuhen lag, die unter dem einzigen Ohrensessel abgestellt standen. Sie fotografierte die Position, hob dann die Brille hoch und betrachtete die Gläser, die so dick waren, dass sie an der Innenseite über das Horngestell ragten.
Schließlich nahm sie sich das obere Stockwerk vor und inspizierte ein Badezimmer ohne Heizung. Hier gab es nichts Auffälliges zu entdecken. Von dort gelangte sie direkt ins Schlafzimmer. Blickfang waren, neben dem riesigen Doppelbett, von dem nur eine Seite bezogen war, Unterlagen, die auf dem Fußboden verstreut lagen. Lou rief einen Fotografen, bevor sie vorsichtig über das Durcheinander hinwegstieg und sich einer sperrigen Kommode näherte.
Die oberste Schublade war ein gutes Stück herausgezogen. Bescheinigungen und Urkunden lagen durcheinander, es herrschte das reinste Chaos. Lou öffnete die beiden anderen Laden. Hier lagerten Briefe und Ansichtskarten, ordentlich in Reihen gesteckt. Sie nahm einige Kuverts heraus und betrachtete Zeitzeugnisse eines Lebens.
Im nächsten Zimmer herrschte Ordnung, in Regalreihen verstaubten Bücher. Vor dem einzigen Fenster baumelte ein Plissee bis zur Kante der Heizung.
Zum Schluss betrat Lou ein Zimmer, das Rendel Sukowa offenbar als Arbeitszimmer gedient hatte. Hier brannte Licht. Bücher und Ordner waren aus den Regalen gerissen. Zwei Schränke standen weit geöffnet. Fotos, Briefe, Kontoauszüge und Unterlagen jeder Art lagen verstreut auf dem Boden. Auch die Schubladen eines Sekretärs standen offen, die Schreibfläche war leer gefegt. Lou bemerkte eine Tür mit heruntergelassenem Rollladen. Als sie ihn hochzog, blickte sie auf einen geräumigen Wintergarten. Topfpflanzen, fachmännisch in Luftpolsterfolie und Jutefilz verpackt, warteten hier auf den Frühling. Viele Blumenkübel hatten gigantische Ausmaße.
Lou schloss die Tür, ging ins Erdgeschoss zurück und schickte zwei Kollegen vom Erkennungsdienst nach oben, damit sie dort ebenfalls Spurenbilder aufnahmen. Zudem ordnete sie die anschließende Versiegelung der beiden durchwühlten Zimmer an und begrüßte danach Heinrich Meller.
Der Rechtsmediziner nahm jetzt die weitere Untersuchung der Leiche vor. Lou mochte Heinrichs ruhige, systematische Art, die jedem Tatort guttat. Sein Mundschutz verdeckte den weißen Vollbart und das in den letzten Jahren entstandene Doppelkinn. Er kniete im Sicherheitsoverall neben der Toten. Lou betrachtete den Körper, der rotviolette Totenflecke aufwies.
»Von einem Sexualdelikt gehe ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aus«, sagte Heinrich.
»Suizid kommt auch nicht in Frage.« Ben deutete auf die Einstichstelle in Brusthöhe. »Die Tatwaffe ist nicht auffindbar.«
»Nicht so schnell.« Heinrich schüttelte den Kopf. »Das Fehlen von Tatwaffe und Abwehrspuren deutet nicht zwangsläufig auf einen Mord. Manche Herzstiche lassen dem Opfer durchaus Zeit, die Waffe zu verstecken, um ein Tötungsdelikt vorzutäuschen. Auch wenn ich in diesem Fall nicht davon ausgehe.«
»Nach was für einer Waffe suchen wir denn?« Lou richtete diese Frage an den Mediziner. »Dolch? Schraubenzieher? Küchenmesser?«
»Da will ich mich ungern irgendwelcher Spekulation hingeben. Die Größe der Einstichstelle lässt nicht unbedingt Schlussfolgerungen auf die Klingenbreite zu. Ich muss mir zuerst den Stichkanal genauer ansehen, nach der Obduktion wissen wir mehr.« Heinrich Meller betrachtete die Hände der Toten eingehend. »Abwehrspuren sehe ich wie schon gesagt nicht. Auf den ersten Blick hat der Täter von vorn angegriffen und nur einmal zugestochen.«
Lou beobachtete, wie er den Schädel nach möglichen Frakturen abtastete und Mund, Ohren sowie die Nase auf Fremdkörper untersuchte. Anschließend sah er sich den Hals genauer an, suchte nach Würgemalen und testete die Beweglichkeit.
»Genickbruch kann ich ausschließen. Am Hinterkopf gibt es lediglich eine Schwellung, die mit großer Wahrscheinlichkeit vom Aufschlag herrühren wird.«
»Was glaubst du, wie lange sie hier liegt?« Lou ging neben Meller in die Hocke.
»Die Leichenstarre ist im Rumpfbereich noch nicht ausgebildet und betrifft bisher nur Fuß-, Hand- und Kiefergelenk.« Der Rechtsmediziner nahm ein Sondenthermometer aus seinem Arbeitskoffer. »Die Farbe der Totenflecke und die nicht abgeschlossene Leichenstarre lassen darauf schließen, dass die arme Frau nicht länger als drei Stunden tot ist. Und das ist schon großzügig gerechnet.«
Ben sah Heinrich Meller über die Schulter. »Kannst du den Todeszeitpunkt vielleicht noch etwas konkretisieren? Auch, damit wir den Datenumfang eingrenzen können, den wir von den Telefonanbietern benötigen?«
Lou machte gedanklich einen Haken auf ihrer imaginären Tatort-To-do-Liste. Das Feststellen, Speichern und Übermitteln vollständiger Verbindungsdaten aller Mobilfunkteilnehmer, die sich in den Funkzellen rund um den Tatort bewegt hatten, gehörte mittlerweile zur Standardmaßnahme, weil viele Täter ein eingeschaltetes Handy bei sich trugen. Damit ließ sich im konkreten Fall möglicherweise ein Aufenthalt in der Nähe zum Fundort nachweisen, wenn dies abgestritten wurde. Da entsprechende Daten nach sieben Tagen gelöscht wurden, war an diesem Punkt immer Eile geboten.